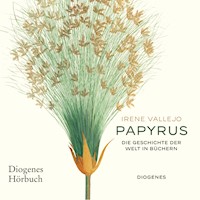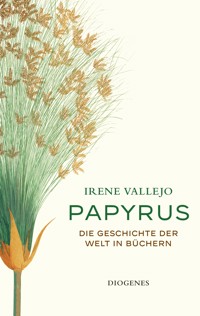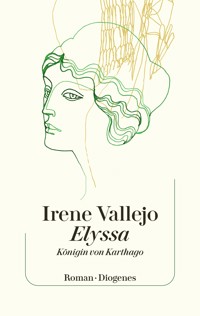
21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als Elyssa, Gründerin und Königin von Karthago, auf eine Gruppe Schiffbrüchige trifft, erkennt sie im trojanischen Helden Aeneas, der aus seiner Heimat fliehen musste, ihr eigenes Schicksal. Unter der Regie von Eros entflammt eine Liebe zwischen den beiden, und sie träumen davon, Karthago in eine florierende Stadt ohne Gewalt, Niedertracht und Leid zu verwandeln. Doch die Götter haben andere Pläne und stellen Aeneas vor eine schwierige Entscheidung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 321
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Irene Vallejo
Elyssa, Königin von Karthago
Roman
Aus dem Spanischen von Kristin Lohmann und Luis Ruby
Diogenes
Für meinen Vater, der seine letzte Reise angetreten hat.
Manche Siege sind weder ruhmreich, noch bleiben sie in Erinnerung; manche Niederlagen jedoch können zur Legende werden und durch die Legende zum Sieg.
Ana María Matute, Der vergessene König Gudú
I.Schiffbruch
Aeneas
Und heute Abend kann ich ein weiteres Mal sagen: Ich wäre beinahe gestorben. Ich habe die Planken meines Schiffes krachen hören. Der Himmel drückte uns gewaltig ins Meer, das Meer schleuderte uns himmelwärts. Dann war mir, als würden Meer und Himmel in Stücke brechen und wären nicht mehr zu unterscheiden. Als fielen wir durch von Blitzen geöffnete Spalten oder in Abgründe in den Wellentälern.
Ich verstehe noch nicht einmal, wie meine Männer es geschafft haben, mit unserem tödlich getroffenen Schiff die Küste zu erreichen. Diese Küste, die vom nächtlichen Meer aus nur ein unzugänglicher Block noch tieferer Dunkelheit war. Doch aus dem schwarzen Regen öffnete sich vor uns ein natürlicher Hafen, eine Bucht mit derart ruhigem Wasser, dass wir nicht einmal Taue brauchten, der Anker genügte.
Das Meer faucht noch immer in meinen Ohren, aber das ist nur ein Echo. Der Sturm legt sich allmählich, die Sterne spähen hervor und öffnen schmale Ritzen in den Wolken. Ich weiß, dass unsere wichtigste Aufgabe in diesem unbekannten Land darin besteht, unser zerbrechliches Leben zu schützen, und ich weiß auch, dass ich mich als Erster aus dem Sand erheben muss, in den ich mich habe fallen lassen. Wer von uns überlebt hat, liegt entkräftet am Boden. Ich spüre feuchte Finger an meinem Bein; sie tasten meinen Körper ab, suchen wohl die Gewissheit, dass wenigstens wir noch am Leben sind, die Gewissheit, dass dieser Strand nicht jenes Ufer ist, an dem die Toten auf den Fährmann warten, der sie in die andere Welt übersetzen wird.
»Aeneas …«, sagt eine Stimme, die in diesem Augenblick dem Schluchzen des Windes gleicht. Mehr brauche ich nicht, um auf die Füße zu kommen.
»Hört mir zu! Hört mir alle zu!«, rufe ich, erhebe meine Stimme über den Sturmwind, der uns immer noch betäubt. »Wir haben den Krieg überlebt, diesen Wahnsinn der Menschen, und auch das Unwetter, den Wahnsinn des Meeres. Die Götter stehen weiterhin auf unserer Seite. Jetzt ist nicht die Zeit, um herumzuliegen und vor der Gefahr zu zittern, die wir bereits überwunden haben. Lasst uns ein Lager errichten, ein Feuer entzünden, das uns die Knochen wärmt, und ein Gebet für unsere Gefährten sprechen, die wir im Sturm verloren haben.«
Wir sind nun wieder eine Streitmacht. Der Sand knirscht unter unseren Schritten. Ich gebe jedem eine Aufgabe, die Verwundeten ausgenommen, erteile Befehl, Korn, Werkzeug und Waffen vom Schiff zu holen. Meine Männer knurren, schimpfen halblaut über mich, aber ich erkenne die wilde, fröhliche Tonlage in ihren Flüchen. Sie nennen mich »Hund« und »nichtswürdig«, aber in Wirklichkeit sind sie schon dabei, mir zu vergeben. Und das, obwohl wir nichts getan haben, als immer weiter zu segeln, auf der Suche nach dem Ort, an dem sich die dunkle Prophezeiung erfüllen soll, und sie kaum je die Ruhe eines Hafens genießen oder eine Frau umarmen konnten. Trotzdem bleiben sie ihrem König treu. Ein Wort von mir, und sie stürzen sich ins Gefecht. Jetzt, da der Tod, der alle gleich macht, den Rückzug angetreten hat, gehorchen sie mir erneut.
Ja, meine Männer sind froh, weil wir noch leben. Das Meer hat keine Leichen angespült, für den Moment müssen wir niemanden beweinen. Und ein Schiffbrüchiger ist stets ein fröhlicher Mensch, wenigstens bis er innehält, um nachzudenken.
Unser Steuermann hat sich den Arm gebrochen, womöglich mehrfach. Vom Ansturm der Wellen geschüttelt kam das Schiff ins Schlingern und schleuderte ihn gegen die Reling. Er prallte ein ums andere Mal aufs Deck, war danach ganz zerschlagen. Als ich zu ihm trete, packt er meine Hand.
»Vater Aeneas!«, flüstert er. So nennen mich die jüngeren Besatzungsmitglieder.
»Du bist gerettet«, sage ich. »Wir sind gerettet.«
Aber bevor ich seine Hand loslasse, überfällt mich die Furcht, meinen einzigen Sohn nicht wiederzusehen.
»Vater Aeneas …«
Achates, meinem treuen Freund, ist es gelungen, einen Funken vom Feuerstein aufs Brennholz und auf das nasse Laub überspringen zu lassen. Ich schaue auf das beginnende Lagerfeuer, schaue zu Achates, der mit angespannten Muskeln die Flamme nährt und schützt, schaue auf das Feuer, wie es sich windet und in der Luft entfaltet, als es endlich hochlodert. Aus diesem ersten Lagerfeuer werden andere entzündet, im Kreis, sodass ein Ring aus Hitze entsteht. Das ist unser erster Sieg über die Angst und über diese einsame Küste.
Die Wärme weckt die Erinnerung an den Hunger. Wir tragen einen Korb mit feuchtem Getreide herbei, das wir aus dem Sturm retten konnten. Geschickte Hände übernehmen die Aufgabe, es auf der Glut zu trocknen und anschließend zu mahlen. Wir haben noch Trinkwasser und auch einige Schläuche Wein aus dem ramponierten Schiff. Die Nacht wird von unseren Gerüchen durchdrungen: Essen, Brennholz, schwitzende Körper. Der weiße Rauch steigt zum Himmel auf wie ein Vogel, der seine Flügel ausbreitet und sich in der Höhe verliert. Und das bereitet mir Sorgen: Die Rauchvögel verraten unsere Anwesenheit.
Ich werde nicht zulassen, dass uns die Behaglichkeit des Lagerfeuers blind für die Gefahr macht, in der wir weiterhin schweben. Wir befinden uns in einem unbekannten Land. In all der Zeit, die der Sturm gedauert hat, haben wir weder Himmel noch Land gesehen. Die Wolken haben einen Stern nach dem anderen ausgelöscht und uns als einziges Licht den Schaum der Wogen gelassen. Der Wind hat uns die Kontrolle über unser Schiff entrissen. Unmöglich zu erraten, welchen Ort wir erreicht haben, unter welchem Volk wir uns befinden, ob es sich um einen Küstenstrich handelt, der Seeleuten bekannt ist, oder ob er in weiterer Ferne liegt, Teil der unerforschten Welt. Wer weiß, ob wir nicht, wenn wir in den Schlaf sinken, von Händen geweckt werden, die uns packen und gefangen nehmen, oder von einem Messer an der Kehle.
Die ganze Nacht über werden Wachposten in die Dunkelheit starren, ohne zu blinzeln. Ich teile die Männer ein, gebe Waffen aus, markiere mit meinem Fuß im Sand, wo die Posten stehen sollen.
Danach ziehe ich alleine los, um das Terrain zu erkunden. Als ich das Lager hinter mir lasse, kühlt der Wind die feuchten Kleider auf meiner Haut. Das Meersalz hat Spuren an mir hinterlassen, wie die Narben des Schiffbruchs. Verstohlen schleiche ich durch die Dunkelheit. Ich will zu den Klippen gelangen, die sich ins Meer hineinziehen und so die Bucht begrenzen. Ich will am gebogenen Horizont nach den Schiffen meiner Flotte Ausschau halten, die im Sturm verloren ging. Haben die anderen Besatzungen überlebt? Und mein Sohn?
Die Bäume, die ihre Wurzeln in den Hang graben, werfen ihre Schatten ins Meer. Zweifache Dunkelheit. Die Äste zerkratzen mir das Gesicht. Ich steige weiter, taste mich vor, halte das Gleichgewicht. Endlich öffnet sich die Landschaft dem Blick. Im schwachen Licht ein leerer Himmel und ein Meer, das ihn verdoppelt. Keine Andeutung von einem Bug oder einem Mast.
Seit Anfang unserer Fahrt sind mein Sohn und ich auf Rat meiner weisesten Männer auf verschiedenen Schiffen gesegelt. Ihr seid die letzten Angehörigen des Königshauses von Troja, hieß es. Wenn es zu einem Schiffbruch kommt, haben wir bessere Chancen, dass wenigstens einer überlebt.
Ich hoffe, dass ich nicht gelebt habe, um auch noch ihn zu verlieren.
Taub vor Kälte gehe ich zurück in das Lager, das wir im Nirgendwo erbaut haben, wo meine Männer mich erwarten. Jetzt weiß ich: Selbst wenn ich mich in dieser Küstengegend zurechtfinde, bleibe ich doch verloren. Woran soll ich mich orientieren? Die gesamte bekannte Welt existiert nur noch in unseren Erinnerungen.
Anna
Meine Mutter sei eine Hexe, sagten sie. Anna, die Tochter der Zauberin, so nannten sie mich. Anna, das uneheliche Kind des Königs von Tyros. Keiner dieser Namen war gut. Deshalb will ich in See stechen und ganz weit fortsegeln, so weit, bis das Wasser all die Namen weggespült hat. Durch meine Adern hallt der Ruf des Reisens und all der Länder, die ich sehen will, wenn ich erst groß bin.
Meine Schritte führen mich immer zum Meer. Wer meinen Spuren folgt, wird unweigerlich ans Ufer gelangen.
Auch heute, als ich sah, wie die Wolken sich zusammenbrauten, bin ich losgelaufen und habe mir einen Platz zwischen den Felsen gesucht. Finstere Wolken waren das, mit olivgrünen Bäuchen, gewitterbeladenen Bäuchen. Ganz sicher waren sie schwerer als das Meer, irgendein Gott muss sie gehalten haben, damit sie nicht ins Wasser stürzen.
Ich kenne die besten Plätze, um den Wolken beim Vorbeiziehen zuzusehen, und die besten Orte, um Leute zu beobachten. Sie wissen nicht, dass ich da bin und sie mit geneigtem Kopf betrachte, nicht die Wolken und nicht die Leute. Denn ich bin flink, und ich bin leise. Dann erzähle ich Elyssa, was ich gesehen und gehört habe, und sie nennt mich ihre kleine Eule, weil mir nichts entgeht. Wenn ich mich verstecke, streife ich mir zuvor den Sand von den Fußsohlen, sonst knirscht es, wenn ich auftrete, und ich werde entdeckt. Mit großen Augen ziehe ich von einem Ort zum nächsten. Weil ich immer schon wissen wollte, was sich hinter den Dingen versteckt. Und weil die Zeit so langsam vergeht und weil jeder neue Tag, der auf die Welt kommt, noch so weit entfernt ist von seiner Nacht. Vielleicht streift sich ja auch der Gott, der die Sonne über den Himmel führt, den Sand von den Fußsohlen, und vielleicht sind aus diesem Sand ja die Sterne, die wir hier unten sehen.
Die Zeit wird mir lang, während ich auf die Reise warte, die mich an eine bessere Küste bringen wird, an der bessere Menschen leben, nicht so verlogene, Menschen, denen ich vertrauen kann. Eines Tages werde ich ganz weit fort segeln, bis ich zu einem Land ohne Paläste komme, wo niemand weiß, was Verrat bedeutet.
Als sich die erste Welle an den Klippen in tausend funkelnde Partikel bricht, sitze ich zwischen den Felsen, ein Bein untergeschlagen. Das Meer türmt Wellen von der goldenen Farbe des Sandes auf, den es vom Grund her aufwühlt und nach oben spült.
Als ich noch in der Stadt lebte, in der ich geboren wurde, in Tyros, sagte meine Mutter an Nachmittagen wie diesem zu mir: »Denk an die Menschen, die jetzt auf See sind.« Und das tue ich, ich denke an sie. In meinen Ohren pfeift der Wind. Und dann, plötzlich, wie aus dem Nichts, sehe ich Schiffe, mehrere Schiffe durch den Sturm taumeln.
Die Buge graben sich ins Wasser, kippen zur Seite. Die Masten, so winzig aus der Ferne, scheinen zu schaudern. Es ist kalt. Meine Knöchel sind nass. Vielleicht sollte ich zurückgehen. Nicht, dass ich Angst habe. Es schreckt mich nicht, das aufgeblähte Meer, auch nicht das eigenartige Licht. Nichts schreckt mich so leicht.
Wie die Schiffe auf den Wellen schwanken. Manchmal bleiben sie schwebend weit oben. Ich glaube, so hoch habe ich die weißen Schaumkronen noch nie gesehen. Das Meer kommt mir hungrig vor. Auch ich habe Hunger; wenn ich jetzt zum Palast zurückgehe, bekomme ich ein Brot, und wenn ich es breche, wird es innen noch dampfen.
Vielleicht sollte ich zurückgehen, auch wenn es nicht richtig ist, die Schiffe jetzt, wo berghohe Wellen über sie hereinbrechen, allein zu lassen. Ein Weilchen bleibe ich noch, halte den Windstößen stand und der Schwermut dieses Nachmittags, bleibe bei den Schiffen, die in den Wellen taumeln, und bei meiner Mutter, die tot ist und kein Mitleid mehr haben wird mit den Seefahrern, nie wieder.
Was mögen das für Männer sein, die da gegen den Sturm ankämpfen, während das Meer über ihre Köpfe hinwegfegt? Vertriebene, so wie wir?
Die Sonne, todmüde, hat sich nun ganz zurückgezogen. Der Sturm heult, und es wird immer dunkler.
Und wenn auch sie aus Tyros kommen, weil mein Halbbruder sie gesandt hat, Elyssa zu töten, uns beide zu töten?
Woher weiß man, wann man weit genug geflohen ist?
Ich springe auf und renne zurück zum Palast.
Elyssa
Der Sturm schleicht sich in meinen Palast und krümmt die Flammen. Ein kalter Windstoß trifft mich im Nacken. Das Unwetter macht uns alle unruhig, die Hunde haben sich schon vor Stunden versteckt und zittern weit entfernt von unseren Blicken.
Ich lausche. Das Gemäuer dröhnt wie ein Riff, das von der tosenden Flut umspült wird. Doch meine Ohren, seit meiner Kindheit vertraut mit der Stimme des Meeres, nehmen Pausen wahr in der Wut des Sturms. Bald wird wieder Ruhe einziehen.
Spinnend und webend sitzen meine Sklavinnen auf ihren Schemeln. Das Feuer fängt goldene und grüne Reflexe ein auf ihrer schwarzen Haut.
Ein Wächter erscheint auf der Türschwelle. Er ist vertraut mit den üblichen Respektsbekundungen. Aus der Ferne, den Blick auf den Boden gerichtet, sagt er:
»Ich bringe Neuigkeiten, meine Königin. Die Schiffe der heute Morgen gesichteten fremden Flotte wurden vom Sturm überrascht und sind an unseren Küsten angelandet. Das Meer hat die Körper der Schiffbrüchigen ausgespuckt, manche tot, manche lebendig. Männer und Schiffe sind schwer angeschlagen, doch sie könnten gefährlich sein. Wir erwarten Befehle.«
»Berufe den Rat ein.«
Dem Rat gehören die vier besten Krieger meiner Stadt an. Um ihrer Eitelkeit Genüge zu tun, habe ich ihnen klangvolle Titel gegeben: Schild der Königin, Dolch der Königin, Bogen der Königin und Wurfspieß der Königin. Ich wählte die vier unter den stärksten und treuesten Kriegern meines Vaters aus. Über Jahre hinweg, seit wir die Grundsteine unserer Stadtmauer legten, haben sie mir treu gedient, doch die Zeit hat ihre Ambitionen größer werden lassen. Ich mache mir nichts vor, ich weiß, dass sie besessen sind von dem Wunsch, mich zu besitzen und den Thron zu besteigen. Jedes Mal, wenn ich sie zusammenrufe, spüre ich den fast schon schmerzhaften Druck ihrer Blicke auf meinen Augen und meinem Körper. Bisher haben sie es nicht gewagt weiterzugehen. Keiner will die anderen herausfordern, nur deshalb erhebt niemand offen Anspruch auf mich als verwitwete Königin, auf meine Hand und mein Bett. Nur durch die Balance dieser ebenbürtigen Rivalität bin ich im Moment noch frei.
Ich warte auf sie. Jetzt, in diesem Augenblick, klopfen meine Gesandten wohl an die Türen ihrer Häuser, wo ein jeder von ihnen, so stelle ich es mir vor, bei einer Dienerin liegt und sich auf seine grobe Art an ihr erfreut, mit routinierter Schroffheit. Doch sobald sie den Palast betreten, werden sie ein Labyrinth aus Lügen spinnen. Meine Männer verstecken sich vor mir, ohne Not, aus reiner Gewohnheit. Oder vielleicht sind sie auch nur nicht in der Lage, zu mir zu sprechen, wie sie zu einem König sprechen würden, wie sie in Tyros zu meinem Vater sprachen. Vielleicht kennen sie auch nur die Sprache der Kameradschaft, und alles andere ist Heuchelei. Denn weder meine Berater noch meine Krieger äußern vor mir, was sie eigentlich antreibt: Ehrgeiz, Angst, körperliche Lust, der Traum von Macht und Größe.
Mein Mann sagte immer, ein guter Herrscher müsse wissen, was in den Herzen der Menschen vor sich geht. Er hat versucht, mir diese Fähigkeit beizubringen. Ob er wohl in der Lage war, auch in die Herzen seiner Mörder zu blicken?
Auf dem Weg in den Ratssaal lasse ich die Wohnräume hinter mir und durchquere den Innenhof. Zwei Wachen mit Streitäxten eskortieren mich, stoßen die Flügeltüren auf und ebnen mir den Weg. Meine Männer sind bereits angekommen, sie unterhalten sich in mürrischem oder vielleicht auch nur trägem Tonfall. Sie ahnen, dass ein Einsatz bevorsteht, dass sie Wache halten müssen, draußen in der sturmgepeitschten Nacht.
»Meine getreuen Kommandanten«, sage ich.
»Meine Königin, wir kommen von unserem Dienst am Fuße der Mauer.«
Von all meinen Beratern ist Malko, Schild der Königin, derjenige, der am besten lügt. Ich erwidere sein Lächeln.
»Mehr Ergebenheit könnte ich mir nicht wünschen.«
In der Stille des Raumes ist ihr kräftiger Männeratem wahrnehmbar, ihr Keuchen, die Anspannung. Ihre Körper verbreiten den Geruch nach herbem Sex und altem Schweiß, sie stoßen mich ab.
»Ihr fragt euch sicher, warum ich nach euch rufen ließ in dieser unfreundlichen Nacht«, fahre ich fort. »Einmal mehr bitte ich um eure Kraft und euren Schutz. Eine Flotte von Unbekannten ist an unseren Stränden angelandet. Helft mir, die Zeichen zu deuten und eine weise Entscheidung zu treffen.«
»Meine Königin«, erwidert Safat, der Dolch, »die Fremden könnten friedliche Händler sein oder herzlose Seeräuber. Es ist zu früh, das zu entscheiden.«
Friedliche Händler oder herzlose Seeräuber … Meine Krieger sind so unbeugsam in ihrer Sprache. Wir dagegen wurden in eine Kultur von Kaufleuten hineingeboren, wir sind Söhne und Töchter des Meeres, wir wissen, dass auch der kühnste Kaufmann bei der ersten Gelegenheit zum Seeräuber wird. Alle wissen das. Und keine andere Ware ist so begehrt wie Sklaven; wenn eine Besatzung aus Kaufleuten nahe der Küste segelt und eine junge Stadt wie unsere erspäht, mit noch unfertigen Mauern, dann wird sie sich gleich einem Adler auf sie stürzen und alles geben, um unsere jungen Männer und unsere Frauen zu packen, sie mit Gewalt auf ihr Schiff zu verschleppen und auf den Märkten einer größeren Stadt zu verkaufen. Wenn ich eines mit aller Macht möchte, dann, mein Volk vor diesem schmerzhaften Schicksal zu bewahren.
»Du hast recht, es ist zu früh, das zu entscheiden«, erwidere ich. »Doch mein Herz, das Herz einer Frau, macht sich Sorgen um mein Volk.«
»Lasst uns einen Feldzug gegen die Eindringlinge planen«, schlägt Ahiram, Wurfspieß der Königin, vor, mit pochendem Herzen angesichts des bevorstehenden Kampfes. Eine Narbe entstellt den Saum seiner Lippen, wodurch der Mundwinkel verlängert scheint: der Schatten eines verstörenden Lächelns, für immer offengelegt durch den Schnitt eines Messers.
»Aber wenn ihr euch entfernt von der Stadt – bleiben wir dann nicht ohne den Schutz eurer unbezwingbaren Schwerter zurück? Was, wenn wir während eures Feldzugs angegriffen werden?«, frage ich.
»Meiner Meinung nach, meine Königin, sollten wir die Wachen verstärken und unsere Stadt so unbeugsam verteidigen, wie ein Geizkragen sein Vermögen bewacht«, meint Elibaal, Bogen der Königin.
»Nun gut«, sage ich, »ich vertraue euch. Ihr habt an der Seite meines Vaters gekämpft, und jetzt beschützt ihr mich mit der gleichen Liebe, die er mir einst zuteilwerden ließ. Die Wachen an den Mauern sollen verstärkt werden. Niemand reitet aus, um die Eindringlinge aufzuspüren, doch wenn sie sich uns in feindlicher Absicht nähern, dann ergreift sie. Leisten sie Widerstand, soll das ihr Ende sein. Mögen unsere Feinde Zeugen sein von der Macht der noch jungen Stadt Karthago.«
Aeneas
Der Schlaf hat mich in dieser Nacht nicht besucht, hat mir nicht die Augen geküsst. Stunde um Stunde lausche ich dem Dröhnen des Meeres, den Schritten der Wachleute, dem Knistern der Lagerfeuer. Als es Tag zu werden beginnt, im sanften Grau der Dämmerung, stehe ich auf. Meine Kleider sind klamm, ich spüre die von der Anstrengung verkrampften Muskeln, mir tut alles weh.
Ich blicke mich um. Am safrangelben Himmel zeichnen sich indigoblau die Umrisse einer fernen Bergkette ab. Am Ende der Bucht entdecke ich an den Hängen eines Vorgebirges eine Stadt, das gelbe Band ihrer Mauern. Vögel fliegen knapp über dem Boden, ihre bläulichen Schatten gleiten über den Sand.
Auf Knien am Feuer spreche ich zu den Göttern. Ich recke die Arme mit umgedrehten Handflächen gen Himmel: »Ihr Götter, wenn wir euch je mit unseren Opfern erfreut haben, wenn unsere Leiden euch etwas gelten, so hütet meinen Sohn Iulus und macht, dass ich ihn wiederfinde. Wenn ihr mir diesen Wunsch erfüllt, verspreche ich: Sobald ich den Ort der Prophezeiung erreiche, werde ich zu euren Ehren einen großen Tempel errichten.« Ich gieße Wein aus und beobachte, wie der Sand ihn aufsaugt, während ich zu den Mächten der Erde und der Unterwelt um Iulus’ Rettung flehe.
Das Lager erwacht am Ende der unruhigen Nacht, und die Wachposten werden von ihrer Einsamkeit befreit. Das eifrige Treiben eines neuen Tages beginnt. Die schwache Sonne kommt gegen die Kälte kaum an, und wir müssen die Feuer neu schüren. Wir wärmen die Reste unserer Vorräte auf und essen schweigend, während wir uns die Gelenke reiben. Danach gebe ich Befehl, das Schiff im Schutz der Felsen zu vertäuen, an einer versteckten Stelle. Anschließend suche ich Achates.
»Mit Tagesanbruch mache ich mich auf, um die Küste zu erkunden und herauszufinden, wo wir sind und wohin die Winde unsere Gefährten verschlagen haben mögen«, sage ich.
»Ich gehe mit dir«, gibt er zurück, bereit, die Gefahr mit mir zu teilen.
Ich hülle mich in einen Umhang aus Wolfsfell. Achates und ich bewaffnen uns mit zweischneidigen Schwertern und nehmen Lanzen mit, die uns als Stützstöcke dienen werden, wenn wir über die Dünen gehen. Der Wind um uns herum formt eine Wolke aus rötlichem Staub, ein juckender Wirbel in den Augen und knirschender Sand zwischen den Zähnen. Oben kreischen die Möwen, lassen ihr Gewicht auf den böigen Luftströmen ruhen, überrascht, zerzaust von den Stößen der Brise.
Ich erkläre Achates, was ich vorhabe: Ich will mich der Stadt nähern und ein Vorgebirge finden, das freie Sicht auf die Strände im Westen bietet. Achates betrachtet aufmerksam das Gelände: den Sandnebel, die Dünen, die kargen Flecken der Büsche. Eine offene und unbekannte Fläche zu überqueren heißt sein Leben riskieren.
»Dann mal los«, antwortet er.
Wir gehen hintereinander, rasch, ganz Augen und Ohren. Der Sand verschluckt unsere Schritte. Ich bewundere Achates’ schnelle, zielsichere Bewegungen. Zehn Jahre Krieg haben seinen Körper hart gemacht, haben ihn gestärkt, um sich den Winden der Welt zu stellen.
Ja, auch mich, uns alle. Wir, die wir vor Troja gekämpft haben, sind während der zehn bitteren Kriegsjahre zäh geworden. Aber Iulus? Iulus ist ein Junge, der den Frieden nie erlebt hat. Er ist in einer belagerten Stadt geboren. Sein kindliches Lärmen wurde immer wieder vom Klirren der Waffen übertönt. Was mag ihm von dieser umzingelten Kindheit in Erinnerung bleiben, wenn er einmal zum Mann wird? Und die Geheimnisse seiner Eltern – wird er sich an die erinnern? Wird das, was zwischen seiner Mutter und mir geschehen ist, für alle Zeit verschwinden, oder wird es in seiner Erinnerung Wurzeln schlagen?
Falls er überlebt. Falls es mir gelingt, ihn zu finden.
Wann hat dieses langsame Verhängnis begonnen?
Achates nähert sich auf der Suche nach Deckung einem Tamariskenstrauch. Er geht in die Hocke. Wir kauern uns hin und erholen uns vom eiligen Schritt unseres Marschs. Dann kommen wir überein, die Stadt zu umrunden. Wir sind nur noch die Strecke davon entfernt, die ein Ochsengespann an einem Tag pflügen könnte.
Vorsichtig richten wir uns auf. Der Wind fährt auf Knöchelhöhe in das im Sand wuchernde Unkraut. Meine Sinne sind wachsam. Schnell schreitet der Vormittag voran. Gegen den tiefblauen Himmel heben sich die Mauern ab, teilweise aus Stein, an anderen Stellen aus Lehmziegeln oder schlichten Planken. Es ist eine junge Stadt in einer Grenzregion. Fremdlinge, die vom Meer kommen, werden hier wohl eher gefürchtet. Ob meine Männer hier Gastfreundschaft und Unterstützung gefunden haben?
Ein Schwirren in der Luft, und eine Lanze fliegt über mich hinweg und bohrt sich in den Boden. Ich ziehe den Kopf ein, weiche zurück. Da öffnen sich die Stadttore, und ein Reitertrupp kommt herausgestürmt. Sie umringen uns und schreien etwas in einer fremden Sprache. Zwei der Männer steigen ab und fesseln uns die Hände, ohne auf unsere Einwände zu achten, die sie ja auch nicht verstehen. Dann nötigen sie uns, bis zu ihrer Festung mitzugehen, und werfen uns in eine Zelle. Als die schwere Türe mit einem trockenen Geräusch ins Schloss fällt, stürzen wir ins Dunkel.
Elyssa
Einer meiner Männer überbringt die Nachricht von den gefangenen Seeräubern. Ich will sie mit eigenen Augen sehen, will selbst über ihre Strafe entscheiden, sie sollen das Urteil aus meinem Mund hören. Ich befehle der Wache, mich zum Gefängnis zu geleiten, und mache mich auf den Weg zu den Stallungen.
Seit meiner Kindheit empfinde ich ein seltsames Behagen, sobald ich einen Pferdestall betrete. Auch heute atme ich mit Genuss die drückende, warme, fast süßliche Luft ein, die die Tiere umgibt. Ich lausche dem Geräusch des langsam zermalmten Getreides, dem geduldigen Speichelfluss. Eine Reihe von Köpfen wendet sich mir zu, sie haben meine Anwesenheit bemerkt und begrüßen mich. Ein Schnauben und Wiehern ertönt, und ich erkenne mein Spiegelbild in den vielen wässrigen Augen.
Ich lege meinem weißen sizilianischen Pferd selbst das Zaumzeug an und streiche ihm dabei zärtlich über die Nase. Während ich den Sattelgurt anziehe, rede ich ihm gut zu. Einen Augenblick lang verweile ich in der Liebe, die sein purpurner Blick für mich bereithält.
Die für den Stall zuständigen Sklaven kennen meine Gewohnheiten und lassen mich gewähren, ohne mir vorzugreifen. Ich wähle die Reitknechte, die meine besten Pferde zureiten und versorgen sollen, sorgsam einzeln aus. Ich weiß, dass manche Bediensteten heimlich ihre Wut an den Tieren ihres Herrn auslassen, und allein der Gedanke an diese stille Grausamkeit lässt mich erschaudern.
In dem von der weißen Palisade umschlossenen Innenhof gegenüber der Futterkammer steige ich auf und spüre das Pferd unter meinen Beinen. Es folgt meinem Gewicht und dem Druck meiner Waden. Als wir die Palastanlagen hinter uns lassen und in die Straßenschluchten der Stadt eintauchen, reicht mir einer der Männer aus meiner Garde sein Schwert. Genau so sollen mich meine Untertanen sehen, bewaffnet, auf einem weißen Pferd reitend, mit wehendem Haar und dem Selbstvertrauen der versierten Reiterin, genau so, wie sie sich die Kriegerinnen vorstellen aus den Legenden, die von den Großeltern an die Enkel weitergegeben werden.
Ich werde an unseren Feinden ein Exempel statuieren. Ich werde Gerechtigkeit walten lassen gegenüber den fremden Seeräubern. Es ist nur angemessen, dass Männer wie sie, die sich durch Raub, Plünderung und den Handel mit Frauen bereichert haben, der Gnade einer Frau ausgesetzt sind, zumindest dieses eine Mal.
Plötzlich empfinde ich Freude. Freude darüber, dass ich mich stark gemacht habe für die Stadt, Freude über das geschäftige Treiben in den Straßen mit ihren Keltereien, Weinkellern, Geschäften und Backstuben, die der Stadt Wohlstand bescheren sollen, über die strahlend weißen, in Licht gebadeten Dachterrassen und die beinahe fertiggestellten Palast- und Tempelgebäude in meinem Rücken. Alles um mich herum wächst und gedeiht. Es riecht nach Pinien, Viehherden, Feuerstellen. Die Sonne, eine Zitrone am lichtblauen Himmel, wärmt mir Rücken und Schenkel. Mein Pferd reckt den Hals und bewegt sich mit der Anmut eines Tänzers, der weiß, dass er beobachtet wird und wie schön er ist.
Eine kleine Prozession von Schaulustigen ist mir durch die Straßen gefolgt und versammelt sich nun auf dem Platz vor den Gefängnismauern. Ich gebe meiner Garde ein Zeichen.
»Führt die Gefangenen vor«, sage ich.
Die Menschenmenge wächst an, ebenso das Geraune, die Ungeduld, das Drängen um die Plätze in der vordersten Reihe. Die Krieger zücken ihre Schwerter, schwingen sie durch die Luft und herrschen die Massen an, die jetzt auf die Mitte des Platzes drängen. Meine Wachen rücken vor und bilden einen undurchdringlichen Schutzwall um mich, um den Vorwitzigsten den Weg zu verstellen und die Menge, die sich nun, da das Erscheinen der Seeräuber kurz bevorsteht, zusammenschart, in Schach zu halten.
Das Krachen der Eisenriegel lässt das Volk verstummen. In der vibrierenden Stille, die der angeschlagenen Saite eines Instruments gleicht, das nicht mehr zur Ruhe kommen will, schließen zwei Wachen eine Zelle nach der anderen auf.
Sie zerren die Seeräuber aus den Zellen und stoßen sie vorwärts, bis sie mir gegenüberstehen. Ein Dutzend verdreckter, benommener Männer. Gerade erst aus der Dunkelheit ihrer Gefangenschaft befreit, verweigern ihre Augen ihnen noch die Sehkraft.
Ich betrachte mein hier versammeltes, erwartungsvolles Volk. Ein Mann ballt die Fäuste gleich einem Kämpfer. Die Frauen weichen zurück, so weit es nur geht. Ich sehe mir ihre offenen Münder an, die Überraschung und Gefräßigkeit zugleich ausdrücken. Die Blutgier meines Volkes gefällt mir nicht, doch heute werde ich demonstrieren, dass meine Macht vor niemandem ins Zittern gerät.
»Gefangene!«, rufe ich. »Die Zeit ist gekommen, für eure Vergehen zu bezahlen. Habt ihr etwas zu eurer Verteidigung vorzubringen?«
Doch die Gefangenen verstehen mich nicht, sie fühlen sich nicht angesprochen. Als sich ihre Augen an das Licht gewöhnt haben und der Vorhang der Blindheit fällt, erkennen sie einander. Solange ein jeder in seiner Zelle saß, wussten sie nicht, welches Schicksal die anderen ereilt hatte. Jetzt begreifen sie überwältigt und mit unerwarteter Freude, dass sie alle vereint und noch am Leben sind.
Ich lasse die Zeit, die ihnen für ihre Verteidigung bleibt, verstreichen. Wenn sie nicht antworten können oder wollen, werde ich mein Urteil fällen. Sie sollen sterben und ihre Leichen sollen außerhalb der Stadtmauern mit dem Gesicht zum Meer hängen, bis die Geier sie gefressen haben. Möge das Schauspiel künftigen Plünderern eine Warnung sein. Und mögen die Götter dafür sorgen, dass die Nachricht bis ins Landesinnere vordringt, zu den kriegslustigen Einheimischen, die unsere Reichtümer immer unverhohlener begehren, wenn unsere Karawanen an ihnen vorbeiziehen.
Meine Männer schlagen den Gefangenen auf die an den Rücken gefesselten Arme, damit sie schweigen und sich anhören, was ich zu sagen habe. Unbeeindruckt von den Stockhieben und voll stillem Stolz hebt einer der Gefangenen, der mit einem Wolfsfell bedeckt ist, den Blick und sieht mich an.
»Königin«, sagte er. Er spricht in der alten Sprache der Akkadier, der Sprache der Paläste und Botschaften. »Königin, wir sind ohne feindliche Absichten an deine Küste gekommen.«
In seinen Augen liegt ein seltsamer, altertümlicher Glanz.
Ich mache ein Zeichen mit dem Kopf. Das Zeichen bedeutet: »Ja, ich verstehe dich, auch ich gehöre der Welt an, in der diese Sprache gesprochen wird. Fahre fort.«
»Ich weiß nicht, ob die Kunde vom Unheil, das über Troja hereingebrochen ist, bis hierher vorgedrungen ist«, sagt er. »Zehn Jahre lang hielt Troja einer Belagerung stand, bis es schließlich durch Verrat besiegt wurde.«
Ich streiche über die dicke Pferdemähne, grabe meine Finger hinein, denke nach. Schließlich antworte ich:
»Ich habe gehört, dass die griechischen Streitkräfte Troja zerstört haben, dass sie die Männer getötet und die Frauen, ganz nach grausamer Kriegssitte, zu Sklavinnen gemacht haben. Aber sag: Wer bist du?«
»Mein Name ist Aeneas. Meine Frau Creusa war die Tochter des Königs von Troja. Für sie und für unseren Sohn habe ich die Stadt bis zum letzten Atemzug verteidigt, und als alles in Trümmern lag, brachte ich mithilfe einer Truppe mutiger Männer die Abbilder unserer Götter in Sicherheit. Meine Frau blieb zurück und mit ihr eine Wunde, die schmerzhafter ist als der Tod. Seither segle ich mit meinen treuen Gefährten über die Meere. Unser Ziel ist das Land, das die einen Hesperia und die anderen Italien nennen.«
»Wonach sucht ihr dort?«, frage ich. Seine Augen leuchten noch immer.
»Eine alte Prophezeiung besagt, dass wir ein neues Troja errichten werden und dass diese Stadt die Wiege eines Imperiums sein wird, das größer ist als unsere Träume und beständiger als unser Niedergang.«
Ein Hund bellt. Die Menschen fangen an zu zetern, sie sind aufgebracht. Sie sind hergekommen, um der Bestrafung der Seeräuber beizuwohnen, um das Todesurteil über sie zu bejubeln. Dieses eigenartige Gespräch in fremder Sprache verstehen sie nicht, diesen seltsamen Prolog zur eigentlichen Strafe. Protestrufe ertönen, hasserfülltes Geschrei und wütende Gesten sollen mich an meine Pflicht erinnern.
»Ihr seid weit von eurer Route abgekommen. Was hat euch hierher geführt?«, frage ich.
»Der Sturm hat uns mitgerissen und vom Kurs abgebracht, Königin. Wir sind Schiffbrüchige, und Schiffbrüchige können sich den Ort ihrer Rettung nicht aussuchen.«
Die Wut und das Geschrei brechen sich jetzt endgültig Bahn und übertönen die Befragung. Dem Fremden ist es gelungen, mich durch die Barriere einer Sprache, die nur wir beide verstehen, von meinem Volk zu trennen.
Doch ist unser Erkennen in einer Sprache, die nur in den Königshäusern gesprochen wird, unser Erkennen als Geflüchtete aus derselben Welt, nicht Grund genug, ihm Zuflucht zu gewähren? Sollte ich einem Reisenden, der seine Stadt hat brennen sehen und das Feuer noch in den Augen trägt, nicht die Gastfreundschaft meines Palastes und meine Tafel anbieten?
Nur: Wird mein Volk es hinnehmen, wenn ich die Fremden verschone, für die die Schwerter schon gewetzt wurden?
Anna
Ich habe Angst. Ich will weg von hier. Ich will dieses hässliche Mädchen mit den knochigen Armen nicht sein.
Während der letzten Monde bin ich groß geworden. Ich strecke mich in die Länge, wie eine Weinranke strebe ich hinauf. Meine Beine sind viel zu lang, ich bin die Schwester dieser Vögel mit den roten Flügeln, die dem See seine Farbe geben, die Schwester der Flamingos. Wenn der Wind mit meinem Körper spielt und die Tunika anhebt, dann siehst du meine dünnen Beine und die dicken Knie. Immer weiter wachsen meine Knochen, entfernen mich von der Erde, ziehen am Fleisch, ziehen mich in die Länge, so, wie der späte Nachmittag meinen Schatten immer länger werden lässt.
Elyssa hat gesagt, bald kommt das erste Blut und dass ich nicht erschrecken soll. Ich weiß nicht genau, was sie meint. Wie kann sich mit einem Mal eine Wunde öffnen zwischen meinen Beinen, die nicht mehr verheilt? Und wenn ich erst mit meinem eigenen Blut befleckt bin, werde ich dann wissen, dass ich groß bin?
Vor den Fremden aber, die über das Meer gekommen sind, müssen wir keine Angst haben. Im Schutz der Menge beobachte ich den als Wolf gekleideten Mann und höre ihm zu. In der Sprache der Könige spricht er über Verrat und Flucht. Ich sehe seinen Rücken, seine dunkel angelaufenen, geschwollenen Hände in den verknoteten Seilen, die kräftigen Waden, die Narben an den Beinen.
»Der Sturm hat uns mitgerissen, Königin«, sagt der Gefangene. »Schiffbrüchige können sich den Ort ihrer Rettung nicht aussuchen.«
Von ihrem Pferd aus blickt Elyssa auf ihn herab. Sie spricht gerne von dort oben herab mit Männern. Man soll nicht vergessen, wie mächtig sie ist.
»Tapferer Aeneas«, sagt sie jetzt, und dabei wird ihr Lächeln wehmütig, und die Augen verdunkeln sich. »Auch ich habe meine Heimat verloren, den Ort, an dem ich geboren bin. Auch ich wurde verraten. Ich kenne diesen Schmerz und auch den Weg über das Meer und den sehnlichen Wunsch, eine neue Stadt aufzubauen. Dein Schicksal und meines gleichen sich.«
Die beiden sehen sich an.
Ein Stein sirrt durch die Luft und trifft einen der Gefangenen an der Schläfe. Der Aufprall ist hart, der Gefangene reißt an den gefesselten Händen, die er nicht zur Wunde führen kann, ballt sie zu Fäusten. Das Blut läuft ihm die Wange hinab, verzweigt sich, zieht die Fliegen an.
Die Rufe der Menge werden gellender und gewaltvoller.
Elyssa hebt die Hand, um die Menschen zum Schweigen zu bringen. Dann spricht sie in unserer Sprache zu ihnen.
»Tut ihnen nichts. Die Fremden sind keine Seeräuber. Sie sind Überlebende des Trojanischen Krieges und suchen ein Stück Land, das sie ihr Eigen nennen können. Denkt daran, auch viele von uns haben erfahren, was es heißt, verfolgt zu werden. Deshalb möchte ich die Trojaner bei uns willkommen heißen und ihnen Hilfe gewähren und Zeit für die Reparatur ihrer Schiffe. Solange sie bei uns sind, können ihre und unsere Schwerter sich vereinen, sollten wir bei Nacht angegriffen werden.«
Elyssas Worte treffen auf harte Augen, feindselige Gesichter, angespannte Körper. Niemand rührt sich, niemand gibt einen Laut von sich. Wenn jetzt einer den ersten Schritt tut, sich auflehnt, dann revoltiert die ganze Meute. Dann schlagen sie auf die Fremden ein und hängen sie auf, treten auf die Wagen ein, erbeuten die Weinamphoren und fallen trunken unter den sanft in der Luft wiegenden Beinen der Gehängten in Tiefschlaf.
Ich weiß das. Ich habe diese Männer schon entsetzliche Dinge tun sehen. Schon mehrmals haben sie mir das Blut in den Adern gefrieren lassen.
Ich halte die Luft an. Eingeschlossen in meiner Brust bebt mein Atem.
Ob ein knochiges, hässliches Mädchen sie aufhalten kann?
Ich mache ein paar Schritte nach vorne. Die Menge teilt sich. Mit lautlosen Schritten trete ich vor die Trojaner.
Als ich noch in Tyros lebte, nannten sie mich die Tochter der Magierin. Hier aber sagte Elyssa zu mir: Du wirst die Priesterin des Eschmun sein, das Prophetenmädchen. Doch werden sie mir auch glauben, wenn ich im Namen der Götter zu ihnen spreche? Oder werden sie mich verhöhnen und mit Steinen nach mir werfen?
Ich stehe in der Mitte des Platzes. Ich breite die Arme aus.
»Gastfreundschaft ist heilig«, sage ich, »auch die Götter preisen sie. Diese Männer stehen unter dem Schutz der Götter.«
Ich lege eine Hand auf den Arm des verletzten Gefangenen. Dann drehe ich mich um, damit alle meine dürre Gestalt sehen können und vor allem das schwarze Mal in meinem Gesicht. Mein Gesicht, das entstellt ist, seit ich aus dem Bauch meiner Mutter kam.
Meine Mutter habe am Feuer gesessen und Beschwörungsformeln gemurmelt, sie habe Tiere bei lebendigem Leib zerrissen und unter eigenartigem Gestöhne zu den Toten gesprochen, so erzählt man es sich. Wenn sie all das wirklich glauben, dann werden sie jetzt auch meine dunklen Mächte fürchten.
Wir sehen uns an, Angst gegen Angst. Ich fürchte mich vor ihrer Mordlust, sie fürchten sich vor der schwarzen Blume auf meiner Wange.
Noch einmal berühre ich die Wunde des Gefangenen, das blutverklebte Haar. Ich löse den Strick um seine bläulichen Hände. Ein paar Männer drehen sich um, binden ihre Maultiere los und gehen vom Platz. Weitere folgen ihnen. Die Zeit der Gewalt ist vorüber.
Elyssa steigt von ihrem Pferd. Mit ihrem Schwert löst sie die Fesseln der Gefangenen.
»Folgt mir zum Palast. Meine Sklavinnen werden euch ein Bad bereiten und neue Gewänder geben«, sagt sie, denn die Trojaner sind schmutzig und stinken.
Aeneas übersetzt ihre Worte für seine Männer. Während sie sich austauschen, reiben sie sich die Handgelenke und dehnen die schmerzenden Finger. Fliegen huschen über ihre Haut.
Der Platz hat sich unter halblautem Geraune schroffer Worte geleert. Die Wachen sind auf ihre Posten zurückgekehrt.
Elyssa kommt zur mir und nimmt mich an der Hand. Ihre Finger verschränken sich mit meinen. Ich würde sie so oft gerne umarmen, so, wie ich meine Mutter umarmt und mein Gesicht in den weichen Bergen ihrer Brüste vergraben habe. Aber dafür bin ich jetzt zu groß, deshalb bietet sie mir nur ihre Hand, ihre zarte Handfläche und unsere wie das Geflecht eines Korbes ineinander verschlungenen Finger sind meine Belohnung.
Ich war sehr mutig. Sie ist stolz auf mich.
Aeneas dankt uns, aber ich höre gar nicht richtig zu. Die langen Sätze in der Sprache der Paläste, die nur immer dasselbe sagen, langweilen mich. Doch dann dringt ein Wort zu mir vor, nach dem ich mich insgeheim sehne, seit wir aus Tyros geflohen sind, das magische, das geflügelte Wort: Sie sprechen von einem Kind!
»Königin Elyssa«, sagt Aeneas jetzt, »ich habe einen Sohn namens Iulus, er hat außer mir keine Familie und niemanden sonst, der ihn beschützt. Ich muss wissen, ob er den Sturm überlebt hat. Daher bitte ich dich um Erlaubnis, in den Wrackteilen meiner Flotte nach ihm zu suchen.«
Elyssa entflechtet den Korb unserer Hände und deutet auf den Palast.
»Komm mit mir«, sagt sie. »Ich biete dir ein Pferd und das Geleit meiner Männer, die mit dem Gelände vertraut sind.«
Ich begleite sie nicht zum Palast. Mit schlenkernden Armen lasse ich den Platz hinter mir.