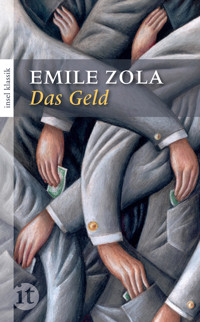1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Booksell-Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In "Nana" entführt uns Emile Zola in die pulsierende Welt des Pariser Theaters des 19. Jahrhunderts, ein Mikrokosmos der sozialen Spannungen und kulturellen Verwerfungen seiner Zeit. Der Roman folgt der außergewöhnlichen Lebensgeschichte der Protagonistin Nana, einer ehemaligen Fiormel von der Straße, die es schafft, vom einfachen Mädchen zur gefeierten Schauspielerin und Geliebten der Mächtigen aufzusteigen. Zola, als Hauptvertreter des Naturalismus und Meister der psychologischen Porträtierung, webt mit eindringlichen Beschreibungen und scharfer Sozialkritik ein vielschichtiges Bild, das sowohl den Glamour als auch die Abgründe der Gesellschaft enthüllt. Die Themen Macht, Sexualität und der Einfluss der Umwelt auf das Individuum bilden das Fundament seines literarischen Schaffens und spiegeln sich durchgängig in diesem Werk wider. Emile Zola, geboren 1840, gilt als einer der bedeutendsten französischen Schriftsteller und Wegbereiter des Naturalismus. Sein eigenes bewegtes Leben, insbesondere die Zeit der Dreyfus-Affäre, prägte seine Auffassung von sozialer Gerechtigkeit und Verantwortung. Zola's unermüdliches Streben, das Leben der unteren Schichten und die inhärenten Ungerechtigkeiten der Gesellschaft sichtbar zu machen, war eine treibende Kraft bei der Schaffung von "Nana". Seine Fähigkeit, das Elend und die Hoffnung seiner Charaktere auf eindringliche Weise darzustellen, verankert Zola fest im literarischen Kanon. "Nana" ist nicht nur ein fesselnder Roman über eine bemerkenswerte Frau, sondern auch ein wertvolles historisches Dokument, das die Zwänge und Freiheiten seiner Zeit reflektiert. Für Leser, die sich für tiefgründige Charakterstudien und die Entlarvung gesellschaftlicher Missstände interessieren, bietet dieses Werk von Zola eine packende und aufschlussreiche Lektüre. Die Kombination aus fesselndem Plot und kritischer Auseinandersetzung mit der menschlichen Natur macht "Nana" zu einem absoluten Muss für jeden Literaturfreund. In dieser bereicherten Ausgabe haben wir mit großer Sorgfalt zusätzlichen Mehrwert für Ihr Leseerlebnis geschaffen: - Eine prägnante Einführung verortet die zeitlose Anziehungskraft und Themen des Werkes. - Die Synopsis skizziert die Haupthandlung und hebt wichtige Entwicklungen hervor, ohne entscheidende Wendungen zu verraten. - Ein ausführlicher historischer Kontext versetzt Sie in die Ereignisse und Einflüsse der Epoche, die das Schreiben geprägt haben. - Eine Autorenbiografie beleuchtet wichtige Stationen im Leben des Autors und vermittelt die persönlichen Einsichten hinter dem Text. - Eine gründliche Analyse seziert Symbole, Motive und Charakterentwicklungen, um tiefere Bedeutungen offenzulegen. - Reflexionsfragen laden Sie dazu ein, sich persönlich mit den Botschaften des Werkes auseinanderzusetzen und sie mit dem modernen Leben in Verbindung zu bringen. - Sorgfältig ausgewählte unvergessliche Zitate heben Momente literarischer Brillanz hervor. - Interaktive Fußnoten erklären ungewöhnliche Referenzen, historische Anspielungen und veraltete Ausdrücke für eine mühelose, besser informierte Lektüre.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Emile Zola: Nana - Roman
Inhaltsverzeichnis
Einführung
Glanz verführt, aber er verschlingt. In Nana bündelt Émile Zola die Lockkraft des Spektakels und die Kosten der Bewunderung zu einer schonungslosen Studie über Begehren, Status und Geld. Der Roman blickt auf eine Gesellschaft, die ihre Hoffnungen auf Fortschritt in den blendenden Lichtern der Bühne spiegelt, während im Schatten alte Ordnungen zerbröckeln. Die Figur im Mittelpunkt wird zur Projektionsfläche für Lust und Angst, zur Ware und zum Machtinstrument zugleich. Zola zeigt, wie Aufmerksamkeit zur Währung einer Epoche wird und wie die Sehnsucht nach Aufstieg nicht nur die Begehrten, sondern auch die Begehrenden formt und gefährdet.
Émile Zola (1840–1902) gilt als Leitfigur des literarischen Naturalismus in Frankreich. Sein Roman Nana erschien 1880 in Buchform, nachdem zuvor Teile in Fortsetzungen veröffentlicht worden waren. Das Werk ist der neunte Band der zwanzigteiligen Reihe Les Rougon-Macquart, die Zola programmatisch als „Natur- und Sozialgeschichte einer Familie unter dem Zweiten Kaiserreich“ entwarf. Nana steht innerhalb dieses Zyklus für die Untersuchung einer spezifischen gesellschaftlichen Sphäre: der Welt der Bühne, der Salons und des mondänen Vergnügens im Paris des Zweiten Kaiserreichs. Entstehung und Stoff verknüpfen sich mit Zolas Anspruch, Kunst und Beobachtung zu einer Erkenntnisform zu verschmelzen.
Innerhalb der Rougon-Macquart breitet Zola die Wechselwirkung von Vererbung und Milieu aus. Nana, die literarisch aus dem Umfeld von L’Assommoir stammt, ist als Figur zugleich Kind ihrer Herkunft und Kind ihrer Zeit. Der Roman fragt, wie soziale Umstände, städtische Modernität und die Mechanismen eines auf Konsum ausgerichteten Lebens die Wege einer jungen Frau prägen. Anstelle moralischer Wertungen setzt Zola auf genaue Beschreibung und Konstellationen, in denen sich Charakterzüge unter Druck zeigen. So entsteht ein Panorama, das die individuellen Impulse einer Protagonistin mit den anonymen Kräften des Marktes, der Öffentlichkeit und des Spektakels verschränkt.
Die Ausgangssituation ist klar und spannungsreich: Eine junge Frau mit bescheidenen Anfängen betritt die Bühne des Pariser Vergnügungslebens und wird rasch zur Attraktion. Ihre Präsenz zieht Männer aus höchsten Kreisen in ihren Bann; zugleich entstehen Kreise aus Bewunderern, Vermittlern und Profiteuren, die am Glanz mitverdienen. Die Erzählung folgt ihrem Aufstieg in eine Welt, die von Aufmerksamkeit, Geldströmen und gesellschaftlicher Geltung getragen wird. Ohne vorzugreifen, lässt sich sagen: Zola beobachtet, wie Beziehungen, Geschäfte und Gerüchte ineinandergreifen und wie eine öffentliche Figur zugleich Produkt und Motor eines von Erwartungen angeheizten Systems wird.
Stilistisch verbindet Zola minutiöse Recherche mit einer erzählerischen Technik, die Szenen wie Bühnenbilder schichtet. Detailreiche Beschreibungen von Kostümen, Interieurs und Stadtlandschaften entfalten nicht bloß Atmosphäre, sondern erklären soziale Funktionen: Kleidung, Räume und Rituale markieren Rang, befördern Begegnungen und öffnen Falltüren. Die Sprache bleibt präzise, sinnlich und zugleich analytisch. Zola zeigt Vorliebe für Kollektivszenen, in denen Gesichter, Stimmen und Gerüche zu einem Strom verschmelzen, gegen den sich individuelle Figuren behaupten müssen. Dabei nutzt er Perspektivwechsel, um das Verhältnis von öffentlicher Wirkung und privatem Kalkül sichtbar zu machen.
Historisch blickt der Roman in die Phase nach der großstädtischen Umgestaltung von Paris. Boulevards, Theater, Rennbahnen, Zeitungen und neue Formen der Freizeit bilden den Resonanzraum der Handlung. Das Zweite Kaiserreich etabliert eine Ordnung, in der Schein und Repräsentation politischen und sozialen Nutzen stiften. Die Regulierung der Sitten, die Ökonomie des Vergnügens und ein sich verdichtender Markt für Aufmerksamkeit strukturieren Chancen und Risiken. Zola zeigt die Durchlässigkeit von Klassen an Orten, an denen Geld und Ruhm Rang ersetzen – und die Härte der Grenzen dort, wo Herkunft, Geschlecht und Anstandsdiskurse behauptet werden.
Bei Erscheinen löste Nana Diskussionen, Bewunderung und Anstoß aus. Die direkte Darstellung von Sexualität als sozialer und ökonomischer Kraft galt vielen als Provokation, anderen als notwendige Wahrhaftigkeit. Der Roman avancierte rasch zu einem Publikumserfolg und festigte Zolas Ruf als Chronist seiner Gegenwart. Sein Einfluss reicht über Frankreich hinaus: Naturalistische Erzählweisen in Europa griffen die Verbindung von Milieustudie, sozialer Diagnose und psychologischer Präzision auf. Die Figur der verführerischen, zugleich gesellschaftlich lesbaren Frau prägte Literatur und Theater und wurde zu einem Prüfstein für Debatten über Moral, Modernität und Darstellung.
Als Klassiker gilt das Werk, weil es formale Strenge mit thematischer Kühnheit verbindet. Zola entwirft keinen Sittenroman im moralisierenden Sinn, sondern eine Analyse der Kräfte, die Verhalten formen: Geld, Begehren, Prestige, Presse. Nachhaltig ist seine Einsicht, dass Körper und Gefühle in modernen Gesellschaften nicht außerhalb der Ökonomie stehen, sondern durch Preise, Blicke und Geschichten geprägt werden. Die Sprache des Romans bewahrt die Konkretion des Alltags und öffnet den Blick auf Strukturen. Diese doppelte Optik – nah an der Szene, weit in der Diagnose – macht Nana zu einem dauerhaften Bezugspunkt literarischer Moderne.
Nana selbst ist als Figur weder rein Symbol noch bloße Fallstudie. Zola zeichnet ihre Wirkung und ihr Auftreten, ihre Strategien und Unsicherheiten. Sie ist Subjekt und Oberfläche zugleich, handelt und wird gelesen, besitzt Anziehungskraft und wird von dieser Anziehung gelenkt. In der Spannung zwischen Selbstentwurf und Zuschreibung zeigt der Roman, wie Öffentlichkeit Identität prägt. Die Menschen um sie herum – Bewunderer, Rivalinnen, Vermittler – spiegeln Möglichkeiten und Grenzen sozialer Beweglichkeit. Daraus entsteht keine simple Moral, sondern ein Befund über die Reibung von individueller Freiheit und gesellschaftlichen Skripten.
Räume haben in diesem Roman eine eigene Grammatik. Bühnen und Boudoirs, Rennbahnen und Restaurants organisieren Sichtbarkeit, Nähe und Distanz. Vorhänge, Spiegel und Lichter werden zu Apparaten des Blicks, an denen Anerkennung und Macht ausgehandelt werden. Das Gedränge auf den Boulevards kontrastiert mit den abgeschlossenen Interieurs, in denen Preise gesetzt und Versprechen gegeben werden. Zola nutzt diese räumlichen Choreografien, um soziale Energie sichtbar zu machen: wie Gerücht zu Ruf wird, wie Mode zu Maßstab wird, wie das Kollektiv die Einzelnen formt. Der Roman liest die Stadt als Maschine der Wünsche.
Heute wirkt Nana aktuell, weil sich ihre Themen in veränderter Gestalt fortsetzen. Die Ökonomie der Aufmerksamkeit hat neue Medien gefunden, doch Mechanismen von Inszenierung, Begehren und Bewertung sind vertraut. Fragen nach Selbstbestimmung, nach der Grenze zwischen Agency und Ausbeutung, nach der Macht von Bildern und Storys treiben Debatten an. Auch der Zusammenhang von Luxus und Ungleichheit, von moralischem Urteil und öffentlicher Neugier, bleibt brisant. Zolas Analyse hilft zu verstehen, wie eine Person zur Schnittstelle kollektiver Fantasien wird – und wie gesellschaftliche Verhältnisse sich in Biografien einschreiben.
Dieses Buch bleibt lesenswert, weil es seine Zeit erfasst und zugleich über sie hinausweist. Es bietet Erkenntnis durch Genauigkeit, Spannung ohne Effekthascherei und Figuren, die die Widersprüche ihrer Welt verkörpern. Als Teil eines großen Erzählprojekts zeigt es, wie Literatur soziale Wahrheit herstellen kann, ohne die Freiheit der Kunst zu verlieren. Wer Nana liest, begegnet der Moderne in einem ihrer ersten und schärfsten Spiegel. Darin liegt seine zeitlose Qualität: Es lehrt, hinter den Glanz zu sehen und die Kräfte zu erkennen, die ihn erzeugen – eine Einladung, die auch heute nichts von ihrer Dringlichkeit verloren hat.
Synopsis
Émile Zolas Nana erschien 1880 als Teil des Rougon-Macquart-Zyklus und zeichnet ein Panorama des Pariser Zweiten Kaiserreichs. Im Zentrum steht Nana Coupeau, Tochter aus einfachen, prekären Verhältnissen, die in die schillernde Welt des Theaters und der mondänen Salons aufsteigt. Der Roman verknüpft individuelle Lebensgeschichte mit gesellschaftlicher Diagnose: Verführungskraft, Geld und Spektakel bilden ein Geflecht, das Figuren aus Adel, Finanzwelt und Kunst gleichermaßen anzieht. Zola zeigt mit nüchternem Blick, wie Begehren, Konsum und sozialer Ehrgeiz ineinandergreifen und Normen erodieren. Ausgangspunkt ist Nanas Auftritt auf einer Pariser Bühne, der weniger durch Kunst als durch Aura Wirkung entfaltet.
Die Eröffnungsszene im Variété-Theater markiert einen ersten Wendepunkt: Nanas Gesang und Spiel sind ungeschliffen, doch ihr körperlicher Auftritt elektrisiert das Publikum. Wohlhabende Gönner und gelangweilte Aristokraten wenden sich ihr zu; ein Publikumsliebling entsteht mehr aus Faszination als aus Talent. Produzent Bordenave erkennt das Geschäft hinter der Erscheinung und setzt auf Skandal und Glanz. In den Logen entstehen Verbindungen, die Nanas weiteren Weg bestimmen. Sie beginnt, die Regeln der Bühne und des Boudoirs zu verknüpfen, und etabliert sich als Kurtisane, deren Wert aus Aufmerksamkeit, Präsentation und taktischer Distanz entsteht, nicht aus künstlerischer Meisterschaft.
Zola verankert Nanas Gegenwart in ihrer Herkunft: Als Tochter von Gervaise und Coupeau, bekannt aus einem früheren Band der Reihe, bringt sie die Spuren eines Milieus mit, das von Entbehrung und Zufall geprägt ist. Ihre Vergangenheit bleibt im Roman spürbar, ohne ausführlich erzählt zu werden, und bildet einen stillen Kontrast zu den neuen Kreisen. Ein kleiner Sohn verkompliziert ihre Situation, denn Zuneigung, Verantwortung und materielle Sicherung kollidieren. Der Text vermeidet Sentimentalität und zeigt stattdessen, wie soziale Herkunft, städtisches Umfeld und die Strukturen des Vergnügungsbetriebs die Handlungsoptionen formen, selbst wenn scheinbar unbegrenzte Möglichkeiten in Sicht sind.
Mit wachsender Bekanntheit entsteht um Nana ein Wirtschaftskreislauf aus Garderobe, Schmuck, Pferdekutschen und aufwändigen Wohnungen. Händler, Schneiderinnen, Theaterleute und Vermieter profitieren von ihrem Nimbus, während Rivalinnen wie die gefeierte Rose Mignon den Markt um Aufmerksamkeit anheizen. Bordenaves Pragmatismus liefert die Bühne, doch der eigentliche Antrieb ist die städtische Gier nach Neuem. Zola setzt das Theater als Labor ein: Hier werden Rollen erfunden, Grenzen getestet und Moral zur Kulisse. Nanas Auftritte verwandeln sich in gesellschaftliche Ereignisse, bei denen die Zuschauer die eigene Begierde konsumieren und zugleich moralische Urteile über die Darbietung fällen.
Zentrale Beziehungen verdeutlichen die Spannungen der Zeit. Ein fromm erzogener Aristokrat wird von Nana angezogen und gerät in einen Konflikt zwischen Glauben, Reputation und Begehren. Ein Finanzmann sieht in ihr Prestige und Investition, ein Schauspieler fordert Besitz und Gehorsam. Diese Männerwelt projiziert Sehnsüchte und Machtfantasien, doch Nana entzieht sich festen Zuschreibungen: Mal erscheint sie als zerstörerische Kraft, mal als Frau, die in den engen Bahnen der Verhältnisse handelt. Zola beobachtet wertfrei, wie Geldströme intime Bindungen regieren und wie private Leidenschaften öffentliche Skandale erzeugen, sobald Diskretion, Eifersucht und Schulden kollidieren.
Ein prägnantes Symbol bietet das Rennen auf der Pariser Bahn: Ein Pferd, das ihren Namen trägt, wird zum Spektakel für Wetten, Werbung und Eitelkeit. Der Tag zeigt die Mechanik des Zufalls, die Überhitzung der Erwartungen und die Bereitschaft, Vermögen einem Momentrausch zu opfern. Für Gönner, die in Nana investieren, verschränken sich sportliche und erotische Einsätze; die Rennbahn ist Bühne und Börse zugleich. Zola nutzt die Episode, um Beschleunigung, Gerücht und Prestige als Motoren der Gesellschaft zu zeigen. Der Ausgang des Rennens wirkt wie ein Barometer, das Aufstieg und Absturz in derselben Geste denkbar macht.
Je weiter Nana in die höheren Kreise vordringt, desto deutlicher werden Widersprüche: hinter Salonglanz stehen rigide Konventionen, die sie zugleich benutzt und verletzt. Zwischen Versöhnungsversuchen, luxuriösen Rückzügen und neuen Affären schwankt ihr Alltag. Zola zeichnet die Tyrannei des Geldes nach, die Selbstbilder formt und zerstört. Mode, Interieurs und Feste dienen als Schauplätze moralischer Verhandlungen. Dabei werden Anzeichen politischer Spannung spürbar: Das Ende des Kaiserreichs wirft seinen Schatten voraus, und die fragile Ruhe der Gesellschaft scheint nur noch von Zerstreuungen zusammengehalten, die immer kostspieliger und kurzlebiger ausfallen.
Skandale verdichten sich, Rechnungen türmen sich, Loyalitäten zerbrechen. Die Grenze zwischen privatem Vergnügen und öffentlicher Affäre verwischt, während Krankheit, Gerüchte und Angst vor politischer Umwälzung die Atmosphäre verändern. Zola steigert nicht die Dramatik durch melodramatische Enthüllungen, sondern durch nüchterne Akkumulation: Kleinere Demütigungen, peinliche Enthüllungen und kostspielige Launen ziehen Konsequenzen nach sich. In dieser Verdichtung zeigt sich die Verletzlichkeit von Körpern und Institutionen gleichermaßen. Die Frage, ob Umkehr möglich ist, bleibt offen, doch der Ton signalisiert, dass gesellschaftliche Dynamiken individuelle Entscheidungen überlagern.
Am Ende steht kein einfacher Lehrsatz, sondern ein bleibendes Bild einer Epoche, die sich im Spiegel einer einzelnen Figur erkennt. Nana erscheint als Produkt und Prüfstein des Zweiten Kaiserreichs: Sie bündelt Konsumlust, Doppelmoral und die Macht des Blicks. Zola entfaltet sein naturwissenschaftlich inspiriertes Programm, indem er Vererbung, Milieu und soziale Kräfte in ihrer Wechselwirkung zeigt, ohne zu moralisieren. Die nachhaltige Bedeutung des Romans liegt in seiner Analyse der Verführbarkeit moderner Gesellschaften und in der Frage, wie Körper, Kapital und Öffentlichkeit sich gegenseitig hervorbringen. Die endgültigen Schicksale bleiben der Lektüre vorbehalten.
Historischer Kontext
Émile Zolas Nana spielt im Paris des Zweiten Kaiserreichs, das unter Napoleon III. zwischen 1852 und 1870 eine Epoche rasanter Modernisierung und ostentativer Pracht erlebte. Politische Macht lag beim bonapartistischen Staat mit seiner Zentralverwaltung, dem Pariser Polizeiapparat und einer Hofgesellschaft, die öffentliche Repräsentation kultivierte. Zola veröffentlichte den Roman 1880, blickte jedoch auf die späten 1860er Jahre zurück. Die Bühne, die Boulevards und die mondänen Salons bilden das urbane Setting, in dem Vergnügungskultur, Finanzkapital und staatliche Kontrolle ineinandergreifen. Diese Rahmenbedingungen bestimmen den sozialen Raum, in dem die Titelfigur aufsteigt und ein Netzwerk von Abhängigkeiten offenlegt.
Nana gehört zum Zyklus Les Rougon-Macquart, den Zola als „natürliche und soziale Geschichte einer Familie unter dem Zweiten Kaiserreich“ konzipierte. Der Roman ist im Serienzusammenhang die neunte Folge und knüpft an L’Assommoir an, das die Milieus der Pariser Arbeiterklasse schildert. Zola verbindet individuelle Biografien mit einem Ensemble aus Institutionen, Ökonomien und Sitten. Im Zentrum steht die These, dass Erbe und Umwelt die Handlungsspielräume seiner Figuren bedingen. Nana bewegt sich dadurch zwischen determinierender Herkunft und den Verlockungen einer Gesellschaft, die Ruhm, Geld und Körper als Tauschwerte ausstellt.
Die gesellschaftliche Ordnung des Kaiserreichs war von einer Mischung aus alter Aristokratie, arrivierter Großbourgeoisie und einem Hofstaat geprägt, der Repräsentation und Patronage pflegte. Die Verwaltung zentralisierte Entscheidungen, während die Polizei Sitten und Presse überwachte. Dennoch entstanden in Paris Zonen sozialer Durchlässigkeit, in denen Schauspielerinnen, Journalisten und Finanziers den Umgang pflegten. In diesem „Démimonde“ trafen männliche Eliten auf Frauen, deren gesellschaftliche Macht aus Sichtbarkeit, Beziehungen und kulturellem Kapital erwuchs. Zolas Roman nutzt diese Schnittstellen, um Abhängigkeit, Erpressbarkeit und symbolische Gewalt sichtbar zu machen, die hinter glänzenden Fassaden verborgen blieb.
Wesentlich für das Setting ist die von Georges-Eugène Haussmann gesteuerte Umgestaltung der Stadt. Breite Boulevards, neue Parks, ein modernisiertes Wassersystem und Gasbeleuchtung veränderten zwischen den 1850er und 1860er Jahren den Alltag. Die Umbrüche schufen Orte des Flanierens, Theaterbauten und Passagen, in denen Schaufenster und elektrische Anmutungen der Moderne das Konsumverhalten prägten. Zugleich wurden Arbeiterquartiere verworfen und Ränder neu geordnet. Das Resultat war eine Bühne der Sichtbarkeit, auf der sich soziale Hierarchien performativ einschrieben. Zola inszeniert Nana vor diesem urbanen Panorama als Produkt und Akteurin einer Stadt, die Präsentation belohnt.
Theater, Operette und Café-Concert boomten als Leitformen des Vergnügens. Pariser Bühnen wie die Variétés oder das Gymnase repräsentierten ein Repertoire, das zwischen seichter Unterhaltung und satirischer Gesellschaftsbeobachtung wechselte. Komponisten wie Jacques Offenbach prägten den Ton einer heiteren, oft frivolen Öffentlichkeit. Hinter den Kulissen etablierte sich ein ökonomischer Kreislauf aus Rollen, Gönnerschaft und Presse. Bühnenstars wurden zu Medienfiguren, deren Ruhm ökonomisch verwertbar war. In Zolas Darstellung verschränken sich Rampenlicht und Intimität: Der Zugang zu Macht vollzieht sich über Logen, Hinterbühnen und Soireen, wo künstlerische, sexuelle und finanzielle Transaktionen zusammenfallen.
Die Prostitution unterlag in Frankreich einem Regulationismus: behördlich tolerierte Häuser, Gesundheitskontrollen und eine Sittenpolizei strukturierten das Feld. Zugleich existierte eine halböffentliche Sphäre hochrangiger Kurtisanen, die außerhalb der Registrierung agierten und mit Aristokraten, Industriellen und Militärs verkehrten. Zeitgenössische Beobachter assoziierten Zolas Figur mit realen Darstellerinnen und Kurtisanen wie Blanche d’Antigny oder Valtesse de La Bigne, ohne dass der Roman auf ein einziges Vorbild zu reduzieren wäre. Zola recherchierte in Presseberichten und Milieustudien, um Mechanismen von Schutzgeld, Krediten, Schmuckpfändern und gesellschaftlichem Aufstieg zu dokumentieren.
Mode und Konsumkultur nahmen in den 1860er Jahren eine Schlüsselrolle ein. Haute Couture-Häuser, etwa das von Charles Frederick Worth, inszenierten Kleidung als Statuszeichen; Silhouetten wie Krinoline und spätere Turnüre dominierten die Straßenbilder. Zeitgleich expandierten Kaufhäuser wie Le Bon Marché, Printemps und La Samaritaine, die mit Schaufenstern, Festpreisen und Umtauschrecht neue Kaufpraktiken etablierten. Kosmetik, Parfüm und Accessoires wurden zu markierten Gütern eines weiblich konnotierten Luxus. In Nana fungieren Kleider, Stoffe und Juwelen als Kapital und Kommunikationsmittel; Geschenke und Einrichtungsobjekte binden Liebhaber, verbürgen Kredit und setzen Rangzeichen.
Die Ökonomie des Kaiserreichs wurde von Eisenbahnausbau, Spekulation und Finanzinnovationen getragen. Die Brüder Péreire etablierten das Crédit Mobilier, dessen spektakulärer Aufstieg und Niedergang 1867 als Lehrstück riskanter Kapitalakkumulation gilt. Immobiliengeschäfte im Zuge der Haussmannisierung, Börsenengagements und Rennwetten formten eine Kultur des schnellen Gewinns. Orte wie die Rennbahn von Longchamp, seit den 1850er Jahren Treffpunkt der Elite, verbanden Sport, Prestige und Geldströme. Zola zeichnet nach, wie diese Finanzwelt Männerkarrieren antreibt und ruiniert – und wie Nana als Katalysator konsumtiver Exzesse die inneren Widersprüche dieser Ökonomie freilegt.
Die Presselandschaft erlebte nach schrittweisen Lockerungen der Zensur in den 1860er Jahren einen Aufschwung. Feuilletons und Vorabdrucke machten Romane zum Gegenstand öffentlicher Debatten. Naturalistische Werke wurden häufig zuerst in Zeitungen veröffentlicht und lösten, je nach Inhalt, Skandal- und Moralfragen aus. Auch Nana zirkulierte zunächst in der Presse, bevor das Buch 1880 erschien; die Reaktionen reichten von Empörung über Sitten bis hin zu Anerkennung für soziale Genauigkeit. Die Presse als Verstärker von Ruhm und Rufmord ist zugleich Teil des Romans, in dem öffentliche Meinung Karrieren beflügelt oder vernichtet.
Das rechtliche und kulturelle Geschlechterregime war vom Code civil geprägt, der verheiratete Frauen in vielen Bereichen dem Mann unterordnete. Scheidung war seit 1816 abgeschafft und wurde erst 1884 wieder eingeführt; das beförderte extralegale Arrangements, Patronage und Doppelmoral. Während weibliche Sexualität streng moralisiert wurde, galt männliche Freizügigkeit als sozial tolerierter Standard. Zola zeigt, wie diese Asymmetrie das Begehren der Eliten strukturiert, Frauen ökonomisch abhängig hält und zugleich Räume für strategische Gegenmacht eröffnet. Nana nutzt die Logiken der Repräsentation, um Zutritt und Ressourcen zu gewinnen – stets prekär, da Respektabilität verweigert bleibt.
Zolas Poetik des Naturalismus berief sich auf zeitgenössische Wissenschaften. Unter dem Einfluss von Autoren wie Hippolyte Taine und Physiologen wie Claude Bernard formulierte Zola die Idee des „experimentellen Romans“, die er 1880 theoretisch ausarbeitete. Milieu, Erblichkeit und soziale Determination sollten literarisch beobachtbar werden. In der Rougon-Macquart-Reihe verfolgt er Genealogien über Generationen hinweg, um Laster, Krankheiten und Gewohnheiten zu kartieren. Nana steht exemplarisch für diese Methode: Die Figur ist weniger moralische Allegorie als Versuchsanordnung, die die Wechselwirkung von Herkunft, Stadtlandschaft, Geldverkehr und kultureller Symbolik sichtbar macht.
Die öffentliche Gesundheitslandschaft dieser Zeit war widersprüchlich. Zwar existierte seit dem frühen 19. Jahrhundert die Pockenimpfung, doch blieben Durchführung und Akzeptanz ungleich. Dichte Urbanität, Migration und Massenmobilität begünstigten Epidemien; 1870–1874 erfasste eine schwere Pockenwelle Europa, auch Frankreich. Parallel kreisten medizinische und polizeiliche Diskurse um Geschlechtskrankheiten, was sich in Zwangsuntersuchungen und Registern niederschlug. Zola verankert Krankheit als soziales Faktum und als Metapher: Nanas Tod an den Pocken – während die Stadt politische Erregung erlebt – verweist historisch korrekt auf die Verwundbarkeit einer Gesellschaft, die an Oberfläche und Mobilität gewöhnt war.
Politisch trug das Kaiserreich Züge der Liberalisierung und der Repression. Nach innen lockerte Napoleon III. in den 1860ern schrittweise die Presse- und Vereinsgesetze; Wahlen 1869 zeigten erstarkende Opposition. Außenpolitisch mündeten Spannungen in den Deutsch-Französischen Krieg von 1870. Die Kriegserklärung führte rasch zur Niederlage bei Sedan und zum Sturz des Regimes. Zola setzt den Schluss seines Romans in die Erwartung und den Lärm der Mobilmachung: Parolen auf den Straßen kontrastieren mit privater Katastrophe. So rahmt der Krieg den moralischen und politischen Zusammenbruch, den die Erzählung zuvor im Kleinen durchgespielt hat.
Zeitgenössische Leser erkannten im Roman eine Kritik an der Dekadenz des Kaiserreichs. Der verschwenderische Luxus, die Korruption von Verwaltung und Militär, die Eitelkeit der Aristokratie – all das erscheint bei Zola nicht als Anklage von Einzelnen, sondern als Systembeschreibung. Nana fungiert als Spiegel, der die Selbstzerstörung einer Männergesellschaft offenlegt, die sich an der Fassade berauscht. Das Werk belegt damit, wie Konsum, Macht und Sexualpolitik ineinandergreifen und wie fragile Loyalitäten unter Druck zerfallen. Die spätere militärische Niederlage liefert den historischen Resonanzraum dieser Diagnose.
Die Pariser Topographie des Vergnügens umfasste Parks wie den Bois de Boulogne, elegante Restaurants, Private-Logen in Oper und Theater sowie exklusive Clubs. Hier wurden Verbindungen gestiftet, Geschäfte eingefädelt und Karrieren entschieden. An solchen Orten agieren bei Zola Figuren, deren Ansehen an Sichtbarkeit und Begleitung gemessen wird. Kutschenfahrten, Souper, Diners und Maskenbälle bilden Rituale sozialer Distinktion. Die materiellen Details – von Tapetenmustern bis zu Champagnermarken – illustrieren eine Kultur, in der Ästhetik Zahlungsmittel ist und in der intime Beziehungen als Investitionen in Status und Kredit fungieren.
Literarisch steht Nana im Spannungsfeld von Realismus und Naturalismus. Verfahren wie das genaue Inventar materieller Kultur teilen Zola mit Flaubert, dessen Prozess um Madame Bovary 1857 Debatten über Kunst und Moral befeuerte. Die Brüder Goncourt erprobten Milieustudien; Dumas fils problematisierte in Dramen den „Démimonde“. Diese Diskurse prägten Publikumserwartungen und Behördenpraxis, etwa bei der Theaterzensur. Zola radikalisiert die Beobachtung, indem er das Netz aus Presse, Medizin, Polizei und Geld mit literarischer Akribie dokumentiert und zugleich die Mechanik von Skandal und Aufmerksamkeit als Teil der modernen Öffentlichkeit durchspielt.
Zolas Werk reaggregiert damit zentralen Stoff der Epoche: die Verführungskraft der Großstadt, die massenmediale Verwertung des Privaten und die politische Fragilität eines Regimes im Glanz seiner Fassaden. Nana kommentiert die Zeit, indem es ihre Logiken konsequent zu Ende denkt – vom Ankleidezimmer über die Börse bis zum Schlachtfeld. Die Erzählung verbindet private Tragödien mit kollektiver Selbsttäuschung und zeigt, wie Körper, Geld und Macht sich gegenseitig verschleißen. Als historisches Dokument bleibt der Roman ein präziser, oft unbequemer Spiegel des Zweiten Kaiserreichs und seiner spektakulären, doch brüchigen Moderne.
Autorenbiografie
Émile Zola (1840–1902) gilt als einer der prägenden Romanautoren des späten 19. Jahrhunderts und als zentrale Figur des literarischen Naturalismus. Sein Werk entstand im Spannungsfeld des Zweiten Kaiserreichs und der Dritten Republik und verband erzählerische Genauigkeit mit sozialer Beobachtung. Zola verfolgte das Projekt, gesellschaftliche Mechanismen, Milieus und die Macht wirtschaftlicher Kräfte in Romanform zu analysieren. International bekannt wurde er durch den zwanzigteiligen Zyklus Les Rougon-Macquart sowie durch sein öffentliches Engagement in der Dreyfus-Affäre. Als Journalist, Kritiker und Essayist beeinflusste er Debatten über Kunst, Wissenschaft und Politik und prägte nachhaltige Vorstellungen vom modernen Gesellschaftsroman.
Zola verbrachte einen Teil seiner Jugend in Aix-en-Provence und zog anschließend nach Paris, wo er früh mit dem literarischen und journalistischen Milieu in Berührung kam. Ab 1862 arbeitete er im Verlag Hachette, zunächst als Angestellter, dann im Bereich Werbung, was ihm Einblicke in den Buchmarkt und Pressewesen gab. Prägende Lektüren waren unter anderem Balzac, Stendhal und Flaubert; als theoretische Bezugspunkte dienten Hippolyte Taines Geschichtsdenken und Claude Bernards Konzept des „experimentellen“ Vorgehens. Aus diesen Einflüssen entwickelte Zola seine Vorstellung vom Roman als empirisch informierter Untersuchung gesellschaftlicher Kräfte, mit besonderem Augenmerk auf Milieu, Vererbung und zeitgenössische Institutionen.
Parallel zu seiner Verlagstätigkeit veröffentlichte Zola Literaturkritiken und Kunstberichte und engagierte sich früh für die realistische Malerei seiner Zeit, etwa indem er Manet verteidigte. 1866 verließ er Hachette, um ausschließlich von der Schriftstellerei zu leben. Erste Bücher wie Contes à Ninon (1864) und der Roman Thérèse Raquin (1867) machten ihn bekannt und lösten Debatten über Moral und Darstellungsgrenzen aus. Weitere frühe Arbeiten waren unter anderem Madeleine Férat (1868) sowie journalistische Skizzen und Essays. Programmschriften wie Le Roman expérimental (1880) formulierten sein Verständnis des Naturalismus als methodischer, dokumentarisch untermauerter Annäherung an gesellschaftliche Wirklichkeit.
Den Kern seines Schaffens bildet der Zyklus Les Rougon-Macquart (1871–1893), der das Zweite Kaiserreich durch die Schicksale einer weit verzweigten Familie spiegelt. Zola verknüpfte die Leitmotive Vererbung und Umwelt mit akribischer Recherche in Fabriken, Märkten, Bahnhöfen, Börsenspekulation und auf dem Land. Zu den bekanntesten Bänden zählen La Fortune des Rougon (1871), L’Assommoir (1877), Nana (1880), Au Bonheur des Dames (1883), Germinal (1885), La Terre (1887), La Bête humaine (1890), La Débâcle (1892) und Le Docteur Pascal (1893). Der Zyklus verband erzählerische Breite mit soziologischer Beobachtung und setzte Maßstäbe für den modernen Gesellschaftsroman.
Zolas Romane erzielten hohe Auflagen und provozierten zugleich heftige Kontroversen. L’Assommoir etwa wurde wegen seiner Darstellung von Alkoholismus und Arbeiterelend angegriffen, prägte aber entscheidend die öffentliche Wahrnehmung des Naturalismus. Mit Essays wie Les Romanciers naturalistes (1881) verteidigte Zola sein Programm gegen Vorwürfe des Determinismus und der Unmoral und betonte die Notwendigkeit nüchterner Beobachtung. Die große Resonanz seiner Bücher reichte weit über Frankreich hinaus, beeinflusste Debatten über Industrialisierung, Massenkultur und Urbanität und stimulierte literarische Experimente in verschiedenen Sprachen. Zugleich blieb die Frage nach ästhetischer Freiheit und sozialer Verantwortung ein wiederkehrender Streitpunkt seiner Rezeption.
Eine Schlüsselrolle in Zolas öffentlicher Biografie spielt sein Eingreifen in die Dreyfus-Affäre. Mit der offenen Anklageschrift „J’Accuse…!“ in der Zeitung L’Aurore (1898) prangerte er Justizirrtum und antisemitische Tendenzen an und verband sein Ethos der Wahrheitsfindung mit politischem Mut. Der Prozess wegen Verleumdung führte zu seiner Verurteilung und zu einem zeitweiligen Exil in Großbritannien; im Folgejahr kehrte er nach Frankreich zurück. Zolas Intervention trug wesentlich zur Mobilisierung von Intellektuellen und zur Neuformierung der öffentlichen Debatte bei und schärfte das Verständnis seiner Romane als Prüfsteine institutioneller Macht und moralischer Verantwortung sowie individueller Rechte in der modernen Massengesellschaft.
In den letzten Jahren schrieb Zola weiter Romane, Essays und Artikel und blieb eine prominente Stimme des literarischen und politischen Lebens. Er starb 1902 in Paris. 1908 wurde er in das Pariser Panthéon überführt, was seine symbolische Stellung im nationalen Gedächtnis festigte. Sein Vermächtnis umfasst die Konsolidierung des Naturalismus als internationale Bewegung, ein Panorama der Gesellschaft des 19. Jahrhunderts und erzählerische Verfahren, die Recherche, Dokument und Fiktion verbinden. Werke wie Germinal, Nana oder Au Bonheur des Dames werden bis heute neu gelesen, adaptiert und erforscht und prägen Debatten über Arbeit, Konsum, Geschlecht und Öffentlichkeit.
Nana - Roman
Ein Pariser Sittenroman
Erstes Kapitel
Um neun Uhr war der Saal des Varietétheater[1]s noch leer. Ein paar Leute saßen wartend in den Logen und im Parkett und verloren sich zwischen den rotsamtnen Sesseln. Im Halbdunkel sah der Vorhang wie ein großer roter Fleck aus; kein Geräusch drang von der Bühne herüber, die Rampenlichter waren noch nicht angezündet, die Plätze der Musiker noch leer. Nur hoch oben auf der dritten Galerie, die Kuppel des Plafonds entlang, wo nackte Frauen-und Kindergestalten ihren Aufflug nach einem vom Gaslicht grün bestrahlten Himmel nahmen, hörte man aus einem anhaltenden Stimmengewirr Sprechen und Gelächter, und unter den breiten runden, mit Goldstäben durchkreuzten Luftklappen reihten sich stufenförmig mit Häubchen und Hüten bedeckte Köpfe an-und übereinander. Zuweilen zeigte sich eine geschäftige Logenschließerin, die mit den Eintrittskarten in der Hand einen Herrn im Frack oder eine wohlbeleibte Dame vor sich herschob, die sich dann setzten und langsam ihre Blicke durch den Saal gleiten ließen.
Zwei junge Männer traten in den Orchesterraum. Sie blieben stehen und schauten sich um.
»Was hab' ich dir gesagt, Hector?« rief der ältere, ein hochgewachsener junger Mann mit kleinem, schwarzem Schnurrbärtchen. »Wir kommen viel zu früh. Du hättest mich meine Zigarre ruhig ausrauchen lassen sollen.«
Eine Logenschließerin schritt vorbei.
»Oh, Herr Fauchery«, wandte sie sich familiär zu den beiden Besuchern, »es vergeht sicher noch eine halbe Stunde, bevor angefangen wird.«
»Weshalb wird aber dann auf den Zetteln der Anfang auf neun Uhr angekündigt?« erwiderte Hector, dessen langes, hageres Gesicht ein verdrießliches Aussehen zeigte. »Heute morgen noch hat mir Clarisse, die in dem Stück beschäftigt ist, versichert, daß präzis neun Uhr begonnen werde.«
Einen Moment lang trat Stillschweigen ein; die jungen Leute sahen prüfend zu den Logen hinauf, die durch die grüne Tapete noch dunkler erschienen. Die Parterresitze unterhalb der Galerie waren in völlige Nacht getaucht. Nur in einer Balkonloge saß eine korpulente Dame, die sich mit beiden Ellenbogen auf die Samtbekleidung des Geländers stützte. Die zwischen den hohen Säulen mit langfransigen Vorhängen drapierten Proszeniumslogen zur Rechten und Linken waren leer. Der große Saal, mit weißen und vergoldeten Ornamenten geschmückt, die sich von dem mattgrünen Hintergrund abhoben, schwamm in einem feinen Lichtnebel, der von den niedrigen Flammen des großen Kristall-Armleuchters ausging.
»Hast du übrigens dein Proszeniumsbillett für Lucy bekommen?« fragte Hector.
»Ja«, versetzte der andere, »ohne besondere Mühe ... Oh, es besteht keine Gefahr, daß Lucy zu früh kommt! Die wäre gerade danach!«
Er unterdrückte ein leises Gähnen; dann sagte er nach einer kurzen Pause:
»Du hast wirklich Glück, hast ja bisher noch keine Premiere gesehen ... ,Die blonde Venus' wird das Ereignis des Jahres sein; man spricht schon seit einem halben Jahr von nichts anderem. Ach, mein Lieber, eine Musik! Faktisch hundsmäßig! ... Bordenave, der sein Geschäft aus dem Effeff versteht, hat sich das für die Ausstellung aufbewahrt.«
»Und Nana, der neue Stern, die die Venus spielen soll, kennst du die?«
»Um Gottes willen, laß mich zufrieden! Soll das wieder losgehen!« schrie Fauchery, die Arme in die Luft werfend. »Den ganzen Morgen schon bringt man mich schier um mit dieser Nana. Mit mehr als zwanzig Leuten habe ich heute schon geredet, und Nana hinten, Nana vorne! ... Nana ist der Trumpf unseres Bordenave[1q]. Es wird schon was Sauberes sein!«
Er beruhigte sich, aber die Leere des Saals, das Halblicht des Kronleuchters, die andächtige, von gedämpften Stimmen und leise zufallenden Türen unterbrochene Stille reizten ihn von neuem.
»Aber nein«, rief er plötzlich, »hier langweilt man sich ja wie ein Mops! Ich mache, daß ich weiterkomme. Höre, wir wollen sehen, ob wir nicht unten Bordenave aufgabeln; vielleicht kann er uns Aufklärung geben.«
Unten in dem großen, mit Marmorplatten belegten Vestibül, wo die Billettkontrolle ihren Platz hatte, strömte das Publikum langsam zusammen. Durch die drei geöffneten Türgitter hindurch sah man das hastige Leben auf den Boulevards, die in der schönen Aprilnacht flammten und wimmelten. Das Wagengerassel brach kurz ab, die Portieren schlossen sich geräuschlos, und in kleinen Gruppen traten Leute ein, die sich erst vor der Kontrolle stauten, dann die doppelte Treppe im Hintergrunde hinaufstiegen, auf der die Frauen, ihren Körper hin-und herwiegend, zögernd umherstanden. In diesem grell erleuchteten, mit seiner dürftigen Empiredekoration nackt und kahl aussehenden Vorraum hingen hohe gelbe Plakate, auf denen mit großen schwarzen Lettern der Name »Nana« zu lesen stand. Herren, die sich in dem Durchgang herumdrückten, stellten sich vor ihnen auf und lasen sie; andere plauderten, an der Tür lehnend und den Eingang versperrend, während neben dem Billettschalter ein dicker Mann mit breitem, glattrasiertem Gesicht den Leuten, die durchaus noch einen Platz haben wollten, auf ihre Fragen Antwort erteilte.
»Sieh, da ist Bordenave«, sagte Fauchery, der die Treppe herunterkam.
Aber auch der Direktor war seiner ansichtig geworden.
»Ei, Sie sind mir ein netter Herr!« schrie er ihm schon von weitem zu. »Eine schöne Art und Weise, wie Sie meine Rezensionen besorgen. Ich habe heute morgen im ,Figaro[3]' gesucht. Ja prosit! Nichts ist drin!«
»Warten Sie doch ruhig ab!« versetzte Fauchery. »Erst muß ich doch Ihre Nana gesehen haben, bevor ich über sie schreibe ... Übrigens habe ich Ihnen gar nichts versprochen.«
Dann stellte er dem Direktor, um die Unterredung kurz abzuschneiden, seinen Gefährten als seinen Vetter, Hector de la Faloise, vor, der zur Vollendung seiner Bildung sich längere Zeit in Paris aufzuhalten gedenke. Der Direktor taxierte den jungen Mann mit einem einzigen Blick; Hector dagegen musterte ihn mit einiger Erregung. Das war also Bordenave, jener Mann, der einen förmlichen Weibermarkt hielt, der die armen Geschöpfe wie ein Bagnoaufseher traktierte, das war also der Mann mit dem allezeit über Reklame brütenden Gehirn, der schreiend, spuckend, sich auf die Schenkel klopfend, mit zynischen Gebärden und Häscherblicken hier auf und ab schritt! Hector glaubte, ein paar verbindliche Worte sprechen zu sollen.
»Ihr Theater ...« begann er mit dünner Stimme.
»Bitte, sagen Sie: mein Bordell!« unterbrach ihn Bordenave als Mann, der es liebt, sich ungeniert zu bewegen und auszudrücken.
Faucherys Lippen umspielte ein beifälliges Lächeln, während Faloise mit seiner höflichen Phrase, die ihm im Halse steckenblieb, verdutzt dastand und so tat, als versuche er dem von Bordenave hingeworfenen garstigen Worte Gefallen abzugewinnen. Dieser hatte sich schleunigst einem dramatischen Kritikus, dessen Feuilleton großen Einfluß hatte, genähert, um einen Händedruck mit ihm auszutauschen. Als er zurückkam, trat Faloise, der für einen Provinzler angesehen zu werden fürchtete, wenn er sich allzu bestürzt zeigte, wieder zu ihm.
»Mir ist erzählt worden«, ergriff er wieder das Wort, da er absolut etwas reden wollte, »daß Nana eine herrliche Stimme haben soll.«
»Die!?« rief der Direktor achselzuckend. »Die reinste Krähe!«
Der junge Mann beeilte sich, seiner vorigen Bemerkung hinzuzufügen: »Doch eine ausgezeichnete Komödiantin soll sie sein!«
»Die!? ... Der reinste Klotz! Weiß ja nicht einmal, wie sie die Beine und Hände halten soll.«
Faloise errötete leicht. Er wußte nicht mehr, was er denken sollte. Er stammelte: »Ich hätte um keinen Preis der Welt die heutige Premiere verpassen mögen ... Ich wußte, daß Ihr Theater ...«
»Bitte, mein Bordell!« unterbrach ihn Bordenave nochmals mit der Starrköpfigkeit eines Menschen, der für seine Überzeugung Gründe hat.
Währenddessen schaute sich Fauchery die eintretenden Frauen an. Er kam seinem Vetter zu Hilfe, als er ihn mit offenem Munde, nicht wissend, ob er lachen oder sich ärgern sollte, dastehen sah.
»Gönne doch Bordenave den Spaß und nenne sein Theater, wie er es wünscht, wenn ihm das Freude macht ... Und Sie, mein verehrter Herr Direktor, führen Sie uns nicht auf den Leim! Wenn Ihre Nana nicht singen und nicht spielen kann, so werden wir eben einen Durchfall zu registrieren haben, weiter nichts.«
»Einen Durchfall!? Einen Durchfall!« schrie der Direktor, während sein Gesicht sich puterrot färbte. »Muß denn ein Frauenzimmer nur singen und spielen können? Ach, mein Herrchen, du bist ein wenig allzu dämlich ... Nana hat andere Dinge, ei Donnerwetter! Etwas, was für jeden anderen Mangel entschädigt. Ich hab' sie aufgestöbert, und das, was ich meine, ist ganz famos bei ihr vertreten, oder meine alte Spürnase ist nicht mehr wert als die des dümmsten Einfaltspinsels ... Du sollst sehen, junger Herr, du sollst sehen: sie braucht nur aufzutreten, und der ganze Saal läßt die Zunge lang aus dem Halse heraushängen.«
Er hatte seine feisten Hände emporgehoben, und wie erleichtert senkte er jetzt die Stimme und brummte:
»Oh, sie wird's weit bringen ... Eine Haut, oh! Eine Haut hat diese Nana [2q]...«
Und jetzt verstand er sich auf Faucherys Fragen dazu, Einzelheiten zu geben, mit einer Roheit in den Ausdrücken, die für Hector de la Faloise viel Verletzendes hatte: er habe Nana kennengelernt und habe sich vorgenommen, sie groß herauszustellen, da es sich gerade getroffen, daß er eine Venus brauchte. Er pflege sich nicht erst lange den Kopf warm zu machen mit »so 'nem Frauenzimmer«, sondern halte es für besser, gleich brühwarm damit vor das Publikum zu rücken. Aber er sei in des Teufels Küche geraten in seiner Baracke, die durch die Ankunft dieses langen Weibsbildes ganz aus den Fugen gegangen sei. Rose Mignon, sein Stern, eine vollendete Schauspielerin und bewunderte Sängerin, hatte, weil sie eine Nebenbuhlerin witterte, wütend gedroht, ihn im Stich zu lassen. Und wie's an die Plakate gegangen war, Herrgott, was hatte das für einen Spektakel gesetzt! Es sei ihm zuletzt nichts übriggeblieben, als sich dazu zu bequemen, die Namen der beiden Künstlerinnen in Buchstaben gleicher Größe auf den Theateranschlägen drucken zu lassen. Sonst aber lasse er sich nicht eben viel vormachen. Wenn eines seiner »kleinen Weibsen«, wie er sie nannte, Simonne oder Clarisse, nicht tanzen wolle, wie er pfeife, so gebe er ihnen sehr einfach einen Tritt in den Hintern; anders sei mit solchem Korps kein Auskommen. Er handle ja mit ihnen und wisse sehr wohl, was sie wert seien, diese albernen Mädel!
»Ei, sieh da!« unterbrach er sich. »Mignon und Steiner! Immer beisammen! Sie wissen doch, daß Steiner seit einiger Zeit bis über die Ohren bei der Rose drin sitzt, und nun weicht der Herr Gemahl dem guten Manne nicht mehr von der Pelle, aus Furcht, daß er durch die Lappen gehen könnte.«
Auf dem Trottoir warf die Lampenreihe, die an der Fassade des Theatergebäudes entlang aufflammte, eine Fläche von lebhafter Helle. Zwei Bäumchen hoben sich deutlich mit leuchtendem Grün ab; eine Säule, die so hell erleuchtet war, daß man die Plakate wie beim vollen Tageslicht zu lesen vermochte, schimmerte weiß, und darüber hinaus breitete sich die dichte Nacht des Boulevards mit winzigen Flämmchen, die in dem Bereich der auf und nieder wogenden Menge bald hier, bald dort emporzitterten. Viele traten nicht sogleich ein, sondern blieben, um plaudernd ihre Zigarre zu Ende zu rauchen, draußen unter dem Lichtbereich der Lampenreihen stehen, der ihren Gestalten eine fahle Blässe gab und ihre kurzen schwarzen Schatten auf dem Asphalt abhob. Mignon, ein langer, breitschulteriger Lebemann mit dem dicken Schädel eines Jahrmarktherkules, brach sich einen Weg mitten durch die Gruppen, an seinem Arm den Bankier Steiner schleppend, einen Mann von winziger Figur mit einem spitzen Bäuchlein und einem runden, von einer Krause ergrauenden Barthaars umrahmten Speckgesicht.
»Ah, Herr Steiner«, wandte sich Bordenave an den Bankier, »Sie haben sie ja gestern in meinem Büro gesehen.«
Mignon hörte mit gesenkten Lidern zu und drehte in nervöser Erregung an seinem Finger einen dicken Diamanten. Er hatte begriffen, daß es sich um Nana handelte: und als jetzt Bordenave eine Photographie seiner Debütantin hervorlangte, die eine Flammenröte auf den Wangen des Bankiers entzündete, konnte er nicht länger dem Drang, sich ins Mittel zu legen, widerstehen.
»Aber ich bitte Sie, mein Lieber, lassen Sie doch dieses Dämchen! Das Publikum wird ihr schön heimleuchten! ... Steiner, mein kleiner Schwede, Sie wissen, daß meine Frau in ihrer Loge auf Sie wartet.«
Er wollte ihn fortziehen. Aber Steiner weigerte sich, Bordenave zu verlassen. Eine Menschenschlange drängte und quetschte sich vor ihnen an der Kontrolle, ein Getöse verworrener Stimmen wurde laut, aus dem der Name Nana mit all dem munteren Klang seines Silbenpaares hervortönte. Die Menschen, die sich vor den Plakaten aufpflanzten, sprachen ihn aus mit lauter Stimme; andere warfen ihn im Vorübergehen mit einem fragenden Ton hin, während die Frauen, vor sich hinlächelnd, ihn mit einer Miene des Erstaunens nachsprachen. Niemand kannte Nana. Wo kam denn Nana eigentlich hergeschneit? Allerhand Histörchen kursierten, Späße und Witze wurden von Ohr zu Ohr getuschelt. Es war ein allerliebstes Kosewort, dieser kurze Name, dessen Silbenpaar im Flug jedem Munde vertraut war. Ein Fieber der Neugierde jagte die Menschen, die der leicht auszusprechende Name in kindische Freude versetzte, jene der Pariser Luft eigentümliche Neugierde, die der Heftigkeit eines hitzigen Fieberanfalls gleichkommt. Alle Welt wollte Nana sehen. Einer Dame wurden die Volants ihres Kleides abgerissen, ein Herr verlor seinen Hut.
»Ah, ich bitte, meine Herrschaften! Sie verlangen wahrhaftig auch zu viel von mir!« rief Bordenave, den etwa zwanzig Menschen mit Fragen und Bitten umlagerten. »Sie sollen sie ja sehen ... Ich mache mich jetzt aus dem Staube; man braucht mich anderwärts.«
Er verschwand, entzückt darüber, sein Publikum in Flammen gesetzt zu haben. Mignon zuckte mit den Achseln und rief Steiner wiederholt zu, daß Rose auf ihn warte, um ihm das Kostüm zu zeigen, das sie im ersten Akt tragen werde.
»Sieh doch, da unten steigt Lucy aus dem Wagen«, sagte Faloise zu Fauchery.
Lucy Stewart war es wirklich, ein kleines, häßliches Frauenzimmer von ungefähr vierzig Jahren, mit einem zu langen Hals, einem mageren, abgelebten Gesicht mit dickem, fleischigem Mund, aber so lebendig und graziös, daß sie noch immer einen hohen Reiz ausübte. Sie brachte Caroline Héquet, eine kalte Schönheit, und deren Mutter, eine sehr würdige Person mit urdummem Gesicht, mit ins Theater.
»Fauchery, du kommst mit uns, ich habe einen Platz für dich aufgehoben!« wandte sich Lucy an den jungen Mann.
»Wo denkst du hin? Wohl daß ich nichts sehen soll!« erwiderte dieser. »Ich habe einen Fauteuil belegt, denn ich sitze immer gern dem Orchester so nahe wie möglich.«
Lucy ärgerte sich. Wagte er es vielleicht nicht, sich an ihrer Seite sehen zu lassen? Dann sprang sie, mit einem Male wieder beruhigt, ohne Übergang auf einen anderen Gegenstand über.
»Warum«, fragte sie, »hast du mir denn nicht gesagt, daß du Nana kennst?«
»Ich? Nana? – Ich habe sie im Leben nicht gesehen!«
»Ganz gewiß? Man hat mir hoch und heilig versichert, du wüßtest in ihrem Schlafzimmer vortrefflich Bescheid.«
Aber in diesem Augenblick stellte sich Mignon vor sie und bedeutete ihr, indem er den Finger auf die Lippen legte, zu schweigen. Auf einen fragenden Blick Lucys zeigte er auf einen jungen, eben vorübergehenden Mann und flüsterte: »Nanas Liebster!«
Aller Blicke richteten sich auf ihn. Er war ein hübscher Bursche. Fauchery kannte ihn: Daguenet war es, ein Junggeselle, der mit Weibern dreihunderttausend Franken durchgebracht hatte und jetzt an der Börse spielte, um seinen alten Flammen hier und da einen Blumenstrauß oder ein Diner zu verehren. Lucy fand, daß er schöne Augen habe.
»Ah, da kommt Blanche!« rief sie aus. »Die hat mir gesagt, daß du Nana so genau kennst.«
Blanche de Sivry, eine große, fette Blondine, deren hübsches Gesicht dick mit Schminke belegt war, kam in Gesellschaft eines schmächtigen, mit großer Sorgfalt gekleideten Mannes von sehr distinguiertem Aussehen.
»Der Graf Xavier von Vandeuvres«, flüsterte Fauchery seinem Vetter ins Ohr.
Der Graf tauschte einen Händedruck mit dem Journalisten, während sich zwischen Blanche und Lucy eine lebhafte Auseinandersetzung entspann. Sie nahmen den ganzen Gang ein mit ihren bauschigen, dicht mit Volants besetzten Kleidern; die eine ging in Blau, die andere in Rosa; und der Name Nana kam so oft über ihre Lippen, daß jedermann ihnen zuhörte. Der Graf von Vandeuvres führte Blanche beiseite. Aber jetzt erklang der Ruf »Nana« an allen vier Ecken des Vestibüls. Fing man denn noch immer nicht an? Die Männer zogen ihre Uhr aus der Tasche; Verspätete sprangen aus ihren Wagen heraus, noch ehe die Kutscher angehalten hatten; Gruppen verließen den Gehsteig, auf dem Spaziergänger langsam durch die leergebliebene Gaslichtfläche schritten, den Hals weit vorreckend, um einen Blick in das Theater zu werfen. Ein Gassenjunge, ein Liedchen pfeifend, pflanzte sich vor eins der Plakate und schrie, indem er weiterschlurfte, mit heiserer Schnapsstimme: »Nana! Ohe, Nana!«
Über dem tosenden Lärm erschallte jetzt die gellende Zwischenaktsklingel. Ein Stimmengewirr pflanzte sich fort bis auf den Boulevard. »Es hat geklingelt! Es hat geklingelt!« Und jetzt folgte ein Drängen und Schieben und Stoßen, ein jeder wollte zuerst hinein. Mignon, der sichtlich unruhig geworden war, bemächtigte sich endlich Steiners, der sich Roses Kostüm nicht angeschaut hatte. Beim ersten Erklingen der Glocke hatte sich Faloise, Fauchery mit sich schleppend, den Weg durch die Menge gebahnt, um ja nicht den Beginn zu verpassen. Diese ungestüme Hast des Publikums irritierte Lucy Stewart.
»Die Leute tun gerade, als ob man hier immer nur besondere Stücke zu sehen bekäme!« meinte sie, während sie die Treppe hinaufstieg.
Im Saal schauten sich Fauchery und Faloise von neuem um. Die beiden Vettern suchten Gesichter von Bekannten. Mignon und Steiner standen beisammen in einer Parterreloge, mit den Fäusten auf den Samt der Brüstung gestützt. Blanche de Sivry schien für sich allein die Proszeniumsloge im Parterre belegt zu haben. Aber Faloise betrachtete vornehmlich Daguenet, der in der zweiten Reihe vor ihm einen Parkettsitz innehatte. Neben ihm saß ein blutjunger Mensch von höchstens siebzehn Jahren, der aussah, als sei er eben dem Gymnasium entlaufen, und riß seine schönen Cherubaugen weit auf. Fauchery lächelte, während er ihn betrachtete.
»Wer ist denn die Dame in der Balkonloge«, fragte plötzlich Faloise, »neben der ein junges Mädchen im blauen Kleid Platz genommen hat?«
Er zeigte auf eine korpulente, prall in ihr Korsett gezwängte Dame; das Haar war verfärbt, der Teint vergilbt, und das runde, verschminkte Gesicht quoll auf unter einem wahren Regen von kleinen Löckchen.
»Das ist Gaga«, gab Fauchery zur Antwort.
Und als er bemerkte, daß dieser Name seinen Vetter aufhorchen ließ, fügte er hinzu:
»Du kennst Gaga nicht? Während der ersten Regierungsjahre Louis Philippes hat sie die Herzen aller Männer berauscht. Jetzt schleppt sie ihre Tochter überall mit sich umher.«
Faloise hatte keinen Blick für das junge Mädchen. Der Anblick Gagas regte ihn auf; seine Blicke verließen sie nicht mehr. Er fand, daß sie noch vortrefflich aussehe, wagte es aber nicht zu sagen.
Fauchery zeigte seinem wißbegierigen Vetter die Logen der Journalisten, nannte ihm die dramatischen Kritiker, einen dürren Herrn mit vertrocknetem Gesicht und schmalen, hämisch aufgeworfenen Lippen, einen anderen, dick und behäbig, mit einem wahren Kleinkindergesicht, der sich auf die Schulter seiner Nachbarin stützte, einer harmlosen Unschuld, die er mit väterlichem, liebevollem Blick hütete.
Aber er unterbrach seine Rede, als er Faloise mit Leuten Grüße wechseln sah, die eine Loge ihnen gegenüber innehatten. Er schien erstaunt zu sein.
»Wie«, rief er überrascht, »du kennst den Grafen Muffat de Beuville?«
»Oh, schon seit langer Zeit!« versetzte Hector. »Die Muffat haben ein Besitztum neben dem unsrigen. Ich verkehre oft bei ihnen ... Der Graf sitzt dort mit seiner Frau und seinem Schwiegervater, dem Marquis de Chouard.«
Aus Eitelkeit, glückselig ob des Erstaunens, welches sein Vetter bezeigte, erging er sich nun in Einzelheiten: Der Marquis war Staatsrat, der Graf dagegen war soeben zum Kammerherrn der Kaiserin ernannt worden. Fauchery, der nach seinem Opernglase gegriffen hatte, betrachtete die Gräfin, eine volle Brünette mit weißer Haut und schönen schwarzen Augen.
»Du wirst so gut sein, mich während eines Zwischenaktes vorzustellen?« wandte er sich schließlich zu seinem Vetter. »Ich bin mit dem Grafen schon zusammengewesen, aber ich möchte sehr gern zu ihren dienstäglichen Empfangsabenden geladen werden.«
»Pst! Pst!« schallte es energisch von den höheren Galerien herunter. Die Ouvertüre hatte begonnen; noch immer kamen neue Besucher. Verspätete zwangen ganze Reihen von Zuschauern, die längst schon gesessen hatten, zum Aufstehen; die Logentüren knarrten und fielen ins Schloß zurück; grobe Stimmen stritten in den Gängen, und die Menge schwatzte und schwatzte wie ein Spatzenschwarm, wenn der Tag zur Neige geht. Es war ein Wirrwarr, ein Durcheinander von wogenden Köpfen und Armen; die einen setzten sich oder suchten ihre Sitze, die anderen wollten durchaus stehenbleiben, um einen letzten Blick über den Raum zu werfen. Der Ruf: »Niedersetzen! Niedersetzen!« ertönte mit Heftigkeit aus den finsteren Tiefen des hinteren Parterres. Eine lebhafte Bewegung ging durch die Menge: endlich sollte man die berühmte Nana zu sehen bekommen, mit der sich Paris schon acht Tage lang beschäftigte.
Allmählich stockte die Unterhaltung; nur ein paar schläfrige, fette Stimmen wurden noch ein paarmal laut; und inmitten dieses halblauten Geflüsters, dieses abebbenden Summens sprang aus dem Orchester ein flotter Walzer auf, dessen in die Beine fahrender einschmeichelnder Rhythmus reizte. Das heiter gestimmte Publikum lachte schon ... Jetzt klatschte die auf den ersten Stühlen des Parterres sitzende Claque[2] wütend in die Hände. Der Vorhang ging in die Höhe.
»Ei, sieh doch«, rief Faloise, der in einem fort plauderte, »dort bei Lucy steht ein Herr.«
Er betrachtete die Balkonloge rechts, deren vordere Sitze Caroline und Lucy innehatten. Im Hintergrund sah man das würdige Gesicht der Mutter Carolines und das Profil eines großen, blondhaarigen Herrn in einer Haltung, die jeden, auch den kleinsten Tadel ausschloß.
»Sieh doch«, wiederholte Faloise mit Hartnäckigkeit, »es ist ein Herr drinnen.«
Fauchery ließ sich bestimmen, sein Opernglas nach der bezeichneten Balkonloge hinaufzurichten. Aber er wendete sich sogleich wieder ab.
»Ach, das ist Labordette«, meinte er mit sorglos-unbefangener Miene, als ob die Gegenwart dieses Herrn für jedermann natürlich sein müßte und von keinerlei Belang sei.
Hinter ihnen wurde »Ruhe! Ruhe!« geschrien. Jetzt erst trat Stille im Saal ein, vom Orchester bis zum Amphitheater reckten sich die Kopfreihen erwartungsvoll aufmerksamer Zuschauer empor.
Der erste Akt der »Blonden Venus« spielte im Olymp. Zuerst traten Iris und Ganymedes auf, geleitet von einer Schar himmlischer Diener, die einen Chorgesang ausführten, während sie die Sitze der Götter für den hohen Rat zurechtstellten. Unterdessen hatte Faloise dem Auftreten Clarisse Besnus' Beifall geklatscht, einem von Bordenaves kleinen »Weiberchen«, das die Iris spielte und ganz in duftiges Blau gekleidet erschien, mit einer breiten, siebenfarbigen Schärpe, die über die Taille geschlungen war.
»Du weißt doch, daß sie den oberen Teil des Hemdes umlegt, um das blaue Gewand anziehen zu können«, wendete er sich an Fauchery und sprach dabei derart laut, daß er gehört werden mußte. »Wir haben heute morgen zur Probe kostümiert ... Sie konnte das Hemd nicht so anbehalten, denn es guckte unter den Armen und am Rücken hervor.«
Eine gewisse Spannung lag jetzt über dem Saal; Rose Mignon war als Diana auf die Bühne getreten. Obwohl weder ihre Taille noch ihr ganzes Äußeres zu der Rolle paßte – sie war mager, und ihr Gesicht sah eigentümlich häßlich aus, wie das eines Pariser Gassenjungen –, erschien sie doch ganz niedlich, gleichsam wie eine Verspottung der mythischen Persönlichkeit selbst, die sie spielen sollte. Ihre erste Arie, in der sie sich mit lächerlich dummen Worten über Mars beklagte, der eben im Zuge sei, sie um der Venus willen zu verlassen, wurde mit einer schamhaften Zurückhaltung gesungen, hinter der sich aber so viel Schalkhaftigkeit barg, daß das Publikum in Hitze geriet. Der Herr Gemahl und Steiner, die Arm in Arm zusammenstanden, lachten wohlgefällig, und der ganze Saal brach in Johlen aus, als Prullière, der beliebte Schauspieler, in Generalsuniform als Mars auftrat, mit einem riesigen Federbusch am Hut und einen Säbel hinter sich herschleifend, der ihm bis an die Schulter reichte. Mars-Prullière war seinerseits Dianas überdrüssig; sie rümpfte ihm immer zu sehr die Nase. Diana dagegen schwor hoch und heilig, ihn zu überwachen und sich zu rächen. Das Duo endigte mit einem komischen Jodler, der Prullière mit seiner dem Miauen eines erregten Katers ähnelnden Stimme und seinen rollenden Bramarbasaugen überaus possierlich gelang, so daß aus den Logen helles Gelächter erschallte.
Die folgenden Szenen langweilten. Kaum gelang es dem alten Bosc, einem schwachköpfigen Jupiter, dessen Haupt von einer gewaltigen Krone bedeckt war, das Publikum auf einen Augenblick in jener Szene zu erheitern, wo er mit seiner Gattin Juno bei Gelegenheit der Bemessung des Wirtschaftsgeldes in häuslichen Streit gerät. Das Defilee der Götter Neptun, Pluto, Minerva und so weiter drohte sogar völlig schiefzugehen. Man wurde ungeduldig, und unruhiges Gemurmel schwoll langsam an, die Zuschauer verloren alles Interesse und schauten sich im Saal um. Lucy schäkerte mit Labordette; der Graf Vandeuvres streckte hinter Blanches kräftigen Schultern den Kopf hervor, während Fauchery nach der Muffatschen Familie hinüberschaute, den Grafen beobachtete, der so ernst dasaß, als habe er kein Wort bisher begriffen, oder die Gräfin anstarrte, die träumerisch umherblickte und kaum merklich lächelte. Aber plötzlich erschallte mitten in dieses allgemeine Mißbehagen das Händeklatschen der Claque. Alles wendete sich wieder der Bühne zu. War es endlich Nana? Diese Nana ließ ja entsetzlich lange auf sich warten!
Es war eine Deputation Sterblicher, welche Ganymed und Iris eingeführt hatten, respektable Bürgersleute, sämtlich gehörnte Ehemänner, die dem Herrn der Götter eine Klageschrift gegen Venus unterbreiten wollten, die die Herzen ihrer Eheweiber mit allzu viel Feuer auszustatten beliebt habe. Die Köpfe der Chorsänger waren possierlich, die Gesichter paßten trefflich zu dem Charakter, den ihre Eigner darstellten, ein Dicker vornehmlich mit einem runden Vollmondgesicht rief stürmisches Lachen hervor. Unterdessen war Gott Vulkan erschienen; grimmig nach seiner Frau forschend, die schon seit drei Tagen von ihm fortgelaufen sei. Die Rolle des Vulkan wurde von Fontan gespielt, einem Komiker von grobkörnigem Talent, der sich in einer toll-phantastischen Weise als Dorfschmied herausstaffiert hatte; er trug eine flammende Perücke, während seine nackten Arme mit von Pfeilen durchbohrten Herzen tätowiert waren. Eine Frauenstimme ertönte ganz laut im Saal: »Hu, ist das ein häßlicher Kerl!«, und alles lachte und klatschte stürmisch Beifall.
Die nun folgende Szene schien gar kein Ende nehmen zu wollen. Jupiter wandte sich darin umständlich an den Götterrat, um ihm die Bittschrift der gehörnten Ehemänner zu unterbreiten ... Und noch immer keine Nana! Man sparte also wohl Nana auf, bis der Vorhang fallen würde? Ein so lang hinausgezogenes Warten ärgerte schließlich das Publikum, und heftiges Gemurmel ließ sich wieder von allen Seiten vernehmen.
»Die Sache geht schief«, flüsterte Mignon mit glückselig strahlendem Lächeln Steiner zu. »Geben Sie acht, es wird ein herrlicher Durchfall!«
In diesem Augenblick zerteilten sich die Wolken im Hintergrund und Venus erschien. Nana, ein für seine achtzehn Jahre sehr großes und kräftiges Frauenzimmer, stieg, angetan mit der weißen Göttinnentunika, das lange blonde Haar über den Schultern in einem schlichten Knoten geknüpft, in ruhiger, gemessener Haltung, dem Publikum fröhlich zulachend, nach der Rampe hernieder, während sie ihr Hauptlied anstimmte: »Wenn Venus abends die Beine sich vertritt.. .«
Als sie den zweiten Vers sang, schaute sich alles im Saal um. War das ein schlechter Witz? Oder war Bordenave eine Wette eingegangen? Noch niemals hatte man eine Stimme gehört,die so falsch und mit so geringer Schulung sang. Auch wußte sie sich nicht einmal auf der Bühne zu bewegen, sie warf die Hände nach vorn, ihr Körper blieb in einem beständigen Schaukeln, das man wenig schicklich und höchst ungraziös fand. Oho!-Rufe wurden schon laut im Parterre und in den Logen, ja man pfiff bereits, als plötzlich aus den Fauteuils der Orchesterreihe eine jugendliche Stimme laut und deutlich durch den Saal tönte: »Herrlich! Famos!«
Alles im Saal schaute sich um. Der kleine, kaum vom Gymnasium gekommene Bruder Studio hatte den Ausspruch getan.
Als er die Blicke der Leute auf sich gerichtet sah, wurde er sehr rot darüber, daß er, ohne es zu wollen, so laut gesprochen hatte. Der ihm zur Seite sitzende Daguenet prüfte ihn mit einem lächelnden Blick, das Publikum lachte, es schien entwaffnet und dachte nicht mehr daran, zu pfeifen; ein paar junge, weißbehandschuhte Herren, die ebenfalls von der anmutigen Erscheinung Nanas in Entzücken versetzt wurden, standen mit offenem Munde da und klatschten Beifall.
»Bravo! Famos! Famos! Bravo!«
Nana indessen, als sie das Auditorium lachen sah, fing ebenfalls zu lachen an. Wenn sie lachte, zeigte sich ein reizendes Liebesgrübchen in ihrem Kinn. Nachdem sie dem Kapellmeister einen Wink gegeben hatte, der zu bedeuten schien: »Dreist vorwärts, liebes Männchen!«, begann sie das zweite Couplet: »Um Mitternacht, wenn Venus wacht...«
Es war noch die gleiche dünne, spitze Krähenstimme, aber jetzt kratzte sie das Publikum so geschickt an der richtigen Stelle, daß zuweilen ein leichtes Beben durch die Reihen lief. Nana lachte noch immer, ihr kleiner roter Mund glühte rosig, und ihre großen blauen Augen leuchteten. Bei manchen munteren Versen hob eine wilde Lüsternheit ihre Nase, deren rosige Flügel erzitterten, während eine Feuerflamme über ihre Wangen glitt. Sie fuhr fort, sich zu schaukeln und zu wiegen, denn sie wußte nicht recht, was sie beginnen sollte; und jetzt fand man diese Bewegung nicht abscheulich, im Gegenteil: die Männerwelt setzte die Operngläser an die Augen. Als das Couplet zu Ende war, war ihr die Stimme vollständig ausgegangen; aber ohne sich darüber zu beunruhigen, bewegte sie den Oberkörper mit einem Ruck der Hüften nach hinten, so daß unter der knappen Tunika, während sie die Arme in die Höhe streckte, die liebliche Rundung ihrer Formen zum Vorschein kam. Ein Sturm des Beifalls brach los. Sogleich hatte sie sich umgedreht und zeigte jetzt ihren starken Nacken, auf welchen rötlich blonde Haare gleich einem Vlies herniederfielen; der Beifallssturm wurde zu einem Orkan.
Das Ende des Aktes fiel merklich ab. Vulkan wollte Venus ohrfeigen. Die Götter hielten Rat und entschieden, daß sie sich, bevor sie den gehörnten Ehemännern Genugtuung verschaffen könnten, zu einer Untersuchung auf die Erde herabbegeben wollten. Diana, die zärtliche Worte zwischen Venus und Mars belauscht hatte, schwur, sie während der Reise nicht aus den Augen lassen zu wollen. Dann kam eine Szene, in welcher Amor, den ein zwölfjähriger Backfisch spielte, auf alle Fragen mit »Ja, Mama« und »Nein, Mama« in weinerlichem Tone antwortete, während er mit den Fingern in der Nase bohrte. Darauf sperrte Jupiter mit der Strenge eines in Zorn geratenen Herrn und Meisters den kleinen Monsieur Amor in eine schwarze Kammer und gab ihm auf, das Verbum amo zwanzigmal zu konjugieren. Dann kam das Finale, ein Chorgesang, der von den Schauspielern und dem Orchester brillant ausgeführt wurde. Aber als der Vorhang fiel, bemühte sich die Claque vergeblich, einen Hervorruf zu erzwingen; alles stand auf und bewegte sich ohne Verzug zu den Ausgängen. Man stampfte mit den Füßen, schob und stieß sich, zwischen den Reihen der Fauteuils eingezwängt, und tauschte seine Eindrücke aus. Ein einziges Wort fand schließlich den Weg durch die Menge: »Blödsinn! Gräßlicher Blödsinn!«
Ein Kritiker meinte, daß man das Ding ganz gehörig zusammenstreichen müsse. Um das Stück kümmerte man sich übrigens wenig; hauptsächlich sprach man von Nana. Fauchery und Faloise, die unter den ersten waren, die das Theater verließen, trafen im Orchestergang mit Steiner und Mignon zusammen. Es war zum Ersticken heiß in diesem engen, wie ein Minenschacht zusammengepreßten Gang, der von Gaslampen erhellt wurde. Sie blieben einen Augenblick am Fuß der Treppe unter dem Schutz des Geländervorsprungs stehen. Die Zuschauer der oberen Logen und Galerien polterten die Treppe herab.
»Ich kenne sie!« rief Steiner, sobald er Faucherys ansichtig wurde. »Ganz gewiß, ich habe sie schon wo gesehen ... Im Kasino, glaube ich, und dort ist sie arretiert worden, so betrunken war sie.«
»Ich bin mir nicht ganz klar«, bemerkte der Journalist, »aber es geht mir wie Ihnen, ich bin ihr auch schon irgendwo begegnet.«
Er senkte die Stimme und setzte lachend hinzu:
»Vielleicht bei der Tricon!«
»Gewiß in irgendeinem Schmutzwinkel!« konstatierte Mignon, der lebhaft aufgeregt zu sein schien. »Es ist jämmerlich, daß das Publikum die erstbeste hergelaufene Person derartig aufnimmt. Es wird bald kein einziges anständiges Frauenzimmer mehr beim Theater sein ... Den Teufel auch, wenn's mir zu bunt wird, so untersage ich meiner Rose alles weitere Spielen.«
Fauchery konnte ein Lächeln nicht unterdrücken.
Ein kleiner Mann, der eine Mütze mit steifem Schirm trug, sagte mit einer schleppenden Stimme:
»Oh, nicht übel, nicht übel! Ein stattliches Frauenzimmer! Da liegt noch was drin!«
Im Gange stritten sich zwei junge Männer, die mit gebranntem Haar und hohen steifen Kragen höchst elegant aussahen; der eine wiederholte in einem fort die Worte: »Abscheulich! Erbärmlich!«, ohne einen Grund für sein Urteil zu geben, der andere antwortete mit dem ebensooft gesprochenen Wort: »Reizend! Himmlisch!«, verschmähte aber ebenso jegliche Argumentation.
Faloise fand Nana ganz vortrefflich; er wagte nur die einzige Bemerkung, daß sie noch bedeutend gewinnen würde, wenn sie ihre Stimme kultivierte. Steiner, der nicht mehr zuhörte, schien plötzlich aus einem Traum emporzufahren. Man müsse abwarten. Vielleicht gehe in den folgenden Akten noch alles schief. Das Publikum habe sehr viel Beifall gezeigt, das sei nicht zu leugnen, aber ebenso sicher sei, daß es noch weit davon entfernt sei, begeistert für die neue Künstlerin zu sein. Mignon beteuerte, daß das Stück unmöglich zu Ende gespielt werden würde, und als Fauchery und Faloise sie allein ließen, um sich nach dem Foyer hinaufzubegeben, nahm er Steiner am Arm, lehnte sich an seine Schulter und flüsterte ihm ins Ohr:
»Kommen Sie, mein Bester! Sie sollten sich das Kostüm ansehen, das meine Frau im zweiten Akt tragen wird ... Es ist brillant!«
Oben im Foyer brannten drei Kristallkronleuchter in hellem Lichte. Die beiden Vettern blieben einen Moment lang zögernd stehen; durch die Scheiben der Glastüren hindurch erblickte man eine Woge von Köpfen, die durch zwei Gegenströmungen in einem beständigen Wirbel gehalten wurde.
Fauchery war, um Atem zu schöpfen, auf den Balkon hinausgegangen. Faloise, der die Photographien der Schauspielerinnen studierte, die zwischen den Säulen hingen, entschloß sich endlich, ihm zu folgen. Eben hatte man die Lampenreihe an der Giebelfront des Theaters ausgelöscht. Draußen war es pechfinster, und ein frischer Luftzug wehte; der Balkon schien leer zu sein, nur ein einzelner junger Herr stand im Schatten über die Steinbrüstung gelehnt und rauchte eine Zigarette, die ab und zu aufglomm. Fauchery erkannte den Herrn: es war Daguenet. Sie tauschten einen Händedruck aus.
»Was machen Sie denn da, mein Lieber?« fragte der Journalist. »Sie verstecken sich heute in allen Ecken und Winkeln, und an anderen Premieretagen setzen Sie den Fuß nicht aus dem Parkett.«
»Ich rauche, wie Sie sehen«, erwiderte Daguenet.
Dann fragte Fauchery, um ihn zu überrumpeln:
»Sagen Sie doch, Daguenet, was denken Sie denn über die Debütantin? ... Im Foyer und in den Zwischengängen reißt man sie gehörig herunter.«
»Oh«, gab Daguenet leise zur Antwort, »das sind wohl meist Leute, von denen sie nichts hat wissen wollen.«
Dies war sein ganzes Urteil über Nanas Talent. Faloise neigte sich über die Brüstung und blickte hinab auf den Boulevard. Die gegenüberliegenden Fenster eines Hotels und eines Klublokals waren hell erleuchtet, während auf dem Trottoir eine schwarze Masse die Tische des »Café Madrid[5]« besetzt hielt.
Trotz der vorgerückten Stunde war es auf der Straße voll zum Erdrücken: man konnte nur kurze Schritte machen. Aus der Passage Jouffroy[4] kamen beständig Leute heraus. Sie blieben manchmal fünf Minuten lang stehen, bevor ihnen die lange Reihe von vorbeifahrenden Wagen den Übergang gestattete.
»Welch ein Leben! Welch ein Lärm!« rief Faloise aus, den Paris noch in lebhaftes Erstaunen setzte.
Ein Läuten ertönte; das Foyer wurde leer. Man eilte die Verbindungsgänge entlang. Der Vorhang war aufgezogen, als noch scharenweise die Hinausgegangenen zum lebhaften Verdruß der bereits Sitzenden den Zuschauerraum wieder betraten und ihre Sitze einnahmen. Der erste Blick, den Faloise durch den Saal sandte, war auf Gaga gerichtet, aber er war verwundert, den langen blonden Herrn, den er eben erst in Lucys Loge gesehen hatte, jetzt neben Gaga stehen zu sehen.
»Wie heißt denn dieser Herr?« fragte er.
Fauchery sah ihn nicht gleich.
»Ach du lieber Gott, Labordette!« sagte er dann mit der nämlichen halb sorglosen, halb wegwerfenden Miene wie vorhin.