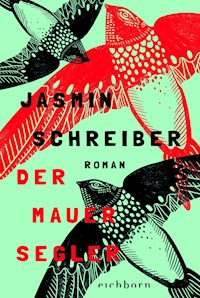22,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 22,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Eichborn
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Artensterben. Abtreibungs- und Verhütungsverbote. Repressalien. Die Welt, in der sich die Frauen dieses Romans zurechtfinden müssen, ist eine andere im Jahr 2041. Zoe ist Biologin und forscht fern der Heimat an Käfern. Als ihre Mutter in Reha muss, kehrt sie nach Hause zurück, um sich um ihre Teenager-Schwester Hanna und ihre schrullige Tante Auguste zu kümmern, die seit Jahren das Haus nicht mehr verlässt. Doch dann verschwindet Augustes Freundin Sophie, und während sich die Ereignisse überschlagen, lauert in Schweden ein dunkler Wald auf sie.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 408
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhalt
CoverÜber dieses BuchÜber die AutorinTitelImpressumWidmungMacroglossum stellatarum – TaubenschwänzchenErithacus rubecula – RotkehlchenPholcus phalangioides – Große ZitterspinneHelix pomatia – WeinbergschneckeOcypus olens – Schwarzer ModerkäferPhlogophora meticulosa – AchateuleOsmia cornuta – Gehörnte MauerbieneEristalis tenax – MistbienePolyergus rufescens – AmazonenameiseCorvus corone – AaskräheDynastes hercules – HerkuleskäferAnthocharis cardamines – AurorafalterHylotrupes bajulus – HausbockCanis lupus familiaris – HaushundCicadetta montana – BergsingzikadeEusphalerum robustum – KurzflügelkäferAquila chrysaetos – SteinadlerMeganeura monyi – RiesenlibelleLuscinia megarhynchos – NachtigallMilvus milvus – RotmilanLamprohiza splendidula – Kleiner LeuchtkäferCanis lupus – WolfAutographa gamma – GammaeuleNicrophorus spec. – TotengräberCorvus corax – KolkrabeFelis catus – HauskatzeCapreolus capreolus – RehUrsus arctos – BraunbärAlces alces – ElchAricia artaxerxes – Großer Sonnenröschen-BläulingRana arvalis – MoorfroschJulus scandinavius – Gemeiner Dunkler SchnurfüßerFormica rufa – Rote WaldameiseVipera berus – KreuzotterPandion haliaetus – FischadlerArgiope bruennichi – WespenspinneAthene noctua – SteinkauzSus scrofa – WildschweinPavo cristatus – Blauer PfauSciurus vulgaris – Eurasisches EichhörnchenCepaea nemoralis – Hain-BänderschneckeDanksagungÜber dieses Buch
Artensterben. Abtreibungs- und Verhütungsverbote. Repressalien. Die Welt, in der sich die Frauen dieses Romans zurechtfinden müssen, ist eine andere im Jahr 2041. Zoe ist Biologin und forscht fern der Heimat an Käfern. Als ihre Mutter in Reha muss, kehrt sie nach Hause zurück, um sich um ihre Teenager-Schwester Hanna und ihre schrullige Tante Auguste zu kümmern, die seit Jahren das Haus nicht mehr verlässt. Doch dann verschwindet Augustes Freundin Sophie, und während sich die Ereignisse überschlagen, lauert in Schweden ein dunkler Wald auf sie.
Über die Autorin
Jasmin Schreiber, 1988 in Frankfurt/Main geboren, ist Biologin, Schriftstellerin und Wissenschaftsjournalistin. Wenn sie nicht gerade Expeditionen zu Farn und Gliederfüßern macht, schreibt sie sich auf die Bestsellerliste und erzählt Geschichten aus Wissenschaft und Natur im Podcast Bugtales.fm. Bei Eichborn erschienen die Romane MARIANENGRABEN und DER MAUERSEGLER. Auf Instagram und Twitter findet man sie unter @lavievagabonde, ihre Natur-Kolumne gibt es per Mail auf schreibersnaturarium.de.
JASMIN SCHREIBER
ROMAN
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Eichborn Verlag
Originalausgabe
Copyright © 2023 by Bastei Lübbe AG,
Schanzenstraße 6 – 20, 51063 Köln
Vervielfältigungen dieses Werkes für dasText- und Data-Mining bleiben vorbehalten.
Textredaktion: Doreen Fröhlich, Chemnitz
Umschlaggestaltung: Jasmin Schreiber, Massimo Peter-Bille
Einband-/Umschlagmotiv: Jasmin Schreiber
eBook-Produktion: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7517-4837-7
eichborn.de
Für meine Eltern.Für meine Mutter, die den härtesten Job der Welt (= Mutter) parallel zu mehreren anderen Jobs durchgezogen hat, damit ich als ihr Kind jetzt an einem Rechner sitzen und mit Geschichtenschreiben Geld verdienen kann.Für Gerhard. Weil er nie aufgibt, und selbst wenn die gesamte Menschheit auf einen Schlag aussterben würde, wäre er der Letzte, der hier das Licht ausmacht.Für meinen Vater, weil er so viel Fantasie, Kreativität und Neugier in mein Gehirn gepflanzt hat, dass es vermutlich für drei Schriftstellerinnenleben reichen würde.
Macroglossum stellatarumTaubenschwänzchen
irgendwann kracht das alles auf mich drauf. all die ausgestopften tiere, globen, mikroskope, auf nadeln aufgespießte insekten, die ganzen bücher über biologie, über naturgeschichte und spinnen, präparate in gläsern, kleine terrarien, forschungsnotizen und hefte, ferngläser, feldführer, konservierte pflanzenproben, die muschelsammlung, poster und diagramme und das hölzerne bettgestell, auf dem tante auguste liegt und die mit rudernden armen auch mit durch die decke bricht. das kracht alles auf mich drauf, und das war’s dann.
Eine Nachricht von meiner kleinen Schwester. Ich nahm einen Schluck von meinem kalten Tee, der schon seit heute früh neben meinem Notebook stand, und wartete. Drei Punkte tanzten im Chatfenster und zeigten an, dass sie noch tippte.
Das war nicht ihre erste Nachricht an mich an diesem Tag. Hanna und ich hielten konstant Chatkontakt, was wichtig war, da wir uns nicht häufig sehen konnten: Sie lebt mit Mama in Frankfurt, ich in München, und wegen der in letzter Zeit so häufig auftretenden Pandemien war Reisen nicht immer so einfach. Deshalb stand ich unter ziemlichem Nachrichtenbeschuss, was mir aber ganz recht war. Ich freue mich, wenn meine kleine Schwester mir schreibt.
kaboom, tot!, tauchte in unserem Chatfenster auf.
Du musst vorher noch dein erstes Buch fertig schreiben und siebenundzwanzig werden, erst dann darfst du sterben, antwortete ich ihr.
ein echtes künstlerinnenende? wäre cool, glaub aber nicht, dass die decke noch so lange durchhält.
Du willst ja auch nicht bis siebenundzwanzig zu Hause wohnen.
und mama allein lassen?
Sie kommt klar.
sie kommt NICHT klar, aber woher willst du das wissen, du warst lange nicht hier.
Ich komm bald wieder vorbei.
bald bald?
Ganz bald.
okay. bis später! ich schreibe an einer neuen geschichte, schicke sie dir bald. ciao ciao
Ich legte das Handy beiseite und schaute wieder auf den Bildschirm meines Computers. Ich schreibe gern. Für mich ist es ein schönes Hobby, aber Hanna ist jetzt sechzehn und schreibt schon so gut, da ist im Vergleich jeder Buchstabe, den ich zu Papier bringe, eine Beleidigung der Literatur. Sie nimmt an Wettbewerben teil, schreibt Geschichten online in einem Blog, schreibt, wo immer sie kann. Dass Hanna irgendwann Schriftstellerin wird oder Drehbücher schreibt, das ist ausgemachte Sache in unserer Familie. Sie muss etwas Kreatives machen, etwas Künstlerisches. Für mich wäre das nichts gewesen. Auch wenn ich Sprache liebe, mir fehlt einfach oft die Fantasie, wenn es darum geht, Dinge von Grund auf zu erfinden. Deshalb bin ich Wissenschaftlerin geworden, Biologin und, um genau zu sein: Entomologin. Also so eine komische Insektenfrau.
Eigentlich forsche ich an kleinen Käfern, für die sich kein Schwein interessiert. Na ja, außer mir und noch drei, vier anderen hier in Deutschland. Aber bei uns Insektenleuten ist es so, dass wir natürlich auch hier und da unsere Fühler ausstrecken und unseren Kolleginnen und Kollegen helfen. Und deswegen arbeitete ich gerade an einem Forschungsprojekt über Schmetterlinge.
Schmetterlinge? Hatte ich nie so richtig auf dem Schirm. Ja klar, eure bunten Flügel sind hübsch und so, wir haben’s kapiert! Als ich 2031 meinen Biologie-Bachelor in der Tasche hatte und mich für den Master eingeschrieben habe, da war ich der Meinung, Schmetterlinge wären wohl die größten Langweiler der Insektenwelt. Doch während mein Studium voranschritt, wurde mir klar, dass es gar keine langweiligen Insekten gibt und Schmetterlinge alles andere als öde sind. Überraschung: Nur acht Prozent aller Lepidoptera, also Schmetterlinge, sind tatsächlich als Schmetterlinge klassifiziert. Der Rest? Motten. Und die Bandbreite der Vielfalt in beiden Gruppen ist schlichtweg atemberaubend. Und ja, wie ich bereits erzählt habe: Ich bin die seltsame Insektenlady, und ich liebe es, über alles zu reden, was krabbelt und flattert.
Zum Beispiel könnte ich jetzt von der Vampirmotte schwärmen, Calyptra thalictri, auch bekannt als Wiesenrauten-Kapuzeneule, die sich von Blut ernährt (ja, richtig gelesen; es gibt tatsächlich blutsaugende Schmetterlinge, und ja, die kommen auch bei uns vor; gern geschehen), oder von den Glasflüglern, Sesiidae, die sich mit ihren transparenten Flügeln für Vögel praktisch unsichtbar machen können. Vielleicht nicht so spektakulär in Sachen Gruselfaktor oder Aussehen, aber dennoch, beeindruckend ist der Monarchfalter, Danaus plexippus. Dieser orange-schwarze Wanderfalter legt auf seinen Reisen durch Nord- und Südamerika Tausende von Kilometern zurück, und jedes Mal, wenn ich ein solches Geschöpf auf meinen Exkursionen in der freien Natur beobachtet habe, konnte ich es kaum glauben: So ein winziges Wesen, kaum mehr als ein paar Gramm schwer, bringt die Kraft auf, riesige Gebirge zu überwinden! Gebirge! Genau, so habe ich auch geschaut. Mich bringen drei Treppen schon aus der Puste, denn ich bin in etwa so fit und sportlich wie ein Ast.
Mich hauen diese Rekorde um. Die Vorstellung, zu was so kleine, oft unterschätzte Lebewesen in der Lage sind, macht mir Gänsehaut. In Europa haben wir auch Schmetterlinge, die solche großen Reisen unternehmen können, beispielsweise das Taubenschwänzchen, Macroglossum stellatarum. Jedes Jahr zog es zwischen Süd- und Nordeuropa hin und her, überquerte die Alpen, um in unseren Gärten vor einer Blüte wie schwerelos in der Luft zu stehen und dabei wie ein Kolibri auszusehen. Tatsächlich gibt es in Europa keine Kolibris, allerdings ist dieser Falter so groß und puschelig, dass er auf den ersten Blick wirklich wie ein kleiner, wunderhübscher Vogel mit einem aufgefächerten Schwanz aussieht.
Wieso ich mich gerade mit diesen kleinen Kerlchen befasste, ist jedoch ein weniger schönes Thema. Denn die Taubenschwänzchen waren verschwunden – ja, einfach so. Zack, weg. Und deshalb saß ich hier vor meinem Rechner und brütete gemeinsam mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern über eben jenem Rätsel – 2041, zehn Jahre nach meiner Bachelorarbeit, sieben Jahre nach dem Beginn des großen Baumsterbens. What a time to be alive!
Ich öffnete ein paar Programme. Die Statistiksoftware, mit der ich arbeitete, ermöglichte es mir, tief in die über die Jahre gesammelten Daten einzutauchen und nach Mustern und Zusammenhängen zu suchen, die einen Hinweis auf das plötzliche Verschwinden der Taubenschwänzchen geben könnten, und seit Tagen zerbrach ich mir schon den Kopf über ein paar Werte, die ich von einer Kollegin bekommen hatte.
Ich stellte gerade fest, dass die letzten bekannten Sichtungen der Falter in den italienischen Alpen auf fünfzehnhundert Metern Höhe stattgefunden hatten, also in einem Gebiet, das besonders stark vom Klimawandel betroffen war. Der Temperaturanstieg selbst in diesen Höhen und der Rückgang der Niederschläge haben die Vegetation und die Ökosysteme dort drastisch verändert, kurz gesagt: Die Gegend war ziemlich abgerockt. Mir blutet das Herz, wenn ich an den Zustand unserer Gebirge – meiner Lieblingsorte! – denke. Es begann 2023 damit, dass immer mehr Berggipfel abbrachen; erst in Galtür und den Dolomiten, später auch an der Zugspitze, dem Matterhorn, niedrigeren Gipfeln des Himalayagebirges. Der Grund? Auftauender Permafrost.
Die Berge sind zu warm, so wie die gesamte Welt. Das ist der Grund, wieso viele Tiere und Pflanzen, die auf kühlere Temperaturen angewiesen sind, immer weiter nach oben steigen und uns hier unten abhandenkommen. Das ist aber schon die Variante, wenn es gut läuft. Denn wenn es schlecht läuft, sterben sie komplett aus.
2037 hatte eine Freundin und Kollegin von mir gemeinsam mit ihrem Team beobachtet, dass diese kleinen puscheligen Schmetterlinge in die Berge hineingeflogen waren – deutlich weniger als noch zehn Jahre zuvor, aber durchaus noch amtliche Schwärme. Also alles normal bis dahin. Doch das Problem war, dass sie nicht mehr aus den Bergen herauskamen. Es war, als hätten die Felsmassive den Trupp einfach verschluckt. Keine einzige Spur wurde gefunden, nicht einmal ein zerfetzter Flügel. Auch weiter oben hatte man nach ihnen gesucht: nichts.
Ich grübelte so viel über diesen Umstand nach, dass ich nachts sogar von Taubenschwänzchen träumte. Vielleicht war nur ein Teil in die Berge gezogen und dort aus unbekannten Gründen verschwunden? Und ein anderer Teil hatte eine Route eingeschlagen, die wir nicht mitbekommen haben? Vielleicht übers Meer. Vielleicht. So viele Vielleichts.
Ich begann nun, Mails zu schreiben. An andere Forschende aus den USA, an Naturschutzorganisationen, an Leute an meiner Uni, denn ich hatte Fragen, brauchte noch mehr Daten, irgendwelche Anhaltspunkte, um die ich mein Hirn wickeln konnte. Als ich damit fertig war, sah ich auf die Uhr. Kurz nach elf. Da steckte jemand den Kopf zu meiner einen Spalt geöffneten Tür herein.
»Hey, stör ich gerade?« Es war Hannes, ein älterer Kollege, der auch mein Doktorvater ist und stets in sehr liebenswerter Zerstreutheit durch das Institut läuft, immer etwas am Suchen, immer am Murmeln, die Nase gern in sein Tablet vertieft, weil man die Zeit, in der man herumläuft, ja auch dafür nutzen kann, ein Paper zu lesen. So ist zumindest seine Einstellung. Seine Leidenschaft gilt eigentlich den Heuschrecken, den Orthoptera, aber er hat mich trotzdem als Doktorandin angenommen, weil ich unbedingt mit einer seiner Methoden arbeiten wollte. Heuschreckenleute finden die Faszination für Käfer oft etwas banal, und Käferleute finden Heuschrecken oft langweilig. Ansonsten mögen wir Insektenleute uns eigentlich immer recht gern. Gleichzeitig kann der Streit um die Zugehörigkeit eines Insekts zu einer Gruppe, der oft in leidenschaftlichen Leserzuschriften und Artikeln in einschlägigen Publikationen ausgetragen wird, regelrecht in Krieg ausarten.
Hannes hat mir einmal erzählt, dass an seiner ehemaligen Universität zwei ältere Professoren schon seit vierzig Jahren darüber stritten, ob die Heuschrecke Tetrix kraussi eine eigene Art oder nur eine morphologische Variante, also eine andere Form, von Tetrix bipunctata sei, und dass es schließlich zu einer handfesten Schlägerei zwischen den beiden gekommen war. Hannes war gerade noch rechtzeitig dazugestoßen, um zu verhindern, dass der eine Wissenschaftler dem anderen mit einem Bürostuhl das Gesicht zertrümmerte, den der Erstere bereits mit zitternden Ärmchen hochgehoben und drohend über dem am Boden liegenden Gegner geschwungen hatte. Hach, Systematiker. Sind schon ein lustiges Völkchen.
»Ne, alles gut«, antwortete ich und drehte mich zu ihm um.
»Wie läuft’s?«, fragte er und lehnte sich an den grünen Metallschrank, in dem ich meine Bücher, ein bisschen Equipment und eine absurde Menge fünfundneunzigprozentigen Ethanol aufbewahrte. Letzteres nur so halb legal, da das Zeug eigentlich im Labor gelagert werden musste. Ich hatte jedoch keine Lust, gefühlt einhundert Mal am Tag zwischen Labor und Büro hin- und herzulaufen, wenn ich es für meine Proben brauchte, deshalb tat ich das, was alle taten: Ich bunkerte das Zeug heimlich in meinem Schrank.
»Ach, na ja. Geht so.«
»Macroglossum?«, fragte er und zog seine Strickjacke enger um sich. Die Klimaanlage in meinem kleinen Büroverschlag stand immer auf niedrigster Temperaturstufe, weil mich die zwangsläufig entstehende Wärme in diesem kleinen stickigen Raum sonst unweigerlich todmüde machte.
»Ja, aber es kommt nichts bei rum. Ich dreh durch, ehrlich.«
»Hast du mit Karina gesprochen?«
Karina war unsere Schmetterlingsfrau hier am Fachbereich. Sie war bis oben hin zugestopft mit anderen Projekten, konnte mir aber zumindest die ein oder andere Frage beantworten.
»Ja, ich hab ihr die Daten geschickt und war schon zweimal bei ihr, um sie durchzugehen. Ist einfach frustrierend.«
»Das glaub ich«, stimmte er mir zu und wippte auf seinen Fußballen vor und zurück.
»Du wippst«, sagte ich und kniff die Augen zusammen.
»Ach ja?«, antwortete Hannes und hörte sofort auf damit.
»Ja. Was ist los?« Ich wusste, dass Hannes nur wippte, wenn er sich sehr über etwas freute oder sehr schlechte Nachrichten hatte. Wäre es Ersteres gewesen, wäre er sofort damit herausgeplatzt. Demzufolge musste es sich um Letzteres handeln, was mir jetzt gar nicht gelegen kam.
»Also …«
»Ist … Oh nein, ist es die Doktorandenstelle?«
»Ja.«
»Sie streichen sie, oder?«, fragte ich. Ich hörte meinen Puls in den Ohren pochen.
»Ja, sie haben wieder Gelder gekürzt.«
»Noch mehr?« Ich war stinksauer. »Wie viel denn noch? Einerseits erklären sie die Biodiversitätsforschung zur Prio und beschweren sich, dass die Erkenntnisse zu langsam kämen, andererseits erwarten sie, dass wir uns Angestellte herbeizaubern?« Ich brauchte wirklich dringend Hilfe und Entlastung und hatte mich sogar schon für eine Bewerberin entschieden.
»Sieht so aus, ja. Die Uni meinte, vielleicht im nächsten Jahr.«
»Ja, das sagen sie immer«, schnaubte ich. »Man will eigentlich meinen, dass die Regierung in Geld schwimmen muss. Jetzt, da sie auch das Arbeitslosengeld so stark beschnitten und viele andere Sozialleistungen ersatzlos gestrichen hat. Was machen die mit der ganzen Kohle? Sie in Münzen ausbezahlen, in einen Tresor füllen und wie Dagobert Duck darin ein paar Bahnen schwimmen?«
»Ja, ist scheiße. Bei den Botanikern ist es noch schlimmer. Es ist nur noch einer von den Gräserleuten da, die anderen wurden alle entlassen.«
»Wer ist noch da?«
»Johannes.«
»So ein Zufall, der einzige Mann in der ganzen Abteilung.«
Hannes wippte wieder.
»Ja, egal«, ersparte ich ihm die Antwort und stützte mein Gesicht in meine Hände. Hannes war definitiv einer von den Guten, ich wusste, dass er das alles auch so sah. Dass er alles durchschaute. »Danke fürs Bescheidsagen.«
Hannes nickte, klopfte mir etwas unbeholfen auf die Schulter, was mich wohl aufmuntern sollte, und ging wieder aus meinem Büro. Ich schloss die Augen und atmete ein paarmal ruhig durch.
Gerade als ich mein Büro verlassen wollte, klingelte mein Handy. Ich sah auf das Display: Es war Mama.
Ich nahm den Anruf mit »Mama, warte kurz!« an und versuchte, meine Bluetooth-Kopfhörer irgendwie zum Laufen zu bringen. Ein Telefonat mit ihr konnte durchaus länger dauern, und ich wollte nicht die ganze Zeit das Handy ans Ohr halten müssen. Man sollte meinen, dass man 2041 eine Möglichkeit gefunden hatte, diesen eigentlich simplen Vorgang nicht zu einem kompletten Höllentrip aus Verbindungsversuchen und Hallo, hallo, hörst du mich jetzt? zu machen, doch nein, es funktionierte immer noch genau so furchtbar wie vor fünfzehn oder zwanzig Jahren.
»Warte, ich ruf dich zurück!«, sagte ich und legte auf.
Also Bluetooth-Kopfhörer zurück ins Case.
Kurz warten.
Bluetooth-Kopfhörer wieder aus dem Case holen.
Warten, bis mein Handy sich dazu herablässt, mit den Dingern zu kommunizieren.
Jetzt noch mal Mama anrufen.
»Mama?«
»Bluetooth-Kopfhörer?«, fragte sie.
»Japp, genau.«
»Hach ja, das alte Lied.«
»Ja, nun … Ist alles in Ordnung?«
»Ja, ja, alles okay … Wie geht es dir denn, Schätzchen?«
»Ach, es gibt viel zu tun. Ist ja nichts Neues. Mit Hanna alles guti?«
»Ja, ja. Keine Sorge.«
»Rufst du wegen etwas Bestimmtem an?«, fragte ich. Ein ziemlicher Wink mit dem Zaunpfahl, aber ich hatte in einer Stunde ein Meeting und wollte vorher noch ein paar Sachen erledigen.
»Ja, tatsächlich, ich wollte … Also ich hab eine Bitte an dich, und ich weiß nicht … Also ich will dir auch keine Umstände machen. Du hast ja viel zu tun, die Projekte und das alles, die Forschung, du sagst es ja selber …«
Ich ging in die Küche, um mir einen Kaffee zu machen, weil ich jetzt schon merkte, dass das wohl nicht in fünf Minuten erledigt sein würde. Der Beginn des Telefonats war typisch Mama. Zum besseren Verständnis der Situation im Folgenden ein paar Dinge, die man über meine Mutter wissen sollte.
Erstens: Sie will niemandem Umstände machen, fühlt sich oft zu viel, hat Angst, anzuecken, zu nerven, zu stören. Das kommt sicher von der sehr traditionellen Erziehung, die sie genossen hatte. Omas und Opas Vision für ihre Tochter war ein braves, ordentliches Mädchen, das zu einer braven, ordentlichen Frau heranwuchs. Was dabei herauskam, war jedoch eine unsichere, ängstliche Person, die immer das Gefühl hat, zu viel zu sein. Ja, sie hat hier und da dennoch manchmal rebelliert, zum Beispiel bei ihrer Berufswahl. Ihre Mutter, also meine Oma, hatte sich gewiss nicht ausgemalt, dass ihre Tochter einmal tote Tiere für Museen präparieren wollte. Dennoch war Mama nicht unbedingt selbstbewusst. Wenn sie etwas sagen möchte, leitet sie oft mit Verzeihung oder Sorry, dass ich das sage, aber ein. Wenn sie könnte, würde sie sich pausenlos für ihre Existenz entschuldigen.
Zweitens: Trotz allem ist Mama unglaublich lustig. Es dauert zwar eine Weile, bis sie auftaut, aber dann kennt sie kein Halten mehr. Meist ist Alkohol im Spiel, denn den scheint sie zu brauchen, um sich aufzulockern, sich frei und unbeschwert zu fühlen, den Ballast ihrer Ängste und Unsicherheiten abzuwerfen. Früher nicht so häufig, jetzt jedoch immer mehr. Oft sagt sie, wenn sie verkatert aufwacht: Puh, nein, ich lass den Alkohol, das ist nichts für mich!, doch dann wird auf ihrer Arbeit im Museum wieder angestoßen, dann trinkt sie wieder sprudelnden Sekt, der ihr sofort in den Kopf schießt und ihre Wangen rötet, oder ein Bier mit den Kollegen, dann noch eins und vielleicht noch eins, und dann ist Mama wieder auf Tempo, macht Scherze, ist so charmant wie nur wenige Menschen, die ich kenne. Mit ihr zu sprechen fühlt sich dann an, als schippere man auf einem kleinen Kanu einen Fluss entlang, man wird von ihren Worten wie von sanften Wellen hin und her gewogen, und es ist einfach nur gut. Kein Wort zu viel, keins zu wenig, keine turbulenten Stellen. Mama weiß immer genau, welche Bemerkung oder Frage jetzt passend ist und welche nicht, weiß immer, wie weit sie gehen kann oder wie sie in eine unangenehme Gesprächssituation eingreifen muss, um die Beteiligten da herauszuretten. Manche Menschen werden beim Trinken rechthaberischer, aggressiver, gereizter, Mama nie. Sie wird immer weicher und fällt am Ende allen dauernd um den Hals, quillt über vor Liebe, die Gefühle sprudeln aus ihr heraus wie aus einer Sektflasche, die man zu viel geschüttelt hat vor dem Öffnen. Und irgendwann wird sie müde, dann muss sie ganz schnell nach Hause, von jetzt auf gleich. Und dann fällt sie schwer ins Bett, noch berauscht und beglückt, und am nächsten Morgen sagt sie: Das mach ich nie wieder!, nur um drei Tage später wieder ein Sektglas in der Hand zu haben.
Nur: Mittlerweile ist das alles dann eben doch gekippt. Das Glas findet nicht mehr nur alle paar Tage den Weg in ihre Hand, sondern jeden. Und das ist das Dritte, das man über Mama wissen muss: Sie ist Alkoholikerin. Viele denken bei diesem Wort an versoffene Schlägertypen am Bahnhof, aber so ist sie nicht. Sie brilliert in ihrem Job als Präparatorin im Naturkunde-Museum, ist immer engagiert, pünktlich, freundlich; ich bin mir sicher, dass nicht einmal die meisten ihrer besten Freundinnen und Freunde irgendetwas ahnen, vor allem, da Alkohol in unserer Gesellschaft so normalisiert ist wie keine andere Droge. Dass im Kollegium lustig eine Heroinspritze die Runde macht, weil Gisela befördert wurde? Unvorstellbar. Dass man mittags zu diesem Anlass ein paar Gläschen lecker schmeckendes Zellgift kippt? Komplett normal. Machen wir im Labor auch. Wie soll Mama in dieser Atmosphäre auffallen? Es ist ja nicht so, dass sie sich mit hartem Korn zusäuft, bis sie kotzt, bis sie in der Gosse liegt, bis sie ihr Leben vollkommen versaut hat. Das ist das Klischee, das so viele bei Alkoholikern im Kopf haben. Nein, so ist das nicht. Nur seit Papa tot ist, ist der Alkohol eben ihre Medizin geworden, sie trinkt, um sich nicht eingestehen zu müssen, dass sie depressiv ist, nutzt perlenden Schaumwein und elegante Longdrinks und dunkles, starkes Bier als Selbstmedikation. Und wie das beim Alkohol so ist, kann es durchaus sein, dass sie sich eben doch irgendwann mit hartem Korn zusäuft, bis sie kotzt, bis sie in der Gosse liegt, bis sie ihr Leben vollkommen versaut hat.
Und nun kommen wir zum vierten Fakt: Mama ist Witwe.
Bei der vorletzten Pandemie vor sechs Jahren hatte Papa sich auf der Arbeit angesteckt. Er war Techniker bei der Bahn, ein systemrelevanter Beruf, und irgendwie musste er sich dabei infiziert haben, während wir alle isoliert zu Hause saßen. Erst lachte er es weg, meinte, so alte starke Bäume wie er würden nicht gefällt. Und ein alter starker Baum war Papa definitiv, er war fast zwei Meter groß und ein bisschen dick, trug einen schwarzen Vollbart wie unser Opa, der Spanier war, und eine stets zu rote Nase wegen des etwas zu hohen Blutdrucks, gegen den Mama ihm morgens immer die Tabletten hinlegte, und die er dennoch immer so oft vergaß, weil er so wuselig war.
Als Papa krank wurde, war es zu Beginn nur Husten und ein kleiner Ausschlag, ein wenig Fieber, nicht viel, 38,7 Grad die meisten Tage, was die rote Papanase noch kirschiger werden ließ. Doch irgendwann stieg das Fieber, die Blutungen begannen – erst in seinen Augen, dann in seinem Mund, irgendwann im Darm, in der Lunge. Wir saßen an seinem Bett und blickten auf diesen so fremd aussehenden Menschen hinab, wir hielten seine Hand und bangten so sehr um ihn, Mama, Hanna, Tante Auguste und ich. Papa hatte zu dem Zeitpunkt schon lange nicht mehr gelacht, sondern lag, drei Wochen nach seiner Infektion, nur mit Sauerstoffmaske im Krankenhausbett und sah uns mit müden, aber auch ängstlichen, eingebluteten Augen an. Papa wurde immer verwirrter, sprach irgendwann nur noch bruchstückhaftes und eingerostetes Spanisch, die Sprache seiner Kindheit und seiner Eltern, was jedoch niemand von uns verstand. Und irgendwann lag Papa im künstlichen Koma und schrumpfte uns unter unseren Händen davon. Aus unserem dicken, lustigen Vater wurde ein krankes, dünnes Strichmännchen, das am Ende nicht mehr aufwachen würde und das Mamas Lachen mitgenommen hatte.
»Mama, es ist okay«, sagte ich jetzt am Telefon, schaltete die Kaffeemaschine an und suchte nach Keksen. Nervennahrung war in diesem Moment nicht unangebracht.
»Nun, also ich … Also meine Therapeutin meinte, dass es gut wäre, wenn ich eine kleine Auszeit nehme. Ich hab ihr direkt gesagt, dass das nicht geht, wegen Hanna und Tante Auguste …«
»Was heißt kleine Auszeit?«, fragte ich.
»Nun, sie sprach von einer Reha … sechs Wochen. Vielleicht mal nicht jeden Tag ein Sektchen zum Feierabend …«
Sektchen. Ich habe in den letzten Monaten häufiger im Internet nach Symptomen für Alkoholismus gesucht und mir durchgelesen, woran man – abgesehen vom offensichtlich problematischen Trinkverhalten – erkennt, wenn jemand in ein Alkoholproblem abrutscht. Was dort oft stand: Verniedlichungen scheinen ein erster Hinweis zu sein, der einen aufmerken lassen sollte. Ein Sektchen, ein Gläschen, ein Schnäpschen. Alles kleinreden, verniedlichen, ach, es ist doch nur ein Gläschen, und noch eins, und ein drittes, viertes, fünftes. Am Ende sind es ja nicht fünf Gläser, sondern fünf Gläschen, deshalb ist es ja nicht so schlimm, oder? Mama jedenfalls war Meisterin im Kleinreden.
»… und sie meinte, ich muss da aufpassen. Und ja, auch wegen meiner Stimmungsschwankungen, und weil ich mich so schlapp fühle insgesamt … Da meinte sie eben, dass ich eine Pause brauche und dass mir so eine Kur guttun würde. Dass ich da gute Methoden lernen könnte, alles besser zu bewältigen. Und auch mal paar neue Gesichter sehen.«
»Aber das klingt doch gut!«
Das klang tatsächlich sehr gut. Länger schon hatte ich mich gefragt, ob meine Mutter einen Entzug machen müsste, hatte versucht, mich zu informieren und zu verstehen, wann das nötig wäre und wie man so etwas angeht. Dementsprechend war ich ziemlich erfreut, zu hören, dass sie das selber anging. Damit hatte ich nicht gerechnet.
»Ja, eigentlich schon«, antwortete sie. Sie zögerte. Ich hörte, wie sie nervös einen Kugelschreiber klicken ließ.
»Aber?«
»Nun, es ist wegen Hanna. Ich kann das in ihren Sommerferien machen, sodass niemand ein Auge darauf haben muss, dass mit der Schule alles läuft. Aber dennoch …«
»Ist Hanna nicht alt genug, das selber hinzukriegen? Mit sechzehn? Tante Auguste ist doch auch da.«
Meine Mutter schwieg.
»Mama?«
»Ja, nun … also eigentlich schon. Bestimmt, irgendwie.«
Das klang jetzt nicht so zuversichtlich.
»Gibt es da ein Problem?«
»Ach, Zoe. Mit Hanna ist es gerade nicht so leicht, weißt du. Bestimmt einfach nur die Pubertät, nichts Wildes. Aber mit Tante Auguste ist es deutlich schlimmer geworden.«
Noch schlimmer? Ich versuchte mir auszumalen, was das bedeuten könnte. Das letzte Mal war ich 2038 zu Hause gewesen, und damals hatte Tante Auguste schon drei Jahre lang – seit der Beerdigung meines Vaters, ihres Bruders – das Grundstück nicht mehr verlassen. Mittlerweile waren es also schon sechs Jahre. Meistens besuchen meine Mutter und meine Schwester mich hier in München, um mal ein bisschen rauszukommen. Nicht nur aus Frankfurt, sondern einfach auch aus diesem Haus mit seinen vielen unverarbeiteten Erinnerungen, die wie Geister durch die Zimmer spuken.
»Was heißt deutlich schlimmer?«, fragte ich meine Mutter.
»Na ja …« Sie schwieg kurz. »Deine Tante verlässt ihre Wohnung mittlerweile gar nicht mehr, wir müssen ihr Lebensmittel und alles bringen, weil sie auch den Lieferanten nicht mehr traut. Also wegen der Bakterien und so, weißt du … Sie desinfiziert alles, und … Nun, es ist einfach schlimm. Schwer zu erklären. Deinem Vater würde es das Herz brechen.«
Ich gab die Suche nach Keksen auf, schenkte mir endlich eine Tasse Kaffee ein, setzte mich damit an den Küchentisch und drückte mit Daumen und Zeigefinger der rechten Hand auf meine Nasenwurzel. Seit drei oder vier Tagen hatte ich Kopfschmerzen, und diese Informationen machten es nicht besser. Migräne kommt direkt aus der Hölle, da bin ich mir sicher.
»Wieso habt ihr mir das nicht erzählt? Also dass sie mir das nicht erzählt, ist klar, aber wieso habt ihr es nicht erwähnt? Seit wann ist das denn so schlimm?«, fragte ich Mama.
»Hm, eine Weile … Also als du zuletzt da warst, war es ja schon schlimm. Aber dass sie gar nicht mehr … also … Also bestimmt seit anderthalb Jahren, würde ich sagen. Tut mir leid, ich weiß es gar nicht sicher, ähm. Aber wir wollten nicht, dass du dir Sorgen machst. Du hast doch so viel Arbeit, so viel wichtige Arbeit!«
»Gut, hör zu. Du gehst zu deiner Kur, das ist auch wichtig. Ich will, dass du das unbedingt machst. Und ich komme nach Hause und zieh bei Hanna und Auguste ein und passe auf.«
»Bist du dir sicher?«, fragte Mama. Ihre Stimme klang jetzt aufgeregt.
»Ja, ganz sicher. Wann geht es los?«
»In fünf Wochen, Ende Juni. Da fangen auch die Sommerferien an.«
»Alles klar, wir besprechen das am besten morgen, da ist ja Wochenende. Stress dich nicht, ich komme auf jeden Fall.«
Erithacus rubeculaRotkehlchen
Man bräuchte auch zu Hause ein Fenster, an dem den ganzen Tag Landschaften vorbeiziehen, schrieb ich meiner Schwester.
jetzt wirst *du* aber wieder literarisch!
Na ja.
willst du nicht doch ein buch schreiben? wir könnten die schreibenden schwestern werden, very intellektuell und alles.
Bin mir very sicher, dass ich das nicht will.
wie lange fährst du noch?
Eine Stunde.
ah cool, ich hol dich vom bahnhof ab!
Super.
ist der zug voll?
Ein bisschen.
spiel zombieapokalypse! und erzähl es mir dann!
Mal sehen.
Ich saß im Zug. Es hatte ein bisschen gedauert, mir sechs Wochen freizuschaufeln, aber mit einer Kombination aus Urlaubstagen, Abfeiern von Überstunden und Umschichten von Vor-Ort-Projekten hatte es geklappt. An einigen Sachen konnte ich von der Ferne aus arbeiten, und auch bei der Bachelorarbeit, die ich gerade betreute, reichten Onlinetreffen vollkommen aus. Die Studentin war ziemlich auf Zack und auch schon sehr weit in ihrer Forschung.
Ich legte das Handy wieder weg und schaute aus dem Fenster. Zombieapokalpyse spielen hatte Hanna erfunden, und es ging so: Wenn man irgendwo saß, beispielsweise im Zug, musste man sich vorstellen, dass genau jetzt eine Horde Zombies über einen herfällt. Ein bisschen wie in dem südkoreanischen Retro-Horror-Film Train to Busan von 2016, wo eine Epidemie ausbricht, während ein Vater seine Tochter per Zug zur Mutter bringen will, von der er getrennt lebt. Und na ja, das klappt alles nicht so dolle. Zombies, dies das, alles unschön. Jedenfalls schaut man sich dann im eigenen Zugabteil um. Alle Leute, die dort sind, gehören jetzt zum Team, und man muss sich überlegen, wer welche Rolle einnimmt, welche Rolle man selber spielt und wie hoch unter diesen Bedingungen die Überlebenschancen wären.
Der Waggon war relativ voll, ich sah eine Familie mit Kindern (das wäre schon mal schlecht, also vor allem für sie selbst. Aber auch für uns, Kinder sind laut, und wenn wir uns verstecken, werden wir sofort gefunden. Vorausgesetzt, Zombies können hören), eine ältere Frau (vermutlich eines der ersten Opfer, Mist!), mehrere Leute in ihren Zwanzigern, was wiederum gut war. Und ich hatte das große Glück, dass ein Soldat in Uniform mitfuhr. Jackpot. Zumindest bei diesem Spiel. In anderen Situationen, na ja.
Mit dem beruhigenden Gefühl, bei einer Zombieapokalypse einigermaßen gute Chancen zu haben, betrachtete ich durch das Zugfenster das Panorama, das sich mir bot. Sanft geschwungene Hügel reihten sich aneinander, Ackerland breitete sich vor meinen Augen aus, durch träge kleine Rinnsale und Zäune in Quadrate unterteilt. Kein überwältigender Anblick wie der der Berge, die ich so liebte, aber dennoch nicht ohne Charme.
Mein Blick blieb an einer fernen Baumgrenze hängen. Buchen und Fichten, die Klassiker. Einst waren das wunderbar grüne Refugien, jetzt glichen sie eher müden Greisen. Eine einsame Birke stand am Rand der Gruppe. Es war erstaunlich, wie schnell viele kleine Wälder in Mitteleuropa innerhalb eines Jahrzehnts zusammengebrochen waren. Eine Tatsache, die ich mir nie hätte vorstellen können. Ich hatte es wirklich nicht kommen sehen.
Als ich klein war, hatte ich mich mit meinem Vater mal im Frankfurter Stadtwald verlaufen. Ich meine, wir reden hier nicht vom Schwarzwald, sondern von einem relativ überschaubaren Waldstück in der Nähe des Frankfurter Waldstadions, das heutzutage nur noch bei Tageslicht genutzt wurde, weil die Stromkosten für die Flutlichtanlage einfach zu hoch waren. Damals kannte ich es jedoch vom Fußball, denn Papa war Eintracht-Fan, und ich durfte manchmal zu den Spielen mitkommen. Ich war 2015 mit meinem Vater im Wald unterwegs, und Smartphones mit ihren Umgebungskarten und den Taschenlampen waren zwar schon lange die Norm, mein Vater jedoch eher Typ oldschool, weshalb er nur ein kleines Klapptelefon mit Tasten besessen hatte. Wir hatten an dem Tag Drachen steigen lassen und komplett die Zeit vergessen, weil es einer dieser schönen und sonnigen Spätherbsttage war, an denen man das Echo des vergangenen Sommers noch einmal hören konnte. Irgendwann stand die Sonne schon sehr tief, und wir bemerkten, dass alle anderen Familien bereits nach Hause gegangen waren. Wir machten uns also auf den Rückweg, doch die schon sehr tief stehende Sonne sank rasch, und mein Vater war sich plötzlich nicht mehr so sicher, wo es zur Bahn ging. Es wurde also ziemlich schnell ziemlich dunkel, wir verliefen uns, und ich zitterte an der Hand meines Papas – ich dürfte so acht Jahre alt gewesen sein –, während er mit einem Feuerzeug leicht gebückt den Boden ausleuchtete, damit wir nicht hinfielen. Ein Smartphone hätte uns wirklich geholfen, mit Karte und Taschenlampe und allem, oder zumindest ein funktionierendes normales Handy. Denn natürlich war der Akku von Papas Handy leer, wir hatten also niemanden anrufen können. Auch das noch. Andererseits war das ausgesprochen typisch für Papa. Handy nie geladen, Papa selbst immer etwas zerstreut.
Jedenfalls war mir der Wald damals in der Dunkelheit plötzlich feindlich erschienen. Schatten tanzten im Zwielicht über das Unterholz, und die Farne und Büsche sahen wie furchterregende Gestalten aus, ihre Wedel und Äste wirkten wie gekrümmte Arme und Hände, die nach mir greifen wollten.
Keine Ahnung, was sich der Wald gedacht hatte; die Tiere, die uns beobachteten, die Bäume, über deren Wurzeln wir stolperten. War das Rascheln ihres Laubes vielleicht nicht nur der Wind, sondern ein Flüstern und Lachen? Vielleicht machten sie sich über uns lustig, das hätte ich auf jeden Fall an ihrer Stelle getan. Was für unfähige Clowns Menschen doch sind, schaut mal, drei Minuten im dunklen Wald und schon total hinüber, hahahaha, raschelraschelraschel, hahahaha! Keine Sorge, mir ist schon klar, dass ein Baum nicht lachen kann, vermutlich nicht einmal denken, so wie wir denken aus unserer Menschenperspektive definieren. Trotzdem stelle ich mir so was manchmal gerne vor.
Irgendwann fanden wir den richtigen Weg, wir waren ja nicht in endlosen schwedischen Wäldern gefangen. Nach zwei Stunden Herumgeirre sahen wir das Leuchten der Bahnhaltestelle und konnten nach Hause zu Mama fahren, die schon krank vor Sorge war.
Das war damals. Heutzutage würde man sich selbst bei finsterster Nacht nicht mehr im Frankfurter Stadtwald verlaufen können, denn es ist davon nicht mehr viel übrig. Seit zwölf Jahren haben wir das große Baumsterben, seit acht Jahren nur noch Dürren während Frühling und Sommer. 2033 ist ums Stadium herum so ein schlimmer Waldbrand ausgebrochen, dass am Ende nur noch rund zehn Prozent des Waldes übrig waren. Zehn. Prozent. All die Bäume, all die Tiere, alles verbrannt, alles tot.
Es ist furchtbar, und doch gehört das heutzutage zu meinem Arbeitsalltag. Solange es Insekten zu studieren gibt, machen wir Forscherinnen und Forscher weiter. Wir katalogisieren, beschreiben und archivieren, wir verwalten und sortieren das Artensterben, denn irgendjemand muss das machen, alles muss für die Nachwelt festgehalten werden. Und an der Speerspitze der deutschen Biodiversitätsforschung – also der Wissenschaft von der Vielfalt der Arten, Gene und Ökosysteme – stand unter anderem meine Tante Auguste, eine Koryphäe in ihrem Gebiet.
Auch wenn meine Tante das Grundstück seit Jahren nicht mehr verlässt, ist sie Professorin und ein echtes Workhorse. Sie macht nichts anderes außer arbeiten, von morgens bis abends. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Ihr Einsiedlerkrebsverhalten, das andere wohlwollend als exzentrisch bezeichnen, wird an der Uni geduldet, weil man auf ihre Kompetenz nicht verzichten kann. Deshalb lebt sie in der Wohnung über der meiner Mutter und meiner Schwester, leitet ihre Arbeitsgruppe aus der Ferne, unterrichtet und forscht eingeigelt vor sich hin, allein mit HP14, ihrer Weinbergschnecke.
Japp, meine Tante hat eine Weinbergschnecke als Haustier. Der wissenschaftliche Name ist Helix pomatia, und HP14 war vor allem eins: ein Endling. Die Letzte ihrer Art also, das einsame Überbleibsel einer seit Millionen von Jahren andauernden Erfolgsgeschichte, die mit dem Tod dieses kleinen Exemplars ebenfalls zum Erliegen kommen würde. Meine Tante hing an dieser Schnecke, als würde es um ihr eigenes Leben gehen, wirklich wahr. Seit zwölf Jahren suchten sie und ihr Team einen Partner für HP14, und wenn ich mit ihr sprach oder wir uns per Mail austauschten, gehörte es zum guten Ton, sich zu erkundigen, wie es denn der Schnecke gehe und ob es schon etwas Neues gebe.
Die Welt hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten rasant verändert und der menschliche Einfluss eine Lawine ins Rollen gebracht, die niemand mehr aufhalten konnte. Die Zahl der Endlinge, dieser traurigen, einsamen Geschöpfe, wuchs momentan exponentiell. HP14 war einer der ersten einer richtigen Welle, und mittlerweile bevölkerten sie die Labore in Massen, während wir Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die zusammenbrechenden Ökosysteme dieser Welt auf der Suche nach einem Paarungspartner für diese Tiere durchstreiften. Klingt deprimierend? Oh ja. Schon oft habe ich mir meine Berufswahl vorgeworfen, mich gefragt, ob ich nicht einen Karriereweg hätte einschlagen können, der sich mit weniger deprimierenden Themen beschäftigt. Aber gut, so ist es einfach.
Der Einfluss des Menschen hat nun mal eine unumkehrbare ökologische Krise ausgelöst, und da stecken wir alle drin, Biologin oder nicht. Mein Gott, ich weiß noch, als der Tod des letzten Rotkehlchens namens Mila in einem Freiburger Labor landesweite Trauer auslöste, ich war selbst fix und fertig. Dass es mal keine Rotkehlchen mehr geben würde, hätte ich nicht gedacht – diese kleinen, resoluten Kerlchen, die nicht davor zurückschreckten, sich mit einem Menschen anzulegen, der für ihren Geschmack ein wenig zu nah am Nest vorbeispazierte.
Mila war damals nur die Spitze des Eisbergs, denn der eigentliche Horror war das fast vollständige Absterben der Buchen vor etwa zehn Jahren, eine verheerende Kettenreaktion, die ein Massensterben von Insekten, Pflanzen, Säugetieren und Vögeln nach sich zog. Wir ersaufen seitdem in Stechmücken, weil es viel zu wenig Wespen, Vögel und Spinnen gibt, die es mit ihnen aufnehmen. Dengue-Fieber in Deutschland? Mittlerweile nicht ungewöhnlich.
Natürlich war das alles auch politisch nicht ohne Folgen geblieben. Nach und nach schwappte eine Welle der Angst durch die Gesellschaft, und dann es wurde so richtig schlimm. Und richtig schlimm übersetzte sich bei uns Deutschen natürlich erst einmal direkt in Toilettenpapierhamsterkäufe. Keine Ahnung, was das immer soll. Ob die Leute denken, dass Klopapier von Spinnen und Schmetterlingen fußgeklöppelt wird und dass man, wenn die aussterben, nirgendwo mehr welches finden kann? Jedenfalls wünschte ich mir, dass es dabei geblieben wäre und wir als Resultat dieser German Angst nicht plötzlich von einer rechtskonservativen Koalition regiert werden würden, die versprochen hatte, alles zu regeln und Ängste ernst zu nehmen – und doch kam es genau so.
Über Politik nachzudenken, bereitet mir als Frau derzeit wenig Freude, und als diese Gedanken durch meinen Kopf waberten, während ich aus dem Zugfenster schaute, versuchte ich sie schnell zu verscheuchen, indem ich wieder nach meinem Buch griff, in dem ich schon die ganze Strecke über erfolglos versuchte zu lesen.
Mein Handy vibrierte. Es war Hanna.
kann dich doch nicht abholen, gibt stress zu hause …
Mit Mama?
ne auguste, erzähl ich dir dann.
Ich legte das Handy weg und sah wieder aus dem Fenster. Zehn Minuten noch. Ich konnte schon den Fernsehturm sehen.
Pholcus phalangioidesGroße Zitterspinne
Der Garten sah fantastisch aus. Das Gras stand hoch, eine Clematis rankte am Regenrohr empor und hielt ihre großen blauen Blüten wie eine offene Radarschüssel in den Weltraum. Margeriten blühten, Nelken auch, Pfingstrosen, Disteln, Gänseblümchen und Butterblumen verteilten sich als Farbtupfer zwischen den hohen Grashalmen. Eine Brombeerhecke war über die Schubkarre gewachsen, die seit Jahren an derselben Stelle neben dem Eingang lehnte. Der Garten war ein schöner Lebensraum, oder wie unsere Nachbarin Frau Schäfer gesagt hätte, wenn sie noch leben würde: eine Katastrophe.
Ich stellte meine Reisetaschen ab und ging über die Wiese zu einer Stelle, an der sich viele Kuckuckslichtnelken ausgebreitet hatten. An ihren filigranen Stängeln wiegten sich ihre feinblättrigen rosafarbenen Blüten im Wind. Zufrieden bemerkte ich, dass eine Schwebfliege vor ihr in der Luft flirrte. Es sah aus, als hypnotisierten sie sich gegenseitig, die Pflanze die Fliege und umgekehrt. Ich ging weiter und entdeckte einen Weberknecht in den Brombeeren, ein paar kleine Schnecken, eine Assel.
Manche Dinge funktionieren noch.
Unser Haus war klein, ursprünglich das Elternhaus meines Vaters und von Auguste. Opa war nach dem Tod von Oma in eine kleinere, seniorengerechte Wohneinheit in einem Altenstift gezogen, weil er das Alleinsein nicht mehr ertragen und wegen seiner Parkinson-Erkrankung schon früh Hilfe benötigt hatte, und Vater und Auguste hatten danach jeweils eine Etage des Elternhauses für sich beansprucht und zu Wohnungen umgebaut, Auguste oben, meine Eltern unten. Für uns Kinder war dieser Anschluss an unsere Tante das Beste, das hätte passieren können, denn: Unsere Tante war großartig.
Auguste und ich hatten schon immer eine besondere Verbindung gehabt. Als ich klein war, packten wir zwei- oder dreimal im Monat unsere Rucksäcke und stiegen in den Zug, begierig darauf, der Natur all ihre Geheimnisse zu entlocken. Irgendwann kam auch Hanna mit, aber in den ersten achtzehn Jahren meines Lebens gehörte mir meine Tante ganz allein. Auguste, die eine wirklich brillante Biologin und eine außerordentlich geduldige Lehrmeisterin ist, hatte mir auf unseren Spaziergängen alles erklären können, alle Pflanzen und Tiere, die Stoffkreisläufe, Räuber-Beute-Beziehungen, all so was. Auf diese Weise hatte sie mir eine Ebene unserer Welt eröffnet, die den meisten Menschen ein Leben lang verborgen bleibt. Wenn man durch eine Landschaft geht und plötzlich die Namen der Organismen kennt, die dort leben, wenn man versteht, wie alles funktioniert und zusammenhängt, dann verwandelt sich diese Landschaft von einer dekorativen Tapete in eine Ansammlung von Akteuren. Dann ist das alles nicht mehr anonym, sondern unglaublich konkret. Ein bisschen so, wie wenn man auf eine Party geht und niemanden kennt. Man ist in dem Fall einfach von einer gesichtslosen Menschenmenge umgeben, die nichts in einem auslöst. Aber wenn man mit Jan quatscht und Samira begrüßt, ist alles so vertraut. Geschichten tun sich auf, Beziehungen werden sichtbar. Meine Tante leistete in unserer Kindheit genau das für mich – sie stellte mich der Welt vor, riss den Schleier von meinem Gesicht und ließ mich wirklich sehen, fühlen und verstehen, wo ich bin. Dafür kann ich ihr gar nicht genug danken. Sie ist auch der Grund, warum ich so besessen von Insekten und anderen kleinen Tieren bin, warum ich Biologin geworden bin, all das.
Auch Hanna hat als Kind die Natur geliebt, vor allem die Tiere. Einmal stießen wir bei unseren Bergwanderungen auf die Spuren von Gämsen, und als wir sie schließlich bei ihren halsbrecherischen Manövern in den Steilwänden entdeckten, musste Hanna vor Angst um die kleinen Kitze weinen. Sie war ein vorsichtigeres Kind als ich, aber nicht so vorsichtig, wie es unsere Großmutter – Mamas Mutter – gerne gehabt hätte, die sich ständig um uns sorgte. Hanna war trotz allem so wild, wie es kleine Mädchen eben immer sind, bevor man anfängt, sie wie Origamipapier zu falten und zu verbasteln, bis sie sich in stille und hübsch anzusehende Schwäne verwandeln. Sei ruhig, mach dich nicht dreckig, spiel hiermit, damit aber nicht, nein, das ist für Jungs, schrei nicht so herum, nein, du kannst jetzt nicht raus, spiel doch mal mit den Puppen von Oma, nein, der Rock ist zu kurz, das geht nicht, zieh eine Strumpfhose drunter, schlag die Beine übereinander, nein, zum Toben bist du doch schon zu groß, sei nicht so zickig, sei nicht so schüchtern, sei aber bitte nicht zu laut, sei dies, sei das, jenes aber nicht, nein, nein, NEIN!
Hanna ließ sich zum Glück niemals falten, blieb formstabil, auch, weil man uns gestattete, wir selbst zu sein. Niemals zerrten Mama oder Papa an uns Töchtern herum, niemals stöhnten sie über die schlammverschmierten Klamotten, wenn wir von einem unserer Ausflüge zurückkamen. Und wie abenteuerlich waren diese gewesen! Wir rannten Berge hinauf, stiegen von Hügeln in Täler hinab, tobten und heulten wie die Wölfe, Auguste ein paar Meter hinter uns, immer mit Hut, immer mit Wanderstock, immer mit einem Lächeln. Einmal, bei einem Ausflug in den Schwarzwald, schlug Hanna vor, einen Altar für Gaia zu bauen. Sie kannte diese Göttin aus den Geschichten, die Mama ihr vorgelesen hatte, und so sammelten Hanna und ich Stöcke und Steine, klaubten totes Holz und Laub auf, während unsere Tante etwas abseits versuchte, das Zelt aufzubauen. Wir schichteten die Steine übereinander, legten die Blätter und Stöcke in einem Kreis drum herum und stellten eine kleine Figur aus Zweigen und Bast auf. Das sollte die Göttin selbst sein, und ehrlich gesagt sah das Ding aus wie etwas, das man manchmal in Horrorfilmen sieht. Ich war damals zwar schon erwachsen – Hanna und mich trennen ja achtzehn Jahre, sie ist die ungeplante Nachzüglerin gewesen –, dennoch sprang auch ich um ihr kleines Heiligtum herum und tanzte mit meiner Schwester; meine Schwester, noch nicht einmal sechs Jahre alt, rief die Göttin an und schrie so wild und laut, wie es nur kleine, wütende Mädchen können, denen man ihre Kraft und Wildheit noch nicht genommen hat. Wir haben damals so, so viel erlebt. Wir bauten Dämme und rissen sie wieder ein, errichteten Hütten aus Reisig, trugen Wasserschlachten in Flüssen aus und versuchten, Fische mit den Händen zu fangen. Nachts zogen wir uns ins Zelt oder in gemütliche kleine Pensionen zurück und erzählten uns flüsternd, was wir an diesem Tag besonders spannend gefunden hatten. Wir schliefen mit dem Zirpen der Grillen ein und wachten mit dem Duft von frisch gebrühtem Tee auf, bereit für einen neuen Tag voller Entdeckungen.
Alles hatte sich in diesen Jahren so, so gut angefühlt. Diese Ausflüge erscheinen mir im Rückblick wie wunderbare Märchen; zu schön, um wahr zu sein. Mittlerweile sind sie es auf jeden Fall, denn diese unbeschwerten Zeiten waren lange vorbei.
Anyways, ich ging zurück zu meinen Taschen und schaute die Fassade hinauf zu den Fenstern im ersten Stock. Sie sahen staubig aus, Tante Auguste war nie ein großer Fan davon gewesen, die Fenster zu putzen. Trotzdem hatte sie es früher ab und zu getan, damit die Pflanzen genug Licht bekamen, aber auch das hatte sich anscheinend geändert. Ich schirmte meine Augen mit der Hand gegen die Sonne ab, um zu sehen, ob ich die Schatten von Blättern und Zweigen hinter der Scheibe erkennen konnte, aber nichts.
Ich nahm je eine Reisetasche links und rechts in die Hand und schleppte mich zur Tür. Natürlich hatte ich wieder viel zu viele Sachen dabei. Mein Stereomikroskop mitzunehmen, war ziemlich ehrgeizig und vielleicht auch ein bisschen bescheuert, wenn man bedenkt, wie schwer und sperrig das Ding war, aber gut. Im Zug fiel mir ein, dass Tante Auguste auch Mikroskope hatte, aber da war es schon zu spät gewesen. Doch wenn ich schon sechs Wochen hier sein musste, wollte ich die Zeit wenigstens nutzen, um eine kleine Bestandsaufnahme der Insekten- und Pflanzenvielfalt in der Gegend zu machen, vielleicht würde ja eine wissenschaftliche Veröffentlichung daraus werden, wer weiß.
Im Nachbarhaus ging die Tür auf, und ein schwarz-grauer Haarschopf schob sich raus.
»Ach, Zoe, hallo!«
»Hallo, Herr Karadeniz!«, rief ich zurück und versuchte die Schultern so zu bewegen, dass es aussah, als würde ich irgendwie … winken?
»Lange nicht gesehen! Besuchst du die Mama!«
Unser Nachbar hat die interessante Angewohnheit, jede Frage wie eine Aussage klingen zu lassen. Besuchst du die Mama. Wie geht es dir. Was machst du heute. Hast du heute Schule.
»Ja, genau, ich bin ein paar Wochen hier … Mama … Also Mama geht in Kur!«
»Ach, der Rücken, oder?«
So, das war also die offizielle Geschichte, alles klar. Gut zu wissen.
»Ja genau, der Rücken! Der macht ihr ja schon lange Probleme.« Ich spielte mit.
»Ach ja.« Er trat ganz aus der Tür raus und sah dabei aus wie immer: beige Hose mit Bügelfalten, braune, gemusterte Pantoffeln, ein karierter Pullunder, darunter ein einfarbiges Hemd. Der schwarze Schnurrbart war ebenso akkurat gestutzt wie sein Garten. Der Rasen sah aus, als habe man ihn mit der Nagelschere in Form gebracht, die Buchsbäume waren abgerundet, und links vom ordentlich gefegten Plattenweg stand ein kleines Vogelbad, das seit jeher Konfliktpotenzial in sich trug.
Normalerweise würde man denken, dass sich Menschen, die ein Vogelbad aufstellen, über Vogelbesuch freuen. Nicht so Herr Karadeniz. Jedes Mal, wenn ein Vogel kam, um darin zu baden oder Wasser zu trinken, wurde er von unserem Nachbarn mit finsterer Miene ins Visier genommen. Frau Karadeniz – eine große Tierfreundin, für die er das Vogelbad überhaupt erst eingerichtet hatte – hatte ihrem Mann verboten, die Vögel zu verscheuchen, und so konnte er nur tatenlos zusehen. Kaum war der gefiederte Übeltäter nach seiner Schandtat verschwunden, machte sich unser Nachbar daran, sich zu vergewissern, dass wirklich nirgendwo mehr Vogelkot oder Federn zu finden waren. Er schrubbte alles mit Essigwasser ab und stöhnte dabei ziemlich melodramatisch, aber als Biologin konnte ich das Ganze nur gutheißen. Nachdem uns beim zweiten Meisensterben 2029 fast alle Blaumeisen weggestorben waren, weil sie sich, wie schon einmal ein paar Jahre zuvor, mit einem Bakterium infiziert hatten, begrüßte ich den Putzfimmel unseres Nachbarn durchaus. Man konnte sagen, was man wollte, aber die Vogeltränke der Karadeniz’ glänzte wie neu.
»Cem ist auch da«, erklärte Herr Karadeniz, »ihr habt euch ja auch länger nicht gesehen, oder!«