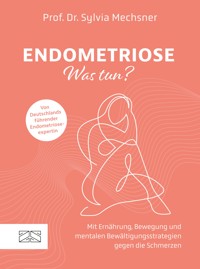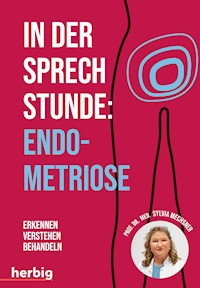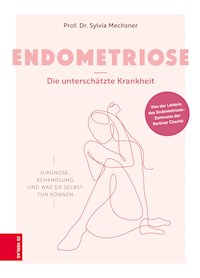
20,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ZS - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Diagnostik, Behandlung und Therapie der chronischen Erkrankung: Chronische Schmerzen, starke Blutungen, zyklische Darmbeschwerden und unerfüllter Kinderwunsch – dies alles kann im Zusammenhang mit einer Endometriose auftreten. Viele Frauen in Deutschland quälen sich mit dieser Krankheit, häufig ohne es zu wissen. Denn bis zur korrekten Diagnose vergehen oft bis zu zehn Jahre, weil sowohl die Patientinnen selbst als auch Ärztinnen und Ärzte die Symptome nicht richtig zu deuten wissen. Prof. Dr. Sylvia Mechsner, eine der führenden Endometriose-Expertinnen mit langjähriger Erfahrung in Forschung und Praxis an der Berliner Charité, verbindet in ihrem ganzheitlichen Ratgeber das aktuelle medizinische Fachwissen mit fundierten Anleitungen und Tipps für kompetente Patientinnen: Wie gelangt man schneller zu einer Diagnose? Wie lässt sich die ärztliche Versorgung verbessern? Welche konservativen und komplementärmedizinischen Möglichkeiten der Behandlung und Therapie gibt es? Was können betroffene Frauen neben der ärztlichen Versorgung selbst für sich tun? Mit viel Fachkompetenz will Dr. Mechsner Mut machen, aktiv gegen die Krankheit anzugehen, den Weg aus der Schmerzspirale zu finden und selbst einen Kinderwunsch nicht von vornherein aufzugeben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 331
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
INHALT
KAPITEL 1Ist doch alles gutartig – Dunkelfeld Endometriose
Warum bleibt Endometriose so oft unentdeckt?
Endometriose und Adenomyose
Subtypen der Endometriose und ihre Einteilung
Zellen auf Abwegen: Wie kommt das da hin?
Die Gebärmutter – ein Muskel, der Höchstleistungen vollbringt
Wehret den Anfängen
KAPITEL 2Endometriose ist eine hormonabhängige Erkrankung
Der weibliche Zyklus
Endometriose-Herde
Hormonelle Therapie
KAPITEL 3Blutungen, Schmerzen, Kinderlosigkeit
Eine Krankheit wie ein Chamäleon
Auffällige Blutungen – Hypermenorrhoe
Unfassbare Schmerzen
Die Sache mit dem Kinderwunsch
Kinderwunschbehandlung
KAPITEL 4Ist es tatsächlich Endometriose – und was dann?
Differenzialdiagnosen
Anamnese – Die Vorgeschichte der Erkrankung erfassen
Schulmedizinische Untersuchungen
Operation vs. konservative Therapie
KAPITEL 5Die Therapie – komplex: Die Therapie – komplex und individuell
Warum Operationen die Sache nicht erledigen
Hormonelle Therapiemöglichkeiten
Alternativen zu Steroidhormonen
Wichtige Helfer gegen Schmerzen: Schmerzmittel
Medikamente, die die Wirkung von Schmerzmitteln unterstützen
Nervenschmerzen behandeln
KAPITEL 6Praktisches Vorgehen anhand typischer Befunde
Die Patientin ohne Organdestruktion
Die sehr junge Patientin unter 18 Jahren
Die Patientin mit Endometriose-Zysten und Verklebungen ohne TIE
Die Patientin mit tief infiltrierender Endometriose (TIE)
Die chronische Schmerzpatientin
Schwangerschaft und Geburt mit Endometriose
Ab der Menopause ist endlich Schluss mit Endometriose – oder?
KAPITEL 7Wir leben jetzt zusammen – Alltag mit Endometriose
Alternative und komplementär-medizinische Behandlungsmethoden
Antientzündliche Ernährung
Darmgesunde Ernährung
Psychologische Unterstützung, Schmerzbewältigungsstrategien und medizinische Reha
Mein Apell
Weiterführende Informationen
Anmerkungen
VORWORT
Als ich vor 20 Jahren als junge Assistenzärztin gefragt worden bin, ob ich mich mit Endometriose beschäftigen wollte, habe ich erst mal in meinem Lehrbuch nachgeschlagen und entsetzt gedacht: »WAS soll ich? Mich mit so kleinen Schleimhautinseln beschäftigen?«Gerade mal zwei Seiten widmeten sich diesem Thema. Ich habe das Buch noch. Völlig uninteressant, habe ich gedacht. Was soll das denn bitte für Probleme machen? Da sterben Frauen an Krebs und ich soll mich mit winzigen Gebärmutterschleimhaut-Herden befassen? Kann ja nicht sein.
Doch mein Oberarzt blieb hartnäckig und hat nicht locker gelassen, wohl auch, weil ich eine grundlagenwissenschaftliche Doktorarbeit im Bereich Biochemie geschrieben und Laborerfahrung hatte. Irgendwann habe ich nachgegeben – und ab ging’s ins Labor. Wir haben dann an der Charité das Grundlagenforschungslabor für Endometriose-Forschung aufgebaut. Es ist eines der ersten universitären Endometriose-Zentren in Deutschland und europaweit.
Ich persönlich habe mich von Anfang an schwerpunktmäßig mit der Frage der Schmerzentstehung beschäftigt. Nach nur zwei Wochen war mir damals bereits klar, dass gar nichts klar ist im Bereich der Endometriose. Hier schien es sich um ein Fass ohne Boden zu handeln. Doch ich bin dabei geblieben – vor allem die Erforschung der Entstehung und Entwicklung der Endometriose (Pathogenese) und die Schmerz-entstehung sowie, im Rahmen der Translationalen Medizin (TM), die Entwicklung neuer Behandlungskonzepte stehen seither im Mittelpunkt meiner Arbeit und Forschung.
Warum dieses Buch?
Schätzungsweise zwei Millionen Frauen in Deutschland quälen sich mit der Krankheit Endometriose – häufig ohne zu wissen, was sie wirklich haben. Denn bis zur korrekten Diagnosestellung vergehen nicht selten bis zu zehn Jahre, obwohl diese Erkrankung der Gebärmutter und ihrer Gewebe überaus schmerzhaft ist, die Frauen enorm in ihrer Lebensqualität einschränkt und mitunter auch die Partnerschaft schwer belastet. Außerdem hängt die Furcht vor Unfruchtbarkeit wie ein Damoklesschwert über den Patientinnen. Das Zeitfenster für ein Kind wird durch eine unbehandelte Endometriose unter Umständen sehr klein. Das ist ein erhebliches Problem vor dem Hintergrund, dass gut ausgebildete Frauen ihren Kinderwunsch heute karrierebedingt nach hinten schieben.
Täglich erlebe ich in der Klinik, dass nicht nur bei den Patientinnen, sondern auch bei Ärztinnen und Ärzten* große Unsicherheiten im Umgang mit dieser Erkrankung bestehen. Und leider bietet unser Gesundheitssystem den niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen wenig Spielraum, um diese Erkrankung, die so weitreichende Folgen haben kann, adäquat zu begleiten. Es fehlt schlicht an Geld. Doch der Bedarf nach umfassender Beratung steigt. Die Frauen fordern zu Recht eine individuelle ärztliche Aufklärung und Betreuung. Man kann unmöglich wollen, dass sie sich ihre Informationen selbstständig aus dem Internet zusammensuchen, nur um dann mit der Einordung dieses Wissens alleingelassen zu werden.
Es gibt bereits viel Literatur zu dieser Erkrankung, meist aus der Sicht von betroffenen Patientinnen oder aus rein medizinischer Perspektive. Ich möchte mit meinem Buch die Komplexität der Erkrankung auf der Basis der medizinischen Fakten darlegen und die vielfältigen Therapiemöglichkeiten vorstellen, sodass sie jeder versteht. Im Zentrum steht immer die individuelle Therapieplanung. Dabei ist die Aufklärung über die Krankheit und ihre Behandlungsmöglichkeiten ganz wichtig, damit die Patientinnen die richtigen Entscheidungen für sich treffen können. Je kompetenter eine Patientin ist, desto erfolgreicher kann sie sich mit ihrer Ärztin oder ihrem Arzt auf eine Therapiestrategie einigen.
Auch ich habe lange gebraucht, bis ich alle Zusammenhänge verstanden habe, und viele Fragen sind noch offen. Vieles, was Sie in diesem Buch lesen werden, resultiert aus meinen klinischen Erfahrungen, untermauert von Studien, die wir sowohl auf der Ebene der Grundlagenforschung als auch im Bereich der klinischen Forschung durchgeführt haben. Zahlreiche Fragestellungen zur Schmerzentwicklung und zur Entstehung der Endometriose versuchen wir im Labor zu verstehen und zu beantworten, mit dem Ziel, aus diesen Erkenntnissen neue Therapiemöglichkeiten zu entwickeln.
In diesem Ratgeber erkläre ich, wie Sie als betroffene Frau schneller zu einer Diagnose kommen, wie sich die ärztliche Versorgung verbessern lässt und was Sie selbst für sich tun können. Denn ein gutes und lebenswertes Leben ist auch mit Endometriose möglich. Die Bausteine dafür sind ein individueller multimodaler Therapieplan und ein achtsamer Lebensstil, bei dem entspannende Bewegungsformen und eine antientzündliche Ernährung im Mittelpunkt stehen.
* Wenn in diesem Buch abwechselnd die weibliche und/oder männliche Form verwendet wird, sprechen wir damit stets Personen jeden Geschlechts an.
IST DOCH ALLES GUTARTIG –
DUNKELFELD ENDOMETRIOSE
Endometriose ist eine der häufigsten chronischen Erkrankungen bei geschlechtsreifen Frauen, die ausgesprochen starke Schmerzen verursacht, doch immer noch unterschätzt wird – auch in der Medizin.
Dabei könnten Gynäkologinnen und Gynäkologen helfen, weil inzwischen viel mehr über den Verlauf, die verschiedenen Formen der Erkrankung und die Therapiemöglichkeiten bekannt ist. Ganz besonders wichtig ist die Früherkennung bei diesem Frauen-leiden, weil sie schwere Verläufe verhindert, die teils sehr heftigen Schmerzen lindert und die Lebensqualität der betroffenen Frauen enorm verbessert.
Obwohl die typischen Beschwerden der Endometriose – schwere Dysmenorrhoe (heftige Regelschmerzen), zyklische und azyklische Unterbauchschmerzen, zyklische Dysurie (Schmerzen beim Wasserlassen) und Dyschezie (Schmerzen beim Stuhlgang), Dyspareunie (Schmerzen beim Geschlechtsverkehr) sowie Unfruchtbarkeit – inzwischen hinlänglich bekannt sind, wird die Erkrankung im Mittel erst zehn Jahre nach dem Einsetzen der ersten Beschwerden diagnostiziert.1 Eine Patientin im deutschsprachigen Raum hat nach den ersten Symptomen bis zur Diagnosestellung im Schnitt eine Odyssee von zehn Jahren hinter sich. Schätzungsweise zehn bis 15 Prozent der europäischen Frauen zwischen 15 und 45 Jahren leiden an Endometriose – bei Frauen mit unerfülltem Kinderwunsch ist dieser Prozentsatz mit 40 bis 45 Prozent deutlich höher.2
SCHMERZEN UND UNERFÜLLTER KINDERWUNSCH SIND DIE LEITSYMPTOME DER ENDOMETRIOSE.
Warum bleibt Endometriose so oft unentdeckt?
Einer der Hauptgründe ist sicherlich, dass neben den endometriose-spezifischen Symptomen unspezifische Beschwerden das eindeutige Beschwerdebild verzerren können, was dazu führt, dass nicht nur Gynäkologen, sondern auch Ärztinnen und Ärzte anderer Fachrichtungen von den betroffenen Frauen aufgesucht werden.3
Es stellt sich daher die Frage, warum die Beschwerden so schwer einzuschätzen sind und warum die Diagnose nicht viel häufiger frühzeitig gestellt werden kann. Immerhin berichten über 60 Prozent der Frauen, bei denen die Endometriose erst im fortgeschrittenen Alter diagnostiziert wurde, dass ihre Beschwerden bereits vor dem 20. Lebensjahr begonnen haben. Dabei besteht zwischen Dauer und Intensität der Beschwerden und dem Ausmaß der späteren Endometriose eine eindeutige Korrelation.4 Eines ist klar: Je weiter die Entwicklung der Endometriose bei einer Patientin voranschreitet, desto komplexer werden die Beschwerden, die mit ihr einhergehen. Endometriose ist eine chronische Erkrankung und tritt auch nachdem Endometriose-Herde operativ entfernt worden sind wieder auf. Etwa 50 Prozent der betroffenen Frauen haben anhaltenden Therapiebedarf.5 Die Kenntnis der Art, der Verteilung und der möglichen Entstehung der Endometriose-Herde erlaubt ein besseres Verständnis hinsichtlich der möglichen Auswirkungen dieser Krankheit.
Häufig wird die Krankheit aber auch deshalb erst so spät oder gar nicht diagnostiziert, weil viele Mädchen und Frauen denken, dass sie Regelschmerzen einfach aushalten müssen – wie übrigens Schmerzen im Allgemeinen. Weit verbreitet ist auch die Meinung, es sei besser, über »die Tage« nicht zu sprechen und sich schon gar nicht deswegen krankschreiben zu lassen. Noch heute lernen Mädchen und junge Frauen, dass Regelschmerzen völlig normal sind. Viele Frauen, die während der Periode unter starken Schmerzen und starken Blutungen leiden, wissen daher nicht, dass ihre Symptome ungewöhnlich sind. Doch sogar in der Ärzteschaft, selbst unter Fachärztinnen und Fachärzten, ist das Wissen über diese Erkrankung und ihre Symptome leider nicht ausreichend verbreitet.
Meist suchen die Frauen mit Regelschmerzen ihre Gynäkologin oder ihren Gynäkologen auf. Dort werden sie untersucht, im Rahmen ihrer Regelschmerzen behandelt und vielleicht wird ihnen die Pille verschrieben. Wenn die Patientinnen über weitere Beschwerden berichten, werden sie in der Regel zu anderen Fachärzten überwiesen. Die Endometriose wird so jedoch nicht angemessen behandelt.
Zum Vergleich: Bei uns im Endometriose-Zentrum bekommt eine Patientin 40 bis 60 Minuten Zeit für eine ausführliche Anamnese, in der erst mal die Entwicklung der Krankheit, die ja meist einen jahrelangen Vorlauf hat, besprochen wird. Danach erfolgt eine gezielte Untersuchung und Therapieplanung. Niedergelassene Ärztinnen oder Ärzte können dies im Rahmen der Basisversorgung so nicht leisten, weil für diese spezielle Fragestellung keine Abrechnungsmöglichkeiten bestehen. Das wird von den Kassen nicht bezahlt. Hier muss der Gesetzgeber dringend etwas ändern.
Viele Frauen müssen also auch deshalb jahrelang allein damit zurechtkommen, weil die Endometriose von den unterschiedlichen Fachärzten gar nicht diagnostiziert werden kann. Kein Wunder also, dass sich die meisten Patientinnen komplett alleingelassen fühlen – in der Diagnose und bei der Behandlung. Es gibt viele, deren Beschwerden von den Gynäkologinnen als Regelschmerz, »mit dem man eben leben muss«, oder als psychosomatische Schmerzerkrankung wahrgenommen werden. Die Frauen haben aber komplexe Beschwerden und suchen deshalb auch Ärztinnen und Ärzte verschiedener Fachrichtungen auf. Ganz häufig landen Frauen, die Endometriose haben, zum Beispiel zunächst beim Orthopäden, weil sie aufgrund der Herde sehr starke Rückenschmerzen haben. Gastroenterologen (Fachärzte für den Magen- und Darmtrakt), die wegen der Unterleibskrämpfe nicht selten aufgesucht werden, stellen dann oft ein Reizdarmsyndrom fest. Auch psychosomatische Störungen werden häufig diagnostiziert, weil andere Fachrichtungen naturgemäß nicht »gynäkologisch« denken. So kommt es, dass viele Frauen einfach keine richtige Diagnose bekommen.
Demgegenüber steht die Tatsache, dass bei 70 bis 80 Prozent der Frauen mit chronischen Schmerzen im Unterbauch Endometriose diagnostiziert wird.6
Die Wahrheit muss ans Licht!
Es ist enorm wichtig, dass die Diagnose Endometriose von den Frauenärztinnen und -ärzten an die Krankenkasse weitergeleitet wird. Wir Endometriose-spezialisten gehen von bis zu 40.000 Neuerkrankungen pro Jahr allein in Deutschland aus, die Krankenkassen wissen aber offiziell nur von zwei bis drei Prozent Endometriose-Patientinnen. Tatsächlich ist Endometriose aber die häufigste gutartige Unterleibserkrankung bei Frauen! Ohne entsprechende Dokumentation der Fälle – weil die Codierung durch die gynäkologischen Praxen ausbleibt – wird die Erkrankung im Gesundheitssystem aber nicht als Problem erkannt. Und ohne Problembewusstsein gibt es auch keine Früherkennungsprogramme für Mädchen oder junge Frauen mit schmerzhafter Regelblutung (Dysmenorrhoe), die aber enorm wichtig wäre.
Endometriose und Adenomyose
Endometriose ist eine sogenannte gutartige, aber chronische Erkrankung, bei der sich gebärmutterschleimhautähnliches Gewebe außerhalb der Gebärmutterhöhle ansiedelt – im Bauchraum, am Bauchfell im kleinen Becken, in der Blasenwand, in den Harnleitern, an den Darmwänden und Eierstöcken oder gar in den Lungen.
Der Name leitet sich vom griechischen Wort Endometrium für Gebärmutterschleimhaut ab. Inzwischen weiß man aber, dass es sich dabei nicht nur um gebärmutterschleimhautähnliches Gewebe (Epithel- und Stromazellen) handelt, sondern auch um glatte Muskelzellen, die der Gebärmuttermuskulatur gleichen. Man kann also sagen, dass es bei Endometriose zur Ansiedlung von Mini-Gebärmüttern kommt.7
Ursprünglich wurden mit dem medizinischen Begriff Endometriose (Endometriose außerhalb der Gebärmutterhöhle) Endometriose-Herde auf dem Bauchfell und in den Genitalorganen (Endometriosis genitalis externa) beschrieben. Doch inzwischen ist damit auch die Abwanderung solcher Herde in die Gebärmuttermuskelwand (Endometriosis genitalis interna oder Adenomyosis uteri, kurz Adenomyose) gemeint. Die Forschungsgruppe um Prof. Gerhard Leyendecker von der Frauenklinik des Klinikums Darmstadt veröffentlichte mehrere Arbeiten über die Zusammenhänge zwischen den Endometriose-Subtypen und stellte sowohl eine gemeinsame Entstehungsgeschichte8 als auch große Gemeinsamkeiten fest.9
Es ist wichtig, die Subtypen der Endometriose zu kennen, um das gesamte Ausmaß der Erkrankung zu verstehen. Beide gehören nämlich zusammen, weshalb das gesamte Krankheitsbild eigentlich Archimetrose genannt werden müsste, da es von einem Teil der Gebärmutter, der Archimetra, seinen Ausgang nimmt. Doch leider ist über die Adenomyose längst noch nicht so viel bekannt wie über die Endometriose. Das liegt auch daran, dass man bei jungen Frauen die Gebärmutter nicht entfernt, sondern bei einer Bauchspiegelung schaut, ob Endometriose zu sehen ist. So wird die Gebärmutter häufig »vergessen«. Mit der Einführung der Bauchspiegelung ist der Fokus also stärker auf die Endometriose denn auf die Adenomyose gelegt worden. Somit hat sich die Forschung über viele Jahrzehnte auch nur um einen Teil der Endometriose-Erkrankung gekümmert.
Adenomyose dagegen wurde noch vor zehn bis 15 Jahren nur dann sicher diagnostiziert, wenn eine Gebärmutterentfernung durchgeführt wurde und eine feingewebliche Untersuchung erfolgte. Daher nahm man lange an, dass Adenomyose eher ein Problem von Frauen kurz vor den Wechseljahren ist – dem typischen Alter für eine Gebärmutterentfernung. Heute wissen wir, dass das falsch ist: Von jungen Frauen lagen einfach keine histologischen Daten vor! Zum Glück erlauben die modernen Untersuchungsmethoden mittels Ultraschall oder MRT (Magnetresonanztomografie) und eine zunehmend geschulte Wahrnehmung inzwischen eine relativ zuverlässige Diag-nose der Adenomyose. Adenomyose und Endometriose liegen in bis zu 80 Prozent aller Fälle in Kombination vor. Und das ist auch logisch, wenn man sich die Entstehung der Erkrankung genauer ansieht. Diese Erkenntnis hat sich allerdings erst in den letzten zehn Jahren durchgesetzt und findet leider international nicht überall die gleiche Beachtung, was ich persönlich sehr kritisch sehe. Für mich hat die Gebärmutter einen zentralen Stellenwert für das Verständnis dieser Erkrankung.
Subtypen der Endometriose und ihre Einteilung
Um die verschiedenen Endometriose-Formen besser zu verstehen, ist ein kleiner anatomischer Exkurs sinnvoll.
Gebärmutterschleimhautartiges Gewebe kann sich an den verschiedensten Stellen im Unterleib ansiedeln. So unterscheidet man Formen der Endometriose gemäß ihrer Ansiedlung und ihrer Ausprägung:
•außerhalb der Genitalorgane (Endometriosis genitalis externa),
•die diffuse und fokale Form der Adenomyose (Endometriosis genitalis interna),
•in andere Organe hineinwachsende, also tief infiltrierende Endometriose (TIE),
•sowie Endometriose-Herde an anderen Organen als den Genitalorganen (Endometriosis extragenitalis), etwa am Zwerchfell oder Nabel (können sowohl im Bauchraum als auch außerhalb des Bauchraums liegen).
Endometriose außerhalb der Genitalorgane
Bei der Endometriosis genitalis externa handelt es sich um Endometriose-Herde außerhalb der Genitalorgane. Dabei siedelt sich Endometriosegewebe vornehmlich auf dem Bauchfell (Peritoneum) im kleinen Becken an, entsprechend dem Rückfluss der Zellen aus der Gebärmutter durch die Eileiter. Die am häufigsten betroffenen Stellen sind die beiden Eierstockgruben (Fossa ovaricae), der Douglas-Raum, die sacrouterinen Bänder (Sacrouterinligamente, SUL), die die Gebärmutter mit dem Iliosakral-gelenk verbinden, und das Bauchfell auf der Blase (Blasenperitoneum).
Innerhalb des Bauchraums bilden sich durch den Halteapparat der Organe bedingt Kuhlen, in denen sich Flüssigkeiten sammeln, sodass Zellen dort »andocken« können, wie etwa an das Bauchfell. Dort können dann Bauchfellherde entstehen. Die Eierstöcke sind ebenfalls häufig betroffen. Sie hängen nämlich nicht frei in der Luft – es sei denn, es wird eine Bauchspiegelung durchgeführt –, sondern liegen an der Beckenwand an. Wenn sich Endometriose-Herde beispielsweise genau zwischen Beckenwand und Eierstock ansiedeln, kann es vorkommen, dass diese auch in den Eierstock einwandern. Dort können sich daraus Zysten bilden (von Endometriose ausgekleidete Räume, die aber dann in sich geschlossen sind). Da dieses Gewebe den hormonellen Abläufen unterliegt, kann es tatsächlich auch nach »innen« bluten und so sammelt sich eine altblutige Flüssigkeit an. Man nennt diese Zysten wegen der sehr dunklen Färbung des alten Blutes auch Schokoladenzysten. Die Größe dieser Zysten schwankt mit dem Zyklus. Sie werden tendenziell aber eher größer, weil sich mit der zunehmenden Zahl an Zyklen immer mehr Flüssigkeit anstaut. Darüber hinaus haben die gebärmutterschleimhautartigen Herde oft entzündliche Reaktionen zur Folge, die wiederum zu Verklebungen von Organen führen können.
Endometriose außerhalb der Gebärmutter ist die am häufigsten vorkommende Form der Endometriose. Nur sehr selten haben Frauen beispielsweise einen außerhalb des Bauchfells gelegenen Befund, der gar nichts mit dem Bauchraum zu tun hat.
Diffuse und fokale Formen der Adenomyose
Bei der Adenomyose (Endometriosis genitalis interna) kommt es zur Ansiedlung von Herden innerhalb der Gebärmuttermuskelwand, dabei unterscheiden wir diffuse und fokale Formen. Bei den diffusen Formen ist eine Gebärmutterwand asymmetrisch verdickt, manchmal auch beide Wände, und die Gebärmutter ist insgesamt vergrößert. Meist erscheint die Wand im Ultraschall inhomogen mit Streifen oder hellen Schleimhaut-Inseln und die innere Muskelschicht der Gebärmutterwand (Junktionalzone) ist auffällig. Es können sich aber auch kleine Zysten (mit Flüssigkeit gefüllte Bläschen) bilden, die verteilt vorliegen. Bei den fokalen Formen ist der Großteil der Gebärmutter ohne Befund und nur an einer Stelle der Muskelwand zeigt sich eine Raumforderung, die leicht mit einem Myom (gutartiger Muskelknoten der Gebärmutter) verwechselt werden kann.
Tief infiltrierende Endometriose (TIE)
Die tief ins Organgewebe eindringenden Formen der Endometriose sind zum Glück am seltensten. Bei etwa zehn Prozent der betroffenen Frauen kommt es jedoch vor, dass Endometriose-Herde die Organgrenzen nicht respektieren, sondern darüber hinaus auch in andere Organe hineinwachsen. TIE ist die gefährlichste Form der Endometriose: So kann sie beispielsweise durch die Verlegung des Harnleiters zu einem Nierenstau oder durch Verlegung des Darmlumens zu einem Darmverschluss führen. Das kommt zwar selten vor, sollte man aber immer im Hinterkopf behalten.
Am häufigsten sind die retrocervikale und die rektovaginale Endometriose. Diese wachsen vom inneren Gebärmutterhals (retrocervikal) und/oder von den sacrouterinen Bändern (rechts und links) oder auch mittig vom Douglas-Raum in die Tiefe (rektovaginal). Wenn sich gebärmutterschleimhautartiges Gewebe von dort ausbreitet, kann es sich weiter im sogenannten Septum rectovaginale, einem bindegewebigen Raum zwischen oberer Scheide und Darm, ansiedeln und dann im hinteren Scheidengewölbe sichtbar werden. Oder die Befunde wachsen von den sacrouterinen Bändern aus mehr seitlich und können dann die Harnleiter erreichen. Beide Formen der Endometriose können auch in die Darmwand hineinwachsen. Ebenso kann an der vorderen Seite der Gebärmutter eine Adenomyose auf die Blase übergehen und sich in der Blase ausbreiten. Hier spricht man von einer Blasenendometriose.
Bei tief infiltrierender Endometriose (TIE) besteht meist irgendwie eine Verbindung oder Berührung zur Gebärmutter. Sie ist, wie gesagt, das zentrale Organ bei dieser Erkrankung. Auch andere Stellen des Darms können betroffen sein, die nach meinen Beobachtungen aber auch immer Kontakt zur Gebärmutter haben. Häufig ist dann noch das Sigma betroffen, der nächste Darmabschnitt, der meist in einer Schlaufe im kleinen Becken liegt und Kontakt zur Gebärmutter haben kann, oder auch der Coecalpol (der Beginn des Dickdarmes auf der rechten Bauchseite) und der Blinddarm selbst. Die anderen Darmabschnitte sind eher selten betroffen.
Endometriose außerhalb des Bauchraums
Der Begriff extragenitale Endometriose beschreibt Endometriose-Herde, die sich nicht im Bereich der inneren Geschlechtsorgane manifestieren, sondern sich außerhalb des kleinen Beckens angesiedelt haben. Sie können zwar auch klein und oberflächlich sein, dringen leider jedoch meist tief ins Gewebe des betroffenen Organs ein.
So können sich Zellen auch weiter oben im Bauchraum ansiedeln, weil die Bauchfellflüssigkeit aufgrund der Atmung und des sich hebenden und senkenden Zwerchfells einer inneren Fließrichtung folgt. Typisch sind solche Herde in der Rinne zwischen aufsteigendem Dickdarm und Bauchwand sowie in der rechten Zwerchfellkuppel. Links können auch Herde vorkommen, doch sind sie dort selten. Die Gebärmutter ist außerdem über das innere Mutterband mit der Leiste verbunden. Frauen spüren dieses Band vor allem bei Schwangerschaften, wenn sich die Gebärmutter aufrichtet und es zu ziehenden Schmerzen bis in die Schamlippen kommt. Auch entlang des Leistenbandes können sich Endometriose-Herde ausbreiten, das ist aber wirklich selten – bei 20.000 Fällen in der Charité kam das bisher dreimal vor. Auch die primäre Nabelendometriose ist selten: Bei 20.000 Fällen in der Charité kam sie bisher 15-mal vor. Die Bauchdeckenendometriose wiederum ist etwas häufiger (bei 20.000 Charité-Fällen kam sie etwa 50-mal vor), als Folge von Operationen durch verschlepptes Endometriose-Gewebe (verloren in der Bauchdecke) oder nach einem Kaiserschnitt durch das Öffnen der Gebärmutter.
Endometriose kann auch im Lungengewebe vorkommen, das ist zum Glück jedoch ausgesprochen selten (bei 20.000 Charité-Fällen kam das bisher dreimal vor). Absolute Raritäten sind Beschreibungen von zyklischem Nasenbluten, Endometriose-Herden im Gehirn, in den Augen, in den Gelenken und so weiter – ich persönlich kenne nicht einen solchen Fall (sondern nur aus der internationalen Literatur).
Verschiedene Klassifikationssysteme
Die Art und die Ausdehnung der Endometriose werden zur besseren klinischen Unterscheidung mithilfe verschiedener Klassifikationssysteme eingeteilt. Die wichtigsten werden im Folgenden vorgestellt. Die Klassifikation der American Society for Reproductive Medicine (ASRM) wurde nach einer Überarbeitung aktualisiert und ist als rASRM-Klassifikation international anerkannt. Sie beschreibt jedoch nur die Endometriose im Bauchraum (Endometriosis genitalis externa), und zwar nach folgenden Kriterien:
•Ausdehnung der Läsionen in cm² auf dem Bauchfell
•Sind die Herde oberflächlich oder tiefer als fünf Millimeter ins Gewebe eingewachsen?
•Die Eierstöcke sind gesondert zu betrachten: Sind die Herde oberflächlich oder
tiefer (das wären dann Zysten)?
•Beschreibung der Verklebungen (zart oder dicht, mehr als ⅓, ⅔ oder ³∕₃ der Ovarloge
einnehmend; Fossa ovarica, da, wo der Eierstock an der Beckenwand anliegt)
•Ist der Douglas-Raum verlötet oder nicht?
•Sind die Eileiter offen?
Entsprechend der Untersuchungsergebnisse werden Punkte vergeben, aus denen sich der Score errechnet. Es gibt vier Stadien: I bis IV. Man kann grob sagen, dass bei rASRM I und II Bauchfellherde führend sind, eventuell können zusätzlich kleine Endometriome (Zysten) vorkommen oder minimale Verklebungen. Beim Stadium III bis IV liegen meist ausgedehnte Verklebungen und auch Zysten vor. Jede Zyste ab drei Zentimetern Größe verlangt automatisch nach einem Punktescore des Stadiums III. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass bei Stadium III und IV durch die Zysten und Verklebungen die Anatomie stärker verändert ist und sich die Chance für eine natürliche Befruchtung verschlechtert.
Diese Einteilung nach Stadien ist in jedem Fall hilfreich für die Einschätzung der Situation, aber sie hat definitiv ihre Grenzen, denn sie lässt die Adenomyose und die tief infiltrierenden Herde völlig unberücksichtigt. Von manchen tief ins Organgewebe eindringenden Endometriose-Herden sieht man bei einer Bauchspiegelung förmlich nur »die Spitze des Eisbergs«.
Daraus ergab sich die Notwendigkeit, einen weiteren Score zu entwickeln, der die »anderen« Endometriose-Herde mit berücksichtigt: die ENZIAN-Klassifikation. Darin werden die Adenomyose (FA), die Blasenendometriose (FB), die rektovaginale Endometriose mit Scheidenbefund (A1, A2, A3), mit SUL-Betroffenheit (B1, B2, B3) und Darminfiltration (C1, C2, C3) beschrieben. Die Ziffern 1 bis 3 stehen dabei für die Größe der Herde in Zentimetern (< 1 cm, 1–3 cm und > 3 cm). Auch andere Darmbefunde (Sigma, Coecalpol oder Blinddarm) (FI) sowie komplett außerhalb des kleinen Beckens liegende Herde (Zwerchfell, Leiste, Nabel) (FO) können so erfasst werden. Zieht man die ENZIAN-Klassifikation nun zur rASRM-Klassifikation hinzu, ergibt sich ein viel genaueres Bild der jeweils individuellen Situation.
Es hat sich eingebürgert, dass Endometriose-Zentren beide Klassifikationen anwenden, um das Ausmaß einer Endometriose möglichst genau zu beschreiben. Daran können Patientinnen übrigens auch erkennen, ob eine Klinik tatsächlich die Expertise besitzt, Endometriose zu beurteilen, oder eher nicht. Da dies aber sehr aufwendig ist, hat die Arbeitsgruppe um Prof. Jörg Keckstein die #ENZIAN-Klassifikation entwickelt, einen einzelnen Score, der das gesamte Ausmaß einer Endometriose beschreiben soll. Dementsprechend ist der Score allerdings auch ziemlich komplex.
Wie es zu Fehleinschätzungen kommt
Wer nicht auf Endometriose spezialisiert ist, verkennt oft das Ausmaß des vorliegenden Befundes. Denn es entsteht ein völlig falscher Eindruck,wenn man einen tiefer als fünf Millimeter wachsenden Endometriose-Herd am sacrouterinen Band nur mit einem rASRM-II-Score versieht, der aber in Wirklichkeit so tief wächst, dass er einen zwei oder drei Zentimeter großen Knoten ergibt. Daher ist jahrelang mittels der rASRM-Klassifikation ein Score vergeben worden, der nicht das ganze Ausmaß einer Endometriose erkennt, aber auf dem basierend viel Forschung und OP-Erfolge beurteilt wurden. So kommt es häufig vor, dass ein Score überhaupt nicht mit dem Ausmaß der Beschwerden in Zusammenhang steht.
Zellen auf Abwegen:Wie kommt das da hin?
Wie es zu den Ansiedelungen von gebärmutterschleimhautartigem Gewebe außerhalb der Gebärmutter kommen kann, ist nach wie vor nicht endgültig geklärt. Dazu gibt es in der Medizin unterschiedliche Theorien. Es folgt ein Überblick über den Stand der aktuellen wissenschaftlichen Diskussion.
Rückwärtslaufende Menstruationsblutung
So vermutete der US-amerikanische Gynäkologe John Sampson bereits 1927,10 dass Endometriose durch eine rückwärtslaufende (retrograde) Menstruation zustande kommt, wodurch abgeschilferte Gebärmutterschleimhaut mit der Regelblutung über die Eileiter in den Bauchraum fließt und sich dort ansiedelt. Die typischen Stellen, an denen sich Endometriose-Herde ansiedeln – auf dem Bauchfell, in den Eierstockgruben (Fossa ovaricae), im Douglas-Raum, den Sacrouterinligamenten oder dem Blasendach –, stützen diese Theorie.
Vermutlich kommt es in den physiologischen Vertiefungen zu Flüssigkeitsansammlungen mit Anreicherung von Zellen, die dann »adhärieren und anwachsen«. Solche Herde sind meist oberflächlich. Sie können aber auch tiefer ins Gewebe einwachsen, an manchen Stellen tiefer als fünf Millimeter, und tief infiltrierende Endometriose (TIE) verursachen. Warum manche Endometriose-Herde so aggressiv tief einwachsen, während andere nur oberflächlich bleiben, ist bislang noch völlig ungeklärt.
Was gegen diese Theorie spricht: Eine retrograde Menstruation kommt bei vielen Frauen vor, dennoch haben nur zehn bis 15 Prozent während ihrer reproduktiven Lebensphase Endometriose. Außerdem besteht die abgeschilferte Schleimhaut (die oberflächliche funktionelle Schicht) überwiegend aus abgestorbenen Zellen, deshalb ist eine Neuansiedlung eher unwahrscheinlich.
Daher müssen noch andere Faktoren eine Rolle spielen, wie etwa das Immun-system und die Art der Zellen, die aus der Gebärmutter abwandern.
Metaplasietheorie
Die Metaplasietheorie des deutschen Pathologen Robert Meyer (1921) befasst sich mit der Annahme, dass die Endometriose-Herde durch den Umbau bestimmter Reste embryonaler Strukturen entstehen.11 Sie könnte das Auftreten von tief infiltrierender Endometriose (TIE) erklären, die hinter dem Bauchfell liegt. Demnach wird die Reaktivierung von Coelomzellen (Rückständen der sogenannten Müllerschen Gänge, aus denen sich embryonalgeschichtlich die Genitalorgane entwickeln) vermutet, die sich dann hormonabhängig fortentwickeln und zu Endometriose-Herden werden können.
Basierend auf einer Reaktivierung solcher Coelomresiduen, die infolge eines physiologischen Nabelbruchs (während der Embryonalentwicklung) im Nabel verblieben sind, kann vielleicht das Auftreten einer primären Nabelendometriose erklärt werden.12
Weitere Faktoren
Weiterhin können das Andocken verlagerter Zellen und die Entwicklung von Endometriose-Herden auch durch lokale Faktoren des Bauchfells selbst begünstigt sein.13 Außerdem scheint das Immunsystem eine Toleranz gegenüber diesen Zellen zu entwickeln, obwohl die Herde von einer immunologischen Reaktion mit Entzündung umgeben sind.14 Diese Entzündung spiegelt sich auch in der Peritonealflüssigkeit wider,15 die vom Bauchfell abgegeben und wieder aufgenommen wird. Diese Flüssigkeit verfügt normalerweise über entzündungshemmende Eigenschaften und schützt die Bauchorgane gegeneinander, indem sie für Gleitfähigkeit sorgt. Die Verteilung von Endometriose-Herden des Bauchfells im Bauchraum folgt darüber hinaus dem zirkulären Fluss der Peritonealflüssigkeit, sodass Endometriose-Herde auch häufiger im Bereich der rechten paracolischen Rinne und Zwerchfellkuppel zu finden sind.
Tief infiltrierende Endometriose (TIE) am Darm scheint sich aufgrund von Abklatschabsiedlungen zu entwickeln, denn diese betreffen fast immer Teile des Darms mit potenziellem Kontakt zu den inneren Geschlechtsorganen, während der aufsteigende und der absteigende Teil des Dickdarms sowie das Quercolon eigentlich nie von Läsionen betroffen sind.16
Verletzungen der Junktionalzone
Mit ihrem »Tissue Injury and Repair«-Konzept (TIAR) beschreiben Gerhard Leyendecker und Ludwig Wildt die Gebärmutter als Ursprung der Erkrankung.17 Demnach führen abnorm gesteigerte und heftige Muskelkontraktionen während der Blutung (uterine Hyperperistaltik) zu zunächst geringfügigen Verletzungen in der Junktionalzone, der inneren Hälfte der Gebärmuttermuskulatur.18 Dadurch freigesetzte Mediatoren regen daraufhin die Bildung des Enzyms Aromatase an, das Östrogen bilden kann. Das lokal freigesetzte Östrogen fördert das Wachstum von Zellen und die Bildung neuer Blutgefäße. Dadurch verändert sich die Junktionalzone: Bei einer Ultraschalluntersuchung erkennt man einen echoarmen Saum, der am Endometrium anliegt, und im 3-D-Ultraschall variabel veränderte Formen.19 Der noch neue Fachbegriff Archimetrose beschreibt diese frühe Veränderung.20 Lokal freigesetztes Oxytocin wiederum verstärkt die lokale Peristaltik und setzt einen Kreislauf in Gang, der die Junktionalzone zunehmend zerstört.21 Vermutlich werden im Rahmen der mechanischen Veränderung und der Wundheilungsprozesse Stammzellen aktiviert, die dann ihre Nische verlassen und entweder durch rückwärtslaufende Menstruationsblutungen in den Bauchraum gelangen und dort Endometriose-Herde verursachen oder in die Muskelschicht der Gebärmutterwand (Myometrium) eindringen und zur Adenomyose führen.22
Auch das Immunsystem ist betroffen – oder beteiligt?
Mit diesen zugewanderten Endometriose-Herden gehen umfangreiche immunologische Veränderungen einher.23 Wir wissen bisher nicht, ob primär das Immunsystem einen Defekt aufweist und die ortsfremden Zellen nicht abbauen kann oder die Gebärmutterzellen, die sich an Orten angesiedelt haben, an denen sie normalerweise nicht vorkommen, das Immunsystem verändern. Fest steht aber, dass umfangreiche entzündliche Reaktionen und mannigfaltige immunologische Veränderungen sowohl im Bauchfell als auch in der Peritonealflüssigkeit nachweisbar sind.24 Dies wird inzwischen mit dem Vorkommen entsprechender Endometriose-Herde in Verbindung gebracht, und den chronischen Entzündungen wird immer mehr Bedeutung bei der Entstehung und dem Verlauf der Endometriose zugesprochen.
Glatte Muskelzellen – Mini-Gebärmütter
Zur Stammzelltheorie passt auch die Tatsache, dass Endometriose-Läsionen, egal, wo sie zu finden sind – in peritonealen Herden, Endometriomen oder TIE oder auch in extragenitalen Manifestationen wie Nabel-, Bauchdecken- oder Leistenendometriose –, nicht nur aus Epithel- und Stromazellen, sondern immer auch aus glatten Muskelzellen bestehen, die typische Merkmale der Gebärmuttermuskulatur aufweisen (Vorkommen von Oxytocin- und Vasopression-Rezeptoren als auch Östrogen- und Progesteron-Rezeptoren).25Somit handelt es sich bei den Endometriose-Herden nicht nur um gebärmutterschleimhautartige Absiedlungen, sondern um Miniatur-Gebärmütter. Die glatten Muskelzellen liegen in unterschiedlichen Reifungsstadien vor. Manche sind noch unreif, andere voll ausdifferenziert, sodass der Prozess der Muskelneubildung den Ursprung der Herde aus pluripotenten, also undifferenzierten Stammzellen unterstreicht.26 Dabei kommt es zur Fibroblasten-zu-Myofibroblasten-Transformation (FMT), das heißt, Bindegewebszellen werden in Muskelbindegewebszellen umgewandelt. Diese Zellen setzen dann auch Kollagen Typ I frei, wodurch die Herde noch mehr Substanz erhalten und sich weiter formieren, also auch Knoten oder narbige Anteile entstehen können.27 Fibrotisch/narbig umgewandeltes Gewebe findet sich im Zusammenhang mit Endometriose-Herden immer. Ob dies reaktiv vom Umfeld getriggert oder aus den Läsionen heraus entsteht, ist Gegenstand aktueller Forschung.
Besonderes einleuchtend finde ich etwa das Auftreten der Bauchdeckenendometriose nach einem Kaiserschnitt. Bei dieser Operation wird die Gebärmutter eröffnet, um das Kind zu holen. Anschließend wird die Gebärmutter Schicht für Schicht wieder vernäht. Dabei können mikroskopisch kleine Stammzellen in die Bauchdecke verschleppt werden – das kann man quasi nicht verhindern –, wodurch sich dort hormonaktives Gewebe ansiedeln und entwickeln kann. Die betroffenen Frauen spüren einen Knoten in der Bauchdecke, der zyklisch schmerzt und anschwillt. Da auch diese Knoten aus allen drei Zelltypen bestehen – Epithel-, Stroma- und Muskelzellen –, scheint mir bewiesen, dass es sich um pluripotente Zellen (Stammzellen) handeln muss, denn einfache Schleimhautzellen könnten keine glatten Muskelzellen bilden.
Beteiligung der Lymphbahnen und Blutgefäße
Eine weitere Theorie befasste sich mit der Vermutung, dass Zellen über die Lymphbahnen und die Blutgefäße aus der Gebärmutter abfließen und sich verteilen könnten.28 Lange Zeit gab es dazu keine neuen Erkenntnisse, bis man dann, im Rahmen von Operationen aufgrund von rektovaginaler Endometriose, bei denen Teile des Darms entfernt werden mussten, in zufällig entnommenen Lymphknoten Endometriose-Herde nachweisen konnte.29 Eine Studie, die wir an der Charité mit Sentinel-lymphknotenmarkierung bei rektovaginaler Endometriose durchgeführt haben, konnte dann das Vorkommen von Endometriose-Herden in markierten Lymphknoten belegen.30 Da das Vorkommen dieser Läsionen in wechselseitiger Beziehung zur Größe der primären rektovaginalen Läsionen stand und auch ein ausgedehntes Wachstum neuer Lymphgefäße nachweisbar war, scheint auch dieser Weg der Krankheitsentstehung belegt.31 Die klinische Bedeutung von Lymphknotenendometriose ist zwar unklar, spiegelt aber wahrscheinlich ein Defizit des Immunsystems wider und zeigt, dass Endometriose auch als eine den gesamten Organismus betreffende, also systemische Erkrankung bewertet werden muss.
Die genetische Komponente
Die Gene scheinen bei der Endometriose ebenfalls eine nicht unerhebliche Rolle zu spielen: So tritt die Erkrankung innerhalb einer Familie auffällig gehäuft auf. Ist die Tochter betroffen, so hatten nicht selten auch die Mutter und die Großmutter mit dem Problem zu kämpfen. Das spricht entscheidend für eine genetische (vererbte) Komponente. Auch eine Beeinflussung der Genese durch eine intrauterine Prägung bei möglicherweise verminderten Testosteronspiegeln der Embryonen wird diskutiert.32
Ein anderer wichtiger Faktor ist, dass die Funktion von Genen auch durch äußere Einflüsse verändert werden kann. So können Gene an- oder abgeschaltet werden und so entscheidend individuell agieren. Das nennt man epigenetische Modulation der Gene. Dieses Phänomen wurde lange vernachlässigt, scheint aber ebenfalls ein wesentlicher Faktor im Geschehen zu sein: So wirken auch Umwelteinflüsse wie etwa Dioxin oder Stress auf die Gene ein.33 Ein Einfluss auf die Endometriose-Entstehung sowie den Verlauf dieser Krankheit scheint gesichert34 und erklärt auch die Vielfalt der Endometriose-Arten.
Die Gebärmutter – ein Muskel, der Höchstleistungen vollbringt
Bestechend ist die Überlegung, die Prof. Dr. Gerhard Leyendecker 2019 publizierte, nach der Gebärmütter mit starkem Muskelkontraktionsvermögen durchaus Vorteile haben können, die sich über die Jahrtausende evolutionsbedingt durchgesetzt haben.
Die Gebärmutter ist ein ganz besonderes Hohlorgan: ein Muskel, der autonom, das heißt unabhängig von unserem Bewusstsein, arbeitet – wie auch unser Herz oder die Darmmuskulatur. Die Funktionen dieses Wunderorgans sind wahrscheinlich viel differenzierter, wenngleich vieles noch im Dunkeln liegt.
Fakt ist, die Gebärmutter muss in verschiedenen Lebensphasen ganz unterschiedlich funktionieren: Zur Zeit der Abbruchblutung müssen die Zellreste der Gebärmutterschleimhaut raus aus der Gebärmutter (Menstruation), zur Zeit des Eisprungs müssen die Spermien rein, und zwar genau in den Eileiter, in dem das befruchtungsfähige Ei wartet (gerichteter Spermientransport), zur Zeit einer Schwangerschaft muss die Gebärmutter ruhig sein, um die Schwangerschaft ungestört auszutragen. Jetzt heißt es, bloß nicht hysterisch werden und vorzeitige Wehen provozieren. Und dann das große Finale: die Geburt. Das Kind muss raus, deshalb sind jetzt heftigste Muskelkontraktionen (Wehen) zu vollführen – oft über Stunden. Ist das vollbracht, müssen die offenen Gefäße, die nach der Ablösung des Mutterkuchens zurückgeblieben sind, ebenfalls mittels Muskelkraft verschlossen werden.
Dies alles schafft die Gebärmutter, weil sie unterschiedliche Muskelanteile hat: zum einen die Archimetra, die aus Endometrium und angrenzendem Myometrium besteht. Sie macht kleinste subtile Bewegungen, die wir eigentlich nicht spüren sollten. Betrachtet man die Gebärmutter im Ultraschall über längere Zeit, kann man bei manchen Frauen peristaltische Wellen beobachten. Zum anderen die Neometra, die dickere Muskelschicht drum herum, die für die Wehentätigkeit verantwortlich ist. Diese findet sich nur bei höher entwickelten Primaten in der Gebärmutter.
Eine gut funktionierende Gebärmutter war überlebenswichtig
Um 1800 lag die durchschnittliche Lebenserwartung weltweit bei 30, maximal 35 Jahren.35 Kein Wunder also, dass Mädchen bereits ab der Geschlechtsreife ihrer biologischen Bestimmung als Frau nachkamen, der Reproduktion – auch wenn uns das heute unvorstellbar scheint. Bereits im Teenageralter wurden unsere Vorfahrinnen schwanger und bekamen Babys. Bis vor 100 Jahren waren jedoch auch die Säuglingssterblichkeit und das Risiko der Frauen, bei der Geburt oder danach zu sterben (Kindbettfieber) besonders hoch. Eine »gut funktionierende« Gebärmutter hatte sicherlich seit jeher erhebliche Überlebensvorteile: erfolgreiche Schwangerschaft, erfolgreiche Austreibung des Kindes und erfolgreiche Nachgeburtsperiode. Ohne die medizinischen Möglichkeiten von heute bedeuteten Geburtsstillstand und Blutungen den sicheren Tod der Frauen. Möglicherweise hatten also Frauen mit »hyperaktiven« Gebärmüttern einen Evolutionsvorteil: Sie bekamen im Laufe ihres Lebens mehr Nachfahren und konnten ihre Gene erfolgreich weitergegeben – und damit auch die Erbinformation der hyperkontraktilen Gebärmutter. Eine mögliche Erklärung für die hohen Endometriose-Fallzahlen.
Außerdem hatten unsere Vorfahrinnen sicher nicht so viele Regelblutungen wie die Frauen von heute: Häufige Schwangerschaften und längere Stillzeiten reduzierten schon mal die Anzahl der Zyklen. Dazu kamen eventuell eine karge Ernährung, Untergewicht, harte körperliche Arbeit, Wanderschaften und Kriege – also Lebensumstände, die zu Stress geführt haben und damit zu Amenorrhoe.
Späte Schwangerschaften und viele Regelblutungen
Heute leben die meisten Frauen (in unserem Kulturkreis) frei und selbstbestimmt: Erst wenn Schule und Ausbildung oder Studium beendet sind und die ersten Karriereschritte absolviert wurden, ist für viele Frauen der richtige Zeitpunkt für eine Schwangerschaft gekommen – die Geburtenkontrolle macht’s möglich. So wird die Geburt des ersten Kindes immer weiter nach hinten verschoben. Seit 1970 ist das Durchschnittsalter der Frauen bei der Geburt des ersten Kindes kontinuierlich gestiegen. Haben die Frauen in den 1970er-Jahren ihre Kinder noch um das 20. Lebensjahr herum bekommen, waren sie 2018 bei der Geburt des ersten Kindes im Schnitt bereits 30 Jahre alt.36 Das bedeutet aber, dass eine 30-jährige Frau, die schwanger werden will, bereits seit etwa 15 bis 20 Jahren ihre Regel hat. Sie hatte also im Schnitt 200-mal ihre Menstruation, bevor ihre Gebärmutter erstmals durch eine Schwangerschaft zum Einsatz kommt.
Doch leider spielt die Anzahl der Regelblutungen bei der Entwicklung der Endometriose eine große Rolle. Eine hyperaktive Gebärmutter gibt heutzutage im Schnitt 20 Jahre lang Monat für Monat alles! Leider ergeben sich daraus Nachteile für Frauen, die diese Veranlagung haben. Was früher ein Vorteil war, birgt inzwischen das Risiko, eine Endometriose zu entwickeln. Zumindest könnte das eine Erklärung für die zunehmende Zahl an Endometriose-Fällen sein. Beweise gibt es dafür nicht, aber logisch erscheint es allemal.
Warum erkläre ich das: Natürlich bin ich für Geburtenkontrolle, und auch ich möchte nicht, dass Teenager schwanger werden. Frauen sollen ihr Leben so leben können, wie sie es wollen. Ein Recht, das unsere Mütter und Großmütter für uns erkämpft haben – und das wir bis heute immer wieder verteidigen müssen. Aber ich möchte auch, dass Frauen überhaupt schwanger werden können – auch mit Endometriose. Und ich will auf gar keinen Fall, dass Frauen unter ihrer Regelblutung und den Schmerzen mit Endometriose so sehr leiden.
Die hyperaktive Gebärmutter
Eine Gebärmutter, die die Veranlagung der Hyperperistaltik mit hohen intrauterinen Drücken hat, birgt auch das Risiko, dass es zur Mikrotraumatisierung der Übergangszone von Gebärmutterschleimhaut und Gebärmuttermuskulatur (Junktionalzone) kommt. Die Gebärmutter ist anders aufgebaut als der Darm. Sie verfügt nicht über eine Verschiebeschicht zwischen der Schleimhaut und der Muskulatur, sodass die Scherkräfte direkt wirken können. Auf diese Weise kann ein Prozess der Autotraumatisierung mit Hochregulation der Wundheilungsprozesse (Entzündungen) in Gang gesetzt werden, die dann peu à peu die Junktionalzone verändern, wodurch Archimetrose entsteht.37 Ab wann das Risiko der Aktivierung von uterinen Stammzellen besteht, ist bisher nicht bekannt, denn leider haben wir keine Möglichkeit, die Gebärmutter genau auf diese Mechanismen hin zu untersuchen, denn die befindet sich unantastbar im Körper der Frau verborgen.
Stadien der Endometriose
Das große Problem bei dieser Krankheit ist, dass sie von den betroffenen Frauen zunächst nur »gefühlt« werden kann.
Erst nachdem die Krankheit schon weit fortgeschritten ist, können wir Veränderungen im Gewebe erkennen und nachweisen. Doch bis dahin haben die Frauen bereits einen langen und schmerzvollen Leidensweg hinter sich.
Etwa 90 Prozent der Frauen, die später eine Endometriose bekommen, hatten bereits bei der ersten Regelblutung Schmerzen (primäre Dysmenorrhoe). Zu diesem frühen Zeitpunkt ist die Erkrankung noch nicht sichtbar und zunächst »nur« durch extrem starke Regelschmerzen charakterisiert (biochemische Ebene). Erst im Lauf der Zeit kommt es zu Veränderungen auf zellulärer Ebene: Jetzt finden Umbauprozesse in der Gebärmutter statt, genauer in der Übergangszone von Gebärmutterschleimhaut (Endometrium) und Gebärmuttermuskulatur (Myometrium), also der Junktionalzone. Daraus entwickelt sich eine Archimetrose, die später dann zur Adenomyose und letztlich zur Endometriose führen kann.
Man kann sich das wie ein ganz schwaches Erdbeben vorstellen, bei dem mikroskopisch kleine, quasi nicht sichtbare Risse im Gewebe entstehen. Was zunächst harmlos ist, führt mit der Zeit dazu, dass sich die Architektur des Gewebes der Junktionalzone verändert und aufbricht. Jetzt erst können wir die Gewebsveränderungen im 3-D-Ultraschall sehen. Wenn dann auch noch aktivierte Stammzellen in die Tiefe der Gebärmuttermuskulatur abwandern – aufgrund der Risse können sie das –, kommt es auch dort zur Ansiedlung von Endometriose-Herden. Jetzt können wir verdickte Mus-kelwände der Gebärmutter erkennen.
In dieser frühen Phase können bereits starke Regelschmerzen bestehen, ohne dass man per 3-D-Ultraschall sichtbare Veränderungen in der Gebärmutter sehen können muss. Übrigens muss es gar nicht jeden Monat zu starken Schmerzen kommen, denn das Ganze ist sehr abhängig davon, ob es eine Ovulation gab, also ob ein Eisprung stattgefunden hat. Denn nur dann erfolgt eine wirkliche Abbruchblutung, die dann typischerweise auch schmerzhaft ist. Zyklen ohne Eisprung können mit einer schmerzfreien Blutung einhergehen. Das irritiert viele junge Frauen, ist damit aber einfach zu erklären. Manche meiner Patientinnen entschuldigen sich regelrecht dafür, dass sie nicht immer diese schlimmen Schmerzen haben. Nicht nötig, ich glaube euch trotzdem!
Wehret den Anfängen
Eine hyperaktive Gebärmutter mit einer gestörten Peristaltik erhöht das Risiko für die Entwicklung einer Adenomyose und einer Endometriose.
Neuere wissenschaftliche Untersuchungen belegen darüber hinaus, dass beim unerfüllten Kinderwunsch sehr oft eine Adenomyose im Spiel ist. Andere Studien belegen, dass verdickte Gebärmutterwände das Risiko für eine Fehlgeburt erhöhen. Das müsste möglicherweise alles nicht sein, wenn bereits die Dysmenorrhoe frühzeitig ernst genommen und behandelt werden würde. Sehr wahrscheinlich ließe sich so der Prozess einer Adenomyose- beziehungsweise Endometriose-Entwicklung verhindern (frühe sekundäre Prävention). Es gibt dazu leider bisher keine wissenschaftlichen Daten, doch liegen uns mehr und mehr Daten von Jugendlichen mit Adenomyose vor: Im Endometriose-Zentrum der Charité betreuen wir über 300 Mädchen, die eindeutig Adenomyose haben, und nicht wenige auch schon mit der Diagnose Endometriose.