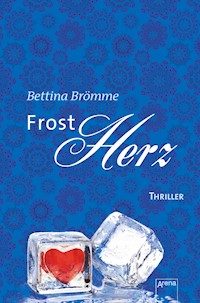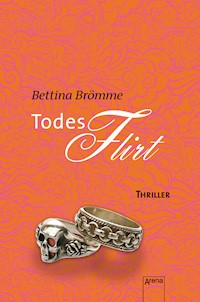7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Arena
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Melina ist auf der Suche nach ihrem Bruder Heiko, seit drei Jahren ist er verschwunden. Auf dem Hof einer religiösen Sekte findet sie ihn wieder, aber er scheint sie nicht mehr zu erkennen. Dann geschieht ein schrecklicher Mord an einer jungen Frau, der Heiko angelastet wird. Denn die Tote war Heikos geheime Freundin - eine verbotene Liebe innerhalb der Sekte. Melina glaubt an die Unschuld ihres Bruders. Doch jemand aus der Gemeinschaft will mit allen Mitteln verhindern, dass die Wahrheit ans Licht kommt ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 334
Ähnliche
Bettina Brömme
Engelmord
Weitere Titel in dieser Reihe:
Tamina Berger: Engelsträne Tamina Berger: Frostengel Ulrike Bliefert: Eisrosensommer Ulrike Bliefert: Lügenengel Ulrike Bliefert: Schattenherz Juliane Breinl: Perlentod Juliane Breinl: Feentod Bettina Brömme: Rachekuss Bettina Brömme: Todesflirt Bettina Brömme: Frostherz Beatrix Gurian: Prinzentod Beatrix Gurian: Höllenflirt Beatrix Gurian: Liebesfluch Beatrix Gurian: Lügenherz Zara Kavka: Giftkuss Zara Kavka: Höllenprinz Agnes Kottmann: Hassblüte Krystyna Kuhn: Schneewittchenfalle Krystyna Kuhn: Märchenmord Krystyna Kuhn: Dornröschengift Krystyna Kuhn: Aschenputtelfluch Kathrin Lange: Schattenflügel Kathrin Lange: Septembermädchen Inge Löhnig: Schattenkuss Inge Löhnig: Scherbenparadies
1. Auflage 2014 © Arena Verlag GmbH, Würzburg 2014 Alle Rechte vorbehalten Einbandgestaltung: Frauke Schneider ISBN 978-3-401-80230-5
www.arena-verlag.dewww.arena-thriller.defacebook.com/arenathriller
Inhaltsverzeichnis
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
Epilog
Prolog
Etwa drei Wochen nach meiner Geburt warf mein Bruder ein langes, brennendes Streichholz in meine Wiege. Er war kurz davor fünf geworden und fand es nicht lustig, vom Thron gestoßen worden zu sein. Noch bevor meine Mutter die brennende Wolldecke löschte, gab sie ihm eine Ohrfeige. Er weinte nicht einmal, als er aus dem Zimmer lief, wie später gerne erzählt wurde.
Mein Bruder hatte nach meiner Geburt intuitiv begriffen, dass sein bisheriges Leben ein Ende haben würde. Er musste die Liebe meiner Eltern nicht mit mir teilen, er musste sie an mich abgeben. Nicht ganz, aber den allergrößten Teil davon. Es sprach für seinen Charakter, dass er schnell lernte, dies nicht mir anzulasten, und stattdessen begann, mich zu lieben. Seinen Schmerz lebte er an anderer Stelle aus.
Natürlich stritten wir uns wie alle Geschwister in den folgenden Jahren fast täglich, aber aufs Ganze gesehen, hätte er für mich sein Leben gegeben. Ich habe das lange Zeit weder verstanden noch zu schätzen gewusst. Als ich es begriff, war es zu spät. Und meine Schuld zu groß.
Es war so selbstverständlich, dass er für mich da war. Immer. Bis vor knapp drei Jahren. Erst teilte er nicht mehr unser Leben. Dann war er ganz fort. Seit einem Jahr, neun Monaten und siebzehn Tagen weiß keiner, wohin er gegangen ist. Nur ein Zettel liegt noch immer auf seinem Schreibtisch: Sucht mich nicht. Es lohnt nicht.
Die zartrosa Wolldecke mit den Brandlöchern, die sogenannte »Brandlochdecke«, gibt es noch heute. Wenn die Sehnsucht nach meinem Bruder mich zu übermannen droht, dann lege ich sie über mein Kopfkissen und versuche, den Geruch unserer Vergangenheit in mich einzusaugen.
1. Kapitel
Die Landschaft sieht aus wie aus dem Ferienkatalog. Wälder und Weiden wechseln einander ab, auf kleine Hügel folgen sanfte Täler, die Blätter an den Bäumen nehmen das dunkle Grün des Hochsommers an. Durch die Busscheiben hindurch, meine ich, das Summen von Bienen, das Brummen von Käfern hören zu können. Mir ist warm, mein Top klebt am Rücken und ich habe Durst. Und doch spüre ich eine Art Hochgefühl wie seit Jahren nicht. Ich werde ihn sehen. Hoffe ich. Gestern Abend habe ich noch kurz meine Mutter besucht und mich von ihr verabschiedet. Es schien, als ob sie ganz froh sei, dass ich eine Zeit lang versorgt bin. Ich habe ihr nicht so genau erklärt, was ich vorhabe, sie hat sich auch nicht dafür interessiert. Ich bin froh, dass sie heute in die Psychatrie verlegt wird. Körperlich geht es ihr schon wieder ganz gut. Wie lange ihre Seele brauchen wird, um zu heilen, kann niemand sagen. Ich habe ihr von dem bunten Origamipapier mitgebracht, damit sie weiter Kraniche falten kann. Vielleicht beruhigt sie das ein bisschen.
Auf der Zugfahrt hatte ich Zeit, mir eine Geschichte zurechtzulegen. Ich werde nicht um einen Praktikumsplatz bitten, ich kann mir nicht vorstellen, dass es dort so etwas gibt, und es würde Fragen aufwerfen nach meiner Herkunft, meinem Namen, würde Formalitäten nach sich ziehen. Und ich will nicht sofort als Heikos Schwester erkannt werden. Wer weiß, wie seine – tja, was? Mitbewohner? Genossen? Brüder und Schwestern? – darauf reagieren würden. Je weniger Fragen, desto besser. Ich werde also mit einer rührseligen Geschichte ankommen, dass meine Eltern mich nicht verstehen, dass ich mich zu Gott hinwenden will, dass ich ein Leben führen will, das naturverbunden und echt ist. Klingt ganz gut, wie ich finde. Und auf ihrer Homepage stand doch: Du brauchst uns? Wir sind für dich da. Ich hoffe nur, dass sie mich nicht löchern werden und mir meine angebliche Motivation zerfleddern. Und dann werde ich in einem stillen Moment meinen Bruder schnappen und ihm alles erzählen, was passiert ist, seit er von zu Hause fort ist. Ihm klarmachen, dass er zurückkommen muss, dass wir ohne ihn nicht zurechtkommen. Was er seiner Mutter angetan hat. Dass sie nur seinetwegen all die Tabletten genommen hat. Ich bin sicher, das erträgt er nicht. Er muss, er wird mit mir nach Hause kommen. Die Sonne, die durch die Fenster scheint, breitet sich wie warmer Grießbrei in meinem Bauch aus. Ich möchte singen.
Eine Feldlerche steigt hoch über die Wiesen auf und zwitschert. Einer der wenigen Vögel, dessen Gesang ich erkenne. Immerhin. Mein Bruder wäre stolz auf mich. Ansonsten ist es still ringsherum. Das Dorf liegt in mittäglicher Ruhe. Kein Mensch, kein Tier zu sehen. Ich habe mir ein Stückchen Karte aus dem Internet ausgedruckt und den Weg markiert, der, wie ich glaube, von der Bushaltestelle zum Bauernhof führt. Doch jetzt sieht alles ganz anders aus, als ich es mir vorgestellt habe. Mist, in welche Richtung muss ich bloß gehen? Am besten an der Straße entlang zurück, bis zu der Kreuzung, wo ich Richtung Norden abbiegen kann. Etwa zwei Kilometer muss ich laufen, habe ich errechnet. Es gäbe einen kürzeren Weg, aber der führt quer durch ein Moor. Nichts für mich – ich will trocken ankommen.
Ich schultere den Rucksack, auf dessen Grund meine Brandlochdecke ruht. Schon nach wenigen Schritten schneiden die Riemen ins Fleisch. Es ist so heiß! Keine Wolke am Himmel, kein Schatten am Wegrand. Okay, vielleicht ist es ganz gut, wenn ich erschöpft und verschwitzt dort ankomme. Das macht meine Geschichte nur glaubhafter.
»Mädle, wo willsch ’n du na?«, lässt mich eine Männerstimme zusammenzucken. Ich drehe mich um und sehe einen älteren Mann mit knorrigen Gesichtszügen auf der anderen Straßenseite. Er wischt sich mit dem Ärmel über seine schweißnasse Stirn, stützt sich auf einem Besen ab.
»Äh«, stottere ich und mache eine unbestimmte Handbewegung. »Zu diesem Biohof hier in der Nähe.« Es klingt fast wie eine Frage.
»Ha noi!«, sagt er spöttisch. »Bisch du a oine von denne? Von die Kinder von der Wegga? Schaust gar ned so aus. Däppisch Baggasch isch des, des glabsch aber, iwwl, iwwl. Bleib liewa fort. Was ma von denne so verzählt … auweh!«
»Was hört man denn?« Ich gehe über die Straße zu ihm hinüber.
»Na, dass die ihr’ Leut’ ausbeude tun, nix als Erwäd und des von früh bis spät. Immer. Ohne Ferien.«
»Aber auf einem Bauernhof ist das doch normal, oder?«, wage ich einzuwenden.
Er macht eine wegwerfende Handbewegung. »Aber des? Hea, danke, hör uff! Und all’s isch g’sichert. Hinter Zäune. Was die da so im Wald all’s anstell’n … Wie seinerzeit die Hex’n uffm Blocksberg …«
»Ich mache mir gerne mein eigenes Bild von den Dingen«, sage ich laut. Er grinst und entblößt eine Reihe gelber, schiefer Zähne.
»Alla gut, viel Glück!« Und dann nimmt er seinen Besen und kehrt so schwungvoll, dass mir Steinchen und Dreck in die Sandalen stieben.
Nachdenklich gehe ich weiter. Ist meine Idee vielleicht doch reichlich gaga? Aber mein Bruder, mein Heiko – der lässt sich doch nicht mit Verrückten ein!
Endlich sehe ich vor mir ein kleines Wäldchen, dessen Baumkronen der Straße Schatten spenden. Ich spüre schon seine Kühle. Als ich den Wald fast erreicht habe, donnert ein weißer Kastenwagen dicht an mir vorbei. Ich zucke zusammen, springe zur Seite und schreie dem Fahrer völlig überflüssigerweise hinterher. Ich kann gerade noch erkennen, dass auf der Hintertür ein kleines lila Emblem mit einer gelben Raute klebt, dann verschwindet der Wagen in einer Senke. Ich weiß nicht genau, ob es mich eher irritiert oder beruhigt, dass die Kinder Wegas so rowdyhaft Auto fahren.
Durch die Bäume erkenne ich grüne Wiesen und dahinter ein großes weißes Gehöft mit einem klobigen, orange gedeckten Dach. Das muss es sein! Mein Atem geht schneller. Ich schlucke schwer. Trotzdem setze ich meine Schritte kraftvoll auf den weichen Waldboden. Bestimmt ist es kürzer, wenn ich direkt durch den Wald gehe. Die Luft ist würzig und nun höre ich einen Kuckuck. Mein Gott, wann habe ich das letzte Mal einen Kuckuck gehört? Vielleicht mit Heiko im Wald? Als ich widerwillig mitgegangen bin auf seinen Touren. Nein, von seiner Liebe zur Natur habe ich mich bis heute nicht anstecken lassen. Ich bleibe stehen, sehe mich um. Meine Gedanken eilen zurück. Als ich fünf oder sechs Jahre alt war, fing er an, mir Vogelstimmen vorzusingen und zu pfeifen. Er konnte die Mönchsgrasmücke von der Hausgrasmücke unterscheiden, imitierte die Feldlerche täuschend echt und hielt Zwiegespräche mit den Rotkehlchen. Wenn seine Klassenkameraden auf die Skaterbahn gingen, streifte er durch den Wald, kontrollierte Nistkästen und kam mit riesigen Bovisten zurück, die er unter Mamas skeptischen Blicken in Butter anbriet. Obwohl sie aussahen, als seien sie aus Styropor, schmeckten sie wunderbar. Nur Mama weigerte sich, die Pilze je zu kosten.
Das Knacken im Unterholz kommt mir zu laut vor für ein Tier. Für ein kleines Tier. Einem großen möchte ich sowieso nicht begegnen. Oder war es ein Mensch? Ich drehe mich um mich selbst und blicke an den hohen Baumstämmen empor. Ich fühle mich, als sei ich aus Raum und Zeit gefallen. Mit dem Rücken stoße ich gegen etwas und muss mich konzentrieren, damit ich nicht stolpere. Ich fahre herum. Ein schwarzer Totenkopf grinst mich an. Das gelbe Schild mit dem fett gedruckten Wort Gefahr darunter wiederholt sich alle paar Meter an einem übermannshohen Maschendrahtzaun. Soweit ich sehen kann, zieht er sich quer durch den Wald, teils versteckt durch üppiges Buschwerk. Wovor warnen die hier? Zum ersten Mal an diesem Tag fröstle ich. Direkt hinter der Absperrung, keine zwei Meter entfernt, erkenne ich so etwas wie einen Altar. Ein Altar aus Naturmaterialien. Im Halbrund sind helle, kinderkopfgroße Steine aufgetürmt, davor liegen Blüten in Lila und Gelb, die das Logo der Kinder Wegas bilden. Ein honiggelber Kerzenstumpen, eine kleine Feuerstelle und Reste von etwas, das mal ein Tier gewesen sein könnte. Zumindest aus der Entfernung sieht es so aus. Ich zwinge mich, genauer hinzuschauen. Das ist Fell, eindeutig, und da – der Fuß eines kleinen Tieres, eines Hasen oder einer Katze –, sein bleicher Knochen ragt in die Höhe, ein bisschen Blut klebt daran. Gleich wird mir schlecht. Vielleicht ist es doch besser, ich drehe um. Der Zaun macht einen scharfen Knick nach links, weiter rechts führt der Weg aus dem Wald hinaus zurück auf die Straße.
Jemand steht dort. Mitten auf der Fahrbahn. Ein hochgewachsener Mann mit langen Haaren und einem üppigen Vollbart. Ich erkenne das lila T-Shirt mit dem gelben Logo darauf, das gleiche, das Heiko und dieses Mädchen am Marktstand getragen haben. Ich hole tief Luft. Soll ich ihn ansprechen?
Der Mann dreht mir den Rücken zu, betrachtet offenbar das Waldstück auf der anderen Straßenseite. Über den Ohren trägt er große Kopfhörer. Wird er auf ein »Hallo« reagieren? Bestimmt auf ein lautes »Grüß Gott«.
Es ist das Geräusch eines sich nähernden Autos, das mich irritiert. Das Geräusch klingt, als ob der Wagen sehr schnell fährt. Ich gehe eilig weiter, der Mann bemerkt das Auto nicht, das sich ihm von hinten in hoher Geschwindigkeit nähert. Aber der Fahrer muss ihn doch sehen!
Ich springe über einen kleinen Straßengraben, mein Rucksack drückt mich vorwärts, ich schreie irgendetwas, der Wagen ist schon ganz nah, ich strecke die Arme aus, der Mann dreht mir sein erstauntes Gesicht zu, dann fliege ich beinahe auf ihn drauf, reiße ihn mit, wir fallen fast auf die Straße und landen im Grünstreifen. In hohem Bogen saust der Kopfhörer durch die Luft.
Der Kastenwagen donnert an uns vorbei. Ich erkenne nichts, außer der hellen Farbe.
Vorsichtig setze ich mich auf. Der Mann neben mir stöhnt.
»Sind Sie verletzt?«, frage ich und packe ihn an der Schulter. Er sieht mich aus seiner liegenden Position verblüfft an, ich rücke etwas von ihm ab und er dreht sich auf den Rücken.
»Was war das denn?«, fragt er mit einer vollen, leicht rauen Stimme.
»Der Wagen hätte Sie fast überfahren«, sage ich. Er stützt sich auf den Unterarmen auf, stiert auf die leere Straße.
»Und du hast mich gerettet?« Er bemüht sich um ein Lächeln. Ich weiß nicht, ob es an den langen Haaren und dem Bart liegt, dass es ein wenig finster gerät.
»Scheint so.«
»Dich hat Gott gesandt«, sagt er und richtet sich auf. »Gelobt sei der Herr.« Wir sitzen nebeneinander auf dem Grünstreifen. Als ich versuche aufzustehen, merke ich, dass meine Beine zittern.
»Langsam«, sagt er und ich setze mich wieder hin. »Hast du dir wehgetan?«
Ich schüttle den Kopf. Seine warmen Augen mustern mich. Dann streckt er seine Hand aus. Ein paar kleine Steinchen haben sich in die Innenfläche gebohrt, an einer Stelle blutet er.
»Danke«, sagt er und ich nehme seine Hand, trotz des Blutes.
»Nenn mich Bruder Samuel«, sagt er und mit einem Mal wird mir klar, dass er gar nicht so alt ist, wie er auf den ersten Blick aussieht. Mitte zwanzig vielleicht.
»Lina«, sage ich spontan. Warum nenne ich ihm nicht meinen richtigen Namen?
Er fängt an zu kichern, legt sich wieder flach auf den Boden und reibt sich mit den Fäusten die Augen aus. »Du hast mir das Leben gerettet«, sagt er erstaunt.
»Scheint so.«
Er nickt, starrt in den Himmel. »Ich habe gar nichts mitbekommen. Ich habe mich auf die Meditationsübung konzentriert, die ich gerade angehört habe … Was war das für ein Fahrzeug?«
»Ein weißer Kastenwagen«, antworte ich. »Ich hab’s nicht genau erkennen können, tut mir leid.« Ob das derselbe Wagen war wie der vorhin? Aber der müsste doch schon längst hier durch sein. Auf einen Aufkleber habe ich nicht achten können.
Vorsichtig steht »Bruder Samuel« auf, rückt eine Kette zurecht, an der ein ziemlich großes Kreuz hängt, schmucklos und aus dunklem Holz ist es. Es sieht selbst geschnitzt aus. Er reicht mir noch einmal die Hand und zieht mich hoch.
»Es gibt immer wieder Menschen, die es nicht gut mit uns meinen«, sagt er.
Ich verstehe nicht ganz. »Wie?«
»Sie können unsere Art und Weise zu leben nicht respektieren. Sie wollen uns hier weghaben. Dabei sorgen wir dafür, dass ihre Natur erhalten bleibt. Wir gehen achtsam mit Menschen und Tieren um.«
»Und die greifen euch dann an?«, frage ich entsetzt. Er nickt nur.
»Krass.«
»Wohin bist du eigentlich unterwegs? Wolltest du zu uns?«
»Wenn Sie zu den Kindern Wegas gehören – ja.«
Er lächelt wieder.
»Sag Du, bei uns duzen sich alle.« Dann nimmt er mir meinen Rucksack ab und schwingt ihn sich über die Schulter. Leicht, behände.
»Warum bist du gekommen?« Er fixiert mich mit seinen dunklen Augen. Er ist der erste Mensch seit Langem, der mir eine ernst gemeinte Frage stellt. Der sich für mich zu interessieren scheint. Mit einem Mal fühle ich mich so erschöpft, nicht nur wegen des Rasers oder von der Hitze, dem Fußmarsch, der langen Anfahrt, sondern vor allem von den Resten meines Lebens, sodass ich statt Worten nur Tränen in meiner Kehle spüre.
»Weil … weil …«, mehr bringe ich nicht heraus, dann laufen die Tränen. Ich schniefe versuchsweise unauffällig.
Seine Hand legt sich leicht auf meine Schulter. »Schon gut«, sagt er. »Das können wir später noch klären.«
Ein großer Schäferhund trottet uns am Schlagbaum zum Hof entgegen.
»Ares«, ruft ihn Samuel und krault ihm das dicke Fell. Neben dem Schlagbaum steht ein kleiner überdachter Unterstand, in dem ein junger Typ sitzt. Auch er hat lange Haare und einen üppigen Bart. Als er Bruder Samuel sieht, öffnet er den Schlagbaum. Auch ich darf passieren. Ich sehe mich um. Der Hof wirkt viel größer als auf dem Foto, das ich im Internet gesehen habe. Gleich rechts liegt eine Art riesiger Scheune, durch die geöffneten Türen kann ich verschiedene Fahrzeuge erkennen. Die Scheune scheint als Garage genutzt zu werden. Geradeaus liegt das Haupthaus. Ein stark gewölbtes Kuppeldach dominiert das ganze Ge bäude, das sich darunter wegzuducken scheint. Daneben gruppieren sich drei zweistöckige Gebäude, weiß getüncht und sehr schlicht. Gegenüber liegt ein üppigst blühender Bauerngarten. Direkt an den Zäunen wachsen hohe Stockrosen in Vanillegelb und Knallpink, wie ich sie aus dem Garten meiner Großmutter kenne, mit der wir seit der Trennung meiner Eltern bis zu ihrem Tod kurz darauf keinen Kontakt mehr hatten. Zahllose Kräuter, orange Ringelblumen, große, lila-blau changierende Blumen, kleine Beete, aus denen Kohlrabi ragen, Gurkenpflanzen, die sich an Hölzern emporranken – es sieht aus wie im Garten Eden.
Vor dem Haupthaus stehen eine klobige Bank, ein breiter, langer Holztisch und einige Stühle. Zwei Frauen sitzen dort im Schatten und pulen Erbsen aus ihren Schoten. Sie unterhalten sich leise, mit sanften Stimmen. Alles wirkt so friedlich, dass sich so etwas wie Ruhe in mir ausbreitet.
Jetzt schauen sie zu mir, ein wenig neugierig, aber auch wohlwollend. Samuel weist auf einen der Stühle, stellt mich den jungen Frauen vor und bittet mich, dort auf ihn zu warten. Aufatmend lasse ich mich fallen. Ein Huhn gackert zu meinen Füßen und pickt nach ein paar Körnern auf dem sandigen Boden. Irgendwo höre ich Kühe muhen. So schlimm kann es hier nicht sein.
Die Frauen fahren in ihrem Gespräch fort, ich höre Worte wie Küchendienst und Ernte und Obstkisten. Ich bin froh, dass sie mich einfach hier so sitzen lassen. Sie haben mich zur Kenntnis genommen, das genügt für den Moment. Sie tragen ähnliche Kleider wie das Mädchen vom Marktstand. Vorgestern. Es scheint mir Jahrhunderte her zu sein. Sie sind gebräunt, sicher von der Arbeit im Freien, sie haben lange, zu Zöpfen geflochtene Haare und sehen so gesund aus, als seien sie einer Werbung für Rotbäckchen-Saft entsprungen. Auch um ihre Hälse baumelt ein großes Holzkreuz. Ein paar Mal quietscht irgendwo eine Tür und ich versuche, die Quelle des Geräusches auszumachen. Ob ich Heiko entdecke?
Nach wenigen Minuten ist Samuel wieder da. Er lächelt mich an und setzt sich dicht neben mich. »Ich habe mit Wega gesprochen«, sagt er. »Wir werden uns nach dem Abendessen deinen Wunsch anhören und dann sehen, wie es weitergeht.«
Ich wundere mich kurz, denn ich habe gar keinen Wunsch geäußert. Aber vielleicht kommen hier jede Woche gestrauchelte und gestrandete Aussteiger an, die von der normalen Konsumwelt einfach genug haben. Ich begnüge mich mit einem Nicken.
»Du kannst heute natürlich auf jeden Fall hierbleiben. Du hast Glück – im Schwesternhaus gibt es ein freies Bett. Einverstanden?« Ich nicke erneut. Und traue mich zu fragen: »Kann ich vielleicht etwas zu essen haben? Ich habe seit dem Frühstück …«
Samuel steht auf. »Es tut mir leid. Du wirst dich gedulden müssen. Um 18 Uhr gibt es Abendessen. Da kannst du etwas bekommen. Zwischen den Mahlzeiten essen wir nicht. Das ist nicht gut. Stört die Konzentration. Jetzt ist die Küche geschlossen. Aber ich denke, der Anblick der Natur ringsum bietet so viel geistige Nahrung, dass du dich gesättigt fühlen wirst. Probier es aus!« Dann nimmt er meinen Rucksack und geht vor mir her auf das rechte der beiden Nebenhäuser zu. Mit grummelndem Magen folge ich ihm.
Das Haus ist leer, die Bewohner sind wohl alle bei der Arbeit. Im unteren Stockwerk gibt es ein kleines, ziemlich schäbiges Bad mit einer Toilette und einer Badewanne sowie zwei Schlafzimmer mit jeweils vier ordentlich gemachten Betten. In sehr schmalen Spinden an der schmucklosen Wand kann man seine persönliche Habe unterbringen. In der Mitte steht ein leerer Tisch mit vier Stühlen darum. Das war’s. Der einzige Schmuck ist der Spruch an der Wand: Kinder Wegas – auf höchstem Niveau. Im oberen Stockwerk liegen drei weitere Schlafkammern, ebenso ausgestattet wie die unteren. Im Zimmer, das zum Hof hinausgeht, weist mir Samuel das Bett in der dunkelsten Ecke zu und legt meinen Rucksack darauf.
»Und wo ist das Bad?«, will ich wissen. Er sieht mich verwirrt an.
»Unten. Hab ich dir doch gezeigt.« Ein Bad für 20 Frauen – ich schlucke.
»Es gibt für das Haus zwei Ordnerinnen, die auf die Pflichteinhaltung achten«, erläutert er nun. »Schwester Kreszentia ist für die innere Ordnung zuständig. Sie kontrolliert, ob alles sauber und aufgeräumt ist, teilt die Putzdienste ein, führt die Termintafel. Die andere, Schwester Sara, achtet auf die äußere Ordnung, dass alle ihre Pflichten erfüllen, an den Terminen teilnehmen. Sie führt Gebetskontrollen durch, überwacht das Führen der Seelen-Leben-Kartei und schlichtet bei Streitigkeiten.«
»Der Seelen-was-Kartei?«
»Die Seelen-Leben-Kartei«, Samuel hat plötzlich etwas beängstigend Zwingendes im Blick. »Wir halten darin fest, wie wir auf dem Pfad zu Gott weiterkommen. Man kann Gott für seine Gnade danken, aber auch Zeugnis ablegen von der eigenen Schwäche, damit man weiß, woran man noch arbeiten muss.«
»So eine Art Tagebuch?«
»Genau.«
»Das aber jeder lesen kann?«
»Nicht jeder«, er schmunzelt. »Nur die Ordnerinnen, Wega, Bruder Gabriel und ich. Wir wollen teilhaben an der Entwicklung, um im Notfall korrigierend eingreifen zu können. Damit Niveau um Niveau erklommen werden kann.«
Schweiß rinnt mir den Rücken herunter, dabei ist es hier drin gar nicht so heiß. »Und was notiert man da so?« Fragen kostet nichts. Er weicht meinem Blick aus.
»Erhol dich ein wenig«, fordert er mich auf. »Leider sind wir alle sehr beschäftigt. Wir haben so viele Aufgaben. Unsere Gemeinschaft ist klein. Aber ich werde dir, falls du bleibst, in den nächsten Tagen alles zeigen.«
»Darf ich mich draußen umsehen?«, frage ich. Er nickt bedächtig.
»Solange du unsere Privatbereiche respektierst, gerne. Du kannst auch die Schwestern fragen, ob du ihnen zur Hand gehen kannst. Fleißige Menschen sind uns sehr willkommen.« Sein Ausdruck ist ernst, seine dunklen Augen weichen mir keine Sekunde aus. Obwohl er offensichtlich viel im Freien unterwegs ist und körperliche Arbeit sicher gewohnt, wirkt er zart. Schmale, lange Finger, lange, sehnige Arme. Hinter seinem dichten dunklen Bart ahnt man einen sensiblen Mund. Auch die Nase ist schmal, die Wangen ein wenig eingefallen. Als Kind habe ich mir Jesus so vorgestellt.
»Kann ich jetzt deinen Personalausweis haben?«
Ich setze mich neben meinen Rucksack, hieve ihn zwischen meine Beine und versuche, nicht rot zu werden. Zittert meine Stimme?
»Ach herrje, den hab ich in all der Eile gar nicht eingesteckt. Sorry! Ich hab nur mein Sparschwein geplündert und dann bin ich los.«
»Bist du denn schon volljährig?«
Ich nicke enthusiastisch. »Seit drei Monaten.« In drei Monaten müsste es korrekt heißen. Er zieht die Augenbrauen hoch, kratzt sich nachdenklich am Kinn. Sein Bart raschelt. »Na dann«, sagt er und ich merke ihm an, dass er mir nicht wirklich glaubt. Aber er insistiert nicht.
Bevor er leise die Tür schließt, lächelt er mich warm an. »Danke noch mal«, sagt er.
Ich grinse. Dann ist er fort. Ich setze mich aufs Bett, die Matratze ist härter, als ich dachte. Hoffentlich durchsuchen die meinen Rucksack nicht. Na ja, das wäre ja noch schöner. Wie ruhig es hier drin ist. Wie verlockend, sich auf dem Bett auszustrecken und erst einmal die Augen zu schließen. Aber dann höre ich Stimmen im Hof und schaue hinaus. Vom ersten Stock hat man einen guten Überblick.
Samuel geht über den Hof und spricht mit den Frauen. Ob sich hier alle mit »Bruder« und »Schwester« anreden? Sie wirken auf den ersten Blick so ernst und in sich gekehrt – vielleicht ist man so, wenn man ein gottesfürchtiges Leben führt. Wie Nonnen und Mönche in einem mittelalterlichen Kloster. Aber ob die tatsächlich so ernst waren? Mir fallen die unterirdischen Gänge zwischen zwei Klöstern ein, die wir auf einer Klassenfahrt im Schwarzwald einmal besichtigt haben. Sie verbanden die Nonnen- und die Mönchsklöster und so manches nächtliche Rendezvous musste dort stattgefunden haben. Forscher haben dort unten in späteren Jahrhunderten Babyknochen gefunden.
Die Mädchen, die zuvor die Erbsen geputzt haben, stehen mit gesenkten Köpfen vor Samuel. Er spricht so leise, dass ich ihn nicht verstehen kann. Dann drehen sie sich wortlos um und verschwinden mit gesenkten Köpfen im Haupthaus. Auweia! Hoffentlich läuft hier nicht so ein patriarchalisches Ding. Die Männer haben das Sagen, die Frauen schaffen an. Aber andererseits ist das Oberhaupt der Gruppe, diese Wega, ja auch eine Frau. Ich bin schon gespannt, sie kennenzulernen. Ich schaue auf meine Uhr. Kurz nach drei erst. Noch fast drei Stunden bis zum Abendessen. Wie soll ich das nur aushalten?
Der Hof wirkt wie ausgestorben. Ich sehe niemanden, den ich fragen könnte, ob ich etwas helfen kann. Nur die Hühner gackern zufrieden in der Sonne. Ares bellt, als er mich im Hof sieht, trottet dann aber davon. Ich setze mich auf die Bank vor dem Haupthaus und lasse die Stille auf mich wirken. Doch ich kann sie nicht genießen. Heiko, Heiko, Heiko, formen meine Lippen. Hoffentlich ist er auch wirklich hier, fällt mir mit einem Mal ein. Was, wenn die Gruppe noch weitere Einrichtungen woanders hat? Auf der Website stand irgendetwas von handwerklichen Partnerbetrieben im Umland. Aber nein, versuche ich, mich zu beruhigen. Heiko wollte immer in die Natur. Immer. Und er wollte nie mehr eingesperrt sein.
Ob ich mich doch mal unauffällig umschauen soll? Vielleicht hängen irgendwo Fotos der Bewohner? Ich schlendere zu dem benachbarten Nebenhaus. Das müsste das Bruderhaus sein. Die Tür ist offen, dahinter liegt ein schmaler, langer Gang. Es ist fast ganz dunkel. Die Wände sind kahl, das immerhin erkenne ich. Nicht einmal ein Kreuz oder ein anderes religiöses Zeichen ist irgendwo zu entdecken. Vielleicht ist Gott doch nicht so wichtig? Vom Gang gehen rechts drei Türen ab, links nur eine. Über den Türen steht etwas, ein Spruch. Ich kann ihn nicht entziffern.
Ich schleiche weiter. Die Dielen unter meinen Füßen knarren. Laut. Mist. Ratlos bleibe ich stehen. Soll ich weitergehen? Auf dem Weg nach draußen mache ich bestimmt ebensolchen Lärm. Was bin ich doof! Samuel hat doch gesagt, ich solle die Privatbereiche respektieren. Langsam drehe ich mich um. Und erschrecke mich beinahe zu Tode.
In der Tür steht ein großer, kräftiger Typ, natürlich mit Bart, das scheint hier so üblich zu sein, und sieht mich finster an. Ich hebe die Hand zum Gruß. Etwas Besseres fällt mir nicht ein.
»Kann ich dir helfen?«, fragt er. Es klingt sehr unfreundlich. Als wolle er sagen: »Kann ich dir helfen rauszufliegen, bevor du überhaupt gelandet bist!«
»Entschuldigung«, stammle ich. »Ich wollte eigentlich nur … äh, zurück in mein Zimmer. Ich muss … blöd, total, ich muss die Häuser verwechselt haben.« Dämliche Ausrede. Er hält mir die Tür auf und deutet hinaus.
»Das rechte Haus«, sagt er und ich sehe ihm an, dass er mir keine Silbe glaubt. Als ich an ihm vorbeigehe, dringt fieser Schweißgestank in meine Nase. Seine Hände sind schwarz von Erde. Wahrscheinlich ist er einfach seiner Arbeit nachgegangen und will sich nun waschen oder ausruhen oder … beten? Keine Ahnung, womit die hier ihre Tage verbringen.
»Entschuldigung«, murmle ich noch einmal und stehe wieder im gleißenden Sonnenlicht. Meine Hände zittern, aber ich schiebe das auf den großen Hunger, der mittlerweile in meinem Magen tobt.
2. Kapitel
Um fünf Minuten vor sechs beschließe ich, das Zimmer zu verlassen. Ich habe mich aufs Bett gelegt, aber schlafen konnte ich keine Sekunde. Immerhin hörte ich, wie sich der Hof langsam mit Leben füllte. Stimmen und schlagende Türen, ein Auto, lautes Grunzen, bestimmt von Schweinen.
Ich erreiche die Schwelle zum Haupthaus und in diesem Moment fällt mir etwas Schreckliches ein: Was, wenn mich das Mädchen vom Marktstand wiedererkennt? Heikos Kollegin. Bei dem Zirkus, den wir veranstaltet haben, hat sie bestimmt mitbekommen, wer meine Mutter und ich sind. Sie wird wissen, was ich vorhabe, sie wird mich verraten. Ich kann auch gleich wieder abreisen. Herrje, Melina, du dumme Kuh, schimpfe ich mich. Meine Pläne haben immer einen Haken, ich denke nie bis zum Ende, niemals.
»Ich zeige dir deinen Platz«, sagt eine weibliche Stimme und ich drehe mich um.
Sie sieht aus, als sei sie aus einem Bullerbü-Film entsprungen: helle Haut, mit Sommersprossen übersät, dicke rote Haare, die sich kaum zum Zopf bändigen lassen. Es ist das Mädchen vom Marktstand. Ich nicke nur, bekomme keinen Ton heraus. Sie geht vor, ihre Bewegungen wirken müde. Ob sie mich erkannt hat? In ihrem ruhigen Gesicht steht kein Erkennen geschrieben.
Durch das Haus zieht der Geruch von Essen. Nicht gerade der nach gebratenem Fleisch oder frischen Pfannkuchen, sondern eher nach Eintopf. Aber das ist mir im Moment völlig egal – Hauptsache, ich bekomme endlich etwas zu futtern.
Wir treten in einen niedrigen Raum mit vielen Holztischen. Sie sind merkwürdig angeordnet. Nah der Tür steht ein Tisch, rechts und links davon ist noch viel Platz. Dahinter zwei Tische, schon enger. Dicht gedrängt stehen in der dritten Reihe drei Tische und ein einzelner Tisch in einem nischenartigen Anbau, dessen schmales Fenster wenig Licht in den Speisesaal wirft. Der Raum verjüngt sich nach hinten. Vorne ist er viel breiter. Es sind an jedem Tisch unterschiedlich viele Plätze gedeckt und ich beobachte, wie zielstrebig die nun hereinströmenden Gemeindemitglieder zu ihrem Platz gehen. Heiko kann ich nicht entdecken. Aber die Männer sehen sich auch alle so ähnlich mit ihren langen Haaren, den Bärten und den uniformen Klamotten.
Zwei Wände sind mit dunklem Holz verkleidet, nur die Wand rechts der Tür ist dunkellila gestrichen, in unendlicher Wiederholung das gelbe Wega-Sternbild darauf. Im gleichen Gelb prangt ein riesiger Spruch auf der Wand:
Gottvater & Wegamutter – deine Leitsterne auf Erden und überall!
Das Marktmädchen schaut mir ungeduldig entgegen. Sie steht am hintersten Tisch in der Fensternische. Rasch gehe ich zu ihr. Ihr Gesicht – noch immer verschlossen. Kein Lächeln zwar, aber auch kein Erkennen. Vielleicht habe ich Glück. Wortlos deutet sie auf den Platz an der Stirnseite.
Ich sitze mit dem Rücken zu den anderen. Noch zwei weitere Gedecke sehe ich auf der abgenutzten Tischplatte seitlich von mir. In der Mitte steht ein Topf mit Deckel, unter dem sich eine Suppenkelle hervorschiebt. Ich will mich schon setzen, bemerke aber gerade noch, dass alle anderen noch stehen. Ich drehe mich rasch zu meinen nächsten Tischnachbarn um. Sie haben die gefalteten Hände auf die Stuhllehnen gelegt, halten die Augen geschlossen und murmeln Unverständliches. Bestimmt ein Gebet.
Die letzten gemeinsamen Essen unserer damals noch kompletten Familie endeten fast immer in Katastrophen. Entweder lief meine Mutter nach einem kurzen heftigen Wortwechsel weinend in die Küche oder mein Vater warf sein Besteck stumm auf den Teller und verließ mit hochrotem Kopf die Wohnung. Schweigend beendete der Rest der Familie die Mahlzeit.
Als Stühle über den Boden quietschen, setze ich mich. In meinem Rücken höre ich Samuels Stimme: »Eine gesegnete Mahlzeit, liebe Brüder und Schwestern, danket dem Herrn und unserer Mutter Wega, die uns versorgt und nährt. Nichts wären wir ohne sie. Alles sind wir durch sie.«
Ohne dass irgendein Stimmengemurmel anhebt, klappern nun Topfdeckel, Geschirr und Suppenkelle. Ich bin noch immer alleine an meinem Tisch und bediene mich nun. Der große Topf ist gerade mal zu einem Viertel gefüllt. Ich erkenne eine sämig-helle Suppe, in der klein geschnittenes Gemüse schwimmt. Ich hasse Eintöpfe und hege einen Moment die Hoffnung, dass sich wenigstens ein paar Würstchen am Topfboden verstecken. Doch ich fische vergebens. Jetzt erst fällt mir der Spruch auf, der auf dem Tellerrand prangt: Sei bereit für das höchste Niveau! Jederzeit! Kaum habe ich meinen Teller so vollgefüllt, wie es geht, erscheinen ein Mann und eine Frau am Tisch, beide mit gesenktem Haupt. Sie sind so leise herangetreten, dass ich sie nicht gehört habe. Der Mann nimmt zu meiner Linken, die Frau rechts Platz. Sie suchen keinen Augenkontakt zu mir und der Mann greift nach der Suppenkelle. Für die Frau ist anschließend kaum noch etwas übrig. Wie peinlich! Ich habe meinen Teller viel zu vollgeschaufelt. Ich bin froh, dass von ihr keine Reaktion deshalb kommt. Eine duldsame Gruppe.
Dass beim Essen offenbar nicht geredet wird, wird mir schnell klar. Außer dem Klappern der Löffel und Gläserklirren, wenn Wasser nachgeschenkt wird, ist nichts zu hören. Aber es ist keine friedliche Stille, habe ich den Eindruck. Es ist eine erschöpfte, verschwitzte und müde Atmosphäre. Die beiden an meinem Tisch haben nur Augen für ihr Essen. Ich bekomme die Suppe kaum herunter. Sie ist nicht gewürzt, lauwarm und das Gemüse weich und labberig. Hoffentlich ist das nicht jeden Tag so! Verstohlen schaue ich mich ein paar Mal um. Überall tief gebeugte Köpfe. Die beiden Tischreihen vor mir sind gut gefüllt. Männer und Frauen sitzen getrennt einander gegenüber. Am vordersten Tisch sitzen nur Samuel und der finstere Mann, der mich im Bruderhaus erwischt hat, sowie das Marktmädchen und eine ältliche Frau mit verkniffenem Gesicht. Das Marktmädchen starrt regungslos in sein Essen. Ihr schmeckt es scheinbar auch nicht. Insgesamt ungefähr 40 Menschen, schätze ich. Meinen Bruder kann ich noch immer nicht entdecken.
Es dauert keine 20 Minuten, bis das Essen beendet ist. Nachschlag gibt es nicht, auch keinen Nachtisch. Hoffentlich wird das Frühstück reichhaltiger. Meine Sitznachbarn stehen wie auf ein geheimes Zeichen hin auf und sammeln die Teller und Bestecke ein, er nimmt die der Männer, sie die der Frauen. Sie laden einen Geschirrwagen damit voll und schieben ihn durch eine kleine Tür. Sicher geht es dort in die Küche. Nun erheben sich alle und bleiben erneut hinter den Stühlen stehen, die Köpfe tief gesenkt.
»Unser Niveau: Eins mit dem Himmel«, ruft eine Frau und ich zucke zusammen, so unerwartet laut ist ihre Stimme.
»Unser Niveau: Eins mit dem Himmel«, wiederholen alle.
»Unser Niveau: Eins mit der Erde«, ruft ein Mann ebenso laut und alle antworten. Ich erschrecke erneut. Nicht wegen der Lautstärke. Sondern wegen der Stimme – die ich so gut kenne wie mein Leben.
Verwirrt folge ich den andern nach draußen. Ich recke den Kopf, ich will ihn endlich sehen. Meine Augen finden die des Marktmädchens, sie mustert mich unverhohlen. Ich verstecke mich hinter einem großen Mann, der leise mit einem zweiten redet. Und dann sehe ich ihn. Er steht etwas abseits. Er zupft an seinem Bart und mir wird klar, wie ähnlich er trotz dieser Werwolfbehaarung unserer Mutter sieht. Er hat ihre Augen, diese hellblauen Wolfswelpenaugen, die immer ein wenig enttäuscht dreinblicken. Mir schiebt sich das Bild in den Sinn, wie wir früher um meinen Großvater sprangen und versuchten, ihn an seinem Bart zu zupfen. Er tat immer so, als wolle er uns fangen und in die Finger beißen, und wir kicherten und lachten, bis uns die Puste ausging. Am Ende zog er mich auf seinen Schoß und bedeckte mein Gesicht mit kratzigen, kleinen Küssen. Und mein Bruder stand daneben und fixierte einen Punkt an der Wand. So wie jetzt.
Ich will mich durch die Menge schieben, dabei weiß ich, dass ich ihn hier und jetzt nicht ansprechen kann. Aber ich will, dass er mich bemerkt. Ich will sehen, dass er mich erkennt.
»Lina«, ruft eine Stimme und ich reagiere gar nicht. »Lina.« Endlich kapiere ich, dass ich gemeint bin, und sehe Samuel hinter mir. Er winkt mich zu sich und bittet mich dann, ihm zu folgen.
Wir gehen zurück in Richtung Haupthaus. Neben dem Eingang zum Speiseraum führt eine enge, steile Stiege nach oben, die mir vorhin gar nicht aufgefallen ist.
Auch hier sind alle Wände mit Holz verkleidet. Als wir vor einer niedrigen Tür anhalten, dreht sich Samuel zu mir um.
»Ich weiß«, sagt er freundlich. »Dir muss alles sehr ungewohnt hier bei uns erscheinen. Das geht jedem Neuankömmling so. Aber wir brauchen Regeln, um unser Zusammenleben so gut wie möglich zu gestalten. Eine Regel lautet: Sprich nur, wenn Wega dich etwas fragt. Halte deine Antworten kurz und knapp. Wega ist ein besonderer Mensch, das hast du vielleicht schon gehört. Sie ist ein Sprachrohr Gottes und ihre Mission ist kräftezehrend. Raube ihr nicht zusätzlich Energie, ich bitte dich inständig.« Ich nicke, ohne auch nur im Geringsten verstanden zu haben, was er mir sagen will. Ein Sprachrohr Gottes – was soll das denn heißen? Und was soll so anstrengend daran sein?
Er klopft und öffnet die Tür vor uns. Ein Geruch von Weihrauch, den ich schon an der Türschwelle wahrgenommen habe, verstärkt sich augenblicklich. Samuel schiebt mich hinein, verbeugt sich und schließt die Tür. Ich bin mit Wega allein. Und warum auch immer – aufgeregt. Die Abendsonne, gedämpft durch einen zarten blassgelben Vorhang, fällt mir ins Gesicht und ich kann im ersten Moment nur Schemen erkennen. Links steht ein großer Paravent, mit asiatisch anmutenden Schwalben bemalt. Vor dem Fenster sitzt auf einem niedrigen Podest ein Mensch im Schneidersitz. Der Oberkörper gerade aufgerichtet, der Hals lang gestreckt, der Kopf rund und beinahe kahl. Ist sie nackt? Langsam erkenne ich, dass sie etwas wie ein hellrosa Trikot trägt, das eng anliegt. Ich kann nicht genau sagen, ob ihr Blick auf mir ruht. Sie wirkt, als sei sie zwar hier, ihr Selbst aber irgendwo anders. Ich starre fasziniert in ihr Gesicht. Der Schädel ist wirklich nur von zartem Flaum bedeckt. Ihre Wangenknochen treten hervor, sie hat ein kräftiges Kinn. Ob ich sie so unverhohlen mustern darf? Ihre Augen weichen mir nicht aus. Plötzlich wird mir klar, warum ihr Blick so seltsam wirkt. Sie hat keine Wimpern. Oder doch – sie hat sogar erstaunlich lange Wimpern, aber nur am Unterlid. Ich gehe ein kleines Stück auf sie zu. Wann wird sie mit mir sprechen? Oder ist es ein Test, wie ich auf ihr Schweigen reagiere?
Ich bemerke, dass sie auf einer Lage Heu sitzt, ihre Beine verschränkt wie ein Yogi. Ich kratze mich fest unter dem Ohr. Die Narbe hat schon lange nicht mehr so gejuckt.
»Ich grüße dich, Tochter Gottes«, sagt sie mit einer tiefen, klaren Stimme. Und dann passiert etwas Verstörendes. Ihre Augen klappen nach oben weg – nein, es sind ihre Lider. Denn erst jetzt sehe ich ihr in die Augen. Augen von einem strahlenden Blau, die Iris schwarz umrandet. Was ich zuvor gesehen habe, war eine Tätowierung auf ihren Augenlidern. Ich verstehe mit einem Mal: Sie hat sich Augen auf ihre Lider tätowieren lassen. Mich fröstelt.
»Hat es dir die Sprache verschlagen? Komm ruhig näher und setz dich zu mir.« Wie ferngesteuert gehe ich auf sie zu. Ich kann mich doch nicht zu ihr auf das Podest setzen! Aber da klopft sie schon neben sich aufs Heu. Vorsichtig lasse ich mich auf die Kante nieder.
Sie rutscht ein wenig zu mir, sodass sich mein Oberschenkel und ihr Knie beinahe berühren. Dann nimmt sie meine Hände und hält sie fest. Ihre sind warm und angenehm. Trotzdem will ich, dass sie mich loslässt. Sie blinzelt und für den Bruchteil einer Sekunde sehe ich ihr zweites Augenpaar.
»Du gewöhnst dich daran«, sagt sie, als könne sie Gedanken lesen. »Ich möchte die Augen immer auf meinen Kindern haben. Tag und Nacht. Damit ihnen nichts passiert.« Ich schlucke trocken.
»Was führt dich zu uns?« Sie versenkt ihren Blick in meinen. Ihre Hände fühlen sich so wohlig an, dass ich erst einmal tief ein- und ausatmen muss. Keine Ahnung, was ein Sprachrohr Gottes so macht, aber so schlecht kann es nicht sein, wenn man eine dermaßen beruhigende Wirkung auf seine Mitmenschen hat.
»Lass dir Zeit«, sagt sie und betrachtet mich weiter. Ihre Hände lassen mich nicht los. Ich schöpfe noch einmal Atem, vielleicht ist es auch der komische Weihrauch-Geruch, der mich so verwirrt. Aber ohne noch länger nachzudenken, öffne ich den Mund und die erstaunlichsten Worte kommen heraus.
»Ich, also, meine Familie«, stottere ich los. »Meine Familie hat sich aufgelöst. Mein Vater hat uns verlassen, meine Mutter ist seitdem schwer depressiv und hat schon zwei Selbstmordversuche gemacht. Mein …« Gerade noch kann ich mich stoppen und erzähle nichts von einem Bruder, der in einer spinnerten Sekten untergetaucht ist. »Meine Familie ist zerbrochen. Mein Freund ist fort. Ich fühle mich so allein. Ich sehne mich nach Gesellschaft. Nein, nach Gemeinschaft.« Ich wundere mich, dass alles stimmt, was ich sage. Dass es sich richtig anfühlt.
»Ich weiß nicht, wo ich hingehöre. Wo ich hingehen soll. Was aus mir wird. Wo doch alle …« Ich muss schlucken.
»… alle dich verlassen haben?«