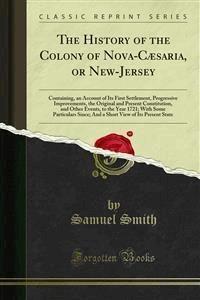Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Geschaffen, nicht gezeugt, Macht geerbt, nicht verdient, Familie erlebt, seine Eltern nie gekannt, mächtige Waffen erhalten, ohne das Wissen darum, das Leben geborgt bekommen, um es zu retten, geprüft, nicht gebrochen, vernichtet und wieder aufgestanden, auserwählt unter den Menschen und doch fremd. Ein junger Mann verlässt seine Familie und flieht mit seinen Gefährten vor mächtigen Feinden. Tief in ihm befindet sich die Saat der Macht und gleichzeitig seine und aller Menschen einzige Hoffnung, Naniten, unsichtbare winzig kleine Maschinen, die Eno assimiliert und die ihn stärker machen. Das hat er auch bitter nötig, denn er trifft auf Wesen aus einer anderen Welt und wird sich erst am Ende, wenn es fast schon zu spät ist, seiner eigentlichen Bestimmung bewusst. Kann er das unvermeidliche Schicksal der Menschheit noch abwenden und die dunkle Prophezeiung erfüllen?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 394
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Titel
Impressum
Widmung
Vorwort
Prophezeihungen
1.Prolog
2.Die Enthüllung
3.Von Anschuks und Fengos
4.Das Werengol
5.Chamulas und Naniten
6.Evif und Attis
7.Zero
8.Das Enabnet
9.Eerht
10.Das Valon
11.Die Sieben vereint
12.Die Prophezeiung
13.Kollektornaniten
14.Überraschung beim Frühstück
15.Flucht
16.Gefangen
17.Im Berg
18.Der Kollektor
19.Der Stankal
20.Hinter Metall
21.Die Flucht vor dem Valon
22.Die Halle der Seelen
23.Die Befreiung
24.Orez
25.Weißer Staub
26.Epilog
Eno
Die Macht der Naniten
Science-Fiction
von
Samuel Smith
Geschaffen, nicht gezeugt, Macht geerbt, nicht verdient, Familie erlebt, seine Eltern nie gekannt, mächtige Waffen erhalten, ohne das Wissen darum, das Leben geborgt bekommen, um es zu retten, geprüft, nicht gebrochen, vernichtet und wieder aufgestanden, auserwählt unter den Menschen und doch fremd.
Ein junger Mann verlässt seine Familie und flieht mit seinen Gefährten vor mächtigen Feinden. Tief in ihm befindet sich die Saat der Macht und gleichzeitig seine und aller Menschen einzige Hoffnung, Naniten, unsichtbare winzig kleine Maschinen, die Eno assimiliert und die ihn stärker machen. Das hat er auch bitter nötig, denn er trifft auf Wesen aus einer anderen Welt und wird sich erst am Ende, wenn es fast schon zu spät ist, seiner eigentlichen Bestimmung bewusst. Kann er das unvermeidliche Schicksal der Menschheit noch abwenden und die dunkle Prophezeiung erfüllen?
© 2016 Samuel Smith
Druck und Verlag: epubli GmbH, Berlin,
www.epubli.de
ISBN 978-3-7375-9920-7
Printed in Germany
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Kontakt: [email protected]
Für meine Frau Katrin,
die geduldig zugehört hat, wenn ich ihr vorgelesen habe und die mich auf Fehler und Ungereimtheiten hingewiesen hat, obwohl sie sich dabei oft überwinden musste, vielleicht auch deshalb, weil sie eher Krimis verschlingt.
… und für meine Tochter Susanne.
die mir versprochen hat, auch ein Buch zu schreiben, bevor sie mal vor Langeweile sterben sollte.
Mein Dank gilt auch meinem Freund Christian,
dessen Adleraugen beim aufmerksamen Korrekturlesen geholfen haben, das Buch an die deutsche Rechtschreibung anzupassen.
Vorwort
Liebe Leserin und lieber Leser,
vielen Dank, dass du dich für dieses Buch entschieden hast. Es ist in Urlauben und an verregneten Wochenenden entstanden. Warum? Vielleicht, weil ich nach dem Konsum vieler guter und weniger guter Bücher gedacht habe, ich könnte das auch mal versuchen. Also habe ich mich bei einer Tasse Kaffee, die Beine angezogen, den IPAD auf den Knien frisch ans Werk gemacht und meiner Fantasie Tür und Tor geöffnet. Was herauskam, war nicht wirklich gut und musste mehrmals umgeschrieben und verbessert werden. Ging es am Anfang noch etwas holprig, wurde ich von Kapitel zu Kapitel flüssiger. Und doch: Ich gebe es zu, ich hatte den Aufwand vollkommen unterschätzt; es artete tatsächlich in Arbeit aus, und es war schwer, den roten Faden über einen Zeitraum von über 3 Jahren neben Beruf und anderen Hobbies nicht zu verlieren. Das Ergebnis liegt vor dir. Wie jeder Schriftsteller finde ich beim wiederholten Lesen immer wieder Passagen, die ich umschreiben würde. Schließlich habe ich entschieden, dass es jetzt gut ist, und hoffe, dass du großzügig über die kleinen und größeren Ungereimtheiten hinweg schaust. Vielleicht findet der eine oder der andere die Geschichte um Eno genauso spannend wie ich. Dies wäre wohl das größte Lob, was ein Hobbyschreiber erwarten kann.
Viel Spaß beim Lesen wünscht dir
Samuel Smith
Wenn einst in fernen Tagen
die Technik aus dem Leben verschwindet,
dann beruht dies nur auf einem einzigen Grund,
sie ist Teil des Lebens oder Leben selbst.
Die Prophezeiung der Sieben
Die Geschichte liebt Gewinner,
verehrt Helden,
erinnert sich an manchen Verlierer,
ignoriert Versager,
vergisst keinen Tyrannen,
wird von den Mächtigen benutzt,
doch was ist schon Geschichte ohne die Menschen, die sie geschrieben haben?
Aus „Chroniken der Maschinen“
1.Prolog
Ein apokalyptisches Panorama breitete sich vor ihm aus. Er stand auf einem kleinen Hügel und überall, wohin er auch blickte, war diese dunkle, fast schwarze Wolke, die von innen in einem unheilvollen vagen Licht glomm. Aus der Wolke schlugen tiefschwarze armstarke Blitze in die aufgewühlte Erde und bei jedem Aufschlag wuchsen daraus metallisch schimmernde riesige Wesen hervor. Die Erde war bedeckt von ihnen und jede Sekunde entstanden neue. Einige kamen ihm bekannt vor. Aber die meisten waren so fantastisch, dass er sie sich nicht mal im Traum vorstellen konnte. Langsam und unaufhaltsam krochen, schoben, glitten und rollten sie auf ihn und seine Gefährten zu. Es war ein tödliches Gewimmel. Er sah sich um und konnte in den Augen der hinter ihm Stehenden keine Furcht erkennen. Stolz, so weit gekommen zu sein, lag darin, und einer nickte ihm sogar aufmunternd zu. Aber er wusste, hier und jetzt waren sie am Ende ihrer Reise angekommen. Es gab keine Hoffnung mehr, und was immer sie auch noch versuchen könnten, gegen die dunkle Kraft, die gekommen war sie zu verschlingen, waren sie machtlos. Er drehte sich um, und tief in seinem Herzen begriff er, dass jetzt, in diesem Moment, die Stunde der Entscheidung gekommen war. Seine Entscheidung, bei der ihm diesmal niemand helfen konnte. Das Lächeln auf seinem Gesicht war erloschen und ein unnatürlicher Ernst lag auf seinen Zügen. Dann plötzlich hatte er seinen Entschluss gefasst. Mit erhobenem Haupt ging er gemessenen Schrittes genau auf die Mitte des dunklen Sturms zu, der ihn aufnehmen würde. Während er noch den Hügel hinabstieg, fühlte er auf‘s Neue die Strapazen der letzten Tage, und Sehnsucht brannte heiß in seinem Herzen wie eine Flamme, die nie verloschen war. Mit ihr kam ein fast vergessenes Gefühl der Hoffnung. Vielleicht konnte er der dunklen Prophezeiung entgehen?
2.Die Enthüllung
Es war ein verregneter und kalter Frühlingstag im April und Eno arbeitete mit seinen zwei Brüdern auf dem Feld, obwohl die Sonne schon tief am Horizont stand. Sie ernteten Wintergerste, die am anderen Tag auf den Weg nach Mauritz gebracht werden sollte, um sie dort auf dem Markt zu verkaufen. Die Familie hatte das Geld bitter nötig, denn der Winter war kalt gewesen, Mutter krank und der Arzt hatte sie alle Ersparnisse gekostet. Sie fristeten ein karges Dasein. Heute Abend allerdings war etwas anders als sonst. Eno, ein braun gebrannter, aber für sein Alter zu klein geratener und eher zierlicher Bursche, war voll Freude und sang sogar, was er ziemlich selten tat. Kein Wunder, denn er hatte morgen seinen achtzehnten Geburtstag und seine Eltern hatten ihm mit vielsagender Miene eine Überraschung angekündigt. Karl, sein jüngerer Bruder, brummelte verstimmt „Du singst wie die Krähen am Morgen“, doch Walter, sein älterer Bruder, hob den Kopf, drehte sich zu Karl um und rief laut, dass alle es hören konnten „Lass ihm doch seinen Spaß. Schließlich wird man nicht jeden Tag achtzehn Jahre alt.“ In Karls Augen trat ein gefährliches Funkeln, welches aber so schnell wieder verschwand, wie es gekommen war. Karl war erst sechzehn und viel kräftiger und größer als Eno. Eno blickte zu Walter und bedankte sich mit einem schnellen Kopfnicken. Dann trällerte er weiter vor sich hin, allerdings nun deutlich leiser, während er die letzten Getreidegarben auf den Wagen warf. „Ich denke“, schlug Eno vor, „wir sollten uns jetzt auf den Heimweg machen. Es ist schon spät und Mutter wartet sicher mit dem Essen.“ Die anderen stimmten ihm nickend zu und hatten es plötzlich sehr eilig, den hoch beladenen Wagen zum Abmarsch vorzubereiten. Die drei Brüder zogen das schwere Gefährt über den vom Regen weich gewordenen Pfad, der zum Dorf führte.
Obwohl es in Strömen regnete, wartete die Mutter am Eingang des Hauses, und schon von weitem winkte sie ihren Söhnen zu. Die drei Brüder winkten zurück und beschleunigten ihre Schritte noch. Völlig durchgeweicht kamen sie im Hof an und schoben den Wagen in die Scheune. Dann wollten sie ins Haus gehen, doch Mutter zeigte nur stumm auf die Tränke, in der sie sich zuerst waschen mussten. Müde, hungrig und lustlos wuschen sich alle gleichzeitig in der Tränke und es war nicht klar, wer nun die Reinigung übernahm, der Regen oder das abgestandene Wasser der Tränke. Als sie sich umgezogen hatten und sich halbwegs sauber und vor allem trocken fühlten, setzten sie sich an den gedeckten Tisch. Viel war allerdings nicht darauf zu sehen. Ein harter Laib Brot, ein Krug Wasser und etwas Suppe, die wohl zum wer weiß wievielten Mal aufgewärmt worden war. Aber alle waren es so gewohnt und fingen an nach dem Tischgebet zu essen. Vater blieb schweigsam wie immer. Er hatte graues Haar und war mit seinen 65 Jahren immer noch eine stattliche Erscheinung. Mutter hatte blasse graue Augen und trug ihre Schürze wie ein Abendkleid. Als alle gegessen hatten, wollten die drei Brüder aufstehen, doch Vater streckte plötzlich eine Hand aus und räusperte sich. Wie auf Kommando setzten sich die ungleichen Brüder wieder und blickten erwartungsvoll auf. Ihr Vater knetete die rauen mit Schwielen übersäten Hände und es sah aus, als würde er sie gleich auspressen wie reife Zitronen. Dann hob er den Blick und sprach mit fester Stimme, jedes Wort betonend: „Kinder, es ist an der Zeit, dass ich euch eine Geschichte erzähle. Ihr seid jetzt alt genug und -“. Er hielt inne, da Mutter ihm einen verzweifelten Blick zuwarf. Ihre Blicke kreuzten sich und ein stummer Kampf schien zwischen den Eltern zu toben. Schließlich nickte die Mutter ergeben, presste die Lippen aufeinander und starrte auf den Tisch, so als hätte sie gerade den letzten liegengebliebenen Brotkrumen entdeckt. Seine Söhne fest anschauend, sprach der Vater weiter, und seine Stimme zitterte jetzt leicht. „Ihr habt es verdient, die Wahrheit zu kennen. Mein Vater hat mir diese Geschichte erzählt und dieser hat es von seinem Vater erzählt bekommen und so fort. Niemand weiß genau, wann sich alles zugetragen hat, aber das ist auch nicht wichtig.“ Die drei Brüder vergaßen völlig, dass sie gerade aufstehen wollten, und da Vater nie viel zu sagen pflegte, musste es etwas sehr Wichtiges sein. Gebannt lauschten sie auf seine Worte und atmeten flach, um ihn ja nicht zu stören. Der ständige Regen musste aufgehört haben und man konnte von draußen die Hühner leise scharren hören, so still war es im Zimmer. „In einer klaren Sternennacht“, fuhr der Vater endlich fort, „fiel einst meinem Ur-Ur-Großvater, Jan hieß er, glaube ich, ein Licht am Himmel auf. Es strahlte hell, viel zu hell für einen Stern und bewegte sich schnell über das Firmament. Erstaunt darüber, was dies sein könnte, blieb mein Vorfahre stehen und beobachtete die Erscheinung. Das Licht schien auf ihn zuzukommen, und es wurde von Sekunde zu Sekunde heller. Als es fast herangekommen war, hielt es mein Vorfahre nicht mehr aus. Angst kroch in seine Seele, kreatürliche nackte Angst vor dem Unbekannten, die seine Füße von allein antrieben wegzurennen. Doch er zwang sich, irgendwie stehen zu bleiben. Er schloss die Augen, um nicht geblendet zu werden, und hielt gleich darauf seine Hände fest vor das Gesicht, als er ein fast schon schmerzhaftes Gleißen auf seiner Haut spürte. Es schien seinen ganzen Körper zu durchdringen, und für einen kurzen Moment fühlte er sich nackt und bloß. Dann war es vorbei und das Licht war erloschen. Finsternis umhüllte ihn wie eine schwarze Decke, und obwohl er die Augen weit aufriss, konnte er nichts erkennen. Was war das? Ist es weg? Er horchte, doch außer dem kalten Wind, der an seinen Haaren zauste und ihn frösteln ließ, war es still. Doch dann hörte er plötzlich eine tiefe, unnatürlich laute und emotionslose Stimme. Sie schnitt durch die Stille wie ein scharfes Schwert und ließ alles andere unwichtig erscheinen. „Höre Jan. Wir kommen von weither. Hab keine Furcht. Wir haben dich beobachtet und haben deine Sippe ausgewählt. Eines Tages wird ein Kind auf deinen Feldern gefunden werden, und ihr sollt es aufnehmen und Eno nennen. Beschützt es gut, denn es ist eure einzige Hoffnung. Es wird -“. In diesem Moment zuckte ein greller Blitz durch die Nacht, gefolgt von einem Donner, dessen Stärke mit nichts vergleichbar war, was Jan je gehört hatte. Eine Titanfaust umklammerte ihn und fegte ihn etliche Meter weit in einen Graben. Der Boden zitterte wie bei einem Erdbeben, und dann war es vorbei. Er lag in dem Graben am Rand seines eignen Feldes und atmete heftig. Seine Augen waren geschlossen und er glaubte zu träumen. Vorsichtig lauschte er in sich hinein und vergewisserte sich, dass er außer einigen Prellungen heil geblieben war. Irgendetwas schien ihn beschützt zu haben, denn für kurze Zeit war da eine Kraft gewesen, die ihn spielend hätte zerquetschen können. Doch fast gleichzeitig hatte er eine andere, entgegengesetzte Kraft gespürt, die ihn einhüllte wie in Watte, und trotzdem war er viele Meter durch die Luft geschleudert worden. Er blieb noch ein paar Minuten liegen, froh, noch am Leben zu sein, und da es um ihn still blieb, stand er schließlich mit einem Ächzen auf. Suchend blickte er sich im Dunkeln um, sah zum Himmel empor, und da er nichts entdecken konnte außer den blinkenden Sternen, ging er schließlich zum Haus zurück. Erstaunt stellte er fest, dass niemand wach geworden war und sogar die Hunde fest schliefen. Hatte er das alles vielleicht nur geträumt? Er ging ins Haus und im Licht der brennenden Öllampe konnte er seine dreckigen Kleider sehen, die aufgeschrammten Knie und etwas Blut, das von seiner Stirn tropfte. Es konnte also wahrlich kein Traum gewesen sein. Jan wusch sich, zog saubere Kleidung an und ging dann ins Bett. Er lag noch sehr lange wach und grübelte über die Worte nach, die er auf dem Feld gehört hatte. Dann schlief er schließlich ein. Die Sonne weckte ihn und es schien ein Sommertag zu werden wie jeder andere. Er behielt alles für sich, um seine Familie nicht zu beunruhigen und ging nach dem Frühstück wie gewohnt hinaus aufs Feld zur Arbeit. Doch dann sah er sie, die Spur der Vernichtung. Eine kreisrunde verbrannte Fläche, tief in den Boden gestanzt, die eigentlich nur bestätigte, was gestern Nacht passiert war, und was Jan bereits erfolgreich aus seinem Gedächtnis verdrängt hatte. Ängstlich schaute er in das metergroße Loch und konnte tief unten sogar etwas Grundwasser erblicken, welches sich über Nacht gesammelt hatte. Dann rannte er zurück, so schnell seine Beine es ihm erlaubten und erzählte alles hektisch seiner Frau. Die glaubte ihm nicht, und erst als sie beide auf das Feld hinausgegangen waren, wurden ihre Augen groß. Nach kurzer Beratung waren sie sich einig geworden. Sie schaufelten das Loch gemeinsam zu und nichts erinnerte mehr an die schreckliche Nacht. Da man ihnen im Dorf sowieso nicht glauben würde und sie kein Aufsehen erregen wollten, beschlossen sie, über alles den Mantel des Schweigens zu legen. Aber was sie gesehen und was Jan gehört hatte, das konnten sie nicht vergessen, ja irgendetwas sagte ihnen, dass sie es nicht vergessen durften. Über die Jahre hinweg entstand eine Legende, die von Generation zu Generation weitergegeben wurde, aber an die niemand mehr so recht glauben wollte. Bis -“ Der Vater trank hastig aus einem Krug einige Schlucke Wasser und es schien so, als sammelte er Kraft, um fortzufahren. Seine Hände, die er die ganze Zeit über gefaltet hatte, umklammerten nun den Tisch. Obwohl Vater stark war, sah es so aus, als ob er sich am Tisch festhalten musste, um nicht umzufallen. In Mutters starren Augen, die immer noch eine imaginäre Brotkrume anstarrten, schlich sich eine Träne, die langsam ihre Wangen herunterlief. Die Stille im Zimmer war noch tiefer geworden und sogar die Hühner mussten ihr unablässiges Scharren für diesen einen Moment aufgegeben haben. Eno, der sich am schnellsten fasste und voller Wissbegierde gerade eine oder gleich zwei Fragen auf einmal stellen wollte, hielt inne, als Vater langsam eine Hand hob, seinen Kopf senkte und sich räusperte. Diesen Augenblick sollte Eno niemals vergessen. Vater schaute auf und sah Eno direkt in die Augen. Die Mutter riss sich endlich von der imaginären Brotkrume auf dem Tisch los und blickte mit feuchten Augen und einem um Verzeihung heischenden Blick ebenfalls zu ihrem Sohn. Eno fühlte sich unbehaglich und rutschte auf dem Stuhl nach hinten. Irgendetwas war nicht richtig. Er konnte es spüren. Seine Brüder drehten sich ihm zu allem Überfluss ebenfalls zu, als wenn er plötzlich ein großes Mal auf der Stirn hätte. Vaters Blick wurde weich und mit gepresster Stimme flüsterte er „Du, Eno, warst das Kind, das deine Mutter und ich vor achtzehn Jahren in der Nacht auf dem Feld schreien hörten, wie es von meinen Vorfahren einst prophezeit wurde.“
Eno spürte einen dicken Kloß im Hals und alles erschien ihm plötzlich unwirklich. Die Brüder starrten ihn erstaunt an, vielleicht zum ersten Mal richtig, denn sie musterten unwillkürlich Enos blonde Haare, die blauen Augen und die kleine, fast zierliche Gestalt. Walter und Karl hatten beide dichtes schwarzes Haar und braune Augen wie ihre Mutter. Die Unterschiede waren eigentlich nicht zu übersehen, doch erst jetzt begriffen sie, dass Eno nicht ihr leiblicher Bruder war. Nach all der Zeit, die sie zusammen verbracht hatten, unvorstellbar. Mutter stand wortlos auf und stellte sich hinter Eno. Sie schlang zärtlich ihre Arme um ihn, zog ihn an ihre Brust und küsste ihn auf den Kopf. Dann hauchte sie mit erstickter Stimme: „Eno, du bist unser Sohn und wir haben dich alle sehr lieb. Du gehörst zu uns, und das soll auch immer so bleiben. Vater und ich haben aber beschlossen, dass du die Wahrheit kennen sollst.“ Sie löste sich fast widerwillig von Eno, trat zurück und setzte sich wieder an den Tisch. Niemand sagte etwas. Die Brüder waren einfach zu verblüfft und schauten hilfesuchend ihren Vater an, darauf wartend, dass dieser böse Scherz schnell ein Ende finden würde. Eno aber vergaß für eine Weile zu atmen und tat es dann umso öfter, sodass man ihn angestrengt keuchen hörte. Endlich war es Vater, der das Schweigen durchschnitt wie ein scharfes Schwert. Er sprach einfach das Dankgebet, als ob alles wie früher wäre, und wie immer fassten sich alle mechanisch an den Händen, froh irgendetwas zu tun. Aber es war nicht wie immer. Schon gar nicht für Eno. Enos Gedanken wirbelten wild durcheinander wie trockenes Laub, und obwohl er überrascht sein sollte, war er es nicht. Tief im Innern schien er es immer geahnt zu haben. Doch sobald er versuchte, den Gedanken an seine Vergangenheit festzuhalten, entglitt er ihm wieder wie ein glitschiger Fisch, den man mit den Händen aus dem Wasser ziehen wollte. Als Vater geendet hatte, hielt Eno immer noch die Hände seiner Brüder, und da niemand zuerst loslassen wollte, blieben alle sitzen und blickten Eno abwartend an. Endlich bemerkte Eno die Blicke und ließ die Hände erschrocken los, als wenn sie plötzlich zu heiß geworden wären. Er stand fluchtartig auf, brummelte etwas von wegen alleine sein und rannte aus dem Haus. Die Mutter und seine Brüder wollten ihm nachgehen, aber Vater hielt sie mit einer entschiedenen Handbewegung zurück.
Eno spürte den einsetzenden Regen nicht, der unablässig auf ihn nieder trommelte und noch um einiges stärker geworden war. Er merkte auch nicht, wohin er ging, bis er sich auf dem Feld wiederfand, von dem Vater erzählt hatte. Etwas in seinem Inneren wusste plötzlich, dass es hier gewesen war, wo seine Eltern ihn gefunden hatten. Einem Instinkt folgend richtete er seinen Blick zum Himmel. Der Regen hatte aufgehört und obwohl am Nachthimmel dunkle Wolken hingen, war wie durch ein Wunder ein kleines Stück Sternenhimmel zu sehen. Nicht viel, aber es schien ihm, als wenn ein Licht dort oben heller leuchtete als alle Sterne, die er je gesehen hatte. Sicher waren es nur seine überreizten Nerven, die ihm etwas vorgaukelten. Spät nachts lief er frierend, müde und völlig durchnässt nach Hause. Seine Brüder schliefen schon, doch seine Eltern hatten noch auf ihn gewartet. Sie umarmten ihn so, als ob er eben erst von einer langen Reise zurückgekommen wäre. Mutter hatte eine warme Decke gebracht und Vater schürte das Feuer im Kamin, das mittlerweile völlig heruntergebrannt war. Dann sagte der Vater sanft und in seinen Augen leuchtete es: „Ich wollte dir eigentlich die Sachen morgen geben, aber vielleicht ist gerade jetzt der beste Augenblick dafür. Er bückte sich und verschwand durch die niedrige Seitentür in die Scheune, die direkt neben dem Haus lag. Eno konnte ihn in der alten großen Truhe kramen hören, die immer abgeschlossen war. Als er nach kurzer Zeit zurückkam, hatte er einen Stab aus Holz dabei. In der anderen Hand hielt er ein Tuch. Es konnte aber auch eine alte Windel sein, dachte Eno bei sich. Er reichte Eno den Stab und das Tuch mit den Worten: „Das haben wir bei dir in der Nacht vor achtzehn Jahren gefunden, als wir dich fanden.“ Dann fasste er unter sein Gewand und holte eine filigran gearbeitete Metallkette heraus. Sie bestand aus vielen kleinen Ringen und hatte eine mattgraue Farbe, die an minderwertiges Eisen erinnerte. Die Kette besaß keinen Verschluss und man musste sie über den Kopf streifen. Vaters Stimme schien für Eno wie aus weiter Ferne zu kommen: „Diese Kette war um deinen Körper gewickelt. Ich habe versucht herauszufinden, ob es sich bei diesen Dingen um etwas Besonderes handelte. Der Stab und das Tuch sind nichts wert und für die Kette bekommt man höchstens einen Kupferling beim Händler in der Stadt. Es wurde mir versichert, dass es um eine simple wertlose Eisenkette handelt, die niemand je tragen würde, so hässlich ist sie. Es tut mir leid, aber das ist alles, was deine wahren Eltern dir mitgegeben haben. Wir wissen nicht, warum du bei uns bist, aber wir wissen, dass du zu uns gehörst, für immer.“ Mit diesen Worten legte er Eno die Kette um den Hals. Sie fühlte sich erstaunlich leicht an, und man spürte sie kaum beim Tragen. Dann nahm Eno den etwa anderthalb Meter langen Stab aus dunklem poliertem Holz. Er war glatt und makellos, keine Einkerbung, kein noch so kleines Astloch war auf dem fast schwarzen Holz zu sehen. Obwohl der Stab schwer aussah, war er unnatürlich leicht und lag gut in der Hand. Zuletzt nahm Eno das Tuch. Es war ein festes grobes Leinentuch, das bei näherem Betrachten wie eine Windel aussah und wahrscheinlich auch eine war. Ausgebreitet war das Tuch erstaunlich groß und man konnte sich darin einwickeln, wenn man denn wollte. Eno wollte nicht. Er bedankte sich bei seinen Eltern für die Aufbewahrung der Sachen, nahm fast behutsam seine neuen Besitztümer und verschwand in seinem Zimmer. Er wollte alleine sein und seine Eltern verstanden das. Eno legte sich in sein Bett und glitt erst nach geraumer Zeit in einen unruhigen Schlaf. Er träumte von dunklen Ungeheuern, die ihn verfolgten, und wie er weit weg von zu Hause in einem fernen Land weilte und Dinge sah, die kein Mensch zuvor gesehen hatte. Plötzlich wurde er von einem finsteren Schattenwesen angegriffen. Er rang mit ihm und gerade als seine Sinne zu schwinden drohten, wachte er auf und sah Mutter an seinem Bett knien, in der rechten Hand eine Öllampe haltend. Sie streichelte ihm das Gesicht, lächelte verständnisvoll und schob eine widerspenstige Haarsträhne aus seiner schweißnassen Stirn. „Bist du wach, mein Sohn?“ Eno, der ins Licht der Lampe blinzelte und froh war, dem Albtraum entkommen zu sein, nickte nur. „Ich muss dir noch etwas sagen mein Junge“, flüsterte die Mutter. „Wann warst du das letzte Mal krank?“ Sie wartete nicht auf eine Antwort, sondern fuhr fort „Du weißt es nicht, kannst dich nicht erinnern? Es ist wahr. Du bist immer gesund gewesen, solange ich zurückblicken kann. Nicht einmal einen Schnupfen hattest du wie deine Brüder. Vielleicht war es das, was dir deine Eltern wirklich mitgegeben haben. Eine strotzende Gesundheit, um die dich jeder beneidet. Ich hab gewartet, bis alle schliefen, um dir das zu sagen. Es macht dich zu etwas Besonderem, und das ist in einer Zeit, wo man schnell als Hexer oder Schlimmeres verschrien oder sogar verurteilt werden kann, nicht gut. Behalte es also für dich. Wir lieben dich alle, so wie du bist. Gute Nacht und schlaf schön. Möge Gott dich segnen.“ Sie küsste Eno auf die Stirn und verließ leise das Zimmer. Enos Augen brannten plötzlich und heiße Tränen rannen ihm übers Gesicht. Er fuhr sich mit dem Handrücken über die nassen Augen und lag noch lange wach in dieser seiner Nacht, die Nacht vor seinem achtzehnten Geburtstag. Nun war etwas anderes daraus geworden und obwohl vieles von dem Gehörten ihn nicht wirklich überrascht hatte, war es doch ein Unterschied, nur zu ahnen oder wirklich zu wissen. Vielleicht war zu viel Kenntnis gar nicht so gut, wie Eno immer geglaubt hatte. Er verdrängte die dunklen Gedanken mit aller Macht, und erst viel später fiel er in einen unruhigen Schlaf. Hätte er zu diesem Zeitpunkt die Wahrheit geahnt, wäre vielleicht alles anders gekommen. Aber Ahnung und Wissen machen oft den Unterschied aus, ob jemand sich aufmacht. Gewissheit zu finden, dabei Risiken eingeht und sich selbst dabei findet oder das Wissen einfach annimmt und letztlich nichts damit anzufangen weiß, und es nichts mehr gibt, wofür der Einsatz lohnt. Eno hatte eine Ahnung in sich, was das alles bedeuten könnte, aber er war weit davon entfernt, sich deshalb aufzumachen, um die Wahrheit zu finden. Aber die Wahrheit sollte ihn finden.
3.Von Anschuks und Fengos
Am anderen Morgen fühlte sich Eno zerschlagen und müde. Der kurze Schlaf, in den er endlich gefallen war, hatte ihn nicht erfrischt. Mit einem Mal fiel ihm alles wieder ein. Er war nicht der leibliche Sohn von Mutter und Vater. Seine wirklichen Eltern hatten ihn irgendwo auf einem Feld liegen lassen, und er glaubte sogar, zu spüren, dass er anders als seine Brüder war, nicht nur vom Aussehen. Eno fühlte einen Stich in der Brust, und als hätte man ihn mit eiskaltem Wasser übergossen, sprang er auf. Er hörte, wie seine Brüder bereits den Wagen luden und die Sonne schon hoch am Himmel stand. Man musste ihn schlafen gelassen haben, heute zu seinem Geburtstag. Er war ihnen dankbar, aber nun stieg er rasch die Treppe hinunter, wusch sich, zog sich an, und erst dann lief er auf den Hof. Mit herzlichen Glückwünschen zum Geburtstag wurde er begrüßt. Er war nun volljährig und es war heute sein Tag. Alle umarmten ihn und schlugen ihm freudig auf die Schulter. Eno ließ alles mit sich geschehen, wie in einem seiner Träume, von denen er in letzter Zeit zu viele hatte. Dann gab er sich einen Ruck, lächelte zaghaft und tat zumindest so, als wenn alles wie eh und je war. Mit Eifer half er seinen Brüdern, den Wagen fertig zu beladen, das Pferd anzuschirren, denn er freute sich schon darauf, das erste Mal zum Markttag mit zu dürfen. Es war abhängig vom Wetter mindestens eine Tagesreise vom Dorf in die Stadt Trangall. Sie würden in einer Raststätte die Nacht verbringen müssen. Diesmal kam Vater nicht mit und er durfte erstmals mit seinem älteren Bruder Walter fahren. Nach dem Frühstück verabschiedeten sich die ungleichen Brüder. Er drückte Karl fest an sich, umarmte Vater und Mutter, und dann spannten sie gemeinsam das Pferd vor den Wagen und Eno stieg mit Walter auf den Kutschbock. Mutter wischte sich über die Augen, als ob ihr etwas ins Auge geflogen war. „Hey jah“, schrie Eno im Übermut und knallte mit der alten Lederpeitsche zweimal laut in der Luft, wie er es so oft geübt hatte. Dann setzte sich der schwere voll beladene Wagen unter Walters heftigen Zügelschlagen und Rufen in Bewegung. Er sah freudig zurück zu seinen Eltern und seinem jüngeren Bruder, die winkend im Hoftor standen. „Macht keine Dummheiten und kommt schnell wieder zurück!“, rief Mutter noch von weitem. Vater hatte seinen starken Arm um Karls‘ Schulter gelegt, und beide winkten ihnen nach. Dann ging es schon auf die holprige Straße und in die erste Biegung. Ein letztes Mal schaute Eno zu seiner Familie zurück, sah das Haus, in dem er aufgewachsen war, roch die Felder und die braune Erde und fühlte zugleich wie sich sein Herz schmerzhaft zusammenzog, so als würde er dies alles ein letztes Mal sehen und der Abschied in Wirklichkeit ein Abschied für immer sein. Er verscheuchte diesen dummen Gedanken, von dem er nicht wusste, warum er ihm gerade jetzt in den Sinn gekommen war. Mit Gewalt wandte er sich ab, aber erst nachdem er sich das Bild seiner ‚Familie’ ein letztes Mal fest eingeprägt hatte und schaute nach vorne auf den Weg zur großen Stadt Trangall, die er bald mit eigenen Augen sehen durfte. Von der Seite stupste Walter ihn an, lächelte auffordernd und hielt ihm die Zügel hin. Überrascht nahm Eno die abgewetzten Lederriemen, trieb das Pferd an, spürte den Ruck, der durch den Wagen ging, als der Gaul mit Macht anzog, und in diesem Augenblick fühlte Eno sich plötzlich erwachsen.
Sie waren einige Zeit unterwegs gewesen, als es zu nieseln anfing. Es war kühl an diesem Morgen und der Weg war alles andere als trocken und fest. Oft mussten Eno und Walter vom Wagen absteigen und mit dem Schlamm kämpfen, der immer wieder versuchte, ein oder mehrere Räder mit Gewalt festzuhalten. Es war anstrengend für die beiden Brüder und obwohl sie nach einer Weile vor Schmutz starrten und ihre Kleider nass und klamm waren, behielten sie ihre gute Laune, denn es war ja bald Markttag. Ein fröhliches Tummeln, Feilschen, Spiele und noch viel mehr erwartete sie. Nach den Geschichten, die Eno gehört hatte, gab es dort Zigeuner, Kneipen und Mädchen. Was wollte das Herz eines achtzehnjährigen Jungen mehr?
Manchmal, wenn Walter nicht auf ihn achtete, blickte Eno auf ein Bündel, welches ganz vorn im Wagen lag. Ein dunkler Stab schaute heraus. Dann wurde er still und fiel ins Grübeln. Walter, der dies zu ahnen schien, schwieg und kümmerte sich in diesen Momenten noch intensiver um die Lenkung des Wagens, in die sie sich nun teilten. Der Himmel hatte ein Einsehen und ihr ständiger Begleiter, der unablässige Nieselregen, hatte endlich aufgehört. Die Sonne kam kurz zum Vorschein und es war Zeit für eine kleine Mittagsrast. Allerdings zogen von Osten wieder dunkle Wolken heran und verhießen nichts Gutes. Die beiden Brüder spannten das Pferd ab und banden es an einen Baum. Sie füllten einen Eimer mit Wasser vom nahegelegenen Bach und ließen das Pferd saufen. Erst dann machten sie es sich mit Mutters Wegzehrung unter einer alten Eiche bequem und begannen zu essen. Die dunklen Wolken kamen viel zu schnell über sie, und es fing wieder an zu regnen. Dicke Tropfen fielen und es würde nicht mehr lange dauern, bis sie sich durch das dichte Blätterdach gearbeitet hatten. Es wurde auch wieder kälter. Der Regen und das von den dichten Zweigen herabtropfende Wasser verursachten ein monotones Geräusch, sodass sie nicht hören konnten, wie sich auf der Straße Reiter näherten. Erst als diese plötzlich vor ihnen auftauchten, sprangen Walter und Eno erschrocken auf. Der vorderste Reiter war sehr groß und breitschultrig. Er hatte ein narbiges Gesicht und trug ein schwarzes Lederwams, welches vor Nässe glänzte. Die Pferde dampften vom schnellen Ritt und erst jetzt sahen die Brüder noch zwei weitere Männer, die sich schnell näherten. Sieben in dunkles Leder gekleidete Männer mit langen Schwertern waren es, die sie von ihren Pferderücken finster ansahen. Walter fing sich als erster von dem Schreck und fragte: „Hallo ihr edlen Herren, was können mein Bruder und ich für euch tun? Wir sind auf dem Weg zum Markt.“ Die Männer antworteten nicht. Der vorderste Reiter mit der Narbe im Gesicht musterte die Brüder schweigend und fragte endlich ungeduldig mit einem ausländischen Akzent „Von woher kommt ihr?“
Walter antwortete wahrheitsgemäß „Aus einem kleinen Dorf, einen halben Tagesritt von hier edle …“ Der Narbige unterbrach Walter schneidend, und seine Stimme klang jetzt wie rostiges Eisen. „Kennt ihr ein Findelkind in dieser Gegend, in seinem Alter?“, und dabei zeigte er streng auf Eno. Walter erstarrte für den Bruchteil einer Sekunde und antwortete dann fast ohne zu überlegen „Aber nein, meine Herren. Wir kennen kein Findelkind.“ Eno wurde blass. Angst drückte seine Kehle zu und legte sich wie ein Mühlstein auf seine Brust. Er sah, wie Walters Hände zitterten und das schien auch der Aufmerksamkeit des Narbigen nicht entgangen zu sein. „Was lügt ihr Pack mich an. Ich frage euch ein letztes Mal. Wo ist der Bengel, der nie Eltern gehabt hat?“
Walter schwitzte und noch bevor er etwas entgegnen konnte, antwortete Eno schnell; „Aber hoher Herr, wir sind nur zwei unwissende Bauern. Ich bin zum ersten Mal auf dem Weg zum Markt in Trangall und war noch nie weiter vom Dorf entfernt. Ihr müsst …“, „Ich muss gar nichts!“, schrie der Narbige jetzt ungehalten und zeigte auf einen seiner Männer. „Du, fessele sie und dann tu, was du tun musst, um endlich die Wahrheit aus ihnen herauszuholen.“ Der schwarz gekleidete Mann, auf den der Narbige gezeigt hatte, trieb sein Pferd dichter heran, stieg ab und riss sein Schwert aus der Scheide. Walter und Eno bewegten sich unwillkürlich rückwärts, bis ihre Rücken an die dicke Eiche stießen, die sie als Lagerplatz gewählt hatten. Der Mann hatte einen wilden Blick und das Schwert hielt er leicht schräg nach oben. Man musste schon blind sein, nicht den geübten Schwertkämpfer in ihm zu erkennen. Die beiden Brüder hatten nie eine Waffe in der Hand gehalten und nicht nur Walter wusste, dass sie keine Chance hatten. „Schnell Eno, lauf weg!“, rief er verzweifelt und drehte sich auf der Stelle um und begann zu rennen. Doch bevor Walter um die Eiche herum in den Wald fliehen konnte, surrte ein Pfeil und bohrte sich mit einem hässlich schmatzenden Laut in seinen Rücken. Eno blieb wie erstarrt stehen. Dies konnte doch alles nicht real sein! Er sprang zu Walter und versuchte ihn zu stützen, aber Walter sackte schwer und lautlos zusammen. Dunkles Blut lief aus seinem Mund und seine Augen blickten unnatürlich geweitet. Eno schossen Tränen in die Augen und mit dem Schmerz kam die Wut. Er stand auf, drehte sich zu dem Angreifer, und gerade als dieser mit dem Schwert auf ihn einschlug, sprang Eno zur Seite, lief zum Wagen und schloss seine Faust um das schwarze Holz seines Stabes. Er schwang ihn, und wie von selbst glitt er durch seine Finger und wirbelte vor den Angreifer. Dieser aber lachte und bewegte sich mit spielerisch tänzelnden Bewegungen auf ihn zu. Sein Schwert zuckte vor wie eine Schlange, und nur mit Mühe und Glück gelang es Eno auszuweichen. Gerade als er glaubte, diesem Schlag entgangen zu sein, riss der Krieger seinen Arm hoch und versetzte ihm mit dem Ellbogen einen fürchterlichen Hieb ins Gesicht. Dann wurde es Nacht um Eno.
Mit dem Erwachen kam die Erinnerung. Walter war von einem Pfeil getroffen worden. Mit einem Ruck wollte Eno aufstehen, doch eine starke Hand drückte ihn auf sein Lager zurück. „Bleib liegen. Du hast ganz schön was abbekommen.“
Diese Stimme war anders, weniger forsch und ungehalten als die der schwarzen Reiter, eigentlich fast schon sanft. Er öffnete die Augen oder versuchte es zumindest, denn seine linke Gesichtshälfte war vollkommen zugeschwollen. Mit dem rechten Auge blinzelte er in die Dunkelheit, während das linke einfach nur höllisch schmerzte. Es war mittlerweile Nacht geworden. Er musste einige Stunden geschlafen haben. Er fragte in die Finsternis hinein „Wer seid ihr?“
„Man nennt mich Neves. Ich habe dich gefunden. Du hattest wohl eine kleine Meinungsverschiedenheit?“, antwortete eine warme tiefe Bassstimme. „Mein Bruder, was ist mit ihm?“, keuchte Eno. „Er lebt. Ich konnte den Pfeil entfernen, aber er hat viel Blut verloren.“
„Was ist mit den Räubern? Sind sie …“
„Sie sind weg“, unterbrach ihn Neves. „Hier trink!“. Eine bauchige Flasche wurde an seine Lippen gedrückt. Gierig trank Eno und schon nach dem ersten Schluck hustete er. „Was ist denn das für ein Trank?“, stieß er zwischen heftigen Hustenattacken aus.
„Das ist ein Geheimrezept meiner Großmutter und macht sogar Tote wieder lebendig.“
Neves grinste, und obwohl Eno dies nicht sehen konnte, verzog auch er seinen Mund zu einem dankbaren Lächeln und sagte: „Na dann gib mir noch einen Schluck. Ich fühle mich eher tot als lebendig.“ Der Alkohol floss wie flüssiges Feuer durch seine Kehle, erzeugte sofort wohlige Wärme in seinem leeren Magen und schien tatsächlich den pochenden Schmerz in seinem Gesicht zu betäuben. Vorsichtig setzte er sich auf. Mit dem noch heilen rechten Auge sah er nun im Licht eines Lagerfeuers, welches Neves entzündet haben musste, Walter auf dem Boden liegen. Neves musste ihn auf weiches Moos gebettet haben und Walter schien fest zu schlafen. Ein frischer Verband war um seine Schulter gewickelt. Plötzlich erstarrte Eno, als er nicht weit von ihrem Lagerplatz in der Dunkelheit fein säuberlich in einer Reihe sieben Leichen im Schein des flackernden Feuers erkannte. Mäntel und auch einige Decken lagen über ihnen ausgebreitet, sodass Eno nicht sehen konnte, wer sie waren. Aber natürlich konnten das nur die schwarzen Reiter sein. „Was ist mit denen dort geschehen?“, fragte er ängstlich und zeigte mit einer Hand unwillkürlich in die Richtung des grausigen Fundes. Neves grinste fast schon schelmisch und erst jetzt nahm Eno sich Zeit, die fremdartigen Züge, das dichte schwarze Haar, die blauen Augen und die seltsame Kleidung aus derbem Stoff und altem Metall des Mannes genauer anzusehen, der ihn gerettet und vielleicht sogar ganz alleine die sieben Krieger getötet hatte. Aber das konnte nicht sein. Das war unmöglich. Er hatte selbst gesehen, wie gewandt und tödlich diese Männer waren. Als ob Neves ahnen würde, was in seinem Kopf vorging, sagte er „Es ist nicht so, wie es aussieht. Ruh dich aus. In dieser Nacht bist du sicher. Übrigens, wie lautet eigentlich dein Name? Nun, da du meinen kennst, ist es an der Zeit, auch deinen zu hören. Meinst du nicht auch?“
Eno nickte nur mechanisch und sagte dann „Mein Name ist Eno. Ich war mit meinem Bruder Walter auf dem Weg zur Stadt Trangall. Da haben uns die Männer angegriffen und meinen Bruder -“, er stockte und schluckte schwer „haben sie einfach von hinten erschossen.“
„Haben sie jemanden gesucht?“, fragte Neves im Plauderton weiter, als wenn er sich nach dem Wetter erkundigte, während er Holz auf das Feuer legte, das die Flammen gierig verschlangen. In Eno begann wieder die Angst herauf zu kriechen, wie eine Natter. Da er nicht antwortete, fuhr Neves im gleichen sanften Ton fort: „Du musst nicht antworten. Ist vielleicht auch nicht wichtig.“ Natürlich war es wichtig, sogar sehr, aber irgendetwas hielt Eno davor zurück wahrheitsgemäß zu antworten. Also sagte er nichts darauf. Das Lagerfeuer prasselte und Schweigen breitete sich zwischen den beiden ungleichen Männern aus. Nach einer Weile stand Neves auf und ging zu seinem Pferd. Er zog ein Leinentuch aus dem Packen hinter dem Sattel hervor und kam langsam zu Eno zurück. Aus dem Leinentuch wickelte er eine kleine Dose und nachdem er sie geöffnete hatte, begann er, Enos Gesicht vorsichtig zu bestreichen. Kaum aber hatte Neves sein Gesicht mit den Fingern berührt, zuckte ein greller Blitz hinter Enos Augen und eine lähmende Schockwelle raste vom Kopf bis zu seinen Füßen. Kam dies von dem Schmerz in seinem geschwollenen Gesicht? Er wusste es nicht und traute sich auch nicht, den unbekannten Mann zu fragen. Er fühlte sich ein wenig schwindelig. Alles ging viel zu schnell, sodass Eno nur tief und heftig einatmete und sich schüttelte, als ob er fröstelte. „Es ist eine besondere Salbe“, fuhr Neves fort. Er schien Enos ungewöhnliche Reaktion nicht bemerkt zu haben oder wenn doch, dann zeigte er es nicht und schrieb es den Schmerzen zu. „Sie wird dich schnell heilen. Ich wünschte, ich hätte auch ein solches Mittel für deinen verletzten Bruder.“
„Danke“, sagte Eno ehrlich „für alles, was du für uns getan hast. Ohne dich wären mein Bruder und ich wohl nicht mehr am Leben.“
„Na na, nicht so voreilig mein Junge. Du hast gut gekämpft. Ich sah, wie du den Stab geschwungen hast und nur aufgrund deiner Unerfahrenheit hast du verloren.“
„Also hast du alle Räuber allein besiegt?“, fragte Eno ungläubig. „Ich habe so meine Methoden“, entgegnete Neves schmunzelnd. „Aber lass uns von dem Stab sprechen. Woher hast du ihn?“
Eno antwortete und irgendwie hatte er das Gefühl doch nicht alles sagen zu dürfen. „Ich habe ihn bei meiner Abreise geschenkt bekommen.“ Zumindest war es nicht gelogen, dachte Eno. „Hast du noch mehr ‚geschenkt‘ bekommen?“, fragte Neves neugierig und grinste schon wieder breit über‘s ganze Gesicht. Sein dunkler Vollbart verdeckte seine Lippen fast zur Gänze, und die blauen irgendwie viel zu alten Augen blitzten wie zwei Diamanten in dem wettergegerbten Gesicht des Fremden. „Wir sind arme Leute und normalerweise bekommt man außer einem guten Essen oder einem reparierten Werkzeug nichts geschenkt. Allerdings ist heute mein achtzehnter Geburtstag und mein Vater gab mir den Stab mit auf die Reise als mein Geburtstagsgeschenk.“ Wieder hatte er die Wahrheit und doch nicht alles gesagt. „Na dann herzlichen Glückwunsch, und jetzt wird geschlafen“, sagte Neves entschieden. „Morgen bei Sonnenaufgang, wenn du ausgeruht bist, kümmern wir uns um deinen Bruder. Er muss schnellstens zu einem Arzt in die Stadt. Er wird heute Nacht bestimmt ein wenig zu Kräften kommen und wir können ihn morgen in den Wagen legen. Ich halte Wache. Was hältst du davon, Eno?“
Eno war nicht sicher, was er von so viel Freundlichkeit halten sollte, willigte er aber doch ein, da er todmüde war. Irgendwie wollte er auch nichts mehr wissen, von den Räubern, dem Stab, dem Findelkind und auch nichts mehr über den Fremden, der sie gerettet hatte und dessen Fragen ihm allmählich komisch vorkamen. Die Salbe roch zwar schlecht aber schien tatsächlich zu helfen. Es tat schon gar nicht mehr so weh, und er hatte sogar das Gefühl, dass die Schwellung in seinem Gesicht zurückging. So hatte sich Eno seinen Geburtstag nicht vorgestellt. Er liebte Abenteuer, aber, wenn man selbst in eines verstrickt war, dann war das etwas ganz anderes. Eigentlich hatte er schon jetzt genug davon und sehnte sich nach Hause. Heimweh überfiel ihn, wie er es nie gekannt hatte, krampfte seinen Magen schmerzhaft zusammen und ließ ihn schwer atmen. Fast musste er weinen, zum zweiten Mal in kurzer Zeit. Mit den Gedanken bei dem verletzten Walter, bei Klaus und seinen Eltern glitt Eno endlich in den ersehnten Schlaf.
Am anderen Morgen weckte ihn ein zischendes Geräusch. Schlagartig war er wach und sah wie Neves das Feuer mit Wasser löschte. Erst dann wurde ihm bewusst, dass er keine Schmerzen mehr im Gesicht hatte und mit beiden Augen Neves beobachtete, wie er das kleine Lager abbrach. „Na, willst du ewig schlafen?“, sagte Neves und fügte hinzu „Kümmere dich um deinen Bruder. Ich glaube, er ist erwacht.“
Schlagartig war Eno wach. Mit einem Ruck sprang er auf und rannte die paar Schritte zu Walters Lager. „Wie geht es dir?“, fragte er hastig, als er die geschlossenen Augen seines Bruders sah. „Es geht schon“, flüsterte Walter mit halberstickter Stimme und ein leises kraftloses Husten schüttelte ihn. „Kannst du aufstehen? Soll ich dir helfen?“
Da kam Neves kopfschüttelnd dazu und rief. „Was für eine Frage Eno! Komm, fass mit an.“