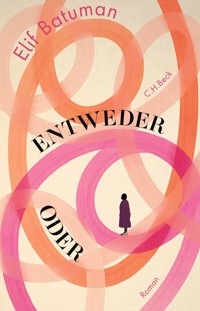
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Bestsellerautorin Elif Batuman ist eine der originellsten Stimmen der amerikanischen Gegenwartsliteratur. Ihr Roman über die junge Literaturstudentin Selin erzählt ebenso witzig wie rührend von der mühsamen Überwindung postpubertärer Scham, von misslungenen ersten Malen und dem völlig verkopften Versuch, erwachsen zu werden. "Entweder/Oder" ist das großartige Porträt einer sehr klugen Frau mit einer sehr komplizierten Gefühlswelt - und eine genauso geistreiche wie lustige Persiflage auf das Akademiker-Milieu. Es ist Selins zweites Jahr an der Harvard-Universität. Sie leidet unter Liebeskummer, möchte Schriftstellerin werden und nimmt seit Kurzem Antidepressiva. So weit, so normal. Doch Selins Problem mit dem Leben ist komplizierter: Sie neigt dazu, alles zu zerdenken, und steht sich dadurch ständig selbst im Weg. Ihr Versuch, sich die Welt über Bücher zu erklären - von Kierkegaard bis Nabokov -, um ja keinen Fuß in die Wirklichkeit setzen zu müssen, liefert Selin keine klaren Ergebnisse. Was ist das soziale Konzept einer Party, wie emanzipatorisch darf, will oder muss ich sein, und warum ist Sex eigentlich so erstrebenswert? Um ihre Fragen ans Leben zu beantworten, begibt sie sich – etwas verkrampft, aber durchaus risikobereit – mitten hinein und gerät dabei an so manchen düsteren Ort ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Elif Batuman
ENTWEDER /ODER
Roman
Aus dem Englischen von Claudia Wenner
C.H.Beck
ZUM BUCH
Die Bestsellerautorin Elif Batuman ist eine der originellsten Stimmen der amerikanischen Gegenwartsliteratur. Ihr Roman über die junge Literaturstudentin Selin erzählt ebenso witzig wie rührend von der mühsamen Überwindung postpubertärer Scham, von misslungenen ersten Malen und dem völlig verkopften Versuch, erwachsen zu werden.
Es ist Selins zweites Jahr an der Harvard-Universität. Sie leidet unter Liebeskummer, möchte Schriftstellerin werden und nimmt seit Kurzem Antidepressiva. So weit, so normal. Doch Selins Problem mit dem Leben ist komplizierter: Sie neigt dazu, alles zu zerdenken, und steht sich dadurch ständig selbst im Weg. Ihr Versuch, sich die Welt über Bücher zu erklären, von Kierkegaard bis Nabokov, um ja keinen Fuß in die Wirklichkeit setzen zu müssen, liefert Selin keine klaren Ergebnisse. Was ist das soziale Konzept einer Party, wie emanzipatorisch darf, will oder muss ich sein, und warum ist Sex eigentlich so erstrebenswert? Um ihre Fragen ans Leben zu beantworten, begibt sie sich – etwas verkrampft, aber durchaus risikobereit – mitten hinein und gerät dabei an so manchen düsteren Ort … «Entweder/Oder» ist das großartige Portrait einer sehr klugen Frau mit einer sehr komplizierten Gefühlswelt – und eine genauso geistreiche wie lustige Persiflage auf das Akademiker-Milieu.
ÜBER DIE AUTORIN
Elif Batuman, geboren 1977 in New York City, ist eine türkisch-amerikanische Schriftstellerin, Literaturwissenschaftlerin und Journalistin. Sie war Finalistin für den Pulitzer-Preis und schreibt regelmäßig für The New Yorker.
Claudia Wenner lebt als Schriftstellerin, Publizistin und Übersetzerin in Frankfurt und Pondicherry. Sie übersetzte u.a. Virginia Woolf, Aravind Adiga, Monique Truong und Kristina Gorcheva-Newberry.
INHALT
Teil 1: September 1996
DIE ERSTE WOCHE
DIE ZWEITE WOCHE
DIE DRITTE WOCHE
DIE VIERTE WOCHE
Teil 2: Der Rest des Herbstsemesters
OKTOBER
NOVEMBER
DEZEMBER
Teil 3: Das Frühjahrssemester
JANUAR
FEBRUAR
MÄRZ
APRIL
MAI
Teil 4: Sommer
JUNI
JULI
AUGUST
HINWEISE ZU DEN QUELLEN
WEITERE ZITIERTE WERKE
Und ist es nicht eine Sünde und Schande: man schreibt Bücher auf die Art, daß man die Menschen am Leben irre, seiner leid werden läßt, bevor sie mit ihm beginnen, anstatt daß man sie leben lehrt.
Sören Kierkegaard, Entweder/Oder
Teil 1
September 1996
DIE ERSTE WOCHE
Als ich in Cambridge ankam, war es schon dunkel. Ich zog den Reisekoffer meiner Mutter über das Kopfsteinpflaster zum Fluss. Riley war richtig wütend, dass wir nicht in einem der historischen, efeubewachsenen Gebäude untergebracht wurden, wo junge Männer einst mit ihren Dienern gewohnt hatten, sondern im Mather House. Doch Geschichte interessierte mich nicht und mir gefiel, dass es Einzelzimmer gab und man daher nicht umständlich ausklügeln musste, wie sich eine Reihe von Räumen unterschiedlicher Größe, in denen Menschen mit ihren Dienern gewohnt hatten, aufteilen ließ.
Seit unserem Abschied im Juli auf einem Parkplatz an der Donau hatte ich nicht mehr mit Iwan gesprochen. Da wir beide auf Reisen waren und außerdem nie viel miteinander telefoniert hatten, hatten wir keine Telefonnummern ausgetauscht. Allerdings war ich mir ganz sicher gewesen, eine E-Mail, die alles erklären würde, von ihm vorzufinden, wenn ich wieder zur Uni kam. Schließlich war es kaum vorstellbar, dass es keine Erklärung geben würde oder dass jemand anderes alles erklären würde oder dass die Erklärung nicht als E-Mail zu mir gelangen würde, denn alles zwischen uns hatte per E-Mail stattgefunden.
Mather ähnelte einem außerirdischen Raumschiff: uneinnehmbar, alt und futuristisch gleichzeitig, seine Kräfte sammelnd. Ich hielt meinen Ausweis vor den Kartenleser und die Tür zum Computerraum ging mit einem Klick auf. Mir fiel auf einmal ein, dass ich ein Buch gelesen hatte, in dem sich eine Frau nach sieben Jahren Gulaghaft zum ersten Mal im Spiegel sah und statt ihres eigenen Gesichts dasjenige ihrer Mutter erblickte. Mir wurde sofort klar, wie beschämend, wichtigtuerisch und beschränkt es von mir – einer amerikanischen Collegestudentin, die ihre E-Mails drei Monate lang nicht gecheckt hatte – war, mich mit einer politischen Gefangenen zu vergleichen, die sieben Jahre in einem Gulag verbracht hatte. Aber es war zu spät – ich hatte den Gedanken schon gedacht.
Erst beim dritten Versuch tippte ich mein Passwort richtig ein. Informationen ergossen sich über den Bildschirm: erst Infos über den Computer und die verschiedenen von ihm verwendeten Protokolle, danach, wann und wo er mich das letzte Mal gesehen hatte, und zum Schluss der Satz, der mein Herz hüpfen ließ: «Sie haben Post.»
Wie ich bereits im Voraus wusste, stand dort Iwans Name. Bevor ich las, was er geschrieben hatte, sah ich mir die E-Mail als Ganzes an, um zu sehen, wie lang sie war und wie sie aussah. Ich sah sofort, dass etwas nicht stimmte. «Etwas stimmt also nicht», las ich. Ich sah die Worte «schockiert» und «Monster»: «Es schockiert mich, dass du so ein Monster in mir siehst», stand dort. «Ich weiß, dass du mir kein Wort glaubst.» Und: «Hoffentlich sagst du mir, warum ich so schrecklich bin, damit ich mich verteidigen kann.»
Ich musste die ganze Mail zweimal lesen, bevor mir klar wurde, dass sie drei Monate alt war. Iwan hatte sie im Juni abgesendet, als Antwort auf eine wütende E-Mail, die ich ihm geschickt hatte, bevor ich den Campus verließ. Streng genommen war seine Antwort durch alles, was in den Monaten seitdem zwischen uns geschehen war, widerlegt worden, und doch wirkte sie auf mich wie ein neues letztes Wort von ihm, weil sich im Posteingang zwar ein paar weitere Nachrichten fanden, aber keine von Iwan. Seit dem Tag auf dem Parkplatz hatte er mir nicht mehr geschrieben – seitdem er mich an sich gedrückt hatte und dann in seinen Wagen gestiegen und davongefahren war.
Die meisten anderen E-Mails waren ebenfalls mehrere Monate alt und überholt. In einer von Peter stand: «Ich muss unbedingt wissen, wann genau du in Budapest landest.» Und eine von Riley, die fragte, ob es okay sei, wenn wir uns für eine Notunterkunft bewarben, damit wir nicht im Mather House wohnen mussten. Nur zwei Mails waren neueren Datums: Die eine war eine Aufforderung, meinen Finanzhilfeberater unmittelbar zu kontaktieren. Die andere war vom neuen Präsidenten der Türkischen Studentenvereinigung und teilte mit, dass jemand in Brookline einen Laden entdeckt hatte, der Pastirma nach Kayseriart verkaufte: gewürztes, luftgetrocknetes Fleisch, von dem manche behaupten, es sei etymologisch mit Pastrami verwandt. Die Mail endete mit dem Satz: «Wenn ihr Kayseri-Pastirma mögt, könnt ihr sie dort kaufen.»
Ich verließ das E-Mail-Programm und benutzte das furchtbare Finger-Programm, um zu sehen, wo Iwan sich befand. Er hatte sich zwei Stunden zuvor von Berkeley aus eingeloggt, war also dort. Nur dass er mir nicht mailte.
◊
Swetlana kam zwar nur einen Tag nach mir auf dem Campus an, aber es kam mir vor wie Jahre. Ich hatte bereits in meinem neuen Zimmer geschlafen, in der Cafeteria gefrühstückt und zu Mittag gegessen, war schon mehrmals zum Lagerraum gegangen und hatte immer den gleichen Wortwechsel gehabt: «Wie war dein Sommer?» «Und deiner?» «Wie war’s in Ungarn?» Ich gab keine klare Antwort, was mich ärgerte. Ich wusste selbst noch nicht, wie ich dazu stand.
«Wie war’s in Ungarn?», fragte mich Lakshmi mit verschwörerisch funkelndem Blick beim Lunch. «Ist irgendwas passiert?» Ungeachtet des starken Gefühls, dass eine Menge Dinge passiert waren, beantwortete ich die Frage wahrheitsgemäß so, wie Lakshmi sie gemeint hatte: Nichts war passiert.
Als ich mich am selben Abend mit Swetlana in ihrer lagerhausartigen Suite im neuen Quincy House traf, stellte sie mir dieselbe Frage. Wir saßen auf Sitzsäcken unter einem Edward-Hopper-Poster und sprachen über alles, was uns widerfahren war, seitdem wir das letzte Mal miteinander geredet hatten – das war in einer Telefonzelle am Bahnhof von Kál gewesen, und Swetlana befand sich zu jener Zeit im Haus ihrer Großmutter in Belgrad. Ich erzählte ihr, dass ich Iwan am Ende in Budapest angerufen hatte, dass er mit einem Kanu aufgetaucht war und wir die ganze Nacht im Haus seiner Eltern gesessen hatten.
«Ist was passiert?», fragte sie mich und klang dabei matter und amüsierter als Lakshmi, meinte jedoch dasselbe.
«Na ja, dieses eine ist nicht passiert», sagte ich.
«Ach, Selin», erwiderte Swetlana.
Als mir Iwan zum ersten Mal von dem Sommerprogramm in Ungarn erzählte, sagte er, ich solle in Ruhe darüber nachdenken, weil er mich zu nichts zwingen wollte. Swetlana sagte, wenn ich mich dafür entscheiden würde, würde Iwan versuchen, Sex mit mir zu haben – eine Möglichkeit, die ich noch nie in Betracht gezogen hatte. Ich träumte die ganze Zeit von Iwan vor mich hin, stellte mir verschiedene Gespräche vor, die wir führen würden, wie er mich ansehen, mein Haar berühren und mich küssen würde. An Sex hatte ich dabei nie gedacht. Was ich über Sex wusste, entsprach in keiner Weise dem, was ich mir wünschte oder bisher empfunden hatte.
Ich hatte mehrfach versucht, einen Tampon zu verwenden. Tampons galten unter den älteren oder aufgeklärteren Mädchen irgendwie als emanzipierter und feministischer als Maxi-Binden. «Ich steck ihn mir einfach rein und vergess die Sache.» Was die beunruhigende Schlussfolgerung nahelegte, dass jemand permanent an seine Maxi-Binde dachte. Trotz alledem probierte ich alle paar Monate Tampons aus. Es war immer das Gleiche: Ganz gleich, in welche Richtung ich den Applikator drückte und wie systematisch ich sämtliche unterschiedlichen Winkel ausprobierte, mich durchzuckte jedes Mal ein rasender Schmerz. Ich las die Gebrauchsanweisung immer wieder. Etwas machte ich eindeutig falsch, nur was genau? Es war vor allem deshalb besorgniserregend, weil ich mir ziemlich sicher war, dass das Ding eines Typen – Iwans – größer sein würde als ein Tampon. Doch an diesem Punkt schaltete sich mein Gehirn aus und die Sache wurde undenkbar.
Swetlana sagte, ich sollte besser darüber nachdenken. «Du willst doch nicht in so eine Lage geraten, ohne es dir vorher überlegt zu haben», sagte sie vernünftigerweise. Es stellte sich jedoch heraus, dass es nichts zu überlegen gab. Wenn Iwan mit mir Sex haben wollte, würde ich einwilligen, das war völlig klar. Vielleicht würde er imstande sein, mir zu sagen, was ich falsch gemacht hatte, und es würde nicht so schlimm werden wie mein Versuch, mir einen Tampon einzuführen.
Aber er hatte keinerlei Versuch unternommen, und die Abende, an denen wir bis spät in die Nacht zusammengesessen hatten, hatten wir nur geredet. Dann reiste er Ende Juli nach Thailand, und ich hatte immer noch zehn Tage im Dorf vor mir, umgeben von Menschen, die nicht er waren. Seltsame Sache: In gewisser Hinsicht war ich nach Ungarn gefahren, um Iwan besser zu verstehen – weil sein Ungarischsein ihm so viel bedeutete –, und erst in den Dörfern hatte ich einigermaßen entsetzt festgestellt, dass Ungarischsein zwar einen Großteil von Iwan ausmachte, dass Iwan jedoch nur ein winziger Teil von Ungarn war. Irgendwie hatte ich immer gewusst, dass Ungarn ein ganzes Land war, Heimat von Millionen Menschen, die Iwan nie begegnet waren und die ihn weder kannten noch mochten. Aber anscheinend hatte ich das nicht richtig durchdacht, sonst wäre ich nicht so überrascht gewesen.
War das der Moment, in dem ich den Faden der Geschichte verloren hatte, die ich mir erzählte – den Faden der Geschichte meines Lebens?
Swetlanas Reise nach Belgrad – ihre erste Heimkehr nach dem Krieg – war gut verlaufen, vielleicht auch dank all der vorbereitenden Gespräche mit ihrem Analytiker. Es gab nur einen einzigen Augenblick, im Laden unter der Wohnung ihrer Großmutter, als sie eine Münze fallen ließ, sich nach ihr bückte und sich plötzlich voller Grauen daran erinnerte, dass eine Milchflasche einst auf genau diesen Bodenfliesen zerbrochen war. Sie konnte sich nur noch daran erinnern, an nichts anderes, auch nicht daran, was so grauenhaft gewesen war. Sie hatte nur noch vor Augen, wie das Glas unwiederbringlich zerbarst, wie die Splitter überall hinflogen und die Milch sich wie eine Teufelshand über die schmuddeligen Fliesen ausbreitete.
«Verschüttete Milch»[1], seufzte Swetlana. «Manchmal wünschte ich, mein Unterbewusstsein wäre ein bisschen origineller.»
Ich hätte gern noch mehr darüber erfahren, doch Swetlana dachte kaum noch an Belgrad, sondern mehr an die Wildnis, durch die sie gerade ein paar Studienneulinge im Rahmen eines Vorbereitungsprogramms geführt hatte. Ich vergaß immer wieder, dass es solche Vorbereitungsprogramme gab. Neben dem in der freien Natur gab es noch eines über Geisteswissenschaften und ein zivildienstliches, bei dem Häuser für Unterprivilegierte gebaut wurden. Sie waren nicht kostenlos – auch die nicht, bei denen man Häuser baute –, daher war ich nie auf die Idee gekommen, mich anzumelden. Doch Swetlana hatte das Programm in der freien Natur absolviert, als sie mit dem Studium anfing, und hatte dort eine tiefgreifende Erfahrung gemacht, die mit dem Erhabenen verbunden war.
Während ich Swetlana zuhörte, schwankte ich zwischen dem Glauben, dass ihr etwas richtig Gutes widerfahren war, und tiefer Befremdung. Sie schilderte, was für intensive Beziehungen sie zu langweilig klingenden Studienanfängern geknüpft hatte, mithilfe von Vertrauensübungen, Spielen und Aktivitäten, die mit den Jahren eigens zu diesem Zweck ersonnen worden waren. Im Gegensatz zu mir schien es sie nicht zu stören, dass die Erfahrung auf einen zugeschnitten war, damit man ein bestimmtes Gefühl bekam.
Swetlanas Schilderungen wurden zunehmend von Scott dominiert, mit dem sie die Gruppe leitete. Jede Gruppe wurde von zwei Personen geführt, einer männlichen und einer weiblichen. Ich schloss daraus, dass es spannend gewesen sein musste, mit einem Typen ein gemeinsames Ziel zu haben, das Zusammenarbeit, Diskussionen und Verantwortung erforderte. Dass alle so sehr auf diese Mama-Papa-Verkleidung mit Campingmotto abfuhren, hatte aber auch etwas Unheimliches. Hatte ich dieses Gefühl vielleicht nur, weil meine Eltern geschieden waren?
Scott, der sich für Bluegrass und Zen interessierte, wirkte wie einer von den nichtssagenden, superamerikanischen Mackern, die Swetlana urkomisch fanden. Aus irgendeinem Grund waren solche Typen mir gegenüber immer negativ eingestellt. Als Swetlana darauf zu sprechen kam, dass Scott in einem höheren Semester war und eine Freundin hatte, deutete ihr Ton an, dass sie von einem Vergleich mit Iwan, der für uns beide sofort offensichtlich war, entweder ablenkte oder ironisch Bezug darauf nahm. Sie betonte immer wieder, dass ihre Beziehung zu Scott genau den Umständen entsprechend war, weil sie einander vollkommen vertrauen mussten, einander körperlich kennen mussten, sich gegenseitig helfen mussten, natürliche und künstliche Hindernisse zu überwinden und die Dinge zu tragen, die ihre Körper brauchten, um in der Wildnis zu überleben, während sie Tag und Nacht von der unbegreiflich schönen Natur eingehüllt waren.
«Wie soll ich je wieder ohne dich leben?», hatte Scott Swetlana an ihrem letzten gemeinsamen Abend gefragt. Swetlana hatte zu ihm gesagt, dass es möglicherweise für sie beide am besten sei, dass ihre Nähe zueinander enden würde, denn nie fühle sie mehr Leben und Tiefe in sich als im Wald. «Ich hab ihm gesagt, ‹Im Winter kann ich ziemlich mattiert sein›», erklärte sie und verweilte, was typisch für sie war, genüsslich bei diesem ungewöhnlichen Wort. «Und ich möchte dich auf keinen Fall enttäuschen.»
«So was brauchst du mir nicht zu sagen, dass du mich enttäuschst oder so», hatte Scott geantwortet. «Wir gehen ja nicht zusammen aus.»
Warum traf mich das so? Swetlana zitierte doch nur, was Scott zu ihr gesagt hatte. Es hatte nichts mit mir zu tun und Swetlana schienen seine Worte nichts auszumachen.
◊
Ich saß mit Swetlana in ihrem Zimmer und wir gingen das Vorlesungsverzeichnis durch. Es war ein magischer Katalog. Das gesamte Wissen der Menschheit befand sich darin, versteckt in der Form seiner Klassifizierung. Es war wie bei Merkwürdiges aus dem Frankweiler-Geheimarchiv, wo die Antwort auf die Frage, ob die Statue wirklich von Michelangelo stammte – eine Antwort, von der die Bedeutsamkeit alles Folgenden abhing –, sich direkt in den Aktenschränken befand, wo die Kinder sie nur finden mussten, was aber voraussetzte, dass sie errieten, unter welchem Stichwort sie abgelegt war.
Ich fand, dass die Fachbereiche und Studiengänge irgendwie falsch organisiert waren. Warum waren die verschiedenen Abteilungen der Literatur nach der Geografie und Sprache kategorisiert, die Naturwissenschaften hingegen nach dem Abstraktionsgrad oder nach der Größe des Studiengegenstands? Warum klassifizierte man die Literatur nicht nach der Anzahl der Wörter? Warum die Naturwissenschaften nicht nach dem Land? Warum hatte die Religion ein eigenes Institut und gehörte nicht zur Philosophie oder Anthropologie? Warum gehörte die Geschichte nichtindustrieller Völker zur Anthropologie und nicht zur Geschichte? Warum wurden die wichtigsten Themen nur indirekt angesprochen? Warum gab es kein Institut für die Liebe?
Noch bevor ich Swetlana dazu befragte, wusste ich, dass sie das Institutssystem verteidigen würde – aber wie? Die Kategorien hatte sich eindeutig irgendwer willkürlich ausgedacht.
«Na ja, natürlich sind sie willkürlich», sagte Swetlana, «aber nur, weil es sich um historische, nicht um formale Kategorien handelt.» Das Vorlesungsverzeichnis, sagte sie, sei darauf zurückzuführen, wie das Wissen der Menschheit seit den alten Griechen in Disziplinen aufgeteilt worden sei. Das Wissen könne nicht von seiner Aneignung und Organisation getrennt werden, daher sei die Unterteilung in historische Kategorien von großer Bedeutsamkeit. Swetlanas Klugheit beeindruckte mich, aber ich war nicht ihrer Meinung. Ich fand, die zufällig geerbten Kategorien müssten überarbeitet und eine bessere Ordnung für sie ersonnen werden.
Ich misstraute Swetlanas Einstellung gegenüber historischen und anderen Einflüssen generell. Sie dachte permanent an den Einfluss ihrer Eltern und war darin nicht die Einzige – in Harvard erzählte einem die Hälfte der Leute spätestens nach fünf Minuten vom Einfluss, den ihre Eltern ausübten.
Sie sagten, von den eigenen Eltern besessen zu sein, sei allgemein üblich, aber dieses Gefühl hatte ich nicht. Als wir in der Highschool Hamlet lasen, langweilte ich mich zu Tode. Ich wollte nur raus, das war alles, woran ich in dieser Zeit dachte. Und Hamlet hatte es geschafft, er war auf dem College und kam dann zurück und verhedderte sich in einem abstoßenden Drama über das Sexualleben seiner Mutter. Nur weil sein Vater es ihm gesagt hatte, in einem seitenlangen, moralisierenden Erguss voller Selbstmitleid, der weder das Wort an Hamlet richtete noch von ihm handelte, sondern die alte Leier über die Lust war, die nur auf Müll Jagd machte. Woraufhin Hamlet herumging und spitze Bemerkungen über seine Mama von sich gab. Für so einen Menschen reichte meine Geduld nicht.
Im letzten Frühjahr hatte Swetlana mehrere Monate vor der Entscheidung für ihr Hauptfach Rat von ihren Eltern und von anderen alten Leuten erbeten. Ihr Vater hatte ihr seine Unterstützung seltsamerweise mit den Worten versagt: «Ich kann dich unmöglich besser kennen, als du dich selbst kennst.» Das war typisch für Swetlanas Dad. Er wusste eindeutig, was sie tun sollte, wollte ihr aber eine Lektion erteilen. Ihre Mutter sagte zu ihr: «Frag Gould», was bedeutete, sie solle Stephen Jay Gould fragen, weil sie einmal in seiner Sprechstunde gewesen war und zwei Stunden lang mit ihm über die Abstammung des Menschen gesprochen hatte. «Ich beneide dich wirklich um diese Auswahlmöglichkeiten», hatte Swetlanas Mutter gesagt. «Ich wünschte, ich könnte mit dir tauschen. Ich freu mich so sehr für dich, dass mir manchmal die Tränen kommen.»
Swetlana tat so, als hätte sie noch nicht alle ihre Kurse gewählt, doch es war klar, dass das nicht stimmte. Wir nahmen beide am Russischschnellkurs teil, den man machen musste, wenn man darauf hoffen wollte, ein richtiges Buch auf Russisch lesen zu können, bevor die vier Jahre College vorbei waren. Der Kurs zählte doppelt. Wenn man einen Hauptfachkurs belegte und ein Tutorium im Hauptfach, hatte man einen vollen Kurs mit vier Unterrichtsstunden.
Ich belegte aber noch einen weiteren Kurs und konnte mir einen aussuchen, der nicht obligatorisch war. Ich verstand nicht, warum die meisten anderen keinen fünften Kurs auswählten. Die Kosten waren dieselben. Man musste nur einen ‹Antrag› ausfüllen und zu einem Dekan gehen. Diese Treffen waren zugegebenermaßen nie sehr erfreulich. Hinter dem angespannten Gesichtsausdruck eines Dekans waren Anzeichen dafür erkennbar, dass er alles, was man sagte, fortwährend so interpretierte, als sei man entweder unvernünftig oder unreif. Doch aus irgendeinem Grund erlaubten die Gesetze ihrer Welt keine direkte Konfrontation. Sie lächelten nur die ganze Zeit starr und versuchten einem zu sagen, man solle nicht so viele Kurse besuchen, und wenn man lange genug ebenso starr zurücklächelte, unterschrieben sie den Antrag letztendlich.
Ich schlug das Vorlesungsverzeichnis auf gut Glück auf.
Vergleichende Lit. 140: Zufall
«Unvorstellbare menschliche Anstrengungen werden unternommen, um das Ärgernis oder die Gefahr des Zufalls zu bekämpfen und einzuschränken», schreibt C. G. Jung im englischsprachigen Vorwort zum I Ging. Wir wollen darüber nachdenken, wie moderne Künstler und Denker diese Anstrengungen umlenkten und den Zufall als künstlerische Praxis einsetzten, als Verbindung zum Unbewussten, um sich den Zwängen des Gedächtnisses und der Vorstellungskraft zu entziehen …»
Als ich erfuhr, dass es ein Literaturseminar über den Zufall gab, schlug mein Herz höher, insbesondere weil es hieß «behandelt werden unter anderem der Flaneur und das Flanieren – der Random Walk – als Paradigma urbanen Erlebens». Zufall und Wahrscheinlichkeit waren Iwans Spezialgebiet. Er war deswegen nach Kalifornien gegangen und hatte seine Dissertation über Random Walks geschrieben! Über Flaneure sprachen alle, die sich mit Literatur befassten, und ich hatte nie verstanden, warum – sie sagten einfach, jemand sei ein Flaneur oder ein Voyeur, und wirkten zufrieden. Ich wusste, dass Flaneure umhergingen und dass Voyeure Dinge betrachteten. Das kam mir nicht besonders interessant vor, und ich war mir auch nicht sicher, warum ein Random Walk erforschenswert war. Vielleicht hing beides miteinander zusammen?
Die Seminarbeschreibung endete mit den Themen, über die diskutiert werden würde, unter anderem «André Bretons surrealistische Strategien in Nadja», was mir ebenfalls wie ein Zeichen vorkam, weil mir das Bändchen Nadja in Swetlanas Zimmer so oft aufgefallen war: ein Leichtgewicht mit auffällig minimalistischem Einband und über den Text verteilten, nummerierten Schwarz-Weiß-Fotos. Als ich einmal auf Swetlana wartete, die gerade duschte, hatte ich die ersten Zeilen gelesen. «Wer bin ich? Wenn ich mich ausnahmsweise einem Sprichwort anvertraute: Warum sollte tatsächlich nicht alles darauf hinauslaufen, zu wissen, mit wem ich ‹umgehe›?» Der Absatz ging noch seitenlang weiter. Interessanter fand ich die Frage, mit wem ich umging.
«Ist das was?», fragte ich sie und hielt das Buch hoch. Swetlana war gerade zur Tür hereingekommen, sah total rosarot aus und hatte ein Handtuch um ihr Haar geschlungen.
Sie sah nachdenklich aus. «Ich weiß nicht, ob es dir gefällt. Du kannst es aber gerne leihen.»
Ich schlug die letzte Seite auf und las: «Die Schönheit wird KONVULSIV sein oder nicht sein.»
«Vielleicht ein andermal», sagte ich und stellte das Buch zurück ins Regal.
Monate später hatte Iwan mir eine lange E-Mail über Fellini und Clowns geschrieben, deren Schlusszeile gelautet hatte: «Die Schönheit, sagt Breton, wird konvulsiv sein oder nicht sein.» Ich hatte beschlossen, mir Nadja noch einmal anzusehen, wenn ich wieder bei Swetlana im Zimmer war, um herauszufinden, ob es irgendwelche Anhaltspunkte gab, die mir mit den Clowns weiterhelfen könnten. Doch irgendwie war das Collegejahr vorbeigegangen, ohne dass ich je wieder in ihrem Zimmer auf sie warten musste und die Zeit gehabt hätte, mir ihre Bücher anzusehen.
Jetzt lebten wir bereits in verschiedenen Häusern, und bald würden wir noch weiter voneinander entfernt wohnen, sie würde heiraten, und ich würde nie wieder in ihrem Zimmer auf sie warten. Wie kurz und wie magisch es doch war, dass wir alle so nah beieinander wohnten und jeweils in den Zimmern der anderen ein und aus gingen und vor allem damit beschäftigt waren, Rätsel zu lösen. Weil es sich um einen vorübergehenden Zustand handelte, war es umso wichtiger, das Richtige zu tun – und den richtigen Anhaltspunkten zu folgen.
◊
Es war spannend, in der Buchhandlung von der Informatikabteilung zur Vergleichenden Literaturwissenschaft zu gehen: Auf den Regalen, die sich gleich um die Ecke befanden, standen Bücher, die einen normalen Umfang und interessante Umschläge hatten und aussahen, als würden sie auch im normalen Leben gelesen – im Gegensatz zu den dickleibigen Informatiklehrbüchern. Die Bücher für das Seminar über den Zufall wirkten abweisend kühl. Ob ich die gerne lesen würde? Bücher, die mir gefielen, waren normalerweise dick, beschrieben Möbel oder erzählten von Menschen, die sich verliebten, und hatten oft Einbände mit hässlichen Gemälden aus dem neunzehnten Jahrhundert. Die Bücher über den Zufall gehörten zu der Sorte schmaler, attraktiver Bücher mit breiten Rändern, die zu lesen ich nie richtig Lust hatte: Bücher, die experimentell oder hybrid oder postmodern oder lyrisch waren. Warum waren Lyrikbände so teuer, wo sie doch so wenige Wörter enthielten? Die Blumen des Bösen kosteten dreißig Dollar! Ich schlug das Buch auf gut Glück auf: Don Juan in der Hölle. «Die Kleider offen, mit entblößten Hängebrüsten,/Wanden sich Weiber unterm finsteren Gezelt/Und schrien wie Vieh, das man zum Opfer rüstet,/Ein Wehgeheul ihm nach, das immer weiter gellt.» Wie bitte? Wieso waren die Frauen in der Hölle? Dreißig Dollar für so was?
Dann sah ich einen dicken Penguin-Klassiker mit einem schlecht reproduzierten Gemälde auf dem Einband. Auf dem schwarzen Medaillon stand in weißer Schrift:
Ich nahm das antiquarische Buch – $ 7.99 – in die Hand und las, was auf der Rückseite stand: «Mithin: entweder man muß aesthetisch leben oder man muß ethisch leben.»
Ich hatte Herzklopfen. Über so was gab es ein Buch?
◊
Den Ausdruck «Ästhetisches Leben» hatte ich zum ersten Mal in einem Seminar über Konstruierte Welten gehört, das war letztes Jahr gewesen. Wir lasen einen französischen Roman namens Gegen den Strich. Er handelte von einem degenerierten Sprössling eines Adelsgeschlechts, der sich aufs Land zurückzieht und sich dort «dekadenten» Projekten widmet. So züchtet er beispielsweise im Rahmen seines Versuchs, Organisches und Anorganisches einander ähnlich zu machen, Orchideen, die Fleisch ähneln. Nach der Lektüre hatte ich keine hohe Meinung von der Leistung dieses Typen. Doch die Vorstellung von einem ästhetischen Leben fand ich immer noch ungeheuer fesselnd. Nie zuvor hatte ich gehört, dass man sein Leben nach einem anderen Prinzip oder Ziel ausrichten konnte als dem, Geld zu verdienen und Kinder zu bekommen. Niemand sagte je, dass dies das Organisationsprinzip seines oder ihres Lebens sei, aber als ich erwachsen wurde, hatte ich oft wahrgenommen, dass sich Erwachsene benahmen, als sei es ein frivoler Traum oder Luxus, wenn man versuchte, irgendwo hinzugelangen oder etwas zu erreichen, statt sich der ernsten Arbeit des Kinderbekommens und Geldverdienens für diese Kinder zu widmen.
Nie hat irgendwer erklärt, was so bewundernswert am Kinderkriegen war oder warum ein jeder und eine jede automatisch diesem Werdegang folgen sollte. Wenn man sich erkundigte, warum jemand ein Kind bekommen habe oder wozu ein bestimmtes Kind gut gewesen sei, wurde das als Blasphemie betrachtet – so als hätte man gesagt, sie sollen lieber sterben oder das Kind sterbe besser. Es war, als könnte man nicht fragen, was sie beabsichtigt hatten, ohne dass der Tod von jemandem mitenthalten war.
Ganz zu Beginn unserer Freundschaft hatte Swetlana mir eines Tages spontan erklärt, sie glaube, ich versuchte, ein ästhetisches Leben zu führen, und dass dies der Hauptunterschied zwischen uns sei, weil sie nämlich ethisch zu leben versuche. Ich verstand nicht genau, warum das Gegensätze sein sollten, und war einen Moment lang besorgt, sie würde denken, ich fände es okay, wenn man betrog oder stahl. Es stellte sich aber heraus, dass sie etwas anderes meinte: dass ich mehr riskierte als sie und mir mehr aus «Stil» machte, während ihr Geschichte und Tradition wichtiger waren.
Schon bald wurden «das Ethische und das Ästhetische» für uns zum Bezugsrahmen, wenn wir darüber sprachen, worin wir uns unterschieden. In der Wahl ihrer Freunde umgab Swetlana sich gerne mit verlässlichen, langweiligen Leuten, die ihre Seinsweise bestätigten, während ich mich mehr für unzuverlässige Leute interessierte, die andere Erfahrungen und Eindrücke einbringen konnten. Swetlana belegte gerne Einführungen und Überblicksseminare, sie «beherrschte» gerne die Grundlagen, bevor sie zur nächsten Stufe weiterging, und hatte glatte Einser. Mein Horror war es, mich zu langweilen, und deshalb wählte ich lieber besondere Seminare mit interessanten Titeln, auch wenn ich die Voraussetzungen dafür nicht erfüllte und keine Ahnung hatte, worum es ging. Ich verstand, dass man das ästhetisch nennen konnte. Nicht so klar war mir, warum Swetlanas Art ethisch sein sollte und nicht einfach nur «verantwortungsbewusst» und folgsam.
Was uns irgendwie verband, war, dass Swetlana ihrem Vater sehr nahestand, der sie auch dazu gebracht hatte, sich mit Philosophie und Ethik zu befassen und darüber zu diskutieren. Damit konnte ich etwas anfangen. Als ich klein war, fuhr ich mit meinem Vater an den Wochenenden in New Jersey übers Land, nur wir beide, und manchmal hielten wir an und pflückten Äpfel auf Farmen oder beobachteten in Naturschutzgebieten Vögel – meistens fuhren wir jedoch umher, hörten klassische Musik und sprachen über Ethik, Moral und den Sinn des Lebens. Diese Gespräche hatten mir damals sehr gefallen, doch jetzt machte mich das Wort «Ethik» ungeduldig.
Bei dem Versuch, festzustellen, wann genau diese Veränderung einsetzte, fiel mir ein bestimmter Abend ein. Ich war zehn und machte gerade in meinem Zimmer Hausaufgaben, als mein Vater abends an die Tür klopfte und eine unserer langen Fahrten mit dem Auto vorschlug, obwohl es ein Werktag war. Im Wagen fragte mein Vater, ob ich auch der Meinung sei, dass es moralisch gesehen nichts Schlimmeres gebe als Verrat und dass Frauen ganz besonders zum Verrat neigten. Beispielsweise hatte Klytämnestra Agamemnon verraten, als er gerade mit einem Fuß aus dem Bad trat, womit sich die Prophezeiung erfüllte, dass Agamemnon weder zu Land noch zu Wasser sterben würde.
Dass Agamemnon seine Tochter als Opfer für den Trojanischen Krieg getötet hatte, erfuhr ich erst von Swetlana. Klytämnestra war wütend darüber. Ich wollte über nichts davon nachdenken oder gar mein Leben danach ausrichten.
Auf der Buchrückseite stand, im ersten Teil von Entweder/Oder gehe es um das ästhetische Leben und dazu gehöre auch «Das Tagebuch des Verführers», der zweite Teil hingegen handele vom ethischen Leben und bestehe aus Briefen eines Richters über die Ehe.
Das ethische Leben hatte also mit Heirat zu tun. Meine Freundschaft mit Swetlana ging unausgesprochen damit einher, dass sie «in einer festen Beziehung» leben und irgendwann Kinder haben wollte, während ich interessante Liebschaften vorzog, über die ich schreiben konnte. Anscheinend hatte Swetlana das Familienleben nicht mehr genossen als ich, doch hatte es in ihrem Fall dazu geführt, dass sie es erneut versuchen wollte, und alles, was ihren Eltern nicht gelungen war, richtig machen wollte. Ich dagegen fand, dass meine Eltern zum Scheitern verurteilt gewesen waren; ich sah nicht, wie ich es hätte besser machen können.
Wie nicht anders zu erwarten, ging aus dem Text auf der Buchrückseite nicht hervor, welche Art Leben besser war. Dort stand nur: «Will Kierkegaard, dass wir einer der beiden Arten zu leben den Vorzug geben? Oder werden wir auf die existentialistische Idee einer radikalen Wahl zurückgeworfen?» Vermutlich stammte das von einem Professor. Ich erkannte darin die typische Freude eines Professors, einem Informationen vorzuenthalten. Trotzdem kaufte ich das Buch – und außerdem eine gebrauchte Ausgabe von Nadja. Es bestand die Möglichkeit, dass eines dieser Bücher oder vielleicht beide mein Leben veränderten.
◊
Manchmal hatte ich ein merkwürdiges Gefühl, weil Swetlana und ich nicht zusammenwohnten. Im Frühjahr hatten wir das Thema angeschnitten. «Unsere Freundschaft ist eindeutig hochgradig inspirierend», sagte sie, «doch mit jemandem zusammenzuwohnen, dessen Persönlichkeit mindestens so stark ist wie meine, finde ich auch ein bisschen bedrohlich.» Swetlana war der einzige Mensch, der kein Blatt vor den Mund nahm. Mir wäre es peinlich gewesen, auch nur in Gedanken zuzugeben, geschweige denn auszusprechen, dass ich mich von einer starken Persönlichkeit bedroht fühlte. Ich hätte nicht einmal zugegeben, dass ich nicht der Meinung war, alle Menschen seien im Hinblick auf ihre Persönlichkeit gleich. Als Swetlana es dann ausgesprochen hatte, erschien es mir glasklar und nicht mehr strittig. Swetlana hatte die stärkste Persönlichkeit, der ich je begegnet war – viel stärker als meine eigene. Nie hätte sie den Sommer in einem Land am Rande Europas verbracht, das kaum etwas mit ihrer eigenen Vergangenheit zu tun hatte und auch nichts mit der großen abendländischen Geschichte und Kultur. Warum hatte sie dann gesagt, meine Persönlichkeit sei mindestens so stark wie ihre? Ich beschloss, dass sie es aus Höflichkeit gesagt hatte – damit ich ihr nicht mehr übel nahm, dass sie nicht mit mir zusammenwohnen wollte.
Wenn ich andererseits an ihre Zimmergenossinnen im ersten Studienjahr dachte, die im selben neuen Trakt wohnten, so schien deren Dynamik mit Swetlana darauf zu beruhen, dass immer beide Seiten Swetlana übereinstimmend als die stärkere Persönlichkeit erachteten. Sie waren Swetlanas Zuschauerinnen, die sie ermutigten und dafür in einer Art feudalem Tausch beschützt, angeleitet und unterhalten wurden. Wie passte ich dort hinein? Ich konnte mir nicht vorstellen, Dolores und Valerie anzuwerben, damit sie mich anfeuerten, und genauso wenig konnte ich mir vorstellen, mich ihnen anzuschließen, um Swetlana anzufeuern. Ich konnte mir nicht vorstellen, über unsere Stofftiere zu sprechen, indem ich ihre Namen verwendete, oder Guthrie, das Schnabeltier, mit zu den Prüfungen zu nehmen. Warum war all das Swetlana wichtiger, als ihre Zeit mit mir zu verbringen?
Als mich Riley fragte, ob ich mit ihr zusammenwohnen wollte, war ich sofort einverstanden, obwohl ich sie nicht richtig kannte. Riley war der kompromissloseste Mensch, den ich kannte – und der witzigste. Ihre engsten Freunde – Oak, Ezra und Lucas – waren Typen und «nahmen das Komische ernst». Witze zu erzählen, war – wie streiten oder Pingpong spielen – eine der vielen nichtprofessionellen menschlichen Gelegenheitsaktivitäten, die sich auf dem College zu strengen technischen Disziplinen wandelten, die von manchen Tag und Nacht erlernt und als wettbewerbsfähige Berufslaufbahn angestrebt wurden.
Als ich mit ihnen in der Cafeteria war – Riley saß kerzengerade da, nach Katzenart sich selbst genug, die anderen hatten ihre schlaksigen Glieder unter und über dem Tisch ausgestreckt, und alle feuerten Witze hin und her, die sich immer mehr hochschraubten und wie subtile Rechtsfragen weiter verzweigten, was ich so nie für möglich gehalten hätte –, als ich also mit ihnen in der Cafeteria war, hatte ich das zwingende Bedürfnis, solche Leute in meiner Nähe zu haben, um gegen die Launen des Schicksals gewappnet zu sein und um zu lernen, wie man das machte.
Sich vorzustellen, Swetlana könnte sich mit Riley unterhalten oder gar mit ihr zusammenwohnen, war schwierig. Noch schwieriger war die Vorstellung, Iwan könne mit Riley reden, obwohl die beiden tatsächlich einmal miteinander geredet hatten, im Frühling, als er rätselhafterweise auf einmal in der Erstsemester-Cafeteria auftauchte. Dies gehörte zu den vielen Dingen, die er nur getan hatte, um mich zu verwirren.
«Wie kommt es eigentlich, dass du hier bist?», fragte ich.
«Ich war im Science Center und hatte keine Zeit mehr, auf mein Zimmer zurückzugehen. Also hab ich gedacht, ich seh mal nach, ob du hier bist.»
«Aber ich bin mit einer Freundin da.»
«Kann ich denn mit euch essen?»
Mit zunehmender Verzweiflung führte ich ihn an unseren Tisch. «Das ist meine Freundin Riley», sagte ich. «Das ist Iwan.»
«Hallo Iwan», sagte Riley.
«Hallo Riley», sagte Iwan.
Ich saß gegenüber von Riley und Iwan saß neben mir. Riley blickte Iwan an, der ein Salisbury-Steak zerkleinerte – etwas, was Riley nie gegessen hätte. Dann tauchten Oak, Ezra und Lucas auf und schafften es, wie mindestens fünf Personen zu wirken. Sie setzten sich, sprangen dauernd wieder auf, holten sich etwas und tauschten die Plätze. Alle machten Witze über einen Typen, der Morris hieß. Riley erzählte, dass sie einmal einen Kamm genommen hatte, der Morris gehörte. Der Kamm zerbrach und sie hatte ihm einen neuen Kamm gekauft. Da sie dem ersten Kamm nichts angetan hatte, denn er war ja einfach zerbrochen, hatte sie das Gefühl gehabt, verantwortungsbewusst und großzügig gehandelt zu haben. Doch Morris wollte den neuen Kamm nicht und sagte verärgert: «Den habe ich fünfzehn Jahre lang benutzt!» Alles an der Geschichte samt dem Kamm, der auf einmal kaputtgeht, war ganz und gar typisch für Morris.
«Vor fünfzehn Jahren warst du drei und hattest kaum Haare», sagte Riley und wandte sich dabei an einen Fantasie-Morris.
«Vielleicht ist der Kamm so was wie die Uhr in Pulp Fiction», schlug Iwan vor.
Oak, dessen Eltern Hippies waren, starrte Iwan mit seinen runden, blauen, geisteskrank wirkenden Augen an und sagte: «Mein Vater hatte diesen Kamm fünfzehn Jahre lang im Arsch!»
Diese Weiterentwicklung der Kammgeschichte wurde kommentarlos von allen akzeptiert. Ich bewunderte Iwan dafür, dass er einen Beitrag zu dem Witz hatte leisten können, der im Sinne von Riley und ihren Freunden war.
In Swetlanas Wohnblock wohnten am Ende sechs orthodoxe Juden, weil Swetlana mit Dave, dem Alphatypen der Orthodoxen, in einer Gruppe über Moralisches Urteilen gewesen war. Die beiden hatten ihre Wohnblocks wie bei einer dynastischen Heirat zusammengelegt. Dave war so alt wie wir, hatte aber einen üppigen kastanienbraunen Bart und die Stimme eines Rundfunksprechers. Er und Swetlana waren beide sehr artikuliert und direkt und hatten ihre Diskussionen oft stundenlang fortgesetzt, mit, wie Swetlana sich ausdrückte, «beinah sexueller Eindringlichkeit». Swetlana sagte, sie sei vom Denken der Antike geprägt, das die Christen in der Renaissance wiederentdeckt hatten, während Dave sich auf das talmudische System von Frage und Kommentar stütze. Dennoch gebe es eine Ebene, auf der sie sich begegneten, weil beide Systeme von der hebräischen Bibel abstammten.
Das Seminar über Moralisches Urteilen hatte geheißen: «Wenn es keinen Gott gibt, ist alles erlaubt.» Ich verstand nicht, wie man im Jahr 1996 über so etwas ausgedehnte Diskussionen führen konnte. Was konnte man mit jemandem anfangen, der sich nur deshalb nicht asozial verhielt, weil er oder sie Angst davor hatte, Ärger mit Gott zu bekommen?
Rileys Protektion war nicht so erdrückend wie die von Swetlana, dafür aber auch weniger wohlwollend. Vielleicht konnte man erst dann wohlwollend sein, wenn man genau über die Angelegenheiten aller anderen Bescheid wusste. Swetlana sagte, ihr Wohnblock sei fürsorglicher, während meiner kühler sei; diese Kühle hätte Swetlana daran gehindert, sie selbst zu sein, ich würde nicht so viel Fürsorglichkeit brauchen. Stimmte das? Beim Wort «Fürsorglichkeit» bekam ich eindeutig Beklemmungen.
Mein Häuserblock gehörte zum Mather House, wo jetzt auch die Typen wohnten: Oak, Ezra, Lucas, Morris und ein paar freundliche Geologen, die irgendwie an Oak hingen. Riley hasste das Mather House jedoch so sehr, dass sie den Rest von uns – mich, Riley, Rileys Kommilitonin Priya, ebenfalls Studienanfängerin in Medizin, und Priyas Mitbewohnerin Joanne – für das Notunterkunftsprogramm angemeldet hatte. Wir benutzten zwar alle Einrichtungen von Mather, doch unsere Zimmer waren in einem anderen Gebäude: einem mittelhohen Backsteinbau voller Zweibettzimmer mit Geschirrspülmaschine, Mikrowelle, Abfallentleerungsanlage, Teppichfußboden und Zentralheizung. Abgesehen davon, dass jedes Zimmer ein Etagenbett aus Metall und zwei Schlafsaalschreibtische hatte, war alles wie in einem normalen Mietshaus. Dass in einem Gebäude, das aussah, als wohnten dort normale Leute, ein Studierendenwohnheim untergebracht war, fand ich irgendwie unheimlich.
Sogar als noch Shopping-Woche war, fand der Russischschnellkurs statt und wir hatten zwei volle Stunden Unterricht. Alle beschwerten sich, aber mir gefiel es insgeheim. Ich mochte es nicht, wenn die Leute so taten, als hätten wir alle Zeit der Welt. «Sie haben noch so viel Zeit, Sie brauchen sich nicht zu beeilen.» Das sagten die Dekane, wenn man versuchte, fünf Seminare zu belegen. Sie hatten gut reden: Sie waren ja bereits Dekane. Falls sie absichtlich Dekane geworden waren, konnten sie es sich leisten, entspannt zu sein; und falls sie eigentlich gar keine Dekane sein wollten, engagierten sie sich jetzt dafür, alle anderen ebenfalls daran zu hindern, etwas zu erreichen.
Das war das Schlimmste an der Kindheit gewesen: Leute, die einem sagten, wie glücklich man sich schätzen könne, so sorglos leben zu können und keine Verantwortung tragen zu müssen. Es war ein Punkt, in dem ich völlig anderer Meinung war als meine Mutter. Sie sagte, es sei eine ganz wunderbare Sache, dass Kinder in Amerika Kinder sein dürften und nicht wie in anderen Ländern Erwachsene sein mussten, bevor sie erwachsen waren; sie wurden sexualisiert oder zur Arbeit geschickt. In Amerika war die Kindheit eine Zeit des Spiels und der Unschuld, in der man kein Geld verdienen musste und nichts tun musste, was zählte. Als ich klein war, überkamen mich immer große Sehnsucht und ein tiefes Gefühl des Scheiterns, wenn ich von Kindern hörte, die sich künstlerisch oder naturwissenschaftlich oder sportlich hervortaten. Doch meine Mutter betrachtete derartige Wunderkinder mit Mitleid und Sorge: Man hatte ihnen nicht erlaubt, Kinder zu sein.
Nach dem Russischunterricht hatte ich eine Besprechung mit Bob, meinem Finanzhilfeberater. Beim Überqueren des Platzes merkte ich, dass ein erwachsener Mann versuchte, auf sich aufmerksam zu machen. Das war mein Untergang. Er konnte nur Geld wollen. Wenn ich ihm welches gab, verschleuderte ich leichtfertig das schwer verdiente Gehalt meiner Mutter – nur um mich selbst vor einem Mann besser zu fühlen. Wenn ich ihm nichts gab, war ich eine Heuchlerin, da ich regelmäßig Geld meiner Mutter für Dinge ausgab, die ich eigentlich nicht brauchte, beispielsweise für einen Sieben-Dollar-Porenverengenden-Hautreiniger von CVS.
Ich tat, als würde ich den Mann nicht sehen, merkte aber, dass er keineswegs von seinem Versuch abließ, mit der berechtigten Energie von jemandem, der wusste, dass ich mehr Geld hatte als er und dass das ungerecht war. Ich gab auf und tat, wozu er mich zwingen wollte: nämlich, ihn anzublicken. Da sah ich, dass er Real Change verkaufte, die Straßenzeitung, und war erleichtert, weil Real Change genau genommen eine Zeitung war – also eine legitime Ausgabe –, die noch dazu billiger und interessanter war als andere Zeitungen. Ich wusste, dass meine Mutter sie ebenfalls interessant gefunden hätte.
«Real Change finde ich toll», sagte ich zu dem Typen und gab ihm einen Dollar. Mit einer schwungvollen Geste überreichte er mir die Zeitung. Beim Weitergehen überflog ich die Titelseite. Die «VERSCHWÖRUNGSECKE» von John Doe – «meinen richtigen Namen kann ich aus Sicherheitsgründen nicht preisgeben» – entzückte mich wegen des schmissigen Tons und abrupten Endes: «Wie dem auch sei, ich muss jetzt weg, mich verstecken. Ein wortloses Tschüs!» Und warum gab es nicht mehr Zeitungen, die Gedichte abdruckten?
Die Gedichte in Real Change waren, soweit ich sehen konnte, nicht schlechter als die in der Literaturzeitschrift von und für Studierende. Waren die Leute, die auf der Straße lebten, gute Dichter oder dichteten wir einfach schlecht? In Wir, die Mehrzahl, wollen keinen Tofu, hatte sich «Tofu» auf «im Gegensatz zu» gereimt. Die erste Zeile eines anderen Gedichts lautete: «Wir leben in einer Welt, wo Kleinkinder auf Jungfrauen setzen./Kuscheln und Niedlichkeit sind ihre Mätzchen.» Weiter unten stellte sich heraus, dass die Kleinkinder tatsächlich eine Art Amt innehatten, in das sie gewählt wurden. Das konnte ich ausschneiden und daraus eine Collage für Riley machen. Seit Neuestem bastelten wir füreinander Collagen und klebten sie an den Badezimmerspiegel.
Im Wartezimmer des Finanzhilfeberaters dachte ich über ein Gedicht nach, das Hass hieß:
Nichts von alldem wirkt echt auf mich. Hab keine Seele mehr, die wer stehlen kann. Mein Herz besteht jetzt aus Stein. Bitte lasst mich nicht ganz allein.
War das ein gutes Gedicht? Es klang wie ein Song von Nine Inch Nails. Waren Nine Inch Nails gut? Ich war sauer, wenn Leute ein Foto von einem Pissoir herumzeigten und damit eine Diskussion anregen wollten, ob das Kunst sei. Trotzdem wollte ich wissen, ob ein Gedicht gut war. «Bitte lasst mich nicht ganz allein.» War das auch meine Angst? Und vielleicht nicht nur meine, sondern die Angst eines jeden? Ich blickte mich im Wartezimmer des Beraters um und nahm verschiedene Gemälde von Segelbooten in Augenschein. Zwei Stühle weiter lehnte ein Junge, die Beine von sich gestreckt; sein Rucksack lag umgekippt vor ihm auf dem Boden und sah aus wie angeschossen. Es war ein Szenarium, das bei mir die Frage aufkommen ließ, ob das Gedicht, so wie alle anderen Gedichte, wie der ganze Rest der Zeitung, und vielleicht auch noch andere Zeitungen, Ausdruck eines Leids waren, dessen Druck, Veröffentlichung und Verbreitung obszön waren.
Na ja, so ist es halt, dachte ich: Man konnte ja einen rohen Schrei des Leids nicht einfach niederschreiben. Das wäre langweilig und selbstverliebt. Er musste verschleiert und in Kunst verwandelt werden. Nur dann war es Literatur. Wenn man dazu Talent hatte, brachte es die Leute dazu, zu lesen, was man geschrieben hatte, und einem Geld dafür zu geben.
Mein Finanzhilfeberater Bob sagte, es gebe Widersprüche zwischen den Vermögenswerten, die meine Mutter angegeben hatte, und meinem Anspruch auf ein Bundesdarlehen. Er zeigte mir eine Kreditauskunft, aus der hervorging, dass meine Mutter eine Hypothek auf ein Haus in Louisiana aufgenommen hatte. Die Kreditauskunft schien absichtlich Verwirrung zu stiften, doch dann verstand ich, was geschehen war: Die Auskunftei hatte meine Mutter mit meiner Stiefmutter verwechselt, die denselben Vornamen und noch dazu denselben Nachnamen hatte. (Meine Mutter benutzte weiterhin den Namen meines Vaters, weil ihre wissenschaftlichen Publikationen unter diesem Namen erschienen waren.) Sogar der Mittelname meiner Stiefmutter fing mit demselben Buchstaben an wie der Mädchenname meiner Mutter.
«Es ist ein seltsamer Zufall», sagte ich, «weil es eigentlich kein häufiger Name ist – ich meine damit, kein superhäufiger türkischer Name.»
Bob sah aus, als hätte er Schmerzen. «Sie wollen also sagen, dass Nurhan M. Karadağ und Nurhan M. Karadağ zwei verschiedene Personen sind.» Er tat mir leid. Jedes Mal, wenn ich zu ihm ging, verdarb ich ihm den Tag.
Da meine Eltern mehr als hunderttausend Dollar verdienten, hatte ich, abgesehen von einem Darlehen, sowieso schon keinen Anspruch auf finanzielle Unterstützung. Dass sie verschuldet waren, weil sie ihr ganzes Geld für den Prozess um das Sorgerecht ausgegeben hatten, als ich vierzehn war, war egal. Das Sorgerecht wurde am Ende meiner Mutter unter der Bedingung zugesprochen, dass sie nach New Jersey umzog. Sie verkaufte ihre Wohnung mit Verlust, kündigte ihre geliebte Stelle in Philadelphia und fand eine schlechter bezahlte Arbeit in Brooklyn, sodass sie jeden Tag pendeln musste. Im Essex County mieteten wir ein halbes Haus von zwei älteren Italienerinnen, die in der anderen Haushälfte wohnten. Letztendlich war es ganz lustig. Jedes Mal, wenn der Strom oder das Gas abgestellt wurde, kam es mir vor wie ein Abenteuer. Meine Mutter war sich sicher, dass ich eine berühmte Schriftstellerin werden würde. Dann wurde ich an der Harvard-Universität aufgenommen, wie wir es uns immer gewünscht hatten. Meine Mama sagte, dass ich nach Harvard gehen würde, sei der Beweis dafür, dass man sie ebenfalls aufgenommen hätte.
Doch als Harvard sagte, ich hätte keinen Anspruch auf finanzielle Unterstützung, und mir eine andere Uni ein Vollstipendium anbot, zog ich diese andere Uni ernsthaft in Erwägung. Meine Mutter wurde wütend und sagte, ich sabotiere mich immerzu. Sie war stolz darauf, dass sie von ihrem Pensionsgeld Geld für mein Harvardstudium leihen konnte, wenn auch mit Verlust. Auch ich war stolz auf sie. Doch auf mich selbst war ich nicht stolz. Meine Bewerbung um einen Studienplatz wirkte dadurch im Nachhinein verletzend und beleidigend: In all den Essays und Vorstellungsgesprächen und Nachträgen und Briefen ging es scheinbar um einen selbst, um die eigene Besonderheit – aber in Wirklichkeit ging es nur darum, die Eltern zu schröpfen.
Harvard war anscheinend richtig stolz auf seine Einstellung zur finanziellen Unterstützung. Immer hieß es, dass «leistungsabhängige Unterstützung», die für andere Universitäten und Colleges galt, nichts für Harvard seien, weil dort alle so viel leisteten. Wenn Eltern ganz allein für die Studiengebühren aufkamen, bezahlten sie unter anderem für das Privileg ihrer Kinder, Menschen zu begegnen, die eine größere Diversität vorzuweisen hatten.
«Meine Eltern bezahlen dafür, dass er hier sein darf und ich von ihm lernen kann», sagte meine Freundin Leora einmal über einen Typen aus Arkansas, der zu Hause unterrichtet worden war und in ihrer Geschichtsgruppe saß, wo er darüber sprach, dass die Juden Jesus getötet hatten. Als ich klein war, war Leora meine beste Freundin gewesen, dann gingen wir auf verschiedene Mittel- und Oberschulen und waren jetzt zusammen auf dem College. Sie war bereits davon überzeugt, dass jeder Mensch auf Erden antisemitisch ist, also hatte sie von diesem Typen nicht das Geringste gelernt.
Was mir an der finanziellen Unterstützung am wenigsten einleuchtete, war, dass alle ausländischen Studierenden Stipendien bekamen, ganz gleich, wie viel ihre Eltern verdienten. Der Sohn des Prinzen von Nepal war bei uns im Kurs und bezahlte keine Studiengebühren. Iwan hatte mir einmal mit einer herablassenden Bemerkung über Leute wehgetan, «deren Eltern hunderttausend Dollar bezahlten, damit ihre Kinder hier studieren konnten». Hat er etwa nicht gewusst, dass meine Eltern hunderttausend Dollar bezahlten, damit ich hier studieren konnte? Der Gedanke daran, dass meine Eltern Iwans Studium bezahlt hatten, machte mich wahnsinnig. Noch so eine Erfahrung, die ich machen durfte, weil sie bezahlten.
◊
Ich ging ins Study Center, um meine E-Mails zu checken. Iwan hatte mir noch nicht geschrieben. Heute macht mir das nichts mehr aus. Er hatte als Letzter gemailt, genau genommen war ich also an der Reihe. Ich checkte die Voicemail und fand eine Nachricht von meiner Mama. Ich rief bei ihr im Labor an. Sie ging beim zweiten Klingeln dran, und ich erzählte ihr von Bobs Verwirrung wegen Nurhan der Zweiten. Ich dachte, meine Mutter fände das lustig, doch sie klang verärgert.
«Ich spreche mit Bob», sagte sie.
«Das brauchst du nicht», sagte ich.
«Wenn sie dir wieder damit auf die Nerven gehen, sag mir Bescheid. Dann ruf ich dort an. Sie sollten dich damit nicht belästigen.»
Meine Mutter sagte, sie sei beim Arzt gewesen und wolle meine Meinung hören. Sie habe nichts Schlimmes, nur eine kleine Zyste. Entweder könne sie sich operieren lassen, dann würde sie entfernt und sei weg, oder sie könne sich für ein Behandlung ohne Operation entscheiden, bei der man alle sechs Monate zu einer Kontrolluntersuchung gehen müsse.
Ich wusste nicht, worauf ich meine Meinung stützen konnte oder was für einen Wert sie haben würde, denn meine Mutter war Ärztin und ich nicht. Sie sagte etwas kühl, sie wisse ja, dass ich keine Ärztin sei, doch sie habe mir alle wichtigen Informationen übermittelt; es gehe ihr nicht um das Medizinische, sondern darum, was ich besser fände. Mir war klar, dass ich etwas Falsches gesagt hatte. Ich fragte sie, wie gefährlich die Operation sei und was passieren könnte, wenn sie eine Kontrolluntersuchung vergäße. Operiert würde unter Vollnarkose, sagte sie, aber das sei Standard und nicht besonders riskant. Die Kontrolluntersuchungen dürfte man jedoch nicht vergessen, sonst ginge man ein hohes Risiko ein.
Ich fand, dass meine Mom schon an viel zu viel denken musste, und sagte deshalb, sie solle sich operieren lassen.
«Das Gefühl habe ich auch», sagte meine Mutter mit inniger Stimme.
Nach dem Telefonat mit ihr merkte ich, dass ich mir Sorgen machte, weil Iwan nicht geschrieben hatte. Es war seltsam: Von außen betrachtet hatte sich nichts verändert, und doch fühlte ich mich anders. Ich landete wieder vor dem Computer und benutzte das Finger-Programm, obwohl ich mich danach noch schlechter fühlen würde.
Benutzername: iwanw
Voller Name des Benutzers: Iwan Warga
Anmeldezeitpunkt: Dienstag 3. Sept 10:24 (PDT) auf pts/7
Leerlaufzeit: 28 Sek.
Motto: Natur, du meine Göttin! Deiner Satzung gehorch ich einzig.
Er war gerade online und blickte genau wie ich auf den Bildschirm. Er hatte dort gesessen und achtundzwanzig Sekunden über etwas nachgedacht. Und er hatte ein «Motto» hinzugefügt.
Von Riley wusste ich, was ein Motto war. Es war eine Datei, in die man x-beliebige Texte eintragen konnte, die dann erschienen, wenn jemand dich mit dem Finger-Programm aufrief. Wenn man nichts eingetragen hatte, stand dort KEIN MOTTO. Weil Professoren nicht wussten, wie man sein Motto ändert, oder weil es ihnen egal war, hatten sie normalerweise KEIN MOTTO. Studierende im Aufbaustudium nannten manchmal ihre Bürozeiten. Studierende im ersten Jahr trugen manchmal WELTHERRSCHAFT oder WELTRAUMÜBERNAHME ein. Am gängigsten waren Zitate oder Maximen. Riley schrieb: «Der schnellste Weg ins Herz eines Mannes führt mit einer Axt durch seine Brust.»
Ich kannte Iwans Zitat nicht, fand es aber ärgerlich und folgerte, dass es von Shakespeare stammen musste. Jemand vom MIT hatte alle Shakespeare-Dramen online gestellt, sodass ich das Zitat in einem Monolog in König Lear fand. Die letzte Verszeile lautete: «Nun, Götter, schirmt Bastarde!»
Obwohl ich vorhatte, König Lear eines Tages zu lesen, hatte ich momentan keine Lust dazu, und Zeit hatte ich sowieso nicht. Ich beschloss, in den Alkoholladen zu gehen, der auch CliffsNotes zu König Lear verkaufte.
Dort fand ich heraus, dass der Monolog «Natur, du meine Göttin!» von Edmund gesprochen wurde, dem unehelichen Sohn des Earl of Gloucester. Edmund, ein machiavellistischer Charakter, lehnte konventionelle Moral, Autorität und Ehelichkeit ab und sprach sich für «das Naturgesetz» aus. Damit verbunden war ein Wortspiel mit dem Ausdruck «Natural Child – uneheliches Kind», das auch «Bastard» bedeutete. Wir verachteten Edmund nicht dafür, dass er plante, die ihm rechtmäßig zustehende Macht an sich zu reißen, denn Shakespeare ließ Edmund direkt zu uns sprechen, und der zog uns in seine gefährlichen und doch aufregenden Abenteuer hinein, zu denen auch seine promiskuitive sexuelle Eroberung von Goneril und Regan gehörte.
Nichts, was ich über Edmund erfuhr, verschaffte mir ein besseres Gefühl.
Swetlana und ich gingen zu einem Vortrag über Mrs Dalloway und die Zeit. Anscheinend war Virginia Woolfs Roman eine Veranschaulichung von Henri Bergsons Theorie über zwei Arten von Zeit: diejenige, die mit einer Uhr messbar war, und eine andere, die sich davon unterschied.
Nach einer Weile stand ein Professor auf und sagte in irritiertem Ton, Virginia Woolf habe Henri Bergson nie gelesen. Die Stimmung im Saal schlug um, und der Sprecher fügte lahm hinzu, Woolf habe nur einmal einen öffentlichen Vortrag von Bergson gehört. Danach erhob sich ein brillanter, italienisch klingender Mann und gab zu bedenken, dass Bergsons Ideen damals «in der Luft lagen». Diese Bemerkung flickte den Riss im Sozialgefüge einigermaßen, sodass der Vortrag fortgesetzt werden konnte. Irgendwie war aber sogar mir klar, dass wir uns etwas Überspanntes, Unhistorisches anhörten, dem es an «Wissenschaftlichkeit» fehlte.
Ich war entrüstet. Dass zwei Schriftsteller einander nicht gelesen hatten, sollte der Beweis dafür sein, dass das, was sie geschrieben hatten, ohne Bezug zueinander war? War eine Theorie der Zeit nicht wahrer, wenn zwei verschiedene Personen unabhängig voneinander auf sie gekommen waren? Was waren das für Schwachköpfe, die lieber eine Vererbungslinie ausarbeiteten als universelle Wahrheiten? Historiker halt. Sie waren erst zufrieden, wenn sie jedes wunderbare Buch zum Kind seiner Zeit erklärt hatten.
Swetlana fand, ein wunderbares Buch würde noch wunderbarer, wenn die historischen Einflüsse auf den Verfasser bekannt seien: Man könne dann das Wunder präziser identifizieren. Für mich war es Zeitverschwendung, die Umstände zu zelebrieren, unter denen jemand irgendein Phänomen entdeckt hatte. War es nicht wichtiger, dieses Phänomen auf unterschiedliche historische Umstände zu übertragen?
Swetlana entschied sich letztendlich für das Hauptfach Geschichte und Literatur, und ich, weil ich mir nichts aus Geschichte machte, wählte ein Hauptfach, das sich nur Literatur nannte.
Fußnoten
1 Bezug auf das englische Sprichwort: «Es hat keinen Sinn, über verschüttete Milch zu weinen.» [Anm. d. Übers.]
DIE ZWEITE WOCHE
Alle, die Literatur im Hauptfach studierten, mussten ein «Tutorium» belegen, wo Bücher gelesen und diskutiert wurden. Meine Tutorin hieß Judith, hatte ein junges Gesicht, weiße Haare und eine vielsagende Stimme. Ab und zu brach sie in schrilles Gelächter aus, und die Themen, für die sie sich begeisterte – dass Star Wars und die Ilias den gleichen Handlungsbogen hatten oder dass die Definitionen für das englische Wort «fix» im Oxford English Dictionary einander «unterminierten» –, waren zwar nicht direkt uninteressant, aber mir fiel dazu nichts ein. Ein-, zweimal hatte ich mir eine Meinung gebildet und sie auch geäußert, doch es hatte lahm und deprimierend geklungen.
Die meisten Kommilitonen in dem Tutorium sagten lahme, deprimierende Dinge. Allie und Jason waren die Einzigen, die jemals etwas Interessantes von sich gaben. Allie hatte einen New Yorker Akzent und einen Katzenaugenlidstrich. Jason wirkte immer zerzaust und schlaftrunken. Wenn die beiden etwas sagten, hörte ich genau zu, weil ich herausfinden wollte, warum es so interessant war.
◊
Nach dem Tutorium ging ich in die Undergraduate Library, um Entweder/Oder zu lesen. In der Eingangshalle blieb ich vor den Bücherregalen stehen, in denen sämtliche Bachelorabschlussarbeiten, die im Jahr zuvor Preise bekommen hatten, als gebundene Bücher ausgestellt waren. Ohne groß nachzudenken, ging ich die goldbeschrifteten Buchrücken durch in der Hoffnung, Iwans Namen zu entdecken. Ich glaubte zu träumen, als ich ihn fand: den Namen, an den ich dauernd dachte, den ich aber nie aussprach – auf einem Bibliothekseinband mit Prägedruck, so als gäbe es bereits ein gedrucktes Buch über die Sache.
Ich nahm die Abschlussarbeit vom Regal. Wie alle Matheabschlussarbeiten war sie ausgesprochen dünn. Überraschenderweise begann sie mit einer Geschichte: «Ein Mädchen geht mit seinen Eltern in ein Museum für sehr moderne Kunst. Es schlendert durch die Kubismusausstellung und beginnt, sich aufs Geratewohl durch drei Dimensionen zu bewegen. Durch wie viele Zimmer muss es gehen, bis es wieder auf seine Eltern trifft?»
Der Rest der Abschlussarbeit bestand aus Symbolen und Gleichungen. Ich stellte sie zurück ins Regal und fragte mich, woher mein Unbehagen kam. Rührte es daher, dass ich etwas sah, was Iwan geschrieben hatte, etwas, was nichts mit mir zu tun hatte und wovon ich noch nie gehört hatte? Der Gedanke, dass man rein zufällig auf die eigenen Eltern treffen konnte, erinnerte an eine griechische Tragödie. Und warum ein kleines Mädchen? Was hatte er mit Mädchen zu schaffen – warum interessierte er sich für so was? Mir wurde bewusst, dass ich eifersüchtig auf das Mädchen war – auf ihre Neugier und ihre Unerschrockenheit, und weil Iwan ein ganzes Buch über sie geschrieben hatte. Ich fragte mich, ob ich je etwas schreiben würde, was zum Bibliotheksbuch avancieren würde und auf dem mein Name in goldenen Lettern stünde.
Normalerweise übersprang ich Einleitungen, doch weil ich wissen wollte, was Entweder/Oder für ein Buch war, las ich sie diesmal. Zwar zählte das Buch zur Philosophie, doch hatte es wie ein Roman verschiedene Erzähler und bestand ursprünglich aus zwei Bänden: aus den Papieren von A, einem Ästhetiker, und denen von B, einem Ethiker. Die Papiere, die angeblich in einem alten Sekretär gefunden worden waren, enthielten Essays, Aphorismen, erbauliche Reden, Briefe, Musikkritiken, ein Lustspiel und die Erzählung «Tagebuch des Verführers», dessen Verfasser A’s Freund Johannes gewesen sein soll. Laut Einleitung übersprangen viele den «ethischen» Teil und sogar den «ästhetischen» und lasen nur das «Tagebuch des Verführers». Kierkegaard hatte über Entweder/Oder gesagt, man müsse entweder das ganze Buch lesen oder die Lektüre sein lassen. Kierkegaard war ein Witzbold! Trotzdem habe auch ich bis zum «Tagebuch des Verführers» vorgeblättert.
Es beginnt mit einer Beschreibung von Johannes, dem Verführer – der ein Mädchen mithilfe seiner «Geistesgaben» dazu bringt, sich in ihn zu verlieben, «ohne daß er sie in strengerm Sinn besitzen wollte»:





























