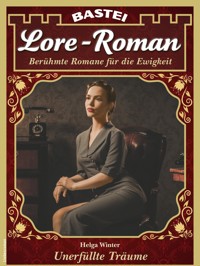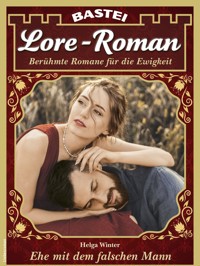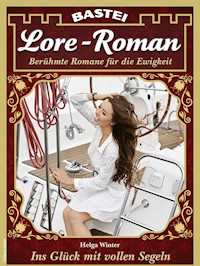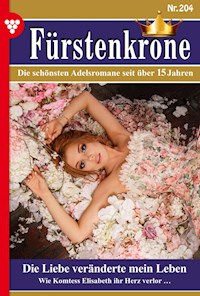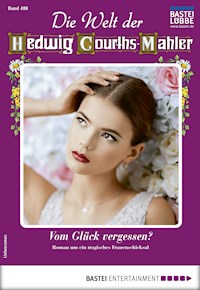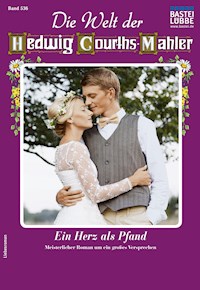Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Martin Kelter Verlag
- Kategorie: Poesie und Drama
- Serie: Erika Roman
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
82 Seiten dramatische Handlungsverläufe, große Emotionen und der Wunsch nach Liebe und familiärer Geborgenheit bestimmen die Geschichten der ERIKA-Reihe - authentisch präsentiert, unverfälscht und ungekürzt! Die beiden alten Leute standen lange auf der Straße und schauten andächtig auf die vielen blanken Messingschilder. Man hätte fast meinen können, sie suchten einen bestimmten Namen auf den vielen Tafeln, die am Eingang des Hochhauses angebracht waren, aber bei näherer Betrachtung bemerkte man, daß dieser Eindruck täuschte. Das alte, einfach gekleidete Ehepaar sah nur auf die eine Tafel, die den eigenen Familiennamen, aber den Vornamen ihrer Tochter trug. "Dr. Eira Althoff", las Vater Gregor mit etwas zitternder Stimme. "Jetzt hat sie es endlich geschafft", sagte die Frau leise und schob ihren Arm unter den des Mannes. "Ob sie böse ist, wenn wir sie jetzt stören? Sie hat doch sicher viel zu tun, hat sie doch ihr Examen mit ›sehr gut‹ bestanden." Sie zögerten, die Drehtür zu durchschreiten, und es störte sie nicht, daß der Pförtner sie aus einer Loge heraus spöttisch unter emporgezogenen Brauen betrachtete. Man sah auf den ersten Blick, daß sie vom Lande kamen. Die Kleidung verriet es ebenso wie die linkische und unbeholfene Art, in der sie auf dem sonnenheißen Pflaster standen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 179
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Erika Roman – 5–
Sehnsucht nach der großen Liebe
Helga Winter
Die beiden alten Leute standen lange auf der Straße und schauten andächtig auf die vielen blanken Messingschilder. Man hätte fast meinen können, sie suchten einen bestimmten Namen auf den vielen Tafeln, die am Eingang des Hochhauses angebracht waren, aber bei näherer Betrachtung bemerkte man, daß dieser Eindruck täuschte.
Das alte, einfach gekleidete Ehepaar sah nur auf die eine Tafel, die den eigenen Familiennamen, aber den Vornamen ihrer Tochter trug. »Dr. Eira Althoff«, las Vater Gregor mit etwas zitternder Stimme.
»Jetzt hat sie es endlich geschafft«, sagte die Frau leise und schob ihren Arm unter den des Mannes. »Ob sie böse ist, wenn wir sie jetzt stören? Sie hat doch sicher viel zu tun, hat sie doch ihr Examen mit ›sehr gut‹ bestanden.«
Sie zögerten, die Drehtür zu durchschreiten, und es störte sie nicht, daß der Pförtner sie aus einer Loge heraus spöttisch unter emporgezogenen Brauen betrachtete. Man sah auf den ersten Blick, daß sie vom Lande kamen. Die Kleidung verriet es ebenso wie die linkische und unbeholfene Art, in der sie auf dem sonnenheißen Pflaster standen.
Der Mann machte keine Anstalten, sein Schiebefenster zu öffnen, als die beiden sich einen Ruck gaben und eintraten. Nur sein Grinsen wurde breiter, als er sah, daß sie zögernd auf den Paternoster schauten. Die haben solch einen Aufzug bestimmt noch nicht gesehen, dachte er verächtlich.
Vater Gregor verzog den Mund, dann ging er mit seiner Frau die zahllosen Stufen der Treppe hinauf. Er war zu alt, um noch solche Abenteuer wie das Betreten einer so modernen Einrichtung zu wagen.
Im sechsten Stockwerk waren sie völlig außer Atem, aber das Strahlen ihrer Augen war nicht erloschen, denn auch hier wies ihnen eine Tafel mit einem Pfeil den Weg zum neuen Büro der Tochter.
Der alte Schlossermeister war sehr stolz auf Eira, die sich ihr Studium hart und schwer erarbeitet hatte und nun endlich am Ziel ihrer Wünsche war.
Das Wartezimmer war leer, eine Minute später schon öffnete sich die Tür zum Büro, und Eira, ihre Tochter, trat heraus. Sie trug ein strenges Schneiderkostüm, das sie älter und fast ein wenig fremd erscheinen ließ.
»Mutter, Vater!« Einen Augenblick nur stand sie erstaunt da, dann flog sie ihrer Mutter in die Arme, küßte das alte, runzelige Gesicht und schmiegte ihre Wange dann an die des Vaters. Ihre Augen waren feucht geworden, und auch die alten Leute spürten, daß Rührung sie überfiel.
»Stören wir nicht?« fragte Vater Gregor nach kräftigem Räuspern und ließ seinen Blick voller Stolz auf die schlanke Gestalt seiner Tochter fallen.
Ihre Wangen waren rosig, ihr Haar kurz geschnitten, es gab ihr ein ernstes Aussehen, ließ sie aber keineswegs männlich erscheinen, sondern betonte ihre Weiblichkeit gerade durch den Gegensatz, den es zu ihrem weichen, fraulichen Gesicht bildete.
»Kommt nur herein, ihr stört bestimmt nicht, leider…«, sagte sie noch etwas leiser, und ihr Tonfall ließ Frau Hedda mißtrauisch den Kopf heben.
Das Büro war sehr modern und geschmackvoll eingerichtet, die alten Leute waren mit ihm vollkommen zufrieden. Sie sahen nicht, was weltkundigeren Menschen bestimmt aufgefallen wäre – die völlige Leere des großen Schreibtisches.
Nur eine Zeitschrift lag aufgeschlagen dort, die kleine Reiseschreibmaschine stand unter einer Wachstuchhülle auf einem Seitentischchen, die Rollschränke waren verschlossen.
»Schön hast du es hier, Eira. Wir wollen auch gleich wieder gehen, du mußt ja bestimmt arbeiten, aber Mutter hat gesagt, daß wir doch unbedingt einmal in die Stadt fahren müßten, um zu sehen, wie du hier so lebst. Ein schönes Büro hast du«, wiederholte Vater Gregor.
Frau Hedda beobachtete aus den Augenwinkeln heraus das Gesicht ihrer Tochter, und sie begann zu begreifen, daß ein schönes Büro und ein mit »sehr gut« bestandenes Examen vielleicht noch nicht ganz ausreichten.
»Ich werde Kaffee holen lassen«, bot Eira an, telefonierte ein in der Nähe gelegenes Lokal an und gab entsprechenden Auftrag. »Wie sieht es zu Hause aus?« fragte sie dann und versuchte, recht unbefangen zu erscheinen, denn sie wollte auf gar keinen Fall, daß ihre Eltern ahnten, wie es hier bei ihr in Wirklichkeit aussah.
Ihr Büro war eine schöne Fassade, aber es steckte eigentlich nichts dahinter, denn das Wichtigste fehlte ihr: Klienten!
Wer ging schon zu einer Rechtsanwältin, die man nicht kannte, die keinen Namen hatte? Manchmal war Eira verzweifelt, wenn sie den ganzen Tag im Büro gearbeitet hatte, ohne daß außer dem Briefträger, der die üblichen Mahnbriefe brachte, niemand gekommen war.
Die Alten erzählten von den unbedeutenden Ereignissen des Dorfes, von Geburten und Todesfällen, von Hochzeiten und Taufen. Wie weit lag das alles für Eira zurück – eine ganz andere Welt, in der der Lebenskampf nicht so hart und unbarmherzig geführt wurde wie hier in der fremden, großen, feindlichen Stadt.
Niemand kannte sie hier, sie hatte keine Freunde, keine Kollegen, niemanden als sich selbst.
Frau Hedda sah die Einsamkeit in ihrem Gesicht, während ihr Mann behäbig und recht umständlich erzählte.
»Und dann war da noch eins«, brachte der alte Mann schließlich zögernd hervor und warf seiner Frau einen bittenden Blick zu, ihm jetzt das Wort abzunehmen.
Frau Hedda nickte ihm lächelnd zu. »Es handelt sich um folgendes, Eira«, begann sie und faltete ihre Hände fest im Schoß zusammen, denn das Sprechen strengte sie an. »Herr Schlüter, du kennst ihn doch auch, der Sohn des alten Tischlers, ist ja damals auch zur Stadt gezogen und hat hier eine Werkstatt eröffnet und auch gut zu tun gehabt.«
Eira krauste nachdenklich die Stirn, denn an den jungen Schlüter konnte sie sich nicht erinnern, während ihr der alte ein Begriff war. Sie hatte als Kind gern in seiner Werkstatt gespielt.
»Er ist in Schwierigkeiten«, fuhr Frau Hedda fort. »Er hatte einen großen Auftrag für einen Bau und nicht unerhebliche Vorschüsse bekommen, und dann… seine Frau ist plötzlich gestorben, im Kindbett, und ihr Tod… Der Jakob hat sehr an ihr gehangen. Er ist völlig durcheinander gewesen, sagt der Alte, und das Geld hat er für Ellens Begräbnis ausgegeben. Ellen war seine Frau, weißt du, und nun…«
»Sie haben ihn angeklagt. Betrug, sagt der alte Otto, und Jakob kann das Geld nicht aufbringen. Sie haben ihm schon die Werkstatt geschlossen, und wahrscheinlich muß er ins Gefängnis. Und da habe ich gedacht, Eira, weil du dich ja in den Paragraphen auskennst und nun mal hier bist, und Otto Schlüter ist doch so etwas wie mein Freund, da meinte ich natürlich nur, wenn du nicht zu viel zu tun hast…«
»Vater hat Schlüter versprochen, daß du Jakobs Verteidigung übernimmst«, erklärte seine Frau knapp, denn aus dem Stammeln ihres Mannes würde Eira bestimmt nicht klug werden.
Vater Gregor atmete befreit auf und nickte seiner Tochter ein paarmal zu. »Du kennst den alten Schlüter ja auch«, begann er wieder, als ob das eine zureichende Erklärung für sein gutmütiges Versprechen sei.
»Ich werde mich der Sache annehmen.« Eira strich über die welke Hand ihres Vaters, die verloren auf der Schreibtischplatte lag. Ihr Lächeln verriet dem alten Herrn, daß sie ihm nicht böse war, wie er befürchtet hatte.
»Dann wollen wir dich nicht länger stören.« Ganz plötzlich hatte es der alte Gregor sehr eilig, wieder fortzukommen, denn er war ein Mensch, der stets fürchtete, anderen lästig zu fallen.
Es bedurfte vieler Worte seiner Tochter, um ihn zum Bleiben zu bewegen, sie tranken den bestellten Kaffee und gingen dann etwas später zusammen zum Essen.
Ihr Zug brachte sie schon am Abend wieder in ihr Dorf zurück, denn Eira hatte keine Möglichkeit, sie in ihrem möblierten Zimmer unterzubringen, und ihre alten Eltern hatten fast entsetzt abgewehrt, als sie vorschlug, daß sie in einem Hotel übernachten sollten.
Eira kannte die verschlungenen Gänge und Korridore des Gerichtsgbäudes gut, obwohl sie bisher noch kein einziges Mal Gelegenheit gehabt hatte, einen Menschen in diesem grauen, düsteren Gebäude zu vertreten.
Ihr Gesicht war vor Eifer gerötet, in ihren Augen ein froher Schein, als sie ein paar Tage nach dem Besuch ihrer Eltern leicht und beschwingt über die ausgetretenen Dielen ging und sich bei Dr. Wendland melden ließ.
Dr. Torsten Wendland war der zuständige Richter für den Fall Schlüter, den sie unentgeltlich übernommen hatte, und er genoß den Ruf, sehr zurückhaltend, aber gleichzeitig auch von unbestechlicher Ehrlichkeit zu sein.
Aus Gesprächen wußte Eira, daß man ihn im Kollegenkreis nicht schätzte, man nannte ihn hinter seinem Rücken arrogant und eingebildet.
Wendland hatte als Richter ein Vorzimmer mit einer Sekretärin, und Eira wurde von einem gewissen Neidgefühl gepackt, als sie die Aktenstöße sah, die sich auf dem Tisch der eifrigen Dame türmten und teilweise sogar neben ihr auf dem Boden lagen, weil der Platz einfach nicht ausreichte.
»Der Herr Doktor«, wisperte Fräulein Franken, die Sekretärin, und beugte ihren Kopf hastig über die Maschine. Als Torsten Wendland eintrat, hämmerten ihre Finger hurtig auf den Tasten, sie bot ihm das gewohnte Bild eifriger Arbeit.
Er nickte ihr kurz, aber nicht unfreundlich zu und ging schnell durch sein Vorzimmer, ohne Eira, die an der linken Wand auf einem Stuhl saß, wahrzunehmen.
»Ich möchte Sie sprechen«, meldete sich die junge Dame.
Wendland schnellte herum, über seiner kräftigen Nase entstanden zwei tiefe Falten, die ihm einen finsteren und abweisenden Ausdruck gaben.
»Ich habe jetzt keine Zeit«, stellte er in einem Ton fest, der jede weitere Diskussion ausschloß.
»Die Dame ist Rechtsanwältin«, hauchte Fräulein Franken, ohne die Augen von ihrer Maschine hochzunehmen.
»So, schon wieder eine neue Rechtsanwältin«, stellte Torsten knurrend fest und öffnete die Tür, um Eira in sein Zimmer zu lassen. Seine Geste war alles andere als einladend, genauso unfreundlich wie seine Worte.
»Es tut mir leid, daß mein Dasein ein Ärgernis für Sie bedeutet«, stellte Eira fest. »Hätte ich vorher gewußt, daß Sie etwas gegen weibliche Kollegen haben, hätte ich mich bestimmt für das Medizinstudium entschieden.«
Torsten schaute sie groß an, offenbar war er es nicht gewohnt, daß man seiner Grobheit in gleicher Art begegnete.
»Bitte, nehmen Sie Platz«, lud Torsten ein, ohne auf ihre Worte einzugehen.
»Ich komme im Fall Schlüter. Sie werden bei der Verhandlung den Vorsitz führen, ich möchte mich mit Ihnen über die Vorgeschichte des Prozesses unterhalten. Zur richtigen Beurteilung eines Falles gehört unbedingt die Kenntnis der menschlichen Hintergründe.«
»Ich danke für die Belehrung.« Torsten verbeugte sich ironisch, und jetzt war das fatale Lächeln auf seinem Gesicht unverkennbar. »Es freut mich immer, wenn ich noch etwas hinzulernen kann. Ich bin nämlich noch sehr unerfahren in meinem Beruf, liebe Kollegin, aber das nur nebenbei.«
Jetzt war es an Eira, verlegen zu werden, denn sie begriff sofort, daß sie einen schweren taktischen Fehler begangen hatte, als sie ihre Einleitung in die Form einer Belehrung kleidete.
»Entschuldigen Sie bitte«, murmelte sie mit Grimm im Herzen, denn seine ironische Zurechtweisung ließ ihre Antipathie nur noch stärker werden. Dann begann sie: »Jakob Schlüter ist durch den plötzlichen Tod seiner Frau aus der Bahn geschleudert worden. Schlüter genießt einen sehr guten Ruf, man achtet ihn überall.«
»Er hat dreißigtausend Mark veruntreut«, stellte Torsten gelassen fest. »Ich glaube, Sie sollten die in Frage kommenden Gesetze noch einmal gründlich durcharbeiten, Fräulein. .«
»Althoff«, knirschte Eira mit hochrotem Kopf. »Ich habe die Gesetze schon studiert, Herr Wendland, aber Sie müssen doch verstehen, daß ein Mensch, der im Grunde ehrlich und aufrichtig ist, einmal durch ein so tragisches Ereignis aus seiner Bahn geworfen werden kann.«
»Er wird dafür seine ihm zustehende Strafe bekommen«, sagte Torsten ruhig. »Sehen Sie, liebe Kollegin, die Gesetze werden zum Schutz der Gemeinschaft gemacht, und die Motive eines Gesetzesübertreters sind zwar bei der Straffindung keineswegs uninteressant, aber letztlich ist es unsere Aufgabe, uns an die Tatsachen zu halten.«
Eira dachte an den verzweifelten Mann mit den grauen Strähnen im Haar, mit dem sie gestern noch gesprochen hatte. Noch immer war Jakob Schlüter völlig apathisch, und sogar das kleine Wesen, das im Babykorb lag und den Tod der Mutter verursacht hatte, konnte ihn nicht bewegen, Anteil am Leben zu nehmen.
Ihm war es sogar gleichgültig, ob man ihn verurteilte oder nicht. Er starrte auf die Trümmer seines Lebens und konnte nicht glauben, daß er noch eine Zukunft hatte. Ellen war tot, war es da nicht gleichgültig, was aus ihm wurde?
»Er hat seine Frau geliebt, Herr Wendland. Ihr Tod hat ihn getroffen, er… er ist nicht mehr der Mensch, der einmal die Tischlerei in die Höhe geführt hat, der allgemeines Vertrauen genoß…«
Eira brach irritiert ab, als Torsten begann, mit der Handfläche rhythmisch auf die Schreibtischplatte zu klopfen.
»Wir wollen doch, bitte, auf dem Boden der Tatsachen bleiben, Fräulein Althoff«, bat Torsten scharf. »Der Mann hat die Vorschüsse für sich verbraucht…«
»Er hat sie für das Begräbnis seiner Frau gebraucht«, berichtigte Eira ihn erregt. »Sie hat den schönsten Grabstein, den er kaufen konnte…«
Torsten lachte amüsiert auf. »Er hat ihn ja auch nicht mit seinem Geld bezahlt.« Er schüttelte den Kopf und schaute Eira dann unter halb gesenkten Lidern ironisch an. »Ich hoffe, daß Sie mir nicht böse sind, wenn ich Sie bitte, mich jetzt zu entschuldigen. Ich habe noch recht viele Fälle, Schlüter ist nur einer von vielen.«
Ohne Gruß drehte Eira sich um und ging zur Tür. »Sie – ich wünschte, Sie würden auch einmal in solch eine Lage kommen wie dieser unglückliche Schlüter«, brach es aus ihr hervor, als sie ihre Rechte auf die Klinke gelegt hatte. »Wenn Sie Ihre Frau verloren hätten wie dieser Mann…«
»Ich bin Witwer, wenn es Sie interessiert, liebes Fräulein Althoff, aber der Tod meiner Frau war durchaus kein Anlaß, mich an fremden Geldern zu vergreifen.«
»Wahrscheinlich haben Sie Ihre Frau auch nicht geliebt.«
Torsten runzelte die Stirn. Er sah plötzlich wieder sehr düster und zornig aus. »Fräulein Franken!« rief er, wartete, bis seine Sekretärin die Tür öffnete, und schaute in der Zwischenzeit gelassen an Eira vorbei, die abwartend stehengeblieben war. »Begleiten Sie Fräulein Althoff hinaus«, befahl er dann, steckte seine Hände in die Taschen und drehte Eira den Rücken zu.
Fräulein Franken zog den Kopf unwillkürlich zwischen die Schultern und warf einen verstörten Blick zu Eira, die fast einen halben Kopf größer war als sie.
»Seien Sie unbesorgt, Herr Wendland, ich gehe schon. Sie hätten mich gar nicht hinauszuwerfen brauchen. Ihre Manieren imponieren mir nicht. Sie können vielleicht damit Ihre bedauernswerte Sekretärin einschüchtern, aber nicht mich!«
»Sie glauben gar nicht, wie froh mich das macht!« bellte Torsten, und Fräulein Franken beeilte sich, Eira hinauszuschieben und die Tür behutsam zu schließen.
»Der Herr Doktor war ja sehr aufgebracht«, wisperte sie im Vorzimmer, warf dabei aber einen langen, scheuen Blick auf die Tür, als fürchte sie, daß der Allgewaltige plötzlich hervorschießen könnte.
»Er ist ein aufgeblasener Affe!«
Eira warf den Kopf in den Nacken, hastete dann zur Tür und warf sie mit rücksichtslosem Schwung ins Schloß.
Erst als sie in ihrem leeren Büro angekommen war, stellte sie fest, daß sie ihre Aktentasche vergessen hatte. Sie schaute zweifelnd auf das Telefon.
Vielleicht würde Fräulein Franken ja dafür sorgen, daß ihr jemand die Tasche brachte?
Sie suchte sich die Nummer heraus und drehte dann mit vor Aufregung bebenden Händen die Scheibe des Telefons.
Eine männliche Stimme meldete sich, die Vermittlung.
»Geben Sie mir das Vorzimmer von Dr. Wendland«, bat sie heiser, dann ertönte ein Knacken, dann eine Stimme, die sie unter Millionen herausgekannt hätte, denn selbst jetzt, als er sich meldete, klang ein unverkennbar arroganter Ton in seiner Stimme mit.
»Sie?« fragte Eira verblüfft und legte den Hörer so schnell auf die Gabel zurück, als sei er plötzlich glühend geworden.
Torsten Wendland schaute auf den toten Hörer in seiner Hand, er hatte ein Knacken gehört, dann war nur noch das Rauschen in der Leitung.
Wer mag das gewesen sein? fragte er sich. Welches weibliche Wesen konnte so entsetzt sein, wenn er sich meldete?
Er kratzte sich seine hohe Stirn am Haaransatz, warf einen vergleichenden Blick auf die Uhr und stellte fest, daß die Zeit für dieses seltsame Fräulein Althoff gereicht hätte, ihr Büro in der Innenstadt aufzusuchen.
Er schmunzelte, ließ sich die Nummer geben und gab sich Mühe, seine Stimme zu verstellen, als er fragte, ob sie im Büro des Richters Wendland angerufen habe.
»Wer ist da?« erkundigte sich Eira mißtrauisch. Sie rieb ihre Unterlippe an den Zähnen, ein typisches Zeichen ihrer Nervosität, aber sie war sofort beruhigt, als der Sprecher erklärte, im Büro des Richters zu arbeiten.
»Ich dachte schon, das alte Ekel sei selbst am Telefon.« Eira atmete auf. »Ich habe meine Aktentasche entweder in seinem Büro oder im Vorzimmer liegenlassen. Sind Sie so freundlich und sehen einmal nach?«
Sie hörte ein kurzes Auflachen, das ihr sehr bekannt vorkam, und schluckte. Nein, das konnte doch nicht sein, daß dieser Wendland erraten hatte, wer angerufen, und nun selbst…
»Ihre Aktentasche ist hier, Fräulein Doktor. Mit all den wichtigen Unterlagen über den weltbewegenden Fall Schlüter mit dem menschlichen Hintergrund. Ich kann Ihren Mandanten zur Wahl seines Rechtsbeistandes nur beglückwünschen.«
Eira fühlte, daß ihr Tränen in die Augen stiegen, Tränen der Wut und der Scham.
Torsten Wendland hatte sich wieder Akten mit nach Hause genommen, denn sein Beruf nahm ihn ganz in Anspruch. Seine Mutter, die ihn vom Fenster aus kommen sah, wunderte sich schon nicht mehr über seine prall gefüllte Tasche, denn es war ein gewohnter Anblick.
Ihre Enkelin, Heide, von allen im Haus zärtlich Heidi gerufen, stellte sich auf die Zehenspitzen und drückte ihr kleines, keckes Stupsnäschen gegen die Scheiben.
»Vati kommt«, jubelte sie und lief dann hinaus, bevor Frau Viktoria sie noch ermahnen konnte, ihrem Vater ruhig entgegenzugehen und nicht zu laufen wie ein Straßenkind.
Viktoria Wendland, geborene Komteß von Greifenhagen, hielt sehr auf Etikette und Zurückhaltung in allen Lebensäußerungen und bemühte sich – zu ihrem Leidwesen allerdings bisher immer noch vergeblich – das Temperament ihrer Enkelin zu zügeln.
Sie muß es von ihrer Mutter haben, dachte sie unmutig, denn obwohl Torsten seine Frau seinerzeit aus Liebe geheiratet hatte, war es ihr nicht gelungen, in ein herzliches Verhältnis zu ihrer Schwiegermutter zu kommen.
Ihr Tod vor drei Jahren hatte auch keine fühlbare Lücke im Haus hinterlassen. Torsten vergrub sich vielleicht noch etwas mehr in seine Arbeit als vorher, und Heidi war noch zu klein gewesen, um den Verlust richtig zu begreifen.
Für sie war das Leben, das sie in der großräumigen Etagenwohnung des Vaters führte, selbstverständlich geworden. Sie entbehrte keine Mutterliebe, weil sie die ganz besondere Wärme, die nur eine Mutter ausstrahlen kann, gar nicht kannte.
»Vati, Vati!«
Torsten wandte den Kopf und lächelte ihr freundlich, aber etwas geistesabwesend zu und vergaß wie immer, die Arme auszubreiten, um sie hochzunehmen.
»Willst du mir gar keinen Kuß geben?« fragte Heidi mit reizendem Schmollmund.
»Entschuldige, das habe ich ganz vergessen, mein Kind.« Richter Wendland beugte sich gehorsam hinab, hob sein Töchterchen empor und fühlte einen Augenblick zwei warme, feuchte Lippen auf seiner Wange.
Es war ein geheiligtes Ritual im Haus, daß Torsten sich erst einmal zu seiner Mutter setzte und sich anhörte, was sie ihm zu sagen hatte. Er glaubte es ihr schuldig zu sein, Anteil an ihren Sorgen zu nehmen, auch wenn sie nur gering und unbedeutend waren. Sie hatte viel aufgegeben, als sie damals seinen Vater, den Arzt Wendland, heiratete, und Frau Viktoria versäumte nicht, ihn manchmal an ihr Opfer zu erinnern.
»Ich habe frischen Aufschnitt gekauft, in einer halben Stunde können wir essen.« Sie nickte ihrem Sohn zu und ging dann in die Küche, überzeugte sich vorher noch durch einen schnellen Blick in das Kinderzimmer, daß Heidi keinen Unfug anrichtete, und beschäftigte sich dann mit den Vorbereitungen für das Abendessen.
Das Kind schien sie nicht bemerkt zu haben, aber es war eine reine Täuschung, denn die alte Frau war kaum in die Küche verschwunden, als eine kleine Kinderhand die Tür vorsichtig einen Spalt weit öffnete und zwei lustige Augen auf den Flur hinauslugten.
Sie wußte, daß sie den Vati eigentlich nicht stören durfte, aber sie mußte ihm unbedingt noch von Peter erzählen. »Die anderen sind alle doof«, vertraute sie ihm an, als sie neben seinem Sessel stand. »Darf ich Peter mal heiraten?« fuhr sie dann in einem Atemzug fort.
Torsten lächelte unwillkürlich und durchforschte das runde, glatte Kindergesicht. Was wußte er eigentlich von dem, was hinter dieser kleinen Stirn vor sich ging? fragte er sich heute zum ersten Male.
»Sag einmal, Heidi, hast du mich eigentlich lieb?«
Das Kind krauste die Stirn, offenbar erforderte diese unerwartete Frage längeres Nachdenken. Dann nickte es gnädig. »Ja, aber Peter habe ich auch lieb. Kannst du mir nicht auch ein Auto bauen? Peters Vati hat es ganz allein gemacht, es läuft pfundig.«
»Aber Heidi, was für ein Ausdruck«, entsetzte sich Torsten. »Man sagt nicht pfundig, ein Auto läuft gut oder es läuft leicht, aber…«
»Och, du hast auch immer was.« Heidi zog die Mundwinkel verdrossen herab. »Peter sagt das auch immer, und sein Vati sagt nicht, daß er das nicht sagen darf. Der ist Tischler, der hat so eine ganz große Werkstatt, da war ich auch schon mal.«
»Tischler?« Dieser Beruf erweckte Erinnerungen in ihm, die nicht gerade angenehm waren. Ein Mädchengesicht stieg vor ihm empor, das ihn empört angeschaut hatte, nur weil er nicht bereit war, sentimentalen Anwandlungen nachzugeben.
»Jetzt siehst du wieder ganz böse aus«, stellte sein Kind fest.
Torsten versuchte sich zusammenzunehmen, aber schon den ganzen Nachmittag verfolgte ihn die Erinnerung an die Auseinandersetzung mit Eira.
Er erhob sich und ging in sein Arbeitszimmer, um im Anwälteverzeichnis nachzusehen, wer sie eigentlich war.
»Ein grünes Ding«, murmelte er, als er fand, daß sie ihre Zulassung erst vor wenigen Wochen erhalten hatte. Wenn sie weiterhin so energisch vorgeht, wird sie sich allerhand Feinde machen, dachte er, und seltsamerweise fand er den Gedanken unbehaglich.
Der Ruf seiner Mutter zum Abendessen unterbrach seine Gedanken, aber Frau Viktoria stellte fest, daß ihr Sohn heute noch geistesabwesender war als sonst.