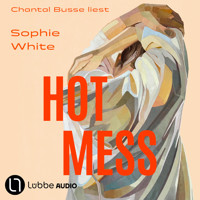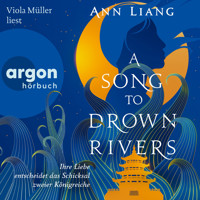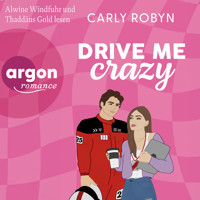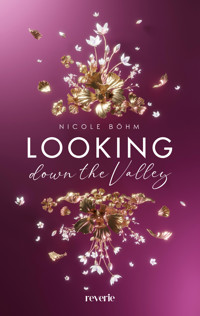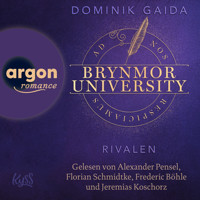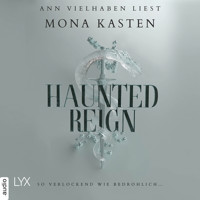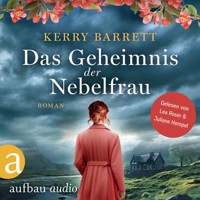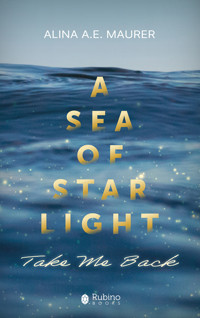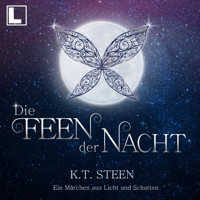Erkundung in der Arktis im Dienst der Wettervorhersage E-Book
9,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Stella Polaris
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Als während des Zweiten Weltkrieges die ausländischen Wetterbeobachtungen aus dem Nordatlantik wegfielen, wurden geheime Missionen gestartet, um für militärische Operationen die benötigten Informationen zu erhalten. Dazu gehörten tägliche Wetterflüge über dem Nordmeer, Wetterbeobachtungsschiffe vor der grönländischen Küste, temporäre Beobachtungen auf U-Booten sowie Wetterstationen auf Spitzbergen. Vier Augenzeugen berichten über Erlebnisse und Erfahrungen in dieser problematischen Phase der deutschen Zeitgeschichte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 191
Ähnliche
Inhalt
Einleitung
Editorische Notiz
Ein Wettererkundungsflug (1940)
Die Unternehmen des Wetterbeobachtungsschiffes »Sachsen« 1940 und 1941
Erfahrungsbericht über die Teilnahme an einer Unternehmung in die westsibirische See auf »U 251« [1942]
Die Eisverhältnisse des Europäischen Nordmeeres und der Barentssee im Jahre 1942
Tagebuch der Unternehmung »Kreuzritter« 1943/44
Anhang 1-8
Maßnahmen zur militärischen Sicherung der Station
Besuch der Station Kreuzritter im Jahr 2000
Glossar
Literaturverzeichnis
Quellennachweis
Abbildungsnachweis
Danksagung
Einleitung
Cornelia Lüdecke
Seit Einrichtung der nationalen Wetterdienste und Gründung des Vorläufers der Internationalen Meteorologischen Organisation gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurde die länderübergreifende Verbreitung von Wetterbeobachtungen organisiert und schrittweise auf den jeweils neuesten technischen Stand gebracht. So wurde die Telegrafie mit Morsezeichen von der Funkübertragung abgelöst und später durch ein Netz von Satelliten, die heutzutage eine erdumfassende Weiterleitung von Wetterdaten ermöglichen. Aus den gemeldeten aktuellen Wetterbeobachtungen wurden zunächst Bodenwetterkarten und ab den 1930er Jahren auch Höhenwetterkarten für etwa 5000 m Höhe gezeichnet, um daraus Wettervorhersagen abzuleiten, die insbesondere für die Fliegerei wichtig sind. Erst durch die Entwicklung von schnellen Computern konnte die nummerische Wettervorhersage eingeführt werden, die es mithilfe unterschiedlich gestalteter Rechenmodelle ermöglicht, auf der Basis von Beobachtungen das Wetter für bis zu 14 Tagen im Voraus zu berechnen. In den 1940er Jahren gab es die computergestützte Wettervorhersage allerdings noch nicht, so dass man umso mehr auf möglichst viele und gute Wetterbeobachtungen angewiesen war, die in Wetterkarten eingetragen und von erfahrenen Meteorologen für die Wettervorhersage aufgrund gewisser Regeln und Erfahrung interpretiert wurden.
Nach Kriegsbeginn 1939 standen im Deutschen Reich verständlicherweise keine ausländischen Wetterbeobachtungen mehr zur Verfügung, so dass nach neuen Möglichkeiten gesucht werden musste, um an die benötigten Daten zu kommen, die für die Beratung von Geleitzügen im Nordmeer wichtig waren. Schiffs- und Flugzeugoperationen brauchten nämlich eine möglichst genaue Wetterberatung, denn Nebel, Stürme, starker Wellengang oder Gegenwinde spielten eine große Rolle in der Planung militärischer Operationen. Mitteleuropa liegt in der Westwindzone, wo das Wetter sozusagen hauptsächlich aus Westen kommt. Insbesondere war damals die Lage der sogenannten Polarfront im Nordatlantik, die mit dem Aufzug von schlechtem Wetter zusammenhängt, als wetterbestimmendes Element von größter Bedeutung. Und genau diese Information aus dem Westen war nun weggebrochen. So verlegten sich sowohl das Oberkommando der Kriegsmarine als auch die Luftwaffe darauf, die fehlenden Wetterdaten sozusagen auf geheime Art und Weise im Feindesgebiet zu gewinnen.
Die Wetterbeobachtung in der Arktis war demnach Mittel zum Zweck der Kriegsführung 1940-1945. Gleich zu Beginn der Krieges nach der Besetzung Norwegens wurden Flugzeuge eingesetzt, die im Rahmen der Wettererkundungs-Staffeln (Wekusta) bzw. abgekürzt Wetterstaffeln (Westa) 5 und 6 ab Mai 1940 zunächst von Vaernes bei Trondheim, (früher Drontheim, Norwegen) aus nach Island und Ostgrönland sowie ab Juni 1941 von Banak (bei 70 °N, Norwegen) nach Spitz bergen und Nowaja Semlja starteten und unterwegs meteorologische Messungen über dem Nordmeer durchführten (Abb. 1).1 Der Luftwaffenmeteorologe Rupert Holzapfel (1905-1960), Teilnehmer der Wegener-Expedition nach Grönland (1930/31), leitete die Ausbildung für die arktischen Wetterstationen, während der habilitierte Meteorologe Werner Schwerdtfeger (1909-1985) für die meteorologische Ausbildung der Beobachter zuständig war.
Abb. 1: Flugrouten der Wetterstaffel 5 und 6 im Nordpolarmeer und Operationsgebiet des Wetterbeobachtungsschiffes WBS I »Sachsen«
Die Wetterflugzeuge waren ganz modern mit einem Autopiloten und einer Funkanlage zur Kommunikation zwischen der Besatzung (Pilot, Meteorologe, Funker und Bordmechaniker) im Flugzeug ausgerüstet. In den Flugzeugen zeichnete ein Meteorograph kontinuierlich den Luftdruck, die Außentemperatur und die Außenfeuchtigkeit auf. Die Werte mussten wegen der hohen Fluggeschwindigkeit anschließend noch mit einem Korrekturfaktor versehen werden. Noch während des Fluges wurden Informationen über die Sicht, die beobachtete Wolkenart, den Niederschlag und ggf. die Vereisung sowie die Böigkeit per Funk zur Bodenempfangsstelle gefunkt.
Während der Flüge wechselten die Piloten für die Gewinnung der Wetterdaten mehrfach sägezahnartig die Flughöhe, durchstießen Wolken, um die Höhe der Unter- und Obergrenze zu bestimmen, oder sie gingen bis fast auf Meereshöhe hinunter, um bei sogenannten Aufstiegen die meteorologischen Parameter wie Luftdruck, Temperatur und Feuchte von nahe der Erdoberfläche bis etwa 6000 m Höhe zu messen. Auf diesen Flügen wurde die Reichweite der Flugzeuge vom Typ He 111 und Ju 88, die bei rund 3000 km für einen Rundflug über dem Nordmeer lag, oft voll ausgeschöpft. Durchschnittlich gab es zwei Wetterflüge pro Tag, an manchen Tagen konnten es aber auch bis zu sechs Flüge sein. Insgesamt wurden zwischen 1941 und 1944 von den beiden Wetterstaffeln über 1000 Flüge über den Nordatlantik durchgeführt.2 Einer der erfahrensten Flugkapitäne war Leutnant Rudolf Schütze (1909-1943), der zudem auch sehr anschaulich seine Flüge beschrieb. Er wird uns in seinem Bericht aus dem Jahr 1940 mit auf einen Wetterflug in Richtung Island nehmen.
Die während der Flüge gesammelten Wetterdaten sind Ende des Zweiten Weltkrieges leider weitgehend verloren gegangen, aber einige generelle meteorologische Erfahrungen über wolkenarme Schönwetterlagen im Frühjahr, sommerlichen Seenebel oder Südwestwindlagen, die bis auf den Sommer immer mit der Vereisungsgefahr für Flugzeuge einhergehen, konnten später noch zusammengetragen werden.3
Etwa gleichzeitig mit den Wetterflügen wurden auch Wetterbeobachtungsschiffe (WBS) auf bestimmte Positionen im Nordatlantik positioniert.4 Zunächst sollte ein Beobachter, in diesem Fall Rupert Holzapfel, auf dem WBS I »Sachsen« von September bis November 1940 zwischen Island und Südgrönland über drei Monate lang regelmäßig mit Barometer, Thermometer und Hygrometer meteorologische Daten sammeln, so wie es damals auch auf den Feuerschiffen in der Deutschen Bucht üblich war (Abb. 1, 2).
Auf dem zweiten Einsatz im Frühjahr 1941 führte Hans-Ro bert Knoespel (1915-1944) in der Dänemarkstraße zwischen Grönland und Island und später bei Jan Mayen die meteorologischen Beobachtungen durch. Dafür war an Deck eine Wetterhütte eingerichtet worden (Abb. 3).
Links oben sieht man einen Thermographen und darunter einen Hygrographen, die kontinuierlich die Temperatur bzw. die Luftfeuchtigkeit aufzeichnen. Im rechten Hintergrund befinden sich zwei identische Thermometer, wobei der Quecksilberbehälter des rechten mit einem Gazestrumpf bedeckt ist und mit einem Asprirator ventiliert wird. Zur Messung der Luftfeuchtigkeit wird der Gazestrumpf benässt und entzieht durch die Verdunstung dem Thermometer Wärme. Aus der Temperaturdifferenz zwischen feuchtem und trockenem Thermometer kann man mittels sogenannter Psychrometertafeln die relative Luftfeuchtigkeit bestimmen. Im Vordergrund liegt oben schräg das Minimumthermometer und darunter gerade das Maximunthermometer, mit denen zwischen den Beobachtungsterminen auftretende Extremwerte erfasst werden können.
Abb. 2: Aufriss des Wetterbeobachtungsschiffes WBS I »Sachsen«
Abb. 3: Typische Wetterhütte des Deutschen Wetterdienstes, links: Thermo- und Hygrograph, rechts: Psychrometer, Minimum- und Maximumthermometer
Zusätzlich zu diesen sogenannten Bodenmessungen sollten auch mit Radiosonden die Wettergegebenheiten in höheren Luftschichten untersucht werden. Dafür wurde eine Radiosonde an einen Ballon befestigt, die während des Aufstiegs bis fast in 20 km Höhe in festgelegten Zeitabständen den Luftdruck, die Temperatur und die Feuchte maß und die Daten dann umgehend per Funk zur Bodenempfangsstelle auf dem Schiff sendete. Zusätzlich wurden zur Bestimmung der Windrichtung in der Höhe auch sogenannte Pilotballone eingesetzt. Es handelt sich hierbei um einfache Ballone, an denen in der Winternacht kleine Lampen befestigt wurden. Mit einem Theodoliten wurden die Ballone beim Aufsteigen in den Himmel verfolgt und in regelmäßigen Abständen Azimuth und Elevation, d. h. Richtungs- und Höhenwinkel, abgelesen und daraus in der entsprechenden Höhe unter Zugrundelegung der Steiggeschwindigkeit des Ballons die Windgeschwindigkeit und die jeweilige Richtung berechnet. (Abb. 4)
Zwei kurze Übersichtsberichte des Meteorologen Franz Nusser (1902-1987) vom Seewetteramt Hamburg (heute Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie) informieren über die beiden Einsätze von WBS I »Sachsen« in den Jahren 1940 und 1941. Im Juli 1944 wurde das elfte und letzte Wetterbeobachtungsschiff, WBS XI »Externsteine«, ein umgebauter Trawler, in Dienst gestellt, das, wie auch andere WBSs, nicht nur für Beobachtungen, sondern auch für spezielle Versorgungsfahrten im Einsatz war.5
Abb. 4: Pilotballonaufstieg in der Winternacht beim Wetterbeobachtungsschiff WBS I »Sachsen«
Fallweise wurden neben Schiffen auch U-Boote verwendet, die unerkannt auf Tauchfahrt spezielle Regionen für ihre Beobachtungen anlaufen konnten. Im Zusammenhang mit den deutschen Operationen gegen die englischrussischen Geleitzüge lieferten sie vor allem Informationen über die Eisverteilung im Nordmeer, die von Flugzeug aus ergänzt wurden. Der Meteorologe Werner Reichelt 1911-1987) berichtete einerseits nüchtern über die Erfahrungen während seines Einsatzes auf dem U-Boot »U 251« in Begleitung der Operation »Wunderland« zur Schließung der Nordostpassage sowie andererseits über die unterwegs beobachteten Eisverhältnisse des Europäischen Nordmeeres und der Barentssee im Jahr 1942 (Abb. 5).
Militärische Aktionen, wie den Beschuss der kleinen Wetter- und Radiostation auf der Einsamkeitsinsel von »U 255«, erwähnt Reichelt nicht, obwohl er dem Wetterbericht am 8./9.9. viel Aufmerksamkeit schenkte (vgl. Abb. 24).6 Nachdem aus Sicherheitsgründen der Einsatz von Wetterbeobachtungsschiffen nur in der dunklen Jahreszeit möglich war, schlug Knoespel aufgrund seiner persönlichen Erfahrung dem Chef des Marinewetterdienstes den Betrieb einer ganzjährig besetzten Landstation in der Arktis vor. Da bot sich jenseits des Polarkreises die von Norwegen verwaltete Insel Spitzbergen an, wo es nur wenige Bergwerkssiedlungen gab und viele gut geschützte Stellen in einsamen Fjorden, die vor allem während der dunklen Polarnacht nicht entdeckt werden konnten.7
Abb. 5: Das U-Boot »U 251« der Operation »Wunderland« unter Kapitänleutnant Timm im Hafen von Narvik, Sommer 1942
Für die Unternehmung konnten sich Freiwillige melden. Benötigt wurde ein Leiter, ein Meteorologe, der auch Stationsleiter sein konnte, ein Wetterdiensttechniker, ein Funker samt Assistent, sowie ein Matrose als Hilfskraft. Dies war für die meist jungen Männer eine großartige Möglichkeit, dem Fronteinsatz zu entkommen und Abenteuer zu erleben. Die erste Station wurde im Oktober 1941 unter der Leitung von Hans-Robert Knoespel auf der Ostseite der Mitrahalbinsel im Kreuzfjord (Westspitzbergen) eingerichtet und erhielt in Anlehnung an den Stationsleiter den Decknamen »Knospe«. Die gesamte Ausrüstung bestehend aus Nahrungsmitteln, Bauteilen für die Überwinterungsstation und den meteorologischen Mess-, Empfangs- und Auswertegeräten wurde mit den Wetterbeobachtungsschiffen WBS I »Sachsen« und WBS III »Fritz Homan« nach Spitzbergen transportiert. Zunächst wurde das Winterlager in Küstennähe aufgebaut (Abb. 6).
Regelmäßig lasen die Männer die Messgeräte in der Wetterhütte ab, die Daten der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit lieferten. Der Barograph zur Bestimmung des Luftdrucks befand sich in der Station selbst. Am wichtigsten waren die Radiosondenaufstiege, die auch in der Winternacht durchgeführt wurden (Abb. 7).
Nach dem Abschmelzen der Schneedecke zog sich die sechsköpfige Gruppe mit ihren Messgeräten zur Sicherheit in ein Versteck auf einem nahegelegenen Bergrücken zurück, wo die Mannschaft bis zu ihrer Abholung mit dem U-Boot »U 425« im August 1942 blieb. Bevor das Material zur Neige ging, hatte die Gruppe im Winter insgesamt 109 Radiosondenaufstiege durchgeführt, davon waren 86 erfolgreich und reichten mindestens bis 5000 m Höhe hinauf. Nachdem ein Flugzeug den dringend benötigten Nachschub abgeworfen hatte, konnte der Radiosondendienst im Frühjahr wieder aufgenommen werden. Von den 42 neuen Aufstiegen waren 29 Aufstiege brauchbar. Dies ergab eine Erfolgsquote von insgesamt 76%, was eine sehr beachtliche Leistung in dieser unwirtlichen Gegend darstellte.
Abb. 6: Winterlager der Unternehmung »Knospe« auf der Mitra-Halbinsel (Spitzbergen) im Frühling 1942
Abb. 7: Winterlager der Station »Nussbaum« im Juni 1943 nach der Entdeckung durch ein norwegisches Kommando
Um weiterhin Wetterdaten zu bekommen, wurde bei der Abholung der Stationsmannschaft in der Nähe der Winterstation eine automatische Station (WFL 21) mit dem Kodenamen »Gustav« eingerichtet, die noch weitere drei Monate lang regelmäßig Wetterdaten zu einer Empfangsstation auf dem norwegischen Festland sendete (Abb. 8).
Der Temperatursensor befindet sich hinter einem Strahlungsschutz an der hohen Stabantenne. Daneben erkennt man den Windmessmast mit dem Schalenkreuzanemometer und der Windfahne. Zehn große Batterietöpfe liefern die benötigte Energie zum Messen und senden.
Der Betrieb einer bemannten Wetterstation auf Spitzbergen hatte sich bewährt und gegenüber den Wetterbeobachtungsschiffen einige Vorteile gezeigt. Sie war ortsfest und benötigte wesentlich weniger Personal als ein Schiff, das zudem immer wieder die Position wechseln musste, um nicht entdeckt zu werden. Außerdem stellte sich heraus, dass die jeweilige Wetterlage im Nordmeer mit den Informationen aus Spitzbergen viel besser analysiert werden konnte.
Nachdem die Station im vorhergehenden Jahr nicht entdeckt worden war, sollte sie schließlich von einer neuen Mannschaft unter dem Decknamen »Nussbaum« im Oktober 1942 wieder in Betrieb genommen werden. Die Vorbereitung der Unternehmung konnte in der äußerst knappen Zeit bis zur Ausreise nur durch den Einsatz aller Kräfte gelingen. Die Leitung bekam der bereits erwähnte Marinemeteorologe Franz Nusser übertragen, der wie auch Knoespel bereits über Polarerfahrung verfügte. Die Dienststelle Admiral Nordmeer in Narvik war jetzt der Ausgangspunkt der Unternehmung, während die Landstation für den Funkverkehr nun die Marinefunkstelle in Tromsö war. Der Ausrüstungstransport ab Narvik geschah diesmal mit U-Boot »U 377«. Allerdings konnten hier zur Verpackung des gesamten Materials nur U-Boot-Kisten mit einem maximalen Durchmesser von 55 cm verwendet werden. Weil der Raum für den Transport sehr begrenzt war, gab es keinen Platz für die Wasserstoffflaschen zur Befüllung der Wetterballone. Stattdessen wurden Aluminiumgries und Ätznatron für eine Wasserstoffproduktion vor Ort mitgenommen. Der Nachschub kam wieder mit dem Flugzeug, vom dem mit Fallschirmen versehene Spezialbehälter abgeworfen wurden. Zufällig wurde im Juni 1943 ein Stationsmitglied bei einem Ausflug entdeckt und während eines Schusswechsels getötet. Die verbleibenden fünf Männer flüchteten in ein Ausweichlager an die Küste und konnten umgehend am 22. Juni mit dem U-Boot »U 302« abgeholt werden.
Abb. 8: Wetterfunkgerät (Land) in der Version von 1944
Zugleich wurde an der Ostküste Grönlands die Station »Holzauge« (1942/43) unter der Leitung von Leutnant zur See Hermann Ritter (1891-1968) besetzt. Ritter hatte 1934/35 zusammen mit seiner Frau Christiane (1897-2000) auf einer Hütte bei Grähuk (Grauhuk) überwintert und war in der Umgebung auf Jagd gegangen.
Abb. 9: Das von Hand-Robert Knoespel aus den Bestandteilen mehrerer Knoespelwürfel konzipierte Arktikhaus für zwölf Personen im Grundriss und Querschnitt.
Während Nusser sich noch auf Spitzbergen befand, hatte Knoespel in Deutschland ein Baukastensystem aus Fertighäusern entwickelt, mit dem sehr einfach verschieden große Überwinterungshütten in der Arktis errichtet werden konnten. Der sogenannte »Knoespel-Würfel« bestand aus einer Hütte mit einer Grundfläche von ca. 3 m × 3 m und 2,20 m Höhe, die beliebig zu größeren Einheiten zusammengesetzt werden konnte. Dies ermöglichte es, in der Arktis aus den Fertigteilen sehr leicht Stationshäuser für bis zu 12 Mann in zu errichten (Abb. 9).8
Holzfachwerk bildete den Fußboden, die einzelnen Wände und die Decke. Die Außenwände wurden mit verfugten Holzbrettern verkleidet, während die Innenwände einen Segeltuchbezug bekamen. Statt Glas erhielten die Fenster weniger bruchempfindliche Cellon-Kunststoff-Scheiben. Aus Gewichtsersparnis gab es aber keine Doppelwände, wodurch die Dämmung zwischen beiden Wänden entfiel. Dies stellte sich bei der Überwinterung allerdings als Nachteil heraus.
Als Nusser im Sommer 1943 aus Spitzbergen zurückgekehrt war, wurde er zum wissenschaftlichen und logistischen Berater für die Arktisstationen des Marinewetterdienstes ernannt. Aufgrund der erfolgten Feindberührung während der Unternehmung »Nussbaum« konnte der alte Standort für geheime Wetterbeobachtungen nicht mehr gehalten werden (Abb. 10). Der neue Standort wurde nun weiter nördlich in den Liefdefjord gelegt und erhielt den Codenamen »Kreuzritter«.
Zudem musste jetzt auch für die militärische Sicherheit gesorgt werden, so dass neben den sechs üblichen Stationsmitgliedern auch noch fünf Soldaten unter der Leitung von Leutnant Scharlipp hinzukamen. Knoespel war erneut für die Stationsleitung vorgesehen. Die Teilnehmer setzten sich folgendermaßen zusammen:
Abb. 10: Verteilung der Marinewetterstationen und der Wetterbeobachtungsschiffe in der Arktis 1941-1945
HANS-ROBERT KNOESPEL: wissenschaftlicher Leiter (Erfahrung aus Unternehmen Knospe)
Ltn. HEINZ SCHARLIPP: militärischer Leiter
GUSTAV MÖNNINGHOFF: Radiosonden- und Gerätetechniker (Erfahrung aus Unternehmen Knospe)
HELMUT (auch Helmuth oder Hellmuth geschrieben) KÖHLER: Sanitäter
ANTON POHOSCHALY: Eis- und Pegelmessungen
(Erfahrung aus Unternehmen Knospe)
EMIL LAURENZ: Koch und Proviantmeister
FRITZ GRAUMANN: Wetterdiensttechniker
Fk. Mt. HEINZ ACKERMANN Stationsaufgaben
(Erfahrung aus Unternehmen Knospe, schied am 29.9.43 aus)
Ob. Gefr. FRANZ KRAUS: Skilehrer und Jäger
Fk. Ob. Gefr. HEINZ MÜLLER: Schlosser und Jäger
Fk. Gefr. WALTER KEIM: Funker
Fk. Gefr. ERNST MÜLLER: Assistent des Gerätetechnikers
Matr. Gefr. FRIEDRICH-WILHELM KRÜGER: allgemeine Stationsaufgaben (Erfahrung aus Unternehmen Knospe)
Die Anreise geschah diesmal mit dem Wetterbeobachtungsschiff WBS III »Karl J. Busch«, weil nun das Baumaterial für eine 12-Personenhütte und der entsprechend vermehrte Proviant mitgenommen werden sollte (Abb. 11).
Abb. 11: Das Wetterbeobachtungsschiff WBS III »K.J. Busch« in Kiel
Zur Sicherung des Transports und für die geheime Erkundung der Nachbarfjorde des Liefdefjords wurde als Begleitung das U-Boot »U 355« zugewiesen. Das hier erstmals veröffentlichte Stationstagebuch von Knoespel gibt einen Einblick in den Aufbau und das tägliche Leben auf einer abgeschiedenen arktischen Station während des Zweiten Weltkrieges, das geprägt war von der militärischen Sicherung, den routinemäßigen Wetterbeobachtungen, Radiosondenaufstiegen sowie der zusätzlichen Sorge, nicht entdeckt zu werden. Aus diesem Grund wurden neben dem Winter- und dem Sommerlager zusätzliche Ausweichlager und Depots eingerichtet und teilweise mit Telefonleitungen untereinander verbunden, um für alle Eventualitäten gewappnet zu sein. Diese schier endlosen Arbeiten beschäftigten vor allem die Soldaten, die sonst glücklicherweise wenig zu tun gehabt hätten. Der Proviant spielte eine große Rolle, und die Verluste von Rauchwaren durch Feuchtigkeit waren oft schmerzlich. Auch hier wurde der Nachschub mit einem Flugzeug gebracht. Als Ende 1943 keine Nachrichten mehr von daheim eintrafen, war die Sorge um die Angehörigen groß. Im Winter stellte sich dann auch Langeweile ein, so dass die Mannschaft beschäftigt werden musste. Ab Mai 1944 gab es schließlich Kontakt mit anderen arktischen Wetterstationen. »Roderich« war der Tarnname für das Wetterbeobachtungsschiff WBS II »Coburg«, das sich vor der Ostküste Grönlands in der Nähe der Station »Bassgeiger« befand. Diese Wetterstation wurde am 22.4.1944 von amerikanischen Soldaten entdeckt und beschossen. Daraufhin wurde der Wettertrupp vorzeitig am 3.6.1944 mit einer Junkers JU 290 von Vaernes aus abgeholt.9
Die Station »Schatzgräber« war auf Alexandra-Land im Archipel von Franz-Josef-Land im Osten tätig. Gespannt wurden die Nachrichten von der Invasion der Alliierten an der Atlantikküste am 6. Juni 1944 verfolgt, die bekanntlich jedoch nicht so ausfielen, wie damals von deutscher Seite erhofft.
Das Tagebuch hört am 29. Juni 1944, drei Tage vor der Abholung der Stationsmannschaft mit U-Boot »U 737« auf. Vom 1. Dezember 1943 bis 26. Juni 1944 wurden insgesamt 608 Bodenwettermeldungen (Obse) und 201 Höhenwettermeldungen (Temps) aus Radiosondenaufstie gen erfolgreich abgesetzt. Trotz dieses Erfolges endete die Wetterdienstoperation tragisch, denn am 30. Juni wollte Knoespel noch die Selbstsprengladung einer nahegelegenen Jagdhütte unschädlich machen, die zum Schutz der Station vor einem Überraschungsangriff angebracht worden war und jetzt nach dem Verlassen der Station keinem zivilen Jäger mehr schaden sollte. Offenbar löste sich der Auslösemechanismus, noch bevor Knoespel den Ort verlassen konnte. Kurz nach der Explosion wurde er schwer verletzt und ohne Bewusstsein aufgefunden. Drei Stunden später verstarb er. Am folgenden Tag wurde er auf dem sogenannten Stationshügel beigesetzt, wo bereits kurz zuvor ein Teil der U-Bootbesatzung die automatische Wetterfunkstation Land (WFL 33) mit dem Kodenamen »Edwin III« eingerichtet hatte (Abb. 12).
Die automatischen und bemannten arktischen Wetterstationenlieferten weiterhin wichtige Daten in dem sich zuspitzenden Kriegsgeschehen. Im September 1944 wurde nach der Ausbringung der Station »Haudegen« auf Nordostland mit dem WBS III »Karl J. Busch« das Gebäude der Station »Kreuzritter« in Brand gesetzt, nachdem noch nützliche Vorräte an Bord genommen wurden (Abb. 13). Sie sollte dem Feind nicht von Nutzen sein.
nützliche Vorräte an Bord genommen wurden (Abb. 13). Sie sollte dem Feind nicht von Nutzen sein.
Die automatischen und bemannten arktischen Wetterstationen lieferten weiterhin wichtige Daten in dem sich zuspitzenden Kriegsgeschehen. Im September 1944 wurde nach der Ausbringung der Station »Haudegen« auf Nordostland mit dem WBS III »Karl J. Busch« das Gebäude der Station »Kreuzritter« in Brand gesetzt, nachdem noch
Abb. 12: Die automatischen Wetterfunkstation Land (WFL 33) »Edwin III« bei der Aufstellung im Liefdefjord am 1. Juli 1944
Abb. 13: Die im September 1944 im Liefdefjord in Brand gesetzte Station »Kreuzritter«
Bei einem Besuch der Station »Kreuzritter« im Jahr 2000 wurden außer dem Grab nur noch Holz- und rostige Metallreste der zerstörten Station gefunden, die nun im Rahmen des Denkmalschutzes in Spitzbergen dort für immer liegen bleiben.
Die hier zusammengestellten Berichte sollen einen Eindruck geben, wie das Wetter unter Kriegsbedingungen mittels Flugzeug, Schiff, U-Boot und Landstation »gemacht wurde«. So unterschiedlich geartet die Berichte auch sein mögen, liefern sie doch ein authentisches Bild jener vergangenen Zeit, die wir hoffentlich nie wieder erleben werden.
1 Holzapfel 1950, Kington and Selinger 2006, Selinger 2001, Schwerdtfeger und Selinger 1982.
2 Macht 1951.
3 Macht 1951.
4 Holzapfel 1950, Nusser 1979, Selinger 2001.
5 Selinger 2001.
6 Selinger 2001: 320.
7 Holzapfel 1951, Nusser 1979, Machoczek 1993, Selinger 2001.
8 Nusser 1948.
9 Selinger 2001: 246-249.
EDITORISCHE NOTIZ
Die Rechtschreibung wurde bis auf offensichtliche Tippfehler gemäß dem Original beibehalten. An einigen Stellen wurden zur besseren Verständlichkeit Ergänzungen in eckigen Klammern hinzugefügt. Die Tabellen, die in Knoespels Tagebuch eingearbeitet waren, wurden um der leichteren Lesbarkeit willen in den Anhang gesetzt. Die meisten Abbildungen und Fotos sowie einige Karten sind zur Illustration des Textes aus den angegebenen Quellen ergänzt worden.
Ein Wettererkundungsflug [1940]
Rudolf Schütze
Während wir in Vaernes in gemütlicher Runde nach dem Abendessen beieinander sitzen, betritt ein Kraftfahrer unseren Raum und überbringt ein eben eingetroffenes Fernschreiben, den Einsatzbefehl für morgen: »Wettererkundung 270°, Startzeit 06.30.«
Pünktlich um 05.45 Uhr versammelt sich die Besatzung, der Meteorologe Regierungsrat Dr. [Paul] Kothe [gest. 1941], der Bordfunker Oberfeldwebel Witt, der Bordmechaniker Unteroffizier Gerber und ich als Flugzeugführer, zu einem kräftigen Frühstück. Jeder bekommt ein Ei, Weißbrot, Butter, Aufschnitt und Bohnenkaffee, eine gute Grundlage für einen langen Flug.
Draußen ist es fast vollständig dunkel, eine leichte Schneedecke bedeckt den Boden, tiefe geschlossene Bewölkung erfüllt den ganzen Himmel. Während wir der Halle näherkommen, klingt uns das Brummen der Flugmotoren entgegen. Das Wartungspersonal hat schon längst unsere schwere Heinkel He 111 aus der Halle gezogen und lässt nun draußen mit mäßiger Drehzahl die Motoren warm laufen. Nach kurzer Triebwerks- und Instrumentenprobe kann es losgehen.
Über eine enge Rollbahn erreichen wir die breite Start- und Landefläche; die Flugleitung hat schon alles vorbereitet und weiße, grüne und rote Lampen wie üblich ausgestellt.
An den grünen Lichtern bringe ich die Maschine genau in Startrichtung. Langsam und gleichmäßig schiebe ich die beiden Gashebel bis ganz nach vorne. Die Motoren beginnen ihr klangvolles Dröhnen und geben ihre volle Höchstleistung. Sie ziehen mit großer Kraft das Flugzeug vorwärts, man spürt es daran, wie die Rückenlehne den Körper mit starkem Druck voranschiebt. Durch Vorwärtsdrücken des Höhensteuers bringe ich schon nach wenigen Sekunden den Rumpf in horizontale Lage, um möglichst schnell auf Geschwindigkeit zu kommen. Den Blick geradeaus gerichtet, steure ich mit den Seitensteuerpedalen das Flugzeug genau auf der Bahnmitte entlang auf die roten Endlampen zu. Der weiße Leuchtpfad zieht links von mir in stetig zunehmendem Tempo vorbei. Mit leicht wogender Bewegung rast die große Maschine dahin. Bald überschreitet der Geschwindigkeitsmesser 150 Stundenkilometer, kaum 45 Sekunden sind bis dahin vergangen. Nun genügt ein ganz leichtes Ziehen am Höhensteuer, und das schwere Flugzeug hebt sich sanft vom Boden, kaum dass man den Übergang vom Rollen zum Fliegen spürt. Schon huschen die letzten roten Lichter etwa 10 m tief unter uns hinweg, dann ist draußen nichts mehr zu sehen, alles ist dunkel; nur die eisernen Auspuffrohre der Motoren glühen in tiefem Rot.