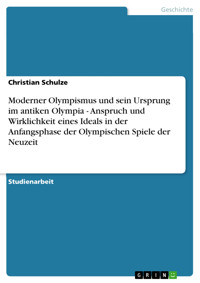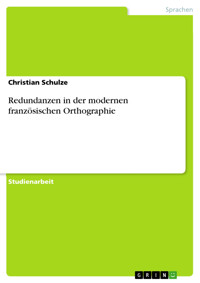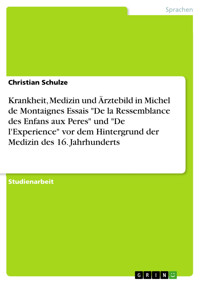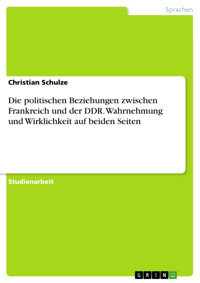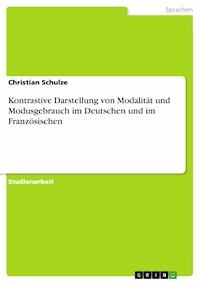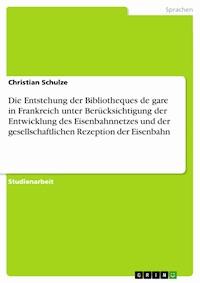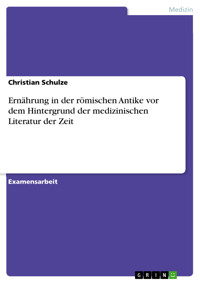
Ernährung in der römischen Antike vor dem Hintergrund der medizinischen Literatur der Zeit E-Book
Christian Schulze
36,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Examensarbeit aus dem Jahr 2010 im Fachbereich Medizin - Geschichte, Note: 1,3, Humboldt-Universität zu Berlin (Institut für Geschichtswissenschaften), Sprache: Deutsch, Abstract: Ernährung ist kein rein physiologischer Vorgang. Die Frage, was Menschen essen, unterliegt vielmehr zahlreichen sozio-kulturellen Einflussfaktoren und ökonomischen Zwängen. Für die römische Antike ist die Ernährungslage inzwischen sehr gut dokumentiert. Verschiedene Historiker widmeten sich zudem einzelnen Unteraspekten des Themas, zu nennen sind hier vor allem Veröffentlichungen zu sozialen und politischen Aspekten der Ernährung oder zur Ernährung in Hungerkrisen. Daneben existiert inzwischen eine breite Literatur, die die Texte der medizinischen Autoren der Antike in den Blick nahm und untersuchte, wie diese über gesunde Lebensführung und richtige Ernährung dachten. Ziel dieser Arbeit ist nun gewissermaßen ein Brückenschlag zwischen medizinischen Texten der Antike und Erkenntnissen zur Ernährungslage. Ausgehend von der Frage, was gegessen wurde, werden die Texte der antiken medizinischen Autoren auf ihre Bewertung dieser Ernährung befragt. Es wird untersucht, welche Ernährung sie für günstig erachteten und welche Qualität sie verschiedenen Nahrungsmitteln zusprachen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Page 1
Page 3
1. Einleitung
Ernährung ist kein rein physiologischer Vorgang. Die Frage,wasMenschen essen, unterliegt vielmehr zahlreichen sozio-kulturellen Einflussfaktoren und ökonomischen Zwängen. Für die römische Antike ist die Ernährungslage inzwischen sehr gut dokumentiert: Jacques André legte mitL’alimentation et la cuisine à Romeein erstes und bis heute wichtiges Standardwerk vor. In der Folgezeit widmeten sich verschiedene Historiker einzelnen Unteraspekten des Themas, zu nennen sind hier vor allem Peter Garnseys Veröffentlichungen zu sozialen Aspekten der Ernährung in Rom und zur Ernährung in Hungerkrisen sowie Ulrich Fellmeths Darstellung zu sozio-politischen Aspekten der Ernährung. Daneben nahmen Ludwig Edelstein, Georg Harig, Erich Schöner und Georg Wöhrle die Texte der medizinischen Autoren der Antike in den Blick und untersuchten, wie diese über gesunde Lebensführung und richtige Ernährung dachten. Zuletzt griff Silke Kotzan die Thematik erneut auf und brachte Erkenntnisse zur Ernährungs- und Gesundheitslage zusammen.
Ziel der vorliegenden Arbeit ist nun gewissermaßen ein Brückenschlag zwischen medizinischen Texten der Antike und Erkenntnissen zur Ernährungslage. Ausgehend von der Frage,wasgegessen wurde, werden die Texte der antiken medizinischen Autoren auf ihre Bewertung dieser Ernährung befragt. Es wird untersucht, welche Ernährung sie für günstig erachteten und welche Qualität sie verschiedenen Nahrungsmitteln zusprachen.
Page 4
Um die Position der antiken Medizin zu erfassen, müssen vor allem die Werke von drei Autoren Beachtung finden: Hippokrates von Kos, Aulus Cornelius Celsus1und schließlich Galen von Pergamon. Ihre hinterlassenen Texte sind derart umfangreiche Quellen, dass sich das heutige Wissen über die antike Medizin zu großen Teilen aus dem Œuvre dieser drei Verfasser speist. Zugleich handelt es sich bei Hippokrates‘ und Galens Texten keinesfalls um konsistente Darstellungen. Bei vielen der über 60 Werke des Corpus Hippocraticum ist entweder die Urheberschaft ungeklärt oder sie sind nachweislich erst nach Hippokrates entstanden,2ebenso sind sehr wahrscheinlich nicht alle Galenschen Texte von ihm selbst verfasst.
Obwohl sich die Arbeit im Hinblick auf die Ernährung auf die römische Welt konzentrieren wird, kann das medizinische Denken nur dann umfassend durchschaut werden, wenn auch Quellen aus der griechischen Antike, im Besonderen das Werk Hippokrates‘, herangezogen werden. Zugleich lassen sich gewisse zeitliche Inkonsistenzen nicht vermeiden. Wenn beispielsweise die Meinungen Hippokrates‘ und Galens zu einer bestimmten Speise verglichen werden, muss der Umstand, dass die Texte im Abstand von mehreren hundert
1Zur Frage, ob Celsus als Arzt der Antike oder vielmehr als medizinischer Laie gelten muss: Schulze,
Christian,Aulus Cornelius Celsus - Arzt oder Laie?. Autor, Konzept und Adressaten der De medicina
libri octo,Trier 1999 (Es handelt sich hier - wie auch bei den beiden Titeln von Christian Schulze,
die im Literaturverzeichnis aufgeführt sind - trotz der Namensgleichheit nicht um den Verfasser
dieser Arbeit).
2Man nimmt heute an, dass das gesamte Corp. Hippokr. von mindestens 20 unterschiedlichen
Autoren verfasst worden sein muss. Vgl. Kotzan, 2007, S. 14. Zudem gibt es nicht nur formale und
sprachlich-stilistische Unterschiede zwischen den Texten, sondern sie fußen oftmals auch auf sehr
unterschiedlichen physiologischen, pathologischen und ätiologischen Theorien. Zudem handelt es
sich um ganz verschiedene Textsorten (Vorträge, Exzerpte, Texte zur Publikation), die oft auch
widersprüchliche Lehrmeinungen vertreten. Vgl. hierzu Schöner, 1964, S. 16; Jouanna, 1996, S. 38f.
Page 5
Jahren entstanden sind, außer Acht gelassen werden. Vielmehr sollen sie als repräsentativ für das medizinische Denken der Antike gelten.
Daneben kommen vor allem die Texte der römischen Agrarschriftsteller Plinius, Varro, Cato und Columella als wichtige Quellen hinzu. Sie liefern viele direkte oder indirekte Hinweise zur Ernährungslage verschiedener sozialer Gruppen. Guten Einblick in die Küche der Oberschicht geben schließlich das Kochbuch des Apicius und Petronius‘Satyricon.Flankiert werden diese literarischen Zeugnisse von archäologischen Quellen, beispielsweise Skelettfunden, Pflanzenresten, Tierknochen oder menschlichen Fäzes.3
Für ein besseres Verständnis der medizinischen Texte soll zunächst das medizinische Denken der Antike etwas globaler umrissen werden: Es geht um die Frage, welche Vorstellung man vom Körper, seiner Gesundheit und einer richtigen Lebensweise hatte. Es scheint sodann sinnvoll, die römische Gesellschaft für eine detaillierte Betrachtung in soziale Gruppen zu gliedern, die einzeln untersucht werden.4Zunächst wird der Blick auf die wenig vermögenden Schichten gerichtet, indem die Ernährung der Sklaven und „Armen“ aus der Sicht der medizinischen Autoren untersucht wird. Obwohl diese alle selbst der Oberschicht entstammten, schrieben sie keinesfalls nur über Gesundheit und
3Vgl. Garnsey, 1999, S. 115. Garnsey verweist hierbei aber auch darauf, dass archäologische Funde
zumeist nur unsichere Rückschlüsse auf die soziale Hierarchisierung zulassen.
4Gunther Hirschfelder weist in diesem Zusammenhang aber darauf hin, dass eine Darstellung zur
römischen Ernährungsgeschichte stets punktuell bleiben muss, da sie gezwungen ist, die
Divergenzen einer 1000-jährigen Epoche, die dazu einem ständigen kulturellen Wandel unterlag,
und die gravierenden lokalen Unterschiede im gesamten Römischen Reich zu nivellieren. Vgl.
Hirschfelder, 2001, S. 77. Vgl. zur Frage der lokalen Besonderheiten auch Gerlach, 1986, S. 15-21;
André, 1998, S. 124; Kotzan, 2007, S. 353-355; 360.
Page 6
Ernährung der Elite. Große Teile ihres Werkes zielen vor allem auf die Essgewohnheiten der unteren sozialen Schichten ab.5Dies ist auch von Vorteil, wenn in einem späteren Kapitel die Ernährung in Krisen- und Hungerperioden genauer betrachtet wird, unter denen in erster Linie die Schichten zu leiden hatten, die weder über große Vorräte noch über finanzielle Reserven verfügten. Im weiteren werden dann die Ernährung der römischen Elite und einer wohlsituierten Mittelschicht in den Blick genommen, denn sie ernährten sich signifikant anders als ärmere Schichten, daher muss auch die Bewertung durch die medizinische Literatur anders ausfallen. Den Abschluss der Untersuchung bilden schließlich Bemerkungen zu der Frage, welche Ernährung die medizinischen Autoren für Kranke als günstig erachteten.
5Vgl. Garnsey, 1999, S. 115.
Page 7
2. Körperbild, Verständnis von Gesundheit, Krankheit,
richtiger Lebensweise und guter Ernährung
Es scheint zunächst geboten, das Wissen um Medizin und Ernährung theoretisch zu betrachten. Es gilt zu fragen, wie die antike Medizin den menschlichen Körper dachte, wie sie seine Funktionsweise beschrieb und wie sie schließlich das Kontinuum Gesundheit und Krankheit imaginierte.
Der Körper wurde als eine Mischung aus vier Körpersäften verstanden. Dieses humoralpathologische Schema findet sich bereits in einfacher Form bei Hippokrates angelegt6und beschreibt die vier Säfte als elementare Körperbe-standteile: Es waren Blut, gelbe Galle, schwarze Galle7und Schleim. Jeder dieser Körpersäfte war einem der vier Kardinalorgane des Körpers (Herz, Leber, Milz, Gehirn) zugeordnet, in dem er gebildet wurde. Zudem entsprach ihm je eine Qualität, die sich aus den beiden Dichotomien heiß/kalt und trocken/feucht ergab:
6Hippokr. Nat. hom. 4. Vgl. hierzu auch Schöner, 1964, S. 58.
7Es ist bislang nicht hinreichend geklärt, was die antike Medizin mit der „schwarzen Galle“ gemeint
haben könnte oder welche Beobachtung zur Annahme ihrer Existenz geführt haben könnte. Erich
Schöner vermutet, es könne sich mehr um ein theoretisches Konstrukt gehandelt haben, um die
Vierzahl der Humoralpathologie zu erreichen. Vgl. Schöner, 1964, S. 56f.; Grant, 2000, S. 19-36.
Page 8
Analog dazu wurden vier Lebensalter, vier Jahreszeiten und vier Elemente je einem der Körpersäfte zugeordnet.8Grundlage dieses Körperverständnisses war eine „naturphilosophische Interpretation des Organismus in der Perspektive des Parallelismus von Mikrokosmos und Makrokosmos“.9Der Mikrokosmos Mensch wurde als verkleinertes Abbild der Welt gesehen, die Entsprechung in den vier Körpersäften war demnach die Repräsentanz des Makrokosmischen im Individuum.
Die vier Säfte standen in jedem Körper in einem spezifischen und höchst individuellen Verhältnis zueinander. Dieses Mischungsverhältnis entschied über die allgemeine Konstitution des Individuums und seinen Gesundheitszustand. Der Körper galt als gesund, wenn die Körpersäfte in einem optimalen Verhältnis zueinander standen. Galen ist überzeugt, dass dieser Zustand, die Eukrasie, lebenslang vor Krankheit bewahren könne.10Ein schlechtes Mischverhältnis, die Dyskrasie, galt jedoch in höchstem Maße als gefährlich, denn es konnte den Körper schädigen, krank machen und in extremer Form auch zum Tode führen.
Damit ist auch klar, dass Gesundheit und Krankheit nicht länger als Folge göttlichen Einwirkens gesehen, sondern vielmehr als Naturvorgang verstanden wurden, auf den das Individuum ganz konkret einwirken konnte.11Hippokrates
8Hippokr. Vict. 1,33. Vgl. auch Steger, 2004, S. 149; Grant, 2000, S. 15. Erich Schöner merkt hierzu
an, dass Galen das Konzept von den vier unterschiedlichen Temperamenten (Sanguiniker,
Choleriker, Melancholiker und Phlegmatiker) zwar anreißt, keinesfalls jedoch so klar ausformuliert,
wie dies in späteren mittelalterlichen Darstellungen den Anschein hat. Vgl. Schöner, 1964, S. 93.
9Engelhardt, 1993, S. 139.
10Gal. De san. tuend. 5,1,17. Vgl. auch Kotzan, 2007, S. 207; Grant, 2000, S. 16;
Harig/Kollesch, 1971, S. 21.
11Vgl. Steger, 2004, S. 147.
Page 9
und Galen folgern, dass sich die individuelle Konstitution des Menschen in einer höchst individualisierten Lebensweise widerspiegeln müsse.12Es wurde angenommen, dass sich durch ein Eingreifen in die Lebensumstände jederzeit ein Zustand der Gesundung und des Wohlergehens erreichen lasse.13Der gesamte Einfluss des Einzelnen auf seinen Zustand komprimiert sich schließlich im Begriffdiaita.Darunter verstand man im engeren Sinne die Lebensweise jedes Einzelnen, es ging dabei um die gezielte positive Beeinflussung der eigenen Lebensumstände durch den Menschen selbst.
Einer der wichtigsten Aspekte bei der Frage nach der Optimierung der Lebensweise war stets die bewusste und planvolle Ernährung, doch schon Hippokrates wusste, dass diese keinesfalls allein genügen könne, dauerhafte Gesundheit zu erhalten. Vielmehr müsse zunächst ein optimales Verhältnis zwischen Ernährung, die Kräfte schafft, und Anstrengung, die Kräfte verbraucht, gefunden werden, um beide opponierenden Kräfte auszubalancieren.14Was Hippokrates bereits andeutet, findet sich dann ganz explizit bei Galen formuliert, nämlich dass noch andere Lebensbereiche die Gesundheit essentiell beeinflussen. Er gliedert das gesamte Spektrum der den Menschen beeinflussen-
12Vgl.Müri, 1950, S. 189; Gil-Sotres, 1996, S. 315; Wöhrle, 1990, S. 83; Harig/Kollesch, 1971,
S. 23.
13Vgl. Müri, 1950, S. 192; 194.
14Hippokr. Vict. 1,2; 3,1. Vgl. hierzu auch Wöhrle, 1990, S. 15; Edelstein, 1931, S. 163.
Page 10
den „nicht-natürlichen Dinge“ in sechs Paare und definiert damit die sogenanntensex res non naturales:15
Licht und Luft (aer)
Speise und Trank (cibuset potus)
Arbeit und Ruhe (motuset quies)
Schlaf und Wachen (somnuset vigilia)
Absonderungen und Ausscheidungen (secretaet excreta)
Anregung des Gemüts (affectusanimi)
Die bewusste Einflussnahme auf diese sechs Bereiche sollte jeden Menschen befähigen, seine Gesundheit zu kontrollieren. Oberstes Gebot war dabei ein ständiges Maßhalten und ein Ausgleichen von Extremen bzw. deren Vermeidung. So musste beispielsweise ein Übermaß an Arbeit mit vermehrter Ruhe ausgeglichen werden, um den Körper auszubalancieren und gesund zu erhalten.16
Bei den verschiedenen noch erhaltenen diätetischen Texten der Antike nehmen die Empfehlungen zurdiaitadann allerdings sehr unterschiedliche Formen an. Als ein recht frühes Zeugnis der griechischen Diätetik gilt ein Fragment des Diokles von Karystos, ein griechischer Arzt des 4. Jahrhunderts v. Chr. Es regelt den unter diätetischen Gesichtspunkten idealen Tagesablauf beinahe minutiös: Nach dem Aufstehen im Morgengrauen und einer sorgfältigen Toilette sollen zunächst ein Morgenspaziergang und ein leichtes Frühstück folgen. Nach der Regelung aller häuslichen Angelegenheiten setzt sich der Tag für die Jungen dann im Gymnasion fort, wo sie massiert und gesalbt werden und Übungen
15Diesex res non naturalesfinden sich erstmals explizit bei Gal. Ars. med. 23. Vgl. auch
Wöhrle, 1990, S. 13f.; 81f.; Engelhardt, 1993, S. 140.
16Vgl. Engelhardt, 1993, S. 140; Gil-Sotres, 1996, S. 317; Steger, 2004, S. 148.
Page 11
ausführen. Ältere Menschen nehmen stattdessen ein Bad. Nach einer leichten Mittagsmahlzeit sollen ein kurzer Schlaf und ein Spaziergang folgen, bevor man wieder das Gymnasion aufsucht, um den Körper zu trainieren. Nach einem Bad und einer Salbung folgt dann die abendliche Hauptmahlzeit, danach ein Verdauungsspaziergang. Das Einschlafen soll schließlich in einer genau beschriebenen Stellung erfolgen.17
Die Klarheit, mit der jedes Detail des Tagesablaufs in dieser diätetischen Anweisung geregelt wird, erlaubt einen guten Rückschluss auf einen offenbar bei Diokles mitgedachten, aber nicht formulierten Punkt: Wer seinen Tag nach diesem Muster gestalten will, muss in der Lage sein, sein gesamtes Tagesgeschäft der Sorge um den eigenen Körper zu verschreiben. Zwar erwähnt Diokles, man solle am Vormittag „häuslichen Angelegenheiten“ nachgehen, doch findet sich in diesem strikt geregelten Plan kaum genügend Zeit für eine regelmäßige Beschäftigung oder gar Erwerbstätigkeit. Darüber hinaus, so merkt Ludwig Edelstein an, fehle sogar Freiraum für angenehmere Tätigkeiten fernab aller beruflichen Verpflichtungen, zum Beispiel für die Teilnahme an einem Symposion.18Es liegt also nahe, zu vermuten, dass Sorge um den eigenen Körper und die eigene Gesundheit vor allem denen möglich war, die über genügend freie Zeit verfügten.
Diese Diskrepanz thematisiert Hippokrates ganz explizit. Er differenziert zwischen der „große[n] Masse der Menschen, die unter dem Druck der
17Vgl. Diokles von Karystos, fr. 141, zit. n. Harig/Kollesch, 1971, S. 16f. Vgl. hierzu auch