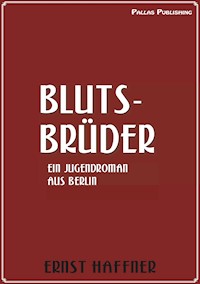
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Pallas Publishing
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ernst Haffner: Blutsbrüder | Für die eBook-Ausgabe neu lektoriert, voll verlinkt, mit eBook-Inhaltsverzeichnis und Fußnoten | Berlin, Anfang der 30er Jahre, kurz vor der Machtübernahme durch die Nazis: Auf den Straßen und Hinterhöfen der Stadt sammeln sich Cliquen obdachloser Teenager und junger Männer, die auf dem nackten Pflaster der Großstadt gestrandet sind. Sie kommen aus kaputten Familien, mit alkoholkranken Müttern, prügelnden Vätern, oder sind aus den berüchtigten Fürsorgeanstalten geflohen. Eine schwere Wirtschaftskrise hat das Land im Griff, die Arbeitslosigkeit ist gewaltig. Die meist noch Minderjährigen halten sich mit Gelegenheitsjobs, Kleinkriminalität, manchmal auch mit Prostitution über Wasser. Was die Jungs zusammenschweißt und am Leben hält, ist ihre Gruppe, ihre Gang, die Blutsbrüder. Es ist die andere, unbekannte Seite der Medaille der in Literatur und Film oft als mondän und dekadent gezeichneten Goldenen Zwanziger.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 228
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
— INHALT —
Innentitel
Vorbemerkung des Herausgebers
BLUTSBRÜDER
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Impressum
Fußnoten
Vorbemerkung des Herausgebers
Berlin, Anfang der 30er Jahre, kurz vor der Machtübernahme durch die Nazis: Auf den Straßen und Hinterhöfen der Stadt sammeln sich Cliquen obdachloser Teenager und junger Männer, die auf dem nackten Pflaster der Großstadt gestrandet sind. Sie kommen aus zerrütteten Familienverhältnissen, sind durch den Ersten Weltkrieg Weisen geworden, aus den berüchtigten, Zuchthaus-ähnlichen ›Fürsorgeanstalten‹ geflohen, oder haben alkoholkranke Mütter, prügelnde Väter. Die schwere Wirtschaftskrise hat das Land im Griff, die Arbeitslosigkeit ist gewaltig, bis in die Mittelschicht hinein herrschen Hunger und Not. Es ist der blanke Überlebenskampf, dem die meist noch Minderjährigen ausgesetzt sind. Sie halten sich mit Gelegenheitsjobs, Betrügereien, Kleinkriminalität, gelegentlich auch mit Prostitution über Wasser. Das einzige, was die Jungs zusammenschweißt und am Leben hält, ist ihre Gruppe, ihre Gang.
›Blutsbrüder‹ ist der Name der Jugendbande, die im Zentrum dieses Romans steht, in dem sowohl Schicksale einzelner Bandenmitglieder geschildert werden, als auch ein spannendes Gesamtbild mit mitreißenden, oft verstörenden und schockierenden Szenen gezeichnet wird. Es ist die andere, unbekannte Seite der Medaille der in Literatur und Film oft als mondän und dekadent gezeichneten ›Goldenen Zwanziger‹. Ernst Haffner deckt diese andere Seite auf, prägnanter als es jemals ein anderer deutscher Schriftsteller tat.
Der Hintergrund ist alles andere als Fiktion: 15.000 obdachlose Jugendliche sollen in Berlin Ende der 1920er Jahre in Cliquen zusammengelebt haben. Der bis vor kurzem vergessene Autor dieses Buches, der soweit man weiß nur dieses eine Werk hinterließ, kannte die Szene aus eigener Anschauung, denn neben seiner literarischen Tätigkeit scheint er auch als eine Art Streetworker die Jugendbanden begleitet zu haben. Ernst Haffner schreibt in einem schnörkellosen, reportagehaften und realistischen Stil, zu verorten zwischen Jack London und Egon Erwin Kisch. Und dieser Roman ist kein bloßer Versuch, sondern ein Meisterwerk, das sich ohne weiteres neben die großen Klassiker einreiht.
Über Ernst Haffner weiß man kaum etwas. Das Geburtsjahr ist nicht bekannt, ebenso wenig das Jahr seines Todes. Was man weiß, ist, dass er zwischen 1925 und 1933 in Berlin lebte und nach der Machtergreifung der Nazis Ende der 30er Jahre zusammen mit seinem Lektor zur Reichsschrifttumskammer zitiert wird. Nach 1938 verliert sich seine Spur, und es ist zu vermuten, dass er von den Nazis ermordet wurde oder in einem KZ ums Leben kam. Haffners Buch wurde in den Bücherverbrennungen wie viele andere Titel zu Asche, denn im Nationalsozialismus waren Themen wie Obdachlosigkeit, Arbeitslosigkeit oder gar die Prostitution junger Männer nicht erwünscht. Deutsche Jungs als verwahrloste Kriminelle und Stricher – das passte nicht ins heroische Männerbild.
›Blutsbrüder‹ ist eine der großen Wiederentdeckungen des letzten Jahrzehnts, die hauptsächlich dem Berliner Verleger Peter Graf zu verdanken ist. Ein Buch wie ein Sturm, mitreißend, schockierend, nackt und realistisch. Ein Klassiker der dramatischsten Zeit deutscher Geschichte, den man gelesen haben muss. Ein Rezensent: »Blutsbrüder ist eines dieser wenigen Bücher, die man inhaliert, ... und nach deren Lektüre man das Gefühl hat, etwas wirklich Wichtiges gelesen zu haben.«
© Pallas Publishing et. al., 2022
BLUTSBRÜDER
Kapitel 1
Winzige Glieder einer sich durch den langen Industriehof und zwei Etagen windenden müden Menschenschlange stehen die acht Jungen der Clique Blutsbrüder und warten gleich den hundert anderen darauf, endlich aus der furchtbaren Nasskälte in die warmen Wartesäle gelassen zu werden. Drei, vier Minuten wird es noch dauern. Dann, acht Uhr pünktlichst, wird in der zweiten Etage die schwere Eisentür geöffnet. Das Bezirkswohlfahrtsamt Berlin-Mitte in der Chausseestraße hat den ersten Ruck zur Ingangsetzung seines bürokratisch komplizierten Betriebes getan. Der Ruck pflanzt sich vielfach gewunden in der Menschenschlange fort. Die Glieder rücken auf, scharren mit den Füssen, halten in den Händen die unzähligen notwendigen Papiere. Zuvorkommend hat man amtlicherseits einen gedruckten Leitfaden herausgegeben, der in endloser Kolonne die nötigen Papiere aufzählt und an welchen vierundzwanzig Stadtzipfeln man solche ausgestellt bekommt.
Die Schlange hat bereits den riesigen Kassenwarteraum erreicht. Aus der Schlange bilden sich flugs zwei Schlänglein, militärisch exakt organisiert. Das eine Schlänglein wartet geduldig, bis das heisere Amtsfaktotum Paule ihm die Stempelkarten zur Vorbereitung der Auszahlungen abnimmt. Schlänglein Nummer zwei windet sich vor den Auskunftsschalter, um hier nach Beantwortung der Woher- und Wohinfragen eine Pappnummer zu erhalten. Dann stieben die einzelnen Glieder in zwei andere Säle vor die Türen der Herren Expedienten, um hier lammsgeduldig den Aufruf der Nummer zu erwarten. Die Lammsgeduld muss gut und gern fünf, sechs Stunden vorhalten. Die acht Cliquenjungen schließen sich weder dem einen noch dem anderen Schlänglein an, sondern flitzen schleunigst in die Ewige Hilfe. Vielleicht ist noch eine Bank zu ergattern.
Wartesaal der ›Ewige Hilfe‹. In den dazugehörigen Büros werden die Anträge auf Gewährung der Erwerbslosenhilfe gestellt. Die amtliche Abkürzung ›E. H.‹ hat eine bissige Schnoddrigkeit in ›Ewige Hilfe‹ umgedeutet. Bereits jetzt, eine halbe Stunde nach Öffnung, ist der große Saal überfüllt. Die wenigen Bänke sind bis auf das letzte Plätzchen besetzt. Die keinen Sitzplatz mehr fanden, stehen im Gang herum oder lehnen sich an die beiden Längswände, die von abertausenden anlehnenden Menschenrücken scheußliche, fettigschwarze Flecken bekommen haben. Ein unsäglich trostloses Licht des grauen Tages mischt sich mit dem Schein der schwachen elektrischen Birne und schafft so ein Zwitterlicht, in dem die Gesichter der Wartenden noch elender, noch verhungerter erscheinen. Hinter den beiden Querwänden sind die hellen sauberen Büroräume. Obwohl man in den Wänden auch Türen nicht vergessen hat, hat man noch extra je ein viereckiges Loch – Größe Beamtenkopf der unteren Gehaltsstufen – in die Wände gestemmt. Unmittelbar neben den Türen. Um jede unnötige Berührung mit dem wartenden Plebs zu vermeiden, rufen die Beamten die Nummern nicht durch die Türen. Nein: die Klappe wird aufgerissen, fein gerahmt erscheint ein Mannskopf und brüllt die Nummer aus. Dann fliegt die Klappe schleunigst wieder zu. Die aufgerufene Nummer – erst im Büro stellt sich heraus, dass sie Meyer,Gustav oder Abrameit, Frieda heißt – trottet durch die Tür neben der Klappe ins Büro. Bei jedem Aufruf der Nummer fliegen die Köpfe der Wartenden hoch. Zuweilen kommt es vor, dass sich an den beiden Wänden zugleich die Klappen öffnen. Dann fliegen – ruck – alle Köpfe hoch, – zuck – alle Köpfe nach hinten.
Die acht Jungen haben noch eine ganze Bank ergattern können, kümmern sich um keinen Aufruf und schlafen, dösen vor sich hin. Sie waren die ganze, endlose Winternacht auf der Straße. Wie schon so häufig: obdachlos. Immer getippelt, immer in Bewegung. Ausruhen war nicht bei dem Wetter. Tagealter Schneematsch, ab und zu ein dünner Strippenregen, alles fein gemixt durch einen Wind, der die Münder der Jungen vor durchdringender Kälte wie Entenschnäbel schnattern ließ. Acht Jungens, sechzehn bis neunzehn Jahre alt. Einige sind aus der Fürsorgeanstalt geflüchtet. Zwei haben noch Eltern irgendwo in Deutschland. Der eine oder andere noch Vater oder Mutter. Ihre Geburt, ihre früheste Jugend fiel in die Zeit des Krieges und Nachkrieges. Schon als sie ihre ersten o-beinigen Gehversuche machten, waren sie sich selbst überlassen. Vater war im Krieg oder stand bereits auf der Verlustliste. Und Mutter drehte Granaten oder hustete ihre Lungen in den Pulver- und Sprengstoff-Fabriken zentigrammweise aus. Die kohlrübenbauchigen Kinder – nicht einmal mehr kartoffelbäuchig waren sie – luchsten in Höfen und auf den Straßen nach Essbarem. Wuchsen sie heran, gingen sie rudelweise auf Raub aus. Raub, um die Bäuche zu füllen. Bösartige, kleine Raubtiere.
Der Dortmunder Ludwig ist beim Ruf einer Nummer wach geworden. Jetzt sitzt er da, Beine von sich gestreckt, Fäuste in den Taschen, im Mundwinkel eine leere Zigarettenspitze. Das schmale verhungerte Jungensgesicht mit den flinken braunen Augen guckt interessiert auf den Saaleingang. Die Kameraden schlafen, vornübergebeugt, zusammengesunken oder sich kraftlos an den Nachbarn lehnend. Jonny, ihr Anführer, ihr Bulle, hat sie zu neun Uhr hierher bestellt. Er wollte, wie so häufig, Geld auftreiben. Wie er das macht, verrät er nicht. Gestern Abend gegen zehn Uhr verabschiedete er sich von den Kameraden. – Ludwig sieht Jonny in den Saal kommen und winkt aufgeregt. »Hier, Jonny, hier!« Jonny ist ein junger Mensch von einundzwanzig Jahren. Das starke Kinn, die hervorspringenden Backenknochen wirken etwas brutal, zeugen wenigstens von Willenskraft. Seine Rede ist klug und wohlgesetzt, fast dialektfrei und beweist, dass er jeden der Clique geistig überragt. Überlegene Körperkraft ist selbstverständlich, sonst wäre er nicht Bulle. »Morgen, Ludwig!« Er reicht ihm eine große Schachtel Zigaretten. Sehnsüchtig, gierig bedient Ludwig sich und kaut wollüstig den entbehrten Rauch. Die Kameraden schlafen noch immer. Ludwig nimmt einen tiefen Zug und pafft die Jungens an. Sie schlucken, husten, wachen auf. Kein anderes Mittel hätte sie schneller wecken können. Zigaretten? Jonny, hallo! Schnell bedient sich jeder. Und jetzt weiß man auch, dass Jonny Geld hat, dass sie endlich mal wieder zu essen bekommen. Also los. Wie immer, gehen sie getrennt, in drei Gruppen. Neun Jungens zusammen erregt unliebsames Aufsehen. Sie biegen von der Chaussee- in die Invalidenstraße ein. Hier wird das Frühstück eingekauft. Fünfundvierzig Schrippen in drei mächtigen Tüten und zwei ganze Zwiebelleberwürste. Das wird reichen für neun Mann.
Rosenthaler Platz, Mulackstraße, dann in die Rückerstraße. Hinein in die Stammkneipe aller Cliquen rund um den Alexanderplatz, in die Rückerklause. Im Schaufenster werden schon fleißig Kartoffelpuffer gebacken. Die fettigen Rauchschwaden ziehen in entfernteste Winkel des düsteren, unheimlichen und unsauberen Lokals. Trotz der frühen Stunde ist die Klause voller Gäste. Sie ist mehr als bloße Kneipe. Sie ist eine Art Zu Hause für den, der es nicht hat. Lärmende Lautsprechermusik, lärmende Gäste. Die Unappetitlichkeit des Büfetts, der biernassen Tische, der schmutzschwarzen bekritzelten Wände stört niemanden. Rechts vom Eingang in einer Ecke nimmt die Clique Platz. Der Kellner bringt schauderhafte, aber wenigstens heiße Bouillon. Dann wird die Vertilgung der Schrippen und der Würste in Angriff genommen. Gesprochen wird nicht viel dabei. Nur dunkle, fast tierische Laute, Gegrunze, mit dem der Magen seine Befriedigung äußert. Wie verwandelt sind die Jungen. Wie sie die Zähne in die Wurstenden hauen, wie die Kiefer arbeiten. Wie sie einander ansehen und sich mit Blicken sagen: »Junge, Junge, ist das gut, so zu essen und zu sehen, dass noch mehr da ist ...« Und die anderen Blicke, die dankbaren, die stolzen, die Jonny gelten, der mal wieder für alle angeschafft hat.
Hinten in einer der Nischen sitzt ein blutjunger Cliquenbursche auf dem Schoß eines benebelten Freiers. Zwei Kameraden des Burschen spazieren vor der Nische auf und ab und rufen ihrem Kumpan ein aufmunterndes »Zieh, Schimmel, zieh!« zu. Zieh deinem Freier die Brieftasche und steck sie uns zu ...
Zwischen zwei Cliquenbullen am Stehtisch vor dem Büfett lehnt ein Mädchen, ein Kind von fünfzehn, sechzehn Jahren. Kess hat es sich das Jackett eines Burschen, dem zu heiß geworden war, übergezogen, die Ballonmütze aufgestülpt und trinkt mit den beiden lederjackenen Bullen einen Schnaps nach dem anderen. Das krankhaft blasse Gesicht mit dem blauen Schläfengeäder verzieht sich zu einem Ausdruck des Ekels, dann aber greift die kleine, schmutzige Hand wieder nach dem Schnapsglas, um einer Lederjacke Bescheid zu tun. Der Mund des Mädchens öffnet sich: fast zahnlos, nur vereinzelte schwarze Reste. Und das Mädchen ist bestimmt noch keine sechzehn Jahre alt ...
Hinter der Theke steht aufmerksam der Wirt. In einem guten blauen Anzug und blütenweißem Kragen, dem einzigen im ganzen Lokal. Ununterbrochen dröhnt Musik. Ununterbrochen kommt und geht es in dem Lokal. Alles junge, jüngste Menschen. Viele kommen mit Rucksäcken, irgendwelchen Paketen. Dann geht es in den Vorraum zu der grauenhaft verschmutzten Toilette. Kurzes Gespräch, Auswickeln, Einpacken. Geld wechselt seinen Besitzer. An der Theke wird ein Schnaps getrunken. Weg. Polizeiliche Razzien sind nichts Seltenes.
Das Mädchen ist jetzt sinnlos betrunken, torkelt von Tisch zu Tisch und bietet sich an. Friedel gibt mal wieder an, sagt man und ist nicht weiter von der traurigen Szene eines betrunkenen Kindes, das seine mageren Reize zeigt, berührt. Rückerklause, eine Art ›Zu Hause‹ für den, der es nicht hat. Der ewige Hunger der Jungen hat Schrippen und Würste und auch noch je zwei Kartoffelpuffer restlos vom Tisch gefegt. Wohlig lehnen sie sich zurück, ziehen an der Zigarette, trinken einen Schluck Bier und summen die Lautsprechermelodie mit: »… Auf die Dauer, lieber Schatz, ist mein Herz kein Ankerplatz ...« Gesättigt sind sie, im Lokal ist es warm. Müdigkeit kommt auf. Die Köpfe sinken auf die Tischplatte. Nur Jonny sitzt wach und raucht und raucht. Er bezahlt die Gesamtzeche. Dann zählt er sein Geld. Noch runde acht Mark. Wo werden sie heute Nacht schlafen? Die billigste Massenherberge nimmt für die Benutzung einer elenden Wanzenmatratze fünfzig Pfennig. Macht vier Mark fünfzig Pfennig, dann reicht es kaum noch für den morgigen Tag. Jonny grübelt nach einer billigeren Schlafgelegenheit. Die Jungens sollen nur weiterschlafen. Der Kellner soll ihnen sagen, dass Jonny sie abends acht Uhr bei Schmidt erwartet. – –
Kapitel 2
Was die Rückerklause für den Tag, ist Schmidt in der Linienstraße für die Nacht. Gewiss, Betrieb, schmetternde Blechmusik gibt es hier auch am Tag. Aber abends wird die Fülle in dem kleinen Lokal zu einer wirren Drängelei. Dann steht nicht eine Minute der Bierhahn still, dann ist jeder Stuhl doppelt besetzt. Und wer noch keinen Platz hat, setzt sich aufs Musikpodium oder bleibt mit dem Glas in der Hand stehen, wo er steht. Die ewigen Papiergirlanden, unbedingt notwendiges Stimmungsrequisit, sind stets von dichten Tabaknebeln umwölkt, trotzdem ein Ventilator verzweifelt bemüht ist, etwas Ordnung in die Luftverhältnisse zu bringen. Die Geräuschkapelle spielt aufopfernd und pausenlos. Bierlagen, freimütig gespendet, belohnen sie. Belohnen sie so lange, bis die Trunkenheit der Musiker sich auch bei der Tonwiedergabe erschreckend bemerkbar macht. Dann erst ist es richtig bei Schmidt. Dann ist das ganze Lokal ein brüllender, stampfender Chorus.
Jonny muss seine acht Kameraden aus allen Ecken und Winkeln zusammensuchen, um ihnen zu sagen, dass er eine billige Schlafgelegenheit gefunden hat. Zwei Mark für die ganze Clique. In einem Lagerschuppen in der Brunnenstraße. Für zwei Mark lässt der Wächter sie um zehn Uhr in den Schuppen. Aber um sechs Uhr morgens müssen sie wieder auf die Straße. Stroh und große Kisten, in die man sich hineinlegen kann, sind genügend vorhanden. Um halb zehn Uhr macht die Clique sich auf den Weg.
Als es zehn Uhr schlägt, sind sie alle in der Nähe ihrer Schlafstelle. Drei stehen vor dem Tor. Die anderen warten nebenan im Hausflur, um, sowie der Wächter das Tor öffnet, hineinzuflitzen. Noch ehe sie den Wächter hören, schnauft und knurrt es wütend hinter dem Tor. Der Wachhund. Dann wird aufgeschlossen, nacheinander schleichen alle in den dunkeln Torweg. Der Wächter schließt wieder ab. Die Dogge jault vor Wut und Enttäuschung. Sie begreift ihren Herrn nicht. Sonst muss sie jedem in die Beine fahren, und hier, bei diesem Haufen höchst verdächtiger Individuen, wird ihr das Stachelhalsband kurz gehalten. Der Wächter schlurft voran mit dem böse funkelnden Hund. In respektvoller Entfernung tappen die Blutsbrüder hinterdrein. Die Tür des niedrigen Holzschuppens wird aufgeriegelt, und Jonny muss seine zwei Mark abladen. Dann tastet der Alte jeden der Jungen einzeln ab. Er sucht nach Streichhölzern und Feuerzeugen. Falls die Bengels auf die Idee kommen sollten, drinnen zu rauchen ... Inmitten des Strohes und trocknen Holzes. Könnte ein nettes Feuerwerk geben. Die Dogge versucht nochmals einen Ausfall auf die Jungens. Aber das Stachelhalsband belehrt, dass nur Nichtzahlungsfähige zu zerfleischen sind. Eben sind die Jungens in dem fensterlosen dunklen Schuppen, da schließt der Alte auch schon wieder die Tür von draußen zu. Die freigelassene Dogge schnüffelt erbost an dem Spalt zwischen Erde und Tür. Dann packt sie sich vor die Tür. Die sollen es nur wagen herauszukommen ...
Ratlos tasten die Jungens in der Finsternis umher. Ihre Finger hacken in die Nägel der Kistenbretter, und wenn jemand glaubt, einen Platz gefunden zu haben, stürzen plötzlich aufeinandergestapelte Kisten über seinem Haupt zusammen. Als endlich jeder einen Platz in einer Kiste oder auf einer Strohschütte gefunden hat, schlägt es elf Uhr. In wenigen Minuten schläft alles. Nur die Mäuse lamentieren ob der Invasion.
Würde man sie sehen können, die zusammengekrümmten Körper der Jungen in den Kisten und auf dem Stroh, in ihren Betten, gäbe es wohl nur eine Stimme des Mitleides. Der sechzehnjährige Walter mit dem eigenartig spitzen Brustkasten, der das Hemd unheimlich wölbt, die vorstehenden Basedow-Augen ... Und der gleichaltrige, hochaufgeschossene Erwin, dessen stakige Arme auch nicht den leisesten Muskelansatz zeigen. Oder der stille, ewig träumende Heinz: sein Jackett benutzt er als Kopfunterlage, das Hemd ist ein zerfetztes, schmutziges Lumpenstück. Ludwig, der achtzehnjährige Dortmunder, vor einem Jahr aus der Erziehungsanstalt geflüchtet, hat sich so tief in das Stroh gebuddelt, dass nichts von ihm zu sehen ist und die Mäuse ungehindert über ihn hinweghuschen. Alle sehen sie erbärmlich aus. Nur Jonny bewahrt auch im Schlaf den Ausdruck der Willensstärke, der Furchtlosigkeit.
Kurz nach sechs Uhr morgens stehen sie wieder auf der dunklen Brunnenstraße. Die Kälte, die sie die ganze Nacht nicht verlassen hat, empfinden sie jetzt fast als körperlichen Schmerz. Den schmächtigen Walter schüttelt es so, dass er als haltlos zitterndes Bündel in die Mitte genommen werden muss, um ihm durch einen Dauerlauf ein wenig Wärme zu verschaffen. In Gruppen getrennt gehen sie Richtung Alexanderplatz. Ins Mexico. Frühbetrieb ab sechs Uhr morgens. Eine heiße Brühe, und ist sie auch noch so dürftig, kann unendliche Wohltat sein. Die Hände um die Tassen gekrampft, sitzen die Blutsbrüder in einer Ecke und schlürfen Wärme, Wärme ...
Lautsprechermusik in einer Tonstärke, die für jede Philharmonie gereicht hätte, von sechs Uhr morgens bis zum anderen Morgen drei Uhr. Zuhälter, Straßenmädchen, Cliquenburschen und Ringvereinler1, Gelegenheitskriminelle und Obdachlose, unterweltlüsterne Bürger und fahndende Kriminalbeamte. Das ist das Mexico. Vor einigen Jahren noch eine kleine Kneipe, die mangels Beteiligung einging. Jetzt stolz als ›Europas bekannteste Gaststätte‹ inseriert. Der neue Besitzer holte sich aus Moritzens Bilderbuch einige Indianerbilder und tünchte sie recht bunt und naiv auf die nackten vier Wände. Baute künstliche Palmen auf, machte die Schaufenster knallbunt und undurchsichtig und nannte sein Werk eine ›mexikanische Blockhütte‹.
Still sitzen die Blutsbrüder an ihrem Tisch. Ein neuer Tag liegt vor ihnen. Planlos stehen sie ihm gegenüber. Ein Mann betritt das Lokal, ein Fremder, kein Stammgast. Sieht sich suchend um und geht auf den Tisch der Blutsbrüder zu. Fred, der Achtzehnjährige, Jonnys Intimus, springt auf, stößt einen Kameraden beiseite und rennt, stürzt auf die Straße. Der Fremde hinterdrein. Aufregung im ganzen Lokal. Wer war der Fremde? Polizei? Aber keiner der Gäste hat ihn je gesehen. Und hier kennt man alle Beamte des Polizeipräsidiums. Die Clique ist ratlos. Hält es auch nicht für ratsam, noch länger im Lokal zu bleiben. Jonny teilt den Rest des Geldes in gleiche Teile, bildet aus der Clique vier Paare, die die Aufgabe haben, Fred in allen Stammkneipen, bei bekannten Cliquenburschen, in allen Schlupfwinkeln zu suchen. Selbst wenn der Fremde Fred nicht geschnappt hat, wird Fred es nicht wagen, wieder ins ›Mexico‹ zu kommen. Er muss also erfahren, wo die Clique geblieben ist. Treffpunkt für alle ist abends acht Uhr das Homosexuellenlokal Alte Post in der Lothringer Straße. Die vier Paare gehen nach verschiedenen Richtungen auseinander. – –
Kapitel 3
In der Erziehungsanstalt ist seit Tagen dicke Luft. Eine kleine Gruppe Fürsorgezöglinge, voran der zwanzigjährige Willi Kludas, hatte eine Art passiver Resistenz beschlossen. Nachts im Schlafsaal wurde sie besprochen und Verräter oder Streikbrecher mit grausamster Feme bedroht: Prügel, Prügel und nochmals Prügel sollten die Abtrünnigen bekommen. Der Direktor und die Erzieher standen den Auswirkungen der passiven Resistenz, ja selbst Sabotageakten, machtlos gegenüber. Das halbe Außenarbeitskommando meldete sich krank, litt plötzlich an den unerfindlichsten Krankheiten. Und die andere Hälfte richtete bei der Scheinarbeit mehr Schaden als Nutzen an. Die Aufsichten tobten, drohten mit Meldungen und Backpfeifen, aber den strikten Beweis der Böswilligkeit vermochten sie nicht zu erbringen. Die Zöglinge grienten sich vorgebeugten Oberkörpers an und arbeiteten weiter. Die Sache begann ihnen Spaß zu machen.
Im Gebäudekomplex der Anstalt selbst zerbrachen auf rätselhafte Weise Fensterscheiben zu Dutzenden. Türschlösser verweigerten die Funktion. Herbeigeholte Handwerker mussten Sand und kleine Steine aus dem Mechanismus entfernen. In den Aborten verstopften die Klosetts, elektrische Birnen und Sicherungen brannten en gros durch. Unbeaufsichtigt liegende Schriftstücke und ganze Aktenbündel verschwanden, oder blaue Tinte hatte sich auf dem Papier allzu breit gemacht. Die Jungens kamen aus dem schadenfrohen Grinsen nicht mehr heraus. Das war mal was anderes, ’ne feine Sache, die der Willi ausgeknobelt hatte. Mit blassen, wutverbissenen Gesichtern gingen die Erzieher herum. Zum Direktor zu gehen, trauten sie sich schon lange nicht mehr. Wehe dem Jungen, der in flagranti ertappt worden wäre. Aber das Aufpasser-, das Schmieresteher-System klappte, wie alles obrigkeitlich Angeordnete schief und in Trümmer ging.
Am Nachmittag des vierten Tages berief der Direktor die Erzieher zu sich. Was ist los? Ja, was ist los? Sie standen vor einem Rätsel. Unter dem Vorwand, die Topfpflanzen im Direktorenzimmer zu begießen, rief ein Erzieher während der Konferenz einen Jungen, ihren Jungen, Georg Blaustein, ins Zimmer. »Georg, du bist doch ein anständiger Junge, sag du uns, was los ist. Du hast uns doch sonst alles erzählt.« Georg Blaustein erinnerte sich an die Nacht vor vier Tagen. Er lag wachend im Bett wie alle anderen Jungen. Da war plötzlich in der Dunkelheit ein Gesicht neben dem seinen. Und er hörte leise aber unheimlich eindringlich: »Wenn du klatschst, dreh ich dir den Hals um ...« Dann war das Gesicht unter Georgs Bett, unter viele Betten hindurch in sein eigenes gerutscht. »Ich ... ich weiß ... ich weiß wirklich nicht, Herr Direktor, warum ...« Aber der Direktor und jeder Erzieher merkten, dass Georg alles wusste, dass Angst ihm den Mund verbot. »Begieß die Blumen, Georg.« Resultat der Konferenz: wir wissen zwar nichts, aber wir wissen doch! Striktes Rauchverbot für alle Zöglinge, Urlaubssperre, drakonische Durchführung der Strafmaßnahmen bei kleinsten Vergehen. Bis wieder geordnete Verhältnisse eintreten. Bericht an die vorgesetzte Behörde mit der Bitte um Verhaltungsmaßregeln.
Und was war los? Was war Ursache der stillen Revolte? Ein fast alltäglicher Vorgang. Willi Kludas, der zwanzigjährige Zögling, hatte von Herrn Friedrich, dem verhasstesten Erzieher, wegen einer Ungehörigkeit eine Ohrfeige bekommen. Ausgerechnet an seinem Geburtstag hatte Willi sie bekommen. Scheinbar ruhig hatte er sie eingesteckt. In der Nacht aber rief er zum stillen Aufruhr auf. Als vorläufige Rache. Dann wollte er Herrn Friedrich die Ohrfeige mit guten Zinsen zurückzahlen und aus der Anstalt flüchten. Für die Rückerstattung der Ohrfeige nebst Zinsen hatte Willi sich einen besonderen Plan ausgeheckt, in den er nur seine sechs besten Freunde, die brauchte er dazu, einweihte.
Zwei Tage weiter. Zwischen zehn und elf Uhr nachts. Der ganze Schlafsaal weiß, dass heute Nacht etwas vor sich gehen soll. Aber nur sieben Jungen, Willi und seine sechs Freunde, wissen, was passieren wird. Vor einer halben Stunde war neben dem Bett Georg Blausteins auch wieder das Gesicht aufgetaucht und hatte fürchterliche Drohungen ausgestoßen, wenn ... Willi weiß, wenn jetzt Krach gemacht wird, kommt sein Freund Friedrich herein. Und das ist gut. Sehr gut. Die sieben Jungen beginnen programmgemäß mit einer ungenierten Unterhaltung, die laut und lauter wird. Streng nach Programm klopft es auch bald von draußen: »Ruhe, da drinnen!« Herrn Friedrichs Stimme. Gut. Nun erst einmal Ruhe. Aber nicht zu lange. Plötzlich machen die Verschworenen einen Heidenkrach, der ganze Saal sitzt aufrecht in seinen Betten. Dann schnappen sich zwei von Willis Freunden ein Bettlaken und laufen barfuß zur Tür. Da kommen auch schon die Schritte des Herrn Friedrich. Auf geht die Tür. Ein Schalter knackt. Es bleibt dunkel. Zwei Gestalten mit vorgehaltenem Laken stürzen sich auf den im dunklen Saal stehenden Erzieher Friedrich. Werfen ihm die Laken über den Körper. Vier andere Freunde halten Hände und Füße fest, ein kaum hörbares Würgen kommt unter dem Tuch hervor. Dann fällt Willi über das weiße Bündel her. Nur das Klatschen der Schläge ist zu hören, der ganze Saal muckst nicht. Mit einem Griff haben die Jungen ihre Laken wieder, und Herr Friedrich fliegt wenig sanft auf den Korridor. Die Tür fällt ins Schloss, die Rächer sausen in ihre Betten.
Eine halbe Stunde vergeht – die Laken konnten unterdes wieder sauber ausgebreitet werden – da kommen Direktor und mehrere Erzieher notdürftig bekleidet, aber bewaffnet in den Schlafsaal. Aber Licht gibt es auch jetzt noch nicht. Zwei Zöglinge müssen erst aus ihrem festen Schlaf geweckt werden. Sie sollen Leitern holen und neue Birnen einschrauben. Dann endlich wird es hell, und jetzt ist es kein Wunder mehr, dass alles wacht und das unterhosene Direktorium anstarrt. Der Tatbestand ist, dass Herr Friedrich, übrigens ziemlich glimpflich, verprügelt wurde von mehreren Gestalten in Nachthemden. Aber von welchen Nachthemden? Der ganze Saal sagt einstimmig: »Ich bin erst von dem Lärm aufgewacht.« Georg Blaustein aber übertrumpft alle. Er ist nicht nur von dem Lärm nicht aufgewacht, nein, er schläft vor Angst auch jetzt noch. Die Untersuchung wird ergebnislos abgebrochen. Jeder der Jungen weiß, dass sie alle eine Gesamtstrafe treffen wird. Wenn schon. Aber der Friedrich hat es gekriegt. Das wiegt alle Strafen auf.
Am Morgen gehen keine Arbeitskommandos los. Alles bleibt in der Anstalt zur Vernehmung. Besonders verdächtige und besonders gute Jungen werden einzeln vernommen. Die anderen in kleinen Gruppen. Das Ergebnis der Untersuchung wird streng geheim gehalten. Auch Strafen sind noch nicht bekannt geworden. Der Vorfall ist zu schwerwiegend. Die vorgesetzte Behörde soll um Entsendung einer Untersuchungskommission gebeten werden. Herr Friedrich hat sich krank gemeldet.
Heute Abend wird getürmt, steht für Willi Kludas fest. In einem Brief, den ein Junge erst am nächsten Morgen finden soll, will er hinterlassen, dass er der Alleinschuldige ist. Die bei der Prügelei geholfen hätten, habe er unter Drohungen gepresst. Aber verhauen habe er Herrn Friedrich ganz allein. Warum, Herr Direktor? Wegen der Ohrfeige an meinem zwanzigsten Geburtstag! – Mittags und abends isst Willi soviel er nur irgend erwischen und verdrücken kann. Wer weiß, wann er wieder was kriegt. Er muss die Nacht durchwandern, um die nächste Fernbahnstation zu erreichen. Dann will er versuchen, mit einer Bahnsteigkarte nach Berlin zu kommen. Zehn Stunden Fahrt. Wie er es anstellen will, im Zug unkontrolliert zu bleiben, weiß er allerdings noch nicht. Nur von seinen sechs Freunden verabschiedet er sich heimlich. Sie geben ihm von ihrem Abendbrot auf den Weg, und der eine oder andere opfert einen Groschen. Willis Barbesitz beläuft sich auf fünfundneunzig Pfennig. Eine Stunde vor der Schlafenszeit wagt er den entscheidenden Schritt. In einer Stunde werden sie merken, dass er getürmt ist; dann muss er weit, weit weg sein. Jetzt müssen die Freunde ihm den letzten Kameradschaftsdienst erweisen. Unter viel Geschrei und Getöse inszenieren sie einen Streit. Von allen Seiten eilen die nervös gewordenen Erzieher und selbst der Direktor in den Aufenthaltsraum. Während die Freunde ganz erstaunt tun, jumpt Willi über die Mauer.
Bis zum ersten kleinen Ort, zehn Minuten entfernt, muss gerannt werden. Aber dann nicht durch den Ort, sondern drum herum. Nur nicht zu schnell, nur nicht sich gleich ganz auspumpen. Mensch, macht das Spaß, so zu rennen! Zu rennen, immer geradeaus! Nicht gleich wieder beidrehen müssen wie auf dem Anstaltshof. Bei dem ungemütlichen Wetter ist Gott sei Dank kein Mensch auf der Chaussee. Willi rennt mit eingezogenen Armen und vorgestreckten Fäusten: »Eins, zwei, drei, vier ..., eins, zwei, drei, vier ...« Junge, ist das fein. Ob die wohl schon was gemerkt haben? Wenn sie bloß nicht einen Erzieher mit dem Fahrrad hinterherschicken ... Eins, zwei, drei vier ... feste, feste. Jetzt links in den Feldweg einbiegen, rechts liegt die Ortschaft. Ei weh, ist der Boden aufgeweicht, richtige Klumpen hängen an den Schuhsohlen. Was das schon ausmacht! Nun erst recht! Feste, feste!





























