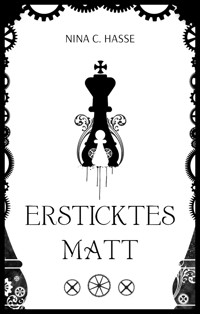
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Ein Viertel ohne Hoffnung. Ein Mörder ohne Skrupel. New York, 1893. In den Floodlands, einem Elendsviertel mitten im East River, verfolgt die Polizei ein Gespenst. An jedem Tatort eine weibliche Leiche, eine Schachfigur in der Hand. Das Spiel eines Wahnsinnigen? Für Remy Lafayette, Gesichtsanalytiker und Berater beim New York Floodlands Police Department, wird die Jagd zu einer Reise in die eigene Vergangenheit, als seine ehemalige Verlobte in den Sog der Ereignisse gerät. Ein Steampunk-Krimi aus den Floodlands. »Ersticktes Matt« ist der erste Teil der Reihe um den Gesichtsanalytiker Remy Lafayette und das New York Floodlands Police Department. ~~~ LESERSTIMMEN »Krimi wie er sein soll.« - Janna von KeJas-blogbuch dot de »Die Floodlands [...] haben mich sofort in ihren Bann gezogen. Ich mag es gerne, wenn Geschichten nicht nur in den höchsten Kreisen spielen, sondern eben auch die andere Seite des Lebens zeigen.« - rebelgirlsadventures dot de »Dieses Buch ist handwerklich, storytechnisch und vom Schreibstil und Detailgrad einfach faszinierend genial. Es steht den großen Namen da draußen in absolut nichts nach.« - bluesiren dot de »Der Fortschrittsglaube der Jules-Verne-Romane ist einer düsteren Steampunk-Welt gewichen. Denn die Autorin denkt das Modell einer von Dampf- und Kohleverbrennung beherrschten Welt konsequent weiter: Klimaerwärmung und Überschwemmungen führen zu einer weltweiten Flüchtlingsbewegung.« - hallespektrum dot de »Die Charaktere sind vielschichtig aufgebaut und wirken glaubwürdig, da sie nicht nur positive, sondern auch negative Eigenschaften haben und mit ihren persönlichen Problemen kämpfen, während sie an der Aufgabe arbeiten, den Schachbrettmörder dingfest zu machen.« - just-art dot de »Wer gerne gute Krimis liest, sollte sich ›Ersticktes Matt‹ auf jeden Fall ansehen.« - Ryek Darkener auf lovelybooks dot de
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
StartTitelVorwort1234 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Zitate Dank Mehr aus den Floodlands
Buch
Ein Viertel ohne Hoffnung.Ein Mörder ohne Skrupel.
New York, 1893. In den Floodlands, einem Elendsviertel mitten im East River, verfolgt die Polizei ein Gespenst. An jedem Tatort eine weibliche Leiche, eine Schachfigur in der Hand. Das Spiel eines Wahnsinnigen?
Für Remy Lafayette, Gesichtsanalytiker und Berater beim New York Floodlands Police Department, wird die Jagd zu einer Reise in die eigene Vergangenheit, als seine ehemalige Verlobte in den Sog der Ereignisse gerät.
Ein Steampunk-Krimi aus den Floodlands.
Autor
Nina C. Hasse wurde 1986 in Paderborn geboren und studierte Germanistik, Religionswissenschaft sowie Belletristik und Kinder- und Jugendliteratur. Wenn sie nicht gerade ihrer zweitgrößten Leidenschaft, dem Reisen, nachgeht, lebt und schreibt sie in Münster, gemeinsam mit ihren felinen Assistenten Holmes und Watson. »Ersticktes Matt« ist ihr erster Roman und der erste Teil der Reihe um den Gesichtsanalytiker Remy Lafayette und das New York Floodlands Police Department.
Auf ihrem Blog http://ninahasse.wordpress.com schreibt sie über die Unwegsamkeiten des Autorenlebens. Zudem findet man sie auch auf Twitter (@nina_hasse), Instagram (@ninaswriting) und bei Facebook (nina.c.hasse).
Das New York Floodlands Police Department hat eine eigene Æthernet-Präsenz unter:https://floodlandsdepartment.com
Impressum
© 2016 Nina C. Hasse
Geiststraße 63
48151 Münster
https://ninahasse.wordpress.com
https://floodlandsdepartment.com
Buchcover: A.K.; Kim & Nina Hasse
Schriftarten: Garton (Titel, © David Rakowski); Arsenal (Name, © Andriy Shevchenko)
Illustrationen: Retrovectors.com, Schachfiguren: © allsilhouettes
Lektorat & Korrektorat: S. & U. D.
Satz: Daniela Rohr
Alle Rechte vorbehalten.
Alle Personen und Handlungen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit realen Personen sind zufällig und nicht beabsichtigt.
♦
Für meinen »alten Herrn«
Danke, dass du Teil meines Lebens warst
und für immer ein Teil von mir bleibst.
♦
Das Leben ist eine Partie Schach.
Miguel Cervantes
VORWORT
Wir schreiben das Jahr 1893.
Doch die Welt ist nicht jene, die Sie aus den Geschichtsbüchern, Zeitdokumenten und Überlieferungen kennen.
Der Lauf der Dinge hat sich hier für eine andere Richtung entschieden. Ein rollender Stein kann eine Lawine auslösen, der Flügelschlag eines Schmetterlings auf der anderen Seite der Welt einen Sturm entfesseln.
Winzige Rädchen greifen pausenlos ineinander, stoßen größere an, die wiederum noch größere Räder antreiben. Folgt man ihrer Spur, kann jede zunächst noch so unbedeutende Abweichung das große Ganze verändern.
Die Menschheit hat sich die Kraft der Dampfmaschine zunutze gemacht und formt nun seit rund einhundert Jahren mit immer tollkühneren Maschinen und Konstruktionen das Antlitz der Erde.
Die Möglichkeiten und der Ideenreichtum scheinen grenzenlos, und ein Zeitalter mechanischer Wunderwerke hat begonnen.
Es herrscht jedoch nicht allerorts Euphorie, denn der immer größer werdende Energiehunger verlangt einen hohen Preis. Kohle brannte in den letzten Jahrzehnten in Millionen von Maschinen und Öfen und veränderte das Klima auf dramatische Weise.
Der steigende Meeresspiegel zwang Millionen von Menschen weltweit, ihre Heimat zu verlassen, machte sie zu Klimaflüchtlingen. Nicht wenige suchten in dem reichen und geschützten Amerika ein besseres Leben.
New York, das Tor zur neuen Welt, war für viele Flüchtlinge der erste Ort, den sie nach ihrer Abreise aus der alten Heimat betraten. Ein guter Teil entschied sich, dort zu bleiben. Manche aus Mangel an Geld oder aus Erschöpfung von den Strapazen der langen Reise und manche, weil sie immer noch die Hoffnung hegten, dass das Versprechen der Freiheitsstatue und die Verheißung des amerikanischen Traumes auch für sie galten.
So erleben Sie nun ein New York, in dem Reichtum und Armut, Luxus und Elend, Macht und Ohnmacht, Mord und Menschlichkeit kaum näher beieinander liegen könnten.
1
Floodlands, New York, 6. Februar 1893
Die Frau sah aus wie eine Wachsfigur. Sie war tot, das erkannte Lafayette auf den ersten Blick. Dieser Blödsinn von friedlichen Toten, die wirkten, als würden sie schlafen, um im nächsten Moment die Augen aufzureißen, war von den Schauer- und Kriminalromanen verbreitet worden, die die Leute gerne heimlich unter der Bettdecke lasen. Nichts jedoch konnte über die wächserne Haut einer realen Leiche hinwegtäuschen, über die unnatürliche Blässe und den grauen Schleier des Todes, der sich über sie legte. Die tote Hülle hatte nichts mehr mit der Person gemein, die sie einmal gewesen war und niemand hätte ihre Gesichtszüge für die eines lebenden Menschen halten können.
Lafayette streckte eine Hand nach ihr aus, zog sie jedoch schnell wieder zurück.
Reiß dich zusammen, Remy. Du bist doch kein blutiger Anfänger.
Es war eine Weile her, seit er das letzte Mal das Gesicht einer Leiche untersucht hatte. Seit über sieben Monaten arbeitete er ausschließlich mit lebenden Menschen und die Arbeit an den Toten hatte ihm – wenn er ehrlich war – nicht wirklich gefehlt.
In Gedanken fertigte er eine Skizze des toten Mädchens an. Sie war jung, vielleicht Anfang zwanzig und zu Lebzeiten bestimmt einmal sehr hübsch gewesen. Blondes Haar, ausgeprägte Wangenknochen, volle, herzförmige Lippen, ein Grübchen auf der linken Wange. Sie hatte sicherlich oft gelacht. Eine zielstrebige Person, voller Energie, Lebensfreude und Selbstbewusstsein. Lafayette seufzte. Ein ungewöhnliches Gesicht in diesem Stadtviertel, dessen Bewohner selten Grund zur Freude hatten. Er machte sich daran, nach Unebenheiten und Auffälligkeiten zu suchen. Keine Narben, Schürfwunden oder blaue Flecken im Gesicht. Was war ihr zugestoßen?
»Sind Sie bald fertig?« Ein schwammiger Kerl mit Halbglatze und Monokel vor dem linken Auge war neben ihn getreten.
»Dr. Blackburne«, begrüßte er den Rechtsmediziner und streckte ihm seine Hand entgegen. »Unsere Wiedersehensfreude wird wohl immer durch Leichen getrübt, also verzeihen Sie bitte, wenn sich meine Begeisterung in Grenzen hält.«
Die grauen Haarspitzen, die unter dem Bowler des Arztes hervorlugten, die buschigen Augenbrauen, die Koteletten, das speckige Kinn – er hatte sich in den letzten Monaten kein bisschen verändert.
»Immer noch der alte Witzbold, was?« Der Doktor ergriff seine Hand.
»Und Sie? Immer noch der alte Perfektionist?«
»Analysieren Sie mich etwa?«
»Ihre stark ausgeprägten Augenbrauen deuten darauf hin, dass sie detailverliebt sind und dazu neigen, andere zu überfordern. Und in Kombination mit der Form Ihrer Lippen -«
»Hören Sie sofort auf damit«, knurrte Blackburne. »Sie nochmal an einem Tatort zu begrüßen, hätte ich mir auch nicht träumen lassen. Willkommen zurück in den Floodlands.«
Lafayette verzog das Gesicht. Normalerweise mied er die Pfahlbautensiedlung im East River – wie jeder normale New Yorker Bürger – wann immer er konnte. Elend, Gewalt, Krankheit und Tod zogen wie die vier apokalyptischen Reiter durch das Viertel und hielten es in eisernem Griff. Die Five Points waren ein Kurort dagegen. Allein der Geruch schloss ihn wie einen lange vermissten Freund in die Arme. Feuchtes Holz, Staub, ungewaschene Haut, Schimmel. Widerlich.
»Klären Sie mich auf, Doc. Was ist mit ihr geschehen? Was haben Sie?«
»Bisher kaum mehr als Vermutungen. Weiblich, weiß, Anfang bis Mitte zwanzig. Wahrscheinlich handelt es sich um die Bewohnerin dieser … Behausung, eine gewisse …«, er blätterte in seinen Notizen, »Carla Lewis. Todesursache wahrscheinlich Erdrosselung.«
Er deutete auf die dunkelroten Striemen, die sich um den Hals des Mädchens wanden.
Lafayette legte den Kopf schief und betrachtete die Tote genauer. Ihr Kopf war zur Seite geneigt, die Augen geschlossen. Unterhalb der Drosselmale schlang sich ein violettes Tuch um ihren Hals.
Er deutete darauf. »Die Mordwaffe?«
Blackburne hob die Schultern. »Die Vermutung liegt nahe. Genaueres kann ich erst sagen, wenn ich sie auf dem Tisch hatte.«
Lafayette spürte einen eisigen Hauch im Nacken. Wahrscheinlich der Regen, der sich in seinen Haaren gesammelt hatte.
Mit einer bizarr anmutenden Apparatur über den Augen beugte Blackburne sich über das Mädchen. Die kupfernen Okulare ließen ihn aussehen wie eine Stielaugenfliege. Dennoch, den Nutzen der Brille konnte Lafayette nicht verhehlen, sie vergrößerte Objekte um ein Vielfaches und war sehr nützlich, wenn es darum ging, Fasern oder Gewebe zu analysieren. Allein die Optik war lächerlich.
Blackburne schien sich daran nicht zu stören. »Violettes Halstuch, wahrscheinlich Seide. Nicht ganz billig.«
»Ich glaube nicht, dass es ihr gehörte.«
»So?«
»Sehen Sie sich doch hier um.« Lafayette deutete in den Raum, der mit einem Bett, einem wackeligen Holztisch und zwei Stühlen selbst für die Verhältnisse in den Floodlands äußerst spärlich eingerichtet war.
»Ich liefere die Fakten, Sie interpretieren sie. Sicher ist jedenfalls, dass das Opfer sich nicht gewehrt hat. Keine Kratzer an den Händen, Handgelenken oder Unterarmen, keine Spuren von Haut oder anderem unter den Fingernägeln.«
»War sie bewusstlos, als sie getötet wurde?«
»Das kann ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen. Sie wurde höchstwahrscheinlich nicht niedergeschlagen; ich konnte keine Spuren von stumpfer Gewalteinwirkung entdecken. Eine Ohnmacht ist jedoch nicht auszuschließen. Wenn jemand versucht hätte, sie bei vollem Bewusstsein zu erdrosseln, hätte sie sich gewehrt – und das hätte Spuren hinterlassen.«
»Todeszeitpunkt?«
Der Mediziner blätterte erneut in seinen Aufzeichnungen. »In Anbetracht des fortgeschrittenen Rigor mortis und der Körpertemperatur würde ich schätzen, dass der Eintritt des Todes etwa sechs bis acht Stunden zurückliegt. Das bedeutet …« Er warf einen Blick auf seine Taschenuhr. Es war ein schönes Stück, offenbar Echtgold und ein Familienerbstück. »Zeitpunkt des Todes etwa zwischen zehn Uhr gestern Abend und Mitternacht. Aber Sie wissen ja -«
»Genaueres erst nach der Obduktion.«
»Genau. Die Figur hat sie übrigens noch in der Hand. Dran kommen wir erst im Leichenschauhaus. Ich will ihr nicht die Finger brechen, bevor ich sie auf dem Tisch hatte.«
»Figur?«
»Na, Sie sind ja bestens informiert«, grunzte Blackburne. Er deutete auf das Schachbrett, das neben einer gesprungenen Tasse auf dem Tisch stand. Ein einfaches Brett aus Holz mit schwarzen und weißen Figuren ohne besondere Verzierungen oder sonstigen Schnickschnack. Die Figuren standen auf dem Brett verteilt, als hätte jemand das Spiel plötzlich abgebrochen. Keiner der Könige stand im Schach, die Partie war noch in vollem Gange.
»Was hat das zu bedeuten?«, fragte Lafayette.
»Woher soll ich das wissen? Die Polizei hat es wohl erst für Zufall gehalten, aber jetzt, bei Opfer Nummer Drei, das auf diese Weise getötet wird, geht sie davon aus, dass der Täter die Schachspiele mitbringt, aufbaut und den Mädchen die Figur post mortem in die Hand legt. Aber da fragen Sie lieber die Kollegen vom Department für Mord und Gewaltdelikte. Ist wie gesagt nicht mein Aufgabenbereich.«
»Schon klar.«
Lafayette ging zum Fußende des Bettes und betrachtete das Mädchen. Sie war bekleidet aufgefunden worden, trug ein Nachthemd und ihr Körper war von einer grauen Wolldecke bedeckt. Also höchstwahrscheinlich kein Sittlichkeitsverbrechen. Ihre Hände waren sorgfältig gefaltet worden, ihr blondes Haar liebevoll auf dem Kopfkissen drapiert.
Vielleicht hatte der Täter eine persönliche Beziehung zu ihr gehabt? Er stellte sich den Mörder vor, der ihr das Haar in sanfte Wellen legte, ihr über die Wange strich, bevor er die Wohnung verließ. Mord aus Leidenschaft? Die Tatsache, dass sie ein Nachthemd trug, verstärkte diese Theorie. Welche Frau würde einem Unbekannten in ihrer Nachtwäsche die Tür öffnen?
»In der Hütte nebenan wartet die Nachbarin der Toten auf ihre Vernehmung. Der Officer, der jetzt bei ihr ist, war mit der alten Dame völlig überfordert. Ist wohl sein erster Mordfall. Ansonsten ist das erst einmal alles. Wir packen sie jetzt ein und dann mache ich mich direkt an die Arbeit. Ich konnte ein paar Termine verschieben.« Blackburnes hängende Schultern deuteten darauf hin, dass er sich nicht auf einen frühen Feierabend freuen durfte. »Sie können Detective Vezér ausrichten, dass sie den Bericht heute Abend auf ihrem Schreibtisch hat.«
»Detective Vezér bearbeitet den Fall?« Schlagartig verknotete sich Lafayettes Magen. Einerseits hatte er gehofft, auf Detective Madeline Vezér zu treffen, anderseits fürchtete er die Begegnung. Ihr letztes Zusammentreffen war nicht eben harmonisch verlaufen.
»Sicher. Sie wird sich irgendwo hier in den Floodlands herumtreiben und das tun, wofür sie bezahlt wird.«
Der Knoten in seinem Magen verstärkte sich. Er atmete tief durch. Gut, dann würde er Madeline eben früher als erwartet treffen, vielleicht sogar mit ihr zusammenarbeiten. Wenn sie ihn denn ließ …
»Sorgen Sie bitte dafür, dass eine Nahaufnahme von ihrem Gesicht gemacht wird«, sagte er im Hinausgehen zu Blackburne. »Und ich brauche bitte noch ein Bild im Profil.«
Der Rechtsmediziner brummte unwillig und Lafayette nickte ihm zum Abschied zu. Wenn Blackburne und seine Helfer das Mädchen einpackten, wollte er nicht mehr zugegen sein.
♦
Als Lafayette vor die Tür trat, schlugen ihm eisiger Wind und Nieselregen entgegen. Er schlang seinen Schal enger um den Hals, stellte den Kragen seines Mantels auf und zog die ledernen Handschuhe an, dennoch war es bitterkalt. Nebeltropfen sammelten sich in seinem dunkelblonden Haar und er fuhr mit den Fingern durch die feuchten Locken.
Er warf einen Blick auf seine Taschenuhr: kurz nach neun Uhr. Wie an jedem Morgen herrschte in den Floodlands geschäftiges Treiben. Lafayette sah zahlreiche zerlumpte Gestalten, die Körbe flochten, Kleider flickten oder in wurmstichigen Booten auf dem East River trieben, um dort ein paar mickrige Fische für das Mittagessen zu fangen. Die Gesichter schmutzig, die Kleidung verdreckt, die Haare verfilzt. Die meisten Bewohner der Floodlands waren Einwanderer, Flüchtlinge aus Europa und Asien, die das steigende Meerwasser aus ihrer Heimat vertrieben hatte.
»Sie haben Almosen?« Ein Mann mit mehr Falten im Gesicht als Zähnen im Mund näherte sich Lafayette in gebückter Haltung, die Hände bittend ausgestreckt. Seine Kleider waren kaum mehr als Lumpen, die den Blick auf seine dürren Beine freigaben. »Mein Frau krank, meine Kinder Hunger. Da, sehen!« Er deutete auf einen der wackeligen Holzstege, die die Hütten miteinander verbanden und Wege durch die Floodlands bildeten.
Lafayette folgte seinem Fingerzeig. Worauf zeigte der Alte? Auf einen Haufen Lumpen? Erst als sich der Haufen bewegte, erkannte er, dass es sich um zusammengekauerte Menschen handelte, die sich gegenseitig vor der Kälte zu schützen versuchten. Eine der Gestalten erhob sich und kam auf sie zu.
»Papa!«, rief sie.
Lafayette erkannte ein Kind, das barfuß über die nassen Holzplanken lief. Er konnte den Anblick kaum ertragen. Am liebsten hätte er sich umgedreht und wäre davongegangen. Doch das verringerte das Elend nicht; er sah es dann nur nicht mehr.
Dunkle Locken umrahmten das Gesicht des Kindes und hüpften bei jeder Bewegung auf und ab. War es ein Mädchen oder ein Junge? Er wusste es nicht, schätzte das Kind auf sechs, vielleicht sieben Jahre.
»Papa!«, rief es erneut.
Der alte Mann winkte ihm zu und wandte sich wieder an Lafayette. »Das mein Sohn, Gianni. Er guter Junge. Aber manchmal er nur Flausen in Kopf.« Er griente zahnlos, als der Junge ihn erreichte und seine Hand nahm.
Seine großen dunklen Augen leuchteten in dem schmutzigen Gesicht, als er zu Lafayette aufsah. »Dein Haar ist gold«, sagte er.
Lafayette lächelte. »Naja, fast.«
»Und sauber. Nicht viele hier sind so sauber. Mein Name ist Gianni. Wie heißt du?« Der Junge betrachtete ihn mit unverhohlener Neugier.
»Mein Name ist Jean-Remy. Aber alle sagen bloß Remy zu mir. Wie alt bist du, Gianni?«
»Fast schon sieben. Und du?«
»Sechsunddreißig.«
Der Junge blies die Backen auf, dann prustete er los. »Du siehst noch gar nicht so alt aus.«
Lafayette lachte mit ihm, obwohl er wusste, dass dahinter eine traurige Wahrheit steckte. Die Bewohner der Floodlands erschienen allesamt wesentlich älter, verbrauchter und verlebter, als sie in Wirklichkeit waren.
Dann ging er in die Knie, um Gianni ins Gesicht sehen zu können. »Hier hat eine Frau gewohnt, die auch so goldenes Haar hat wie ich. Kennst du sie?« Er deutete auf die Hütte, aus der er gerade gekommen war.
»Ja, ihr Name ist Carla, richtig? Sie ist immer sauber und sehr nett. Hat uns Essen gegeben, manchmal. Wenn sie was übrig hatte.«
»Kanntest du sie gut?«
Ein Kopfschütteln. »Nicht gut. Sie war meistens nicht zuhause, immer arbeiten. Und wenn Männer kommen, dann waren Fensterläden zu. Damit wir nicht reingucken.«
»Männer? Was für Männer?«
Schulterzucken. »Manche mit goldenen Haaren, manche nicht. Gute Kleidung, warm. Keine Löcher.«
»Kamen oft Männer zu ihr?«
»Schon. Oft, ja. Aber nur abends, wenn es dunkel war.«
Der Alte trat an seinen Sohn heran und legte ihm eine Hand auf die Schulter, die Augen zu Schlitzen verengt. »Warum du wissen wollen? Warum du neugierig?«
Lafayette erhob sich. Was der Junge erzählte, war höchst interessant. »Gianni, du hast mir sehr geholfen. Ich danke dir. Hier, für dich.« Er nahm seinen Schal ab und legte ihn um die Schultern des Kindes. Er war so lang, dass er ihm bis zu den Knien reichte.
Die Augen des Jungen strahlten vor Begeisterung und er hüpfte auf und ab. »Danke, Mister. Sie sehr nett.« Dann drehte er sich um und rannte zu seiner Familie zurück, um das Stück Wolle von ihnen bestaunen zu lassen.
»Grazie, Sir.« Giannis Vater ergriff seine Hand und hielt sie fest.
Lafayette entzog sie ihm, streifte seine Handschuhe ab und reichte sie dem Mann. »Sie brauchen die mehr als ich.«
Wie gebannt starrte der Alte auf die ledernen Handschuhe, schnell schob er sie unter seine Lumpen, als befürchtete er, man könnte sie ihm wieder abnehmen. »Für mein Frau«, sagte er und verbeugte sich mehrfach. »Grazie! Sie guter Mensch. Sie guter Mensch.«
Dann kehrte auch er zu seiner Familie zurück.
Lafayette beobachtete, wie Bewegung in die Menschen kam, Köpfe sich in seine Richtung drehten, Hände ihm zuwinkten. Zögernd winkte er zurück.
Carla Lewis hatte also Männerbesuch empfangen. Oft. Abends. Hatte sie deshalb so adrett und sauber ausgesehen? Weil sie auf ihr Äußeres achtgeben musste, um fremden Männern zu gefallen?
»Verschenkst du wieder dein letztes Hemd?«
Die spöttische Stimme riss ihn aus seinen Gedanken. Er fuhr herum. In ihrem schwarzen Lodenmantel, den hohen Lederstiefeln, der ganz und gar undamenhaften Reithose und dem Mokka-Ton ihrer Haut, sah Detective Madeline Vezér genauso wild und stolz aus, wie Lafayette sie in Erinnerung hatte. Eigentlich hatte er sich für die Begegnung mit ihr wappnen wollen, doch nun war sie ihm zuvorgekommen.
»Sie haben nicht einmal Schuhe an«, war das erste, was ihm einfiel.
Großartig, Remy. Einfach großartig.
Madeline hob die Augenbrauen. »Bitte?«
»Die Menschen hier. Sie tragen keine Schuhe. Dabei ist es saukalt.«
»Das ist mir auch schon aufgefallen.«
Peinliche Stille trat ein. Lafayette betrachtete die Planken unter seinen Füßen und das Wasser des East River darunter. Klatschend schlug es gegen die Pfähle, die das Fundament der Floodlands bildeten.
»Du warst eine Weile nicht mehr hier, was?«, fragte Madeline schließlich.
»Zuletzt mit dir. Wie lange ist das jetzt her?«
»Acht Monate. Keine sehr lange Zeit. Hier verändert sich nur wenig.«
Mit der Hand fuhr sie über ihr dunkles Haar, das sich im Regen zu kräuseln begann. Lafayette kannte diese Geste gut. Als Halbyoruba hatte Madeline ständig mit ihren krausen Locken zu kämpfen. Sie trug sie gerade so lang, dass sie sie zu einem strengen Knoten binden konnte, den sie mit zahlreichen Haarnadeln fixierte.
Er nickte bloß. Ihr plötzliches Auftauchen hatte ihm die Sprache verschlagen. In den letzten Monaten hatte er sich immer wieder ausgemalt, wie es wäre, ihr gegenüberzutreten. Er hatte ihr so viel sagen wollen. Doch nun war sein Kopf völlig leer.
»Was machst du hier? Du hast den weiten Weg aus der Upper West Side doch nicht auf dich genommen, weil du solche Sehnsucht nach den Floodlands hast.«
Madeline verschränkte die Arme vor der Brust, lehnte sich gegen ein hölzernes Geländer, das den Steg begrenzte und musterte ihn kühl.
»Ich … äh … arbeiten«, brachte er schließlich hervor und räusperte sich.
»Arbeiten? Ich kann mir nicht vorstellen, dass du hier Kunden findest, die Wert auf eine Gesichtsanalyse legen. Geschweige denn das nötige Kleingeld dafür haben.«
»Nein, natürlich nicht.« Er seufzte. »Ich habe mir die Leiche angesehen. Carla Lewis.« Mit einer leichten Bewegung seiner Hand deutete er auf die Hütte, in der Blackburne anscheinend noch immer damit beschäftigt war, die Leiche transportfertig zu machen.
»Was?« Ihr Ausruf klang wie ein Zischen.
»Rooke hat mir eine Nachricht geschickt, heute Morgen«, beeilte er sich zu sagen. »Er wollte mich als Berater, nur für diesen einen Fall.«
»Wie bitte?« Madelines Gesicht verzog sich, als litte sie an heftigen Zahnschmerzen.
»Er meinte, ihr könntet Hilfe gebrauchen. Weil es ein Serientäter ist, der kaum Spuren hinterlässt. Drei Opfer innerhalb weniger Wochen. Ich soll mir die Gesichter der toten Mädchen anschauen, herausfinden, ob es irgendwelche Gemeinsamkeiten gibt.«
Sie schnaubte ärgerlich. »Als würden wir das nicht auch ohne dich herauskriegen. Wir brauchen deine Hilfe nicht, Lafayette. Ich brauche deine Hilfe nicht. Geh in dein warmes Büro und erzähl gelangweilten Hausfrauen, was die Form ihrer Augen oder die Größe ihrer Nase bedeutet. Dort ist deine Arbeit, nicht hier in den Floodlands.«
Dann rauschte sie an ihm vorbei. Die Absätze ihrer Stiefel klapperten über das Holz, als sie auf Carla Lewis’ Hütte zuging.
»Aber der Captain -«
Wutentbrannt drehte sie sich um. »Der Captain ist nicht hier. Du kannst dich gerne bei ihm ausheulen. Ich werde keinesfalls mit dir zusammenarbeiten. Eher ziehe ich hierher.«
»Hör zu, Madeline, es tut mir leid.« Er machte einen Schritt auf sie zu, hob die Hände. »Ich habe damals Fehler gemacht, aber jetzt bist du diejenige, die sich unprofessionell verhält. Ich bin nicht zu meinem Vergnügen hier, sondern weil der Captain mir diesen Auftrag erteilt hat. Sei meinetwegen sauer auf mich, aber vergiss nicht, weshalb wir hier sind -«
»Ich will deine Entschuldigungen nicht hören – und erst recht nicht deine Belehrungen.« Sie kam auf ihn zu, hob den Zeigefinger und deutete auf sein Gesicht. »Und ich will auch nicht hören, ob du ihn gefunden hast oder immer noch nach ihm suchst. Mein Leben ging weiter, Remy, auch ohne dich. Und ich habe nicht vor, vergangenen Zeiten nachzutrauern. Es wird keine Zusammenarbeit mehr zwischen uns geben, habe ich mich klar ausgedrückt? Tu, was du tun musst, aber komm mir ja nicht in die Quere. Und dann verschwinde hier. Du hast die Floodlands doch sowieso immer gehasst. Also sei froh, dass du nicht hier sein musst – im Gegensatz zu mir.«
Die Schöße ihres Mantels wallten hinter ihr her, als sie sich abwandte und dem Steg folgte, der zu Carla Lewis’ Hütte führte. Sie warf die Tür krachend hinter sich zu; schief blieb diese in ihren Angeln hängen.
Lafayette holte tief Luft, bevor er ihr nachging. Das war ja großartig gelaufen.
2
Nur das Klappern der Teelöffel in den geblümten Porzellantassen war in dem winzigen Zimmer zu hören und dann und wann Officer Sagorowskis Schlürfen, wenn er einen Schluck von seinem Kamillentee nahm. Der uniformierte Polizist, der mit seinem roten Haar und den Sommersprossen aussah wie ein verängstigter Kobold, rutschte auf dem alten, aber gepflegten Sofa hin und her. Zu dritt saßen sie auf dem Polster und Madelines düsterer Blick wanderte zwischen Sagorowski und Lafayette hin und her, woraufhin der Officer seine Tasse schuldbewusst auf dem ebenhölzernen Wohnzimmertisch abstellte und an einem Keks zu knabbern begann. Der Junge würde noch einiges lernen müssen. Schweigen zu ertragen beispielsweise.
Auch Mrs. Fisher, die Bewohnerin dieser ärmlichen Behausung, wirkte nicht glücklich. Kein Wunder, denn der Kamillentee schmeckte nach Seifenlauge und die Kekse, als wären sie schon mehrere Jahrzehnte alt.
Neben einem Kohleofen stand ein kupferner Vogelkäfig, der bereits Grünspan angesetzt hatte. In seinem Inneren hockte ein grüner Papagei mit gelbem Gesicht und blauem Fleck über dem Schnabel. Eine Blaustirnamazone, wenn Lafayette sich nicht täuschte. Es war ein ziemlich zerfleddertes Tier, das, als Mrs. Fisher sein Alter – stolze achtundfünfzig Jahre – und seinen Namen – Bobby – nannte, kräftig mit den Flügeln schlug und am Gitter zu knabbern begann.
Der Vogel war das einzige, was sie aus ihrer niederländischen Heimat vor den Fluten hatte retten können. Mrs. Fisher erzählte von ihrer Flucht, als sei es gestern gewesen, dabei lag die Evakuierung Hollands bereits über vierzig Jahre zurück. Vierzig Jahre in den Floodlands …
Da würde ich mich gedanklich auch in die Vergangenheit flüchten, dachte Lafayette.
Mittlerweile war Bobby wieder still und betrachtete das Treiben aus braunen Knopfaugen, als schien er zu verstehen, dass etwas Ungeheuerliches in dieser Gegend seinen Lauf genommen hatte.
Endlich durchbrach Madeline die Stille und Lafayette hörte Sagorowski neben sich aufatmen. »Sie sind sicher, dass es sich bei der Verstorbenen um Ihre Nachbarin Miss Carla Lewis handelt?
Die Frau nickte.
Wie alt war sie wohl? Siebzig? Fünfundsiebzig? Vielleicht hatte aber auch das karge Leben in der Pfahlbautensiedlung sie früher altern lassen. In ihrem wollweißen Haar steckten einige metallene Lockenwickler und sie kauerte mehr in ihrem Sessel, als dass sie saß. In ihrem Gesicht hatte Lafayette keine Anzeichen für Verschlagenheit oder den Hang zum Lügen entdeckt, doch ihm war aufgefallen, dass ihre Augen immer wieder durch den Raum zum einzigen Fenster huschten, welches diese Bezeichnung jedoch kaum verdiente. Es war blank geputzt, eine kleine, verkrüppelte Pflanze stand auf dem Fensterbrett und sog das wenige Licht auf, das durch die Scheibe fiel.
»Aber ja«, sagte sie nun und blinzelte heftig. »Natürlich bin ich mir sicher, dass es Miss Lewis ist. Ich habe sie zwar nicht so häufig gesehen, nur ab und an vor der Tür, wissen Sie? Hier traut man sich ja kaum noch aus seiner eigenen Hütte.« In ihrer Stimme lag ein vorwurfsvoller Unterton, als wären Madeline und ihre Kollegen für die Zustände hier verantwortlich.
»Können Sie sich erinnern, ob sie Verwandte hatte oder Freunde?«, fragte Madeline. »Hat sie häufig Besuch in ihrer Wohnung empfangen?«
Mrs. Fisher nahm einen Schluck Tee und richtete sich auf. »Ich spioniere meinen Nachbarn nicht hinterher.«
Lafayette seufzte und stellte seine Tasse auf den Tisch. Widerliches Gesöff. Das nur notdürftig entsalzene Wasser stammte wahrscheinlich direkt aus dem Fluss, der kaum zwei Meter unterhalb ihrer Füße entlangfloss. Sein Gurgeln war nicht zu überhören. Nicht auszudenken, wenn es stürmte …
Er trat ans Fenster und lehnte sich gegen den Sims. Von hier aus hatte er das Wohnzimmer gut im Blick. Die Möbel waren alt, aber in gepflegtem Zustand. An den Wänden hingen vergilbte Photogramme aus früheren Tagen, vermutlich auch aus glücklicheren. Die meisten zeigten eine jüngere Mrs. Fisher – wahrscheinlich mit ihrem Ehemann, einige mit einem kleinen Mädchen. Auf den neueren Bildern fehlte der Mann und nur noch Mutter und Tochter waren zu sehen.
»Jedenfalls war Miss Lewis sehr beliebt.« Mrs. Fishers Stimme zitterte leicht. »Zu meiner Zeit wäre es unmöglich gewesen, junge Männer allein zu empfangen. Aber die Zeiten ändern sich, nicht wahr?» Sie lachte nervös, hustete.
Madeline beugte sich vor, nicht ohne Lafayette einen Blick zuzuwerfen. »Was meinen Sie mit ›jungen Männern‹? Waren es immer verschiedene oder häufig die gleichen?«
Ein Achselzucken. »Ich glaube, häufig die gleichen. Aber beschwören würde ich das nicht. Ich habe nur ihre Stimmen gehört, wenn sie über die Stege liefen, gesehen habe ich sie nicht. Wie gesagt, ich spioniere nicht.«
»Wie viele?«
»Wie viele was?«
»Wie viele verschiedene Männer?«
»Das weiß ich nicht. Vier oder fünf vielleicht. Vielleicht mehr, vielleicht weniger.«
Wieder ein Blick zum Fenster. Durch ihr Blinzeln versuchte sie, es zu verbergen, doch Lafayette bemerkte, wie sie ihn erst kritisch beäugte und ihren Blick dann auf die Pflanze neben ihm richtete. Es war ein kümmerliches Gewächs, dessen mickrige, violette Blüte halb verwelkt den Kopf hängen ließ.
Was zum Teufel war denn los mit der alten Dame?
»Was hat Miss Lewis beruflich gemacht?«, fragte er und fing sich dafür einen bösen Blick von Madeline ein. Misch dich nicht in meine Befragung ein, hieß das. Schon klar. Aber er war nun mal ein Teil der Ermittlung, ob es ihr nun passte oder nicht.
Mrs. Fisher antwortete nicht sofort, die Tasse in ihrer Hand klapperte auf dem Unterteller. »Sie war Näherin in einer Schuhfabrik, das hat sie mir mal erzählt. Unten in Fulton Landing.«
Sie warf einen sehnsüchtigen Blick auf die pappigen Kekse, die auf dem Tisch standen und an denen Officer Sagorowski sich gütlich tat, dann leerte sie ihre Tasse in einem Zug und stellte sie ab.
»Können Sie sich vorstellen, wer Miss Lewis schaden wollte?«, fragte Madeline. »Einer ihrer männlichen Besucher vielleicht?«
Lafayette schob sich näher an das Pflänzchen heran, gefolgt von Mrs. Fishers unstetem Blick. Irgendetwas verbarg die alte Dame vor ihnen. Ihr Fuß wippte unaufhörlich in ihrem Hausschuh. Fast schien es, als hätte sie die Frage gar nicht gehört.
Das Geräusch von Schritten auf den Planken vor der Tür ließ sie aufmerken. Der Papagei krächzte etwas, das wie »Abby« oder »Addy« klang und plusterte sein Gefieder auf, als wollte er denjenigen, der gerade im Begriff war die Hütte zu betreten, mächtig beeindrucken.
Sie hörten einen Schlüssel, der sich im Türschloss drehte, dann kam eine Frau herein und blieb wie angewurzelt im Rahmen stehen, als sie den ungebetenen Besuch bemerkte.
Alles an ihr war spitz. Sie trug ein spitzes Hütchen, unter dem eine spitze Nase und ein spitzes Kinn hervorlugten. Auch ihr Mund war spitz, was ihr ein dauerhaft pikiertes Aussehen verlieh. Das hochgeschlossene schwarze Kleid und die streng zurückgekämmten Haare milderten diesen Eindruck nicht. Eine Frau wie ein spitzer Stein im Schuh.
Ohne die Polizisten eines Blickes zu würdigen, lief sie zu Mrs. Fisher und legte ihr die Arme um den Hals.
»Oh, Mutter!«, rief sie und Lafayette fühlte sich an ein miserables Theaterstück erinnert. Sagorowski hatte einen angebissenen Keks in der Hand und rührte sich nicht mehr, Madeline versuchte mit hochgezogener Braue streng auszusehen, was ihr nur mäßig gelang.
»Wie schrecklich!«, rief die spitze Frau. »Ich bin so schnell gekommen, wie ich konnte. Aber du weißt ja was derzeit los ist, ich bekomme Cornelis kaum noch zu Gesicht. Geht es dir gut?« Sie legte ihre Hände an die Wangen der alten Dame.
Ohne die Antwort abzuwarten, verließ Lafayette seinen Platz am Fenster und ging mit ausgestreckter Hand auf die aufgeregte Frau zu.
»Sie müssen die Tochter sein«, sagte er. »Die Ähnlichkeit ist unverkennbar.« Nun, das war gelogen, aber das musste sie ja nicht wissen. »Darf ich vorstellen: Detective Vezér und Officer Sagorowski. Mein Name ist Remy Lafayette. Wir untersuchen den Mord an Mrs. Fishers Nachbarin.«
Sie ergriff seine Hand, ihr Händedruck war schlaff, ihre Finger kalt und feucht wie toter Fisch. Er widerstand dem Drang, seine Hand am Mantel abzuwischen. Aus der Nähe wirkte ihr Gesicht noch kantiger. Ihre Wangen waren eingefallen und sie presste die schmalen Lippen aufeinander. Die ungesunde Blässe versuchte sie unter Unmengen von Rouge zu verstecken.
»Mrs. Adelaide van Oosterom«, erwiderte sie beinahe schüchtern. »Und ja, ich bin ihre Tochter.«
Der Name kam Lafayette vage bekannt vor, doch im Moment konnte er sich nicht daran erinnern, in welchem Zusammenhang er ihn schon einmal gehört hatte.
Ihm entging der Blick nicht, mit dem Adelaide van Oosterom Madeline musterte. Ob er ihrer Hautfarbe, den Reithosen oder der Tatsache, dass sie ein weiblicher Detective war, geschuldet war, konnte er nicht sagen. Doch die Ablehnung spürte er deutlich. Gerümpfte Nase, geschürzte Lippen, Mundwinkel, die nach unten zuckten. Ein Stein war herzerwärmend dagegen.
Mit einem fragenden Blick zu Madeline vergewisserte er sich ihrer Zustimmung, die er zu seinem Erstaunen auch bekam. Auch sie hatte den abschätzigen Blick wohl bemerkt. Doch ehe er eine Frage stellen konnte, ergriff Mrs. van Oosterom das Wort.
»Sie sind also Polizisten?« Wieder ein Blick zu Madeline, als könnte sie nicht glauben, dass eine Frau eine solche Stellung innehaben konnte.
»Die beiden sind Polizisten, ja.«
»Und was sind Sie?« Ihre kalten wässrig-blauen Augen richteten sich auf ihn, musterten ihn unverhohlen von Kopf bis Fuß.
»Ich bin Berater.«
Sie verschränkte die Arme vor der Brust. »Was für ein Berater?«
»Gesichtsanalyse. Aber das tut hier eigentlich -«
»Wusste ich es doch!«, rief Mrs. van Oosterom. »Ich wusste, Ihr Gesicht kommt mir bekannt vor. Sie haben vor einigen Jahren auf einem Jahrmarkt gearbeitet, nicht wahr? Unten auf Coney Island. Sie haben den Leuten dort aus dem Gesicht gelesen, ihnen die Zukunft vorhergesagt.«
Er seufzte. Nur ungern erinnerte er sich an die Zeit, als er seine Dienste auf dem Jahrmarkt angeboten hatte. Es war eine Zeit gewesen, in der er jeden Dime mehrmals hatte umdrehen müssen, kurz nachdem er seine Ausbildung abgeschlossen hatte. Immerhin war es ihm so möglich gewesen, sehr viel Erfahrung für seinen jetzigen Beruf innerhalb kürzester Zeit zu sammeln.
»Nicht die Zukunft, Ma’am. Aber Krankheiten und einige Charakterzüge kann ich in den Gesichtern lesen.«
»Ich wollte es damals schon immer machen, aber ich hatte nicht das notwendige Kleingeld.« Sie blickte beschämt zu Boden, als wäre sie schuld an ihrer ärmlichen Herkunft. »Könnten Sie mich auch analysieren?«
Ihre Wangen hatten unter dem ganzen Rouge einen rosigen Farbton angenommen und ihre kalten Augen blitzten plötzlich vor Aufregung. Wie bei einem kleinen Mädchen, das man zum ersten Mal mit auf den Rummelplatz nahm …
»Sicher, aber -«
Madeline räusperte sich vernehmlich. Mit der in Falten gelegten Stirn und den säuerlichen Zügen um den Mund sah sie nicht amüsiert aus.
»Bitte entschuldigen Sie.« Lafayette lächelte gezwungen, dann griff er in seine Manteltasche, zog eine seiner Visitenkarten heraus und reichte sie der Frau. »Sie können gerne einen Termin vereinbaren und zu mir ins Büro kommen. Jetzt befragen wir gerade Ihre Mutter als Zeugin in diesem Fall. Sie war uns bisher eine große Hilfe.«
Auch diese Lüge ging ihm leicht über die Lippen. Vielleicht ließ sie ja auch Mrs. Fisher wieder auftauen, die bleich und mit halb geschlossenen Augenlidern in ihrem Sessel hockte. Schlief die alte Dame ein?
Bevor Lafayette reagieren konnte, ging Madeline neben ihr auf die Knie. »Mrs. Fisher? Geht es Ihnen nicht gut? Mrs. Fisher?«
Keine Reaktion. Nur ein verträumtes, fast seliges Lächeln auf den Lippen. Summte sie etwa? Lafayette glaubte, einige unzusammenhängende Töne zu hören.
Nun erwachte auch Sagorowski aus seinem komatösen Zustand und sprang auf.
»Was geht denn hier vor?«, ereiferte sich Mrs. van Oosterom und packte ihre Mutter bei den Schultern. Der Papagei stimmte in ihr Gekreische ein. »Was haben Sie mit ihr gemacht?« Ihre Stimme schraubte sich in unglaubliche Höhen.
»Beruhigen Sie sich bitte«, sagte Madeline und tastete an Mrs. Fishers Handgelenk nach dem Puls.
»Für einen Schock ist es ein bisschen spät, oder?«, meinte Lafayette.
»Soweit ich weiß, kann er auch später eintreten. Allerdings glaube ich nicht, dass sie einen Schock hat. Ihr Puls ist schwach, die Pupillen stark geweitet. Sie muss dringend in ein Hospital.«
»Du meinst …«, begann Lafayette, doch weiter kam er nicht. Sagorowski stand an der Fensterbank und streckte ihnen den Blumentopf mit der verkrüppelten Pflanze entgegen. In den Fingern drehte er eine der haselnussgroßen Knospen und machte ein vielsagendes Gesicht.
»Schlafmohn«, sagte er und schnupperte an der Blüte. »Die alte Dame baut auf der Fensterbank ihr eigenes Opium an.« Sein Gesicht hellte sich für einen Moment auf und er grinste. »Sie hat einen im Tee.«
♦
Die Abteilung für Mord und Gewaltdelikte war wie ausgestorben. Lafayette wunderte das nicht. Die meisten der zweiundzwanzig Detectives waren wahrscheinlich im Außeneinsatz oder zu Tisch. So konnte sich immerhin niemand an Bobbys Anwesenheit stören – oder an Madelines Gezeter.
»Musstest du dieses elende Vogelvieh unbedingt mitnehmen?«, fragte Madeline ungehalten. »Und wie oft muss ich dir noch sagen, dass du dich nicht in meine Vernehmungen einzumischen hast. Du bist kein Polizist, erst recht kein Detective. Sogar Sagorowski hat die Klappe gehalten, aber das kann der große Gesichtsanalytiker Jean-Remy Lafayette natürlich nicht! Er muss sich in Szene setzen und sich als Ermittler aufspielen.«
»Ich habe dich um Erlaubnis gebeten und du hast sie mir erteilt. Es war ja wohl mein Verdienst, dass Mrs. van Oosterom zugänglicher wurde. Also hör auf, dich zu beschweren.«
Sie schnaubte abfällig. »Außerdem kaut dieser Papagei schon die ganze Zeit an meinem Ohrläppchen und kräht mir ›Ich liebe dich!‹ ins Ohr. Ich bin schon halb taub!«
»Wer weiß, wie lange Mrs. Fisher im Hospital bleiben muss. Und du willst dieses hilflose Tierchen doch nicht in die Obhut ihrer äußerst unsympathischen Tochter geben.«
»Doch, das erscheint mir durchaus eine praktikable Lösung zu sein. Ich weiß nämlich nicht, wie lange dieser Vogel überleben wird, wenn er nicht bald mein Haar in Ruhe lässt.« Sie schob Bobbys Schnabel zur Seite, der Gefallen daran gefunden hatte, einzelne Haarsträhnen aus ihrem Dutt zu ziehen. »Er ruiniert meine Frisur!« Sie stöhnte. »Wann kommt Sagorowski mit dem Käfig?«
Sie hatten den Papagei auf recht unkonventionelle Weise in einer von Mrs. Fishers Hutschachteln zum Polizeihauptquartier transportiert, das einige Blocks entfernt lag. Lafayette amüsierte sich noch immer über das Gesicht des Kutschers, als die Schachtel eine schrecklich schiefe Version von Oh my darling, Clementine zu schmettern begann.
Nun war Bobby dermaßen aufgekratzt, dass er nicht von Madelines Schulter wegzubewegen war und wahlweise Liebesschwüre oder Volkslieder zum Besten gab.
»Ich finde ihn äußerst unterhaltsam«, sagte Lafayette. »Ihr solltet ihn behalten und zum Bürovogel befördern.«
»Dem Chef wird das gar nicht gefallen«, sagte Madeline und neigte den Kopf weit zur Seite, damit Bobby nicht weiter mit ihrem Ohrring spielte.
»Der Chef ist nicht da«, erwiderte Lafayette und schob ein Blatt Papier in die Underwood-Schreibmaschine. Bloß zügig das Gesichtsprotokoll des Opfers fertigstellen, bevor es hieß, er würde nur faulenzen.
»Noch nicht«, gab Madeline zu bedenken. »Dir ist schon klar, dass der Vogel nicht hier bleiben kann? Du wirst ihn mit nach Hause nehmen müssen.«
Lafayette blickte von der Underwood auf. »Das geht nicht. Othello würde ihn zum Abendbrot verspeisen. Henley hat Angst vor Vögeln. Und Rufus … naja, Rufus könnte er gefallen. Trotzdem: nein.«
Madeline stieß geräuschvoll die Luft aus. »Wenn du glaubst, dass ich ihn mitnehme, dann täuschst du dich aber gewaltig.«
Sie fuchtelte mit ihrem Finger vor seinem Gesicht herum und zum ersten Mal an diesem Tag hatte Lafayette das Gefühl, dass sie ihn wirklich ansah. Fast war es wie früher, als sie oft zusammengearbeitet hatten. Wieso nur war er so leichtsinnig gewesen und hatte alles verspielt? Und was hatte es ihm genutzt? Rein gar nichts.
»Sind unangemeldet mitgebrachte Haustiere eigentlich ein Kündigungsgrund?«, fragte Madeline mit skeptischem Blick auf den Vogel.
»Keine Ahnung. Zum Glück sitzt er ja auf deiner Schulter.«
Während Lafayette die Akten zusammensuchte, war Madeline dazu übergegangen, den Papagei mithilfe von Zimtplätzchen ruhigzustellen. Tatsächlich ließ Bobby schließlich von ihrer Schulter ab und nahm artig auf ihrem Schreibtisch Platz.
»So bist du ein feines Federviech«, sagte sie und tippte dem Ara mit ihrem Zeigefinger auf den Schnabel. »Sag mal ›Maddy‹!«
»Maddy«, krächzte der Papagei.
Madeline schmunzelte. »Ich glaube, wir könnten uns vielleicht doch noch anfreunden.«
Lafayette wollte etwas erwidern, wurde jedoch durch ein Dampfen und Zischen aufgehalten. Die Rohre über ihnen vibrierten und mit einem lauten Plopp landete ein kupferner Zylinder im dafür vorgesehenen Korb.
»Pneumatische Post?« Er runzelte die Stirn. »Wer versendet denn heute noch Nachrichten damit? Wieso schickt man nicht einfach eine Mitteilung per Notarius?«
Die pneumtatische Post war zwar praktisch, aber im Vergleich zu den Notari, den modernen mechanischen Schreibern, sehr langsam. Es konnte schon mal einige Stunden dauern, bis eine Nachricht ihren Empfänger erreichte, je nachdem, wie weit der Absender entfernt war.
Lafayette öffnete die Kapsel und warf Madeline den darin liegenden Umschlag zu. Er war an sie adressiert, wahrscheinlich die ersten Ergebnisse von Dr. Blackburne.
»Der gute Doktor hat es wohl nicht so mit dem Fortschritt«, sagte er.
Wenn man bedachte, dass das St. James Hospital einige Blocks nördlich des Polizeireviers lag, hatte der Kupferzylinder eine beträchtliche Strecke zurückgelegt. Nicht schlecht für ein System, das langsam aber sicher aus der Mode kam. Gewartet wurde es wohl dennoch.
Er trat hinter Madeline, spähte ihr über die Schulter und las den Text, der auf dem Zettel geschrieben stand. Nur wenige Wörter standen darauf, mit feinsäuberlicher Handschrift geschrieben:
Sie hatte die schwarze Dame in der Hand. Bericht folgt. H. B.
Seiner Nachricht hatte Blackburne mehrere Photogramme beigefügt. Deshalb also die Postsendung im Zylinder. Während Madeline sie betrachtete, blätterte Lafayette durch die Akten der übrigen beiden Fälle. Sie waren erschreckend dünn für bearbeitete Mordfälle. Er schlug die Ordner auf, betrachtete die verschwommenen Photogramme der beiden Opfer.
Sarah Miller und Stella Mason waren vor wenigen Monaten mit einem violetten Seidentuch erdrosselt und mit einer Schachfigur in der Hand gefunden worden. Zuerst Sarah Miller. Ihr hatte der Täter einen weißen Läufer in die Hand gelegt, Stella Mason war vier Wochen später mit einem schwarzen Springer zwischen den Fingern gefunden worden.
Die Befragungen der Familien und Bekannten hatten nichts ergeben, der Täter hatte keine verwertbaren Spuren am Tatort hinterlassen. Lafayette war zwar kein Polizist und kannte sich mit Ermittlungsmethoden nur durch einige gemeinsam bearbeitete Fälle aus, doch so wie er die momentane Situation beurteilte, hatten sie keinen Anhaltspunkt, an dem sie ansetzen konnten. Keine Verdächtigen, keine Gemeinsamkeiten der Opfer, keine Verbindung zwischen den Fällen außer dem seltsamen Modus Operandi des Täters. Umso wichtiger, dass er nun in den Gesichtern der Opfer Ähnlichkeiten fand.
»Ich verschwinde dann jetzt. Die Abschriften der Akten nehme ich mit. Ist das in Ordnung?«
»Meinetwegen. Denk daran, dass du dich von nun an bitte mit Rooke auseinandersetzt. Ich habe es ernst gemeint, als ich sagte, dass ich nicht mehr mit dir zusammenarbeiten werde. Und ich habe meine Meinung nicht geändert.«
»Erklär das dem Captain, nicht mir … Also dann – mach’s gut.«
»Was soll sie mir erklären?«, brummte plötzlich eine Stimme hinter ihm.
Er drehte sich um. »Morgen, Chef!«, sagte er und konnte sich gerade noch davon abhalten, zu salutieren. »Äh … nichts weiter.«
»Ich hoffe, dass dieses Ding da«, Captain Michael Rooke deutete auf Madelines Schreibtisch, »ein ausgestopftes Andenken aus der Karibik ist.«
Natürlich konnte sich Bobby, der in den letzten Minuten verdächtig ruhig an seinen Keksen geknabbert hatte, nicht zurückhalten. Lafayette hatte bereits befürchtet, dass der Papagei nicht etwa friedlich geworden war, sondern nur seine nächste Attacke plante. Im nächsten Moment hüpfte er auf und ab und schrie in ohrenbetäubender Lautstärke immer wieder: »Karibik! Karibik!«
Lafayette rieb sich mit einer Hand über die Stirn. Als er zu einer Erklärung ansetzen wollte, hob Rooke die Hand.
»Behalten Sie es einfach für sich, in Ordnung? Sie sind dafür verantwortlich. Und für alles, was dieses Tier anstellt. Sorgen Sie dafür, dass ich ihn weder höre noch sehe, geschweige denn rieche! Am besten, Sie nehmen ihn mit nach Hause.«
»Aber …«
»Das war keine Bitte. Wenn Sie wieder für mich arbeiten wollen, dann tun Sie, was ich Ihnen sage. Ohne Ausnahme.«
»Jawohl, Sir.«
»Ich gebe Ihnen noch einmal einen Vertrauensvorschuss – und hoffe, Sie enttäuschen mich nicht.«
»Verstanden, Sir. Ich bin Ihnen sehr dankbar. Ich lasse den Vogel abholen.« Lafayette spürte Madelines triumphierenden Blick in seinem Rücken.
»Gut!« Rooke machte eine wegwerfende Handbewegung. »Bei diesem Fall können wir jede Hilfe gebrauchen, die wir kriegen können. Sie wissen ja, nach dem Eisenbahnunglück mussten wir zahlreiche Männer dorthin entsenden.«
Richtig, davon hatte er gelesen. Im Norden Manhattans war vorgestern ein Zug entgleist, Dutzende Menschen waren dabei verletzt worden, über Todesopfer war bisher nichts bekannt. Die Aufräumarbeiten dauerten noch immer an, mehrere Passagiere galten als vermisst. Deshalb war es hier im Büro also so still.
»Wo wollen Sie überhaupt hin?« Rooke deutete auf die Akten und den Mantel, den Lafayette über dem Arm trug.
»Ins Büro, Sir.«
»Sie sind doch hier im Büro.«
»In mein Büro, Captain. Ich dachte -«
»Nichts da. Sie bleiben schön hier. Ich sprach zwar von Vertrauensvorschuss, aber ich habe Sie trotzdem lieber in Sichtweite. Detective Vezér wird sich Ihrer annehmen.«
»Aber Sir …« Nun erhob sich auch Madeline. »Ich bezweifle, dass das eine gute Idee ist.«
»Stellen Sie etwa meine Autorität in Frage?«
»Nein Captain, aber -«
Auf Rookes Gesicht erschien ein kalter Ausdruck. »Dann ist ja alles geklärt.«
»Aber -«
Mit wenigen Schritten trat er zu Madeline und hob eine Hand. »Genug! Ihre persönlichen Querelen gehen mich nichts an und sie interessieren mich auch nicht. Aber ich erwarte, dass Sie beide professionell genug sind, Ihre Differenzen zu ignorieren und zusammenzuarbeiten. Es geht hier schließlich nicht um Sie, sondern darum, einen Mörder zu fassen, der mindestens drei Frauen auf dem Gewissen hat. Habe ich mich klar ausgedrückt?«
»Natürlich, Captain.«
Auch Lafayette nickte.
»Dann sind wir uns ja einig. Detective Vezér, würden Sie mir bitte kurz Bericht über Ihren heutigen Einsatz erstatten?«
Rooke zog einen Stuhl vom Nachbarschreibtisch zu sich heran, nahm seinen Bowler ab und setzte sich. Sein kurzes dunkles Haar war zerzaust und er wirkte müde.
Madeline berichtete so knapp wie möglich von der Tatortbesichtigung, von der jungen toten Frau und von der schwarzen Dame, die Dr. Blackburne in ihrer Hand entdeckt hatte.
Rookes Stirn legte sich in Falten und er strich mit den Fingern über seine unrasierten Wangen. Dann erhob er sich.
»Statten Sie Dr. Blackburne einen Besuch ab und holen Sie die Schachfigur. So schnell wie möglich. Ich will sie sehen. Und den Bericht bitte stante pede auf meinen Schreibtisch. Finden Sie etwas Verwertbares. Und dann möchte ich, dass Sie nochmal zur ICL gehen und einen dieser Schachfritzen als Berater engagieren. Wir brauchen Ergebnisse, koste es, was es wolle. Der Polizeipräsident sitzt mir im Nacken, ebenso wie die Presse. Wenn wir nicht bald einen Ermittlungserfolg vorweisen …« Er ließ den Satz unvollendet, verschwand in seinem Büro und ließ die Tür geräuschvoll hinter sich ins Schloss fallen.
»Was ist denn mit dem los?«, fragte Lafayette mit gesenkter Stimme. Der Chef war nie die freundlichste Person unter der Sonne gewesen, doch so grimmig hatte er ihn selten erlebt.
Madeline warf ihm einen grimmigen Blick zu. »Der Fall macht ihm zu schaffen. Uns allen. Und dann seine Frau …«
»Seine Frau?«
»Sie ist krank, liegt momentan im St. James Hospital. Wahrscheinlich wird sie nicht mehr gesund.«
Lafayette schwieg. Er kannte Annabelle Rooke seit Jahren, sie war eine seiner ersten Kundinnen gewesen, nachdem er sein eigenes Büro eröffnet hatte. Gesundheitliche Probleme hatte sie bereits damals gehabt, dass es mittlerweile jedoch so schlimm um sie stand, hatte er nicht gewusst.
»Ich muss den Bericht schreiben und noch einmal alle Akten durchgehen. Wenn wir nicht bald etwas finden, wird sich die Presse auf uns stürzen wie ausgehungerte Geier auf ein Stück Aas.« Sie fuhr sich mit der Hand durchs Gesicht. »Und du machst dich am besten nützlich und holst die Schachfigur aus der Gerichtsmedizin. Bei der Gelegenheit kannst du dann auch gleich die anderen beiden Opfer begutachten und deinen Job machen.«
Lafayette schlüpfte in seinen Mantel. Wenn er schon mal im St. James Hospital war, konnte er Annabelle auch gleich einen Besuch abstatten. Falls es wirklich so schlecht um sie stand, wollte er sie unbedingt noch einmal sehen, bevor …
Hastig schob er diesen Gedanken fort. Es gab immer Hoffnung. Immer.
3
Im Treppenhaus hörte Lafayette noch Madelines Bemühungen, Bobby ruhigzustellen, der begonnen hatte, seine Version von Oh! Susanna zum Besten zu geben. Sie beschwerte sich lautstark über sein Gejaule. Rooke kochte in seinem Büro wahrscheinlich vor Zorn. Da war ein Besuch in der Leichenhalle des St. James Hospitals doch gar kein so schlechter Zeitvertreib.
Unten im Foyer traf er auf Officer Sagorowski, der sich mit Mrs. Fishers Vogelkäfig abmühte. Während er die Tür mit dem Rücken aufstemmte und versuchte, sich selbst nebst Käfig durch die Öffnung zu zwängen, ging er in die Knie, was ihn aussehen ließ wie einen Frosch, der sich mit einem gewaltigen Käfer abmühte. Eine Frau stand daneben und half dem jungen Mann, den überdimensionierten Käfig durch die Tür zu wuchten – mehr schlecht als recht, denn sie stützte sich auf einen Gehstock und hatte nur eine Hand frei.
Lafayette eilte die Stufen hinunter. »Wie schön, Sie zu sehen, Officer«, sagte er. »Detective Vezér wird hocherfreut sein. Sie und der Papagei sind sich zwar schon näher gekommen, aber er mag sie mehr als sie ihn. Traurig, aber wahr.«
Die Frau erschrak beim Klang seiner Stimme.
»Verzeihung«, sagte er, als er die letzten Stufen hinunterstieg. »Ich wollte Sie nicht erschrecken.«
Sie würdigte ihn keines Blickes.
»Ist mit Ihnen alles in Ordnung, Miss?«
Sie nickte mit abgewandtem Kopf, wobei sie ihren Hut tiefer ins Gesicht zog. Seltsame Person.
Trotz der kalten Luft, die durch die Tür hereinströmte, rann Sagorowski der Schweiß über das Gesicht und er schnaufte wie eine alte Dampflok, als er das Drahtmonster abstellte.
»Sind Sie den ganzen Weg hierher gelaufen?«, fragte Lafayette.
Mit hochrotem Kopf nickte Sagorowski und stützte sich mit den Händen auf beiden Knien ab.
»Warum haben Sie keine Droschke genommen?«
»Kein … Kleingeld …«, keuchte der Officer.
Lafayette klopfte ihm auf die Schulter und wandte sich zum Gehen. »Wir sehen uns später.«
Die Tür fiel hinter ihm ins Schloss. Auf dem Gehsteig blieb er irritiert stehen. Irgendetwas stimmte nicht mit dieser Frau. Sie kam ihm vage bekannt vor, obwohl er ihr Gesicht nicht gesehen hatte. Vielleicht hätte er ihnen zu Hilfe kommen sollen. Als ihm einfiel, dass die Aufzüge außer Betrieb waren, öffnete er die Tür erneut.
»Dass die Aufzüge heute gewartet werden, wissen Sie, oder? Ich könnte …« Weiter kam er nicht, denn beim Eintreten stieß er gegen die seltsame Frau. »Entschuldigen Sie, Miss«, begann er, doch dann blieben ihm die Worte im Hals stecken. Tausende Bilder und Empfindungen strömten auf ihn ein, als er in ihr Gesicht blickte. In ihre schreckgeweiteten Augen. Diese veilchenblauen Augen, in denen er schon hunderte Male versunken war und die er in den letzten Jahren so sehr vermisst hatte. Lara. Es war Lara. Seine Verlobte.
♦
»Was tust du hier?«, flüsterte er, als seine Stimme ihm wieder gehorchte. »Warum bist du hier?«
So oft hatte er sich in den vergangenen Jahren ihr Wiedersehen ausgemalt, hatte sich Liebesschwüre zurechtgelegt, die sie zum Bleiben bewegen sollten, hatte in Gedanken dutzendfach mit einem Strauß Narzissen – ihren Lieblingsblumen – vor ihr gestanden und sie gebeten, zu ihm zurückzukehren. Erst in den letzten Monaten hatten diese Fantasien endlich nachgelassen.
Und nun stand sie vor ihm und von seinen Liebesbekundungen war nichts mehr geblieben.
Sie presste die Lippen aufeinander und in ihren Augen schimmerten Tränen, die sie ärgerlich wegblinzelte.
»Remy, ich … Es tut mir leid. Ich sollte nicht hier sein.« Mit steifen Bewegungen, als hätte diese Begegnung auch sie völlig aus der Bahn geworfen, wandte sie sich zum Gehen.
»Warte!« Er griff nach ihrem Arm; ihre erste Berührung seit über drei Jahren – wenn auch nur durch den Stoff ihres Mantels. Dennoch kribbelten Lafayettes Fingerspitzen. Sie zuckte unter der Berührung zusammen, und er ließ seine Hand sinken.
»Lara, bitte. Lass uns reden.«
Langsam drehte sie sich zu ihm um, betrachtete ihn unverwandt. Dunkle Schatten lagen unter ihren Augen, um ihre Mundwinkel hatten sich kleine Fältchen eingegraben.
»Geht es dir gut?«, fragte er nun etwas sanfter.
»Es geht schon.« Ihre Stimme schien an Volumen verloren zu haben, klang dünn und schwach. Oder hatte er sich die frühere Lebendigkeit darin bloß eingebildet?
»Sollen wir … ein Stück spazieren gehen?«
Sie wich einen Schritt vor ihm zurück, wie ein scheues Reh, das nicht sicher war, ob die fütternde Hand vielleicht demnächst zuschlug.
»Bitte. Nur ein paar Schritte. Nur ein Spaziergang. Mehr nicht.«
»Gut. Ein Spaziergang.« Ein zögerliches Lächeln. »Central Park«, sagte sie nach einem Moment des Schweigens. »Fährst du mit mir hin?«
Die Fahrt in der Droschke verbrachten sie schweigend. Zu viele Fragen, die sich in den Vordergrund drängten, schwirrten ihm durch den Kopf. Es schien unmöglich, eine einzige davon auszuwählen. Laras plötzliche Anwesenheit, ihre Rückkehr in sein Leben, ihre Nähe in der Kutsche – das alles war für den Moment zu viel. Und doch war es nicht genug.
Auf Höhe der zweiundsiebzigsten Straße half er ihr aus der Droschke.
Sein Blick fiel zum wiederholten Mal auf den Gehstock, auf den sie sich stützte. »Ist alles in Ordnung mit dir? Hast du dich verletzt?« Er hatte über diese Frage nicht nachdenken müssen, sie lag ihm plötzlich auf der Zunge.
»Du bist immer noch der alte, was? Immer um mein Wohlergehen besorgt.«
Lafayette bezahlte den Kutscher und bot Lara seinen Arm an.
»Es ist nur ein verstauchter Knöchel. Mehr nicht«, sagte sie.
»Ich habe dir meinen Arm nicht aufgrund deines Knöchels angeboten.«
Sie lächelte, als sie ihre linke Hand in seine Ellenbeuge legte.
Schweigend betraten sie den Park durch das Inventors’ Gate. Zu dieser Tages- und Jahreszeit trafen sie nur vereinzelt auf andere Menschen – anders als im Sommer, wenn die New Yorker den Park als grüne Insel der Erholung nutzten. Jetzt waren die Bäume kahl, die Rasenflächen vom Regen aufgeweicht und schmutziges Braun hatte das saftige Grün abgelöst.
Ein eisiger Wind pfiff über die Wege, doch Lafayette nahm ihn kaum war. Auch Lara beklagte sich nicht. Ihre Wangen röteten sich durch die Kälte und sie erinnerte ihn langsam wieder an die Frau, die eine Zeit lang der wichtigste Mensch in seinem Leben gewesen war.
»Es tut mir leid, dass ich dich so überrumpelt habe«, sagte sie, während sie dem Weg nach Westen folgten. »Eigentlich solltest du mich gar nicht sehen. Ich wollte dir das nicht antun.«
»Mir was nicht antun?«
»Ich wollte nicht, dass du mich so siehst. Wie ich jetzt bin.«
Er verlangsamte seine Schritte. »Wie bist du denn jetzt?«
»Anders, Remy. Paris hat mich verändert. Die Jahre ohne dich haben mich verändert.«
»Du hattest schon zuvor angefangen, dich zu ändern, Lara. Du warst nicht glücklich und bist deinem Herzen gefolgt. Was ist daran falsch?«
Sie blieb stehen. In ihrem Blick lag Verwunderung. »Keine Vorwürfe? Du bist nicht sauer auf mich?«
Er lachte bitter auf. »Die Zeit steht auch für mich nicht still. Glaub mir, ich war furchtbar wütend auf dich, habe nicht verstanden, warum du mich so kurz nach unserer Verlobung verlassen hast. Doch auch ich habe mich verändert, genau wie du.«
Ein Grübchen zeigte sich auf ihrer Wange. Dieses Grübchen hatte er ganz vergessen. Wie hatte er es vergessen können? Wie hatte er einen Teil ihres Gesichtes vergessen können?
»Was ist mit deinem Vater? Gibt es Neuigkeiten?«, fragte sie nach einiger Zeit des Schweigens.
»Ich möchte nicht darüber reden.«
»So schlimm?«
»Warum bist du zurückgekommen? Bist du Paris etwa leid geworden?«
»Nein, ich … ich bin geschäftlich in der Stadt.«
»Geschäftlich?«
Sie nickte. »Du weißt schon, dieser ganze langweilige Kunstkram, der dich nie interessiert hat.«
»Er interessiert mich jetzt.«
Ihr Blick wurde wieder ernst. »Dein Interesse kommt zu spät, Remy. Ich werde nicht hierbleiben.«
Er nickte schwach. Das hatte er vermutet. Was war schon seine Liebe gegen ihre Liebe zur Kunst? Dagegen kam er nicht an, das war ja nichts Neues.
Schweigend schlenderten sie über die verwaisten Wege. Nur hier und da kam ihnen ein anderer Spaziergänger entgegen, den Kragen gegen die eisigen Windböen hochgeklappt, die Schultern hochgezogen. Sie mussten sich nicht abstimmen, welchen Weg sie einschlugen. Sie beide wurden magisch von einem Punkt angezogen, an den Lafayette auch nach Laras Abreise immer wieder zurückgekehrt war.
Laubreste tanzten im Wind über die Bethesda Terrace. Lafayette wollte Lara die Stufen hinunterhelfen, doch sie wehrte ab. Auf ihren Gehstock gestützt, den Blick starr auf den Brunnen gerichtet, stieg sie Stufe für Stufe hinab.
»Wie ist das passiert? Das mit deinem Fuß?«
»Ich war tollpatschig.« Vor Schmerz verzog sie das Gesicht, doch als er ihr helfen wollte, schlug sie seine Hand fort. »Ich kann das alleine. Ich bin bloß über eine Staffelei gestolpert und gestürzt. Das ist alles. Bitte, Remy, wir müssen das nicht weiter thematisieren.«
Er hob die Hände. »Schon verstanden.«
Der Brunnen war trockengelegt und ohne das gewohnte Plätschern lag eine nahezu unheimliche Still über der Terrasse. Beinahe ehrfürchtig schritten sie auf den Engel zu, der sich oberhalb des Brunnes über den Platz erhob. Einige Tauben saßen auf seinen Schwingen, hatten die Köpfe unter die Flügel gesteckt und trotzten dem Wind ebenso hartnäckig wie die Statue selbst.
Ein paar Meter vor dem Brunnen blieben sie stehen. Wenn es für Lafayette einen heiligen Ort gab, dann war es dieser. Der Engel, der segnend die Hand ausstreckte, das Herz des Parks, eine Oase der Ruhe inmitten der umtriebigen Stadt.
Lara verschränkte die Arme vor der Brust und Lafayette bemerkte ihr Zittern. Obwohl auch er fror, zog er seinen Mantel aus und legte ihn ihr um die Schultern
»Danke«, sagte sie. »Weißt du noch, als wir uns hier zum ersten Mal begegnet sind? Wir waren so jung.«
Acht Jahre war das nun her. Acht lange Jahre, seit er sie damals in ihrem gestreiften Sommerkleid gesehen hatte. Sie hatte mit ihren Freundinnen in einem Ruderboot gesessen und immer wieder zu ihm herübergeblickt. Er konnte sich an blonde Strähnen erinnern, die sich aus ihrer Hochsteckfrisur gelöst hatten und mit denen sanft der Wind spielte. An ihre vor Freude geröteten Wangen, an ihr befreites Lachen und ihre blauen Augen, die ihn spielerisch anfunkelten.
»Du hast mich binnen Sekunden verzaubert«, erwiderte er. »An dem Tag wollte ich nur eins: dich kennenlernen.«
Sie lachte. »Das hast du ziemlich geschickt angestellt. Anna spricht heute noch davon, wie du dir die Schuhe und Socken ausgezogen, die Hosenbeine hochgekrempelt hast und ins Wasser gewatet bist. Du warst so …«
»Penetrant?« Er grinste. »Aufdringlich?«
Wieder lachte sie und kleine Fältchen bildeten sich um ihre Augen. »Aufmerksam. Du hast eine Narzisse vom Ufer gepflückt und sie mir zum Boot gebracht. Es hat dich gar nicht interessiert, dass du bald bis zur Hüfte im Wasser standest und deine Hose völlig durchnässt war.«
»Das war es mir wert.«
Sie nickte. »Ich weiß.«
Schweigend betrachteten sie den Brunnen.
»Er ist so wunderschön«, flüsterte sie. »Ich habe in Paris keinen vergleichbaren Ort gefunden, obwohl die Stadt so viele Jahrhunderte älter ist. Meinst du, er wird auch anderen Menschen so viel bedeuten wie uns?«
Lafayette hatte keine Antwort auf diese Frage. Er schwieg und betrachtete Lara, die den Engel im Blick behielt. Eine Träne bahnte sich einen Weg über ihre Wange, eine weitere folgte. Er zog sein Stofftaschentuch aus der Westentasche und reichte es ihr.
Dankbar nahm sie es an sich, tupfte sich die Augen und betrachtete das Tuch. »Das hast du noch?«, fragte sie. Ihre Finger strichen behutsam über das eingestickte Monogramm. R.L.
»Natürlich«, antwortete er. »Du hast es mir geschenkt.«
Sie humpelte die letzten Meter zum Brunnen und ließ sich auf dem Rand nieder. Lafayette setzte sich neben sie. Er war sich nicht sicher, wie viel Abstand zwischen ihnen angemessen war, und so entschied er sich, lieber eine Handbreit weiter entfernt von ihr Platz zu nehmen.
»Was hast du vor dem Revier gemacht?«
»Ich habe auf dich gewartet.«
»Du sagtest doch, du wolltest mich nicht sehen.«
»Ich habe nicht gesagt, dass ich dich nicht sehen wollte.« Sie seufzte. »Du solltest mich nicht sehen.«
»Warum warst du dort, Lara?«
»Ich musste mich vergewissern, dass es dir gutgeht. Das ist alles. Ich wäre dir gar nicht aufgefallen, wenn nicht der junge Officer mit diesem gigantischen Vogelkäfig aufgetaucht wäre – wofür soll der eigentlich gut sein? Er hat mir leidgetan, also wollte ich ihm schnell helfen. Dass du ausgerechnet in dem Moment die Treppe herunterkommst, konnte ich ja nicht ahnen.«
»Du hättest dich vor mir versteckt?«
Sie zögerte einen Augenblick, knetete das Taschentuch zwischen ihren Fingern. »Ich hätte nicht, Remy. Ich habe.«
»Was heißt das?«
»Ich war heute nicht zum ersten Mal dort. In unserer Wohnung wohnt ja heute jemand anderes. Deshalb habe ich in den letzten Wochen oft vor dem Revier auf dich gewartet, doch du kamst nicht. Ich dachte schon, du arbeitest dort nicht mehr … Aber heute warst du plötzlich da.«
»Moment – was soll das heißen in den letzten Wochen? Wie lange bist du schon hier?«
»Ist das von Bedeutung?«
»Lara!«
Sie schluckte. »Ungefähr vier Monate. Nicht ganz.«
Lafayette stieß hörbar die Luft aus und stand auf. Er fuhr sich durchs Haar und schritt wie ein Tiger im Käfig vor ihr auf und ab. »Vier Monate, Lara? Vier Monate! Und du hältst es nicht für nötig, einmal Hallo zu sagen?«
»Es tut mir leid. Ich wollte keine alten Wunden aufreißen.«
»Und das entscheidest du?« Er fühlte, wie die Hitze in seine Wangen schoss. »Du entscheidest, dass meine Wunden verheilt sind? Du entscheidest das?« Er schnaubte. »Aber das war ja immer deine Stärke, nicht wahr? Entscheidungen ganz allein zu treffen. Auch wenn andere darunter leiden müssen.«
Sie presste die Lippen aufeinander; alles Blut wich aus ihnen. Ihre Hand ballte sich um das Taschentuch zur Faust.
Er stöhnte, rieb sich mit der Hand über die Augen und ließ sich wieder neben ihr nieder. »Entschuldige. Das war gemein.«
»Ich schätze, das habe ich verdient«, sagte sie leise. »Ich wusste nicht, wie ich dir gegenübertreten soll, ob ich dir in die Augen sehen kann.«
Er sah sie an und sie erwiderte den Blick.
»Du kannst«, sagte er.
Eine Weile blieb es still zwischen ihnen. Dann fragte er: »Bist du glücklich, Lara?«
»Glücklich? Inwiefern?«
»Na, mit den Entscheidungen, die du getroffen hast. Mit deiner Arbeit, mit deinem Leben in Paris. Bist du glücklich damit?«
»Glück ist ein so großes Wort. Eine Illusion, nichts weiter.«
»Was sagst du denn da?« Er rückte noch ein Stück von ihr ab. »Wo ist dein Kampfgeist, wo ist deine Lebensfreude geblieben? Wo ist die Frau, die ich einmal kannte?«





























