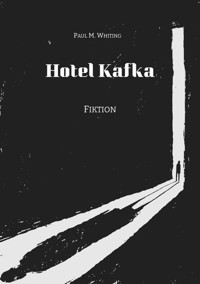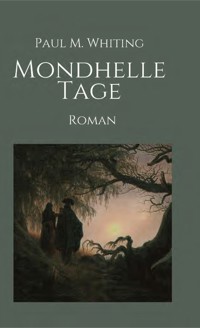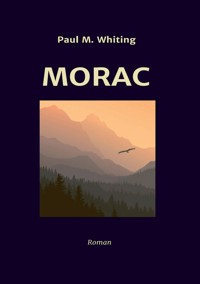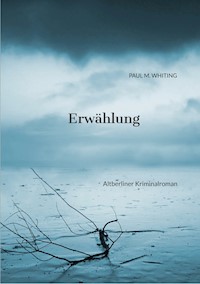
5,99 €
Mehr erfahren.
Die Berliner Oberschicht ist in Aufruhr: Zum zweiten Mal innerhalb von wenigen Wochen ist ein zahlender Kunde des Rotlichtviertels erstochen aufgefunden worden. Polizei-Inspektor Johann Baptist von Arnaud tappt zunächst im Dunkeln, bis ein junger Adeliger, dem es durch einen Sprung in die nächtliche Spree gelungen ist, dem Täter zu entkommen, bei Arnaud ein überraschendes Geständnis ablegt. Indessen hat die Polizeidirektion, der Skandale überdrüssig, mit einem Großaufgebot der Gendarmerie den Bordellbetrieb faktisch lahmlegen lassen. Arnaud, der seine Bemühungen, an den Täter heranzukommen, zunichte gemacht sieht, wendet sich an den Kammergerichtsrat E. T. A. Hoffmann, der sich eine raffinierte Falle ausdenkt, um den Mörder aus der Deckung zu locken—was ihm dann auch gelingt, aber anders als geplant.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 163
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
vom selben Autor:
MORAC
MONDHELLE TAGE
Paul M. Whiting
Erwählung
Altberliner Kriminalroman
© 2022 Paul M. Whiting
Umschlag: Paul M. Whiting unter Verwendung eines Fotos von © Jaroslaw Grudzinski (shutterstock)
ISBN Softcover: 978-3-347-48814-4
ISBN Hardcover: 978-3-347-48815-1
ISBN E-Book: 978-3-347-48816-8
Druck und Distribution im Auftrag des Autors: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg, Germany
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter: tredition GmbH, Abteilung "Impressumservice", Halenreie 40-44, 22359 Hamburg, Deutschland.
Some are born to sweet delight,
Some are born to endless night.
-William Blake, “Auguries of Innocence”
Als ihr Todestag zum zwölften Male wiederkehrte, stand Arnaud eine Stunde früher auf als gewöhnlich, wusch sich das Gesicht und ließ sich von seinem Diener Antoine rasieren und ankleiden, um nach seinem üblichen Frühstück, bestehend aus einer Tasse Tee und einem Croissant, seine Wohnung in der Schützenstraße zeitig zu verlassen. Es war dieselbe Dreizimmerwohnung, die er zwölf Jahre zuvor im geräumigen Friedrichsstädter Patrizierhaus einer Tuchhändlerwitwe bezogen hatte. Der Besitzerin, einer Frau Mathilde Bailleu, hatte ihr Gatte bei seinem unerwarteten Ableben ein ansehnliches Vermögen hinterlassen; dennoch hatte sie nach seinem Tod das Bedürfnis gespürt, das Haus, das sie nun mit ihrer Dienerschaft allein bewohnte, zumindest ansatzweise wieder mit Leben zu füllen, indem sie einen Teil der Zimmer zur Vermietung anbot. Arnaud, dem die großzügig geschnittene Bel-Étage-Wohnung in der Behrenstraße nach dem Tod seiner Frau wie ein Geisterhaus vorgekommen war, hatte ohne lange Überlegung die Gelegenheit ergriffen, sich zu verkleinern, und war mit seinem Diener unter das Dach von Madame Bailleu gezogen. Von dort aus waren es nur wenige Schritte zu seinem Dienstsitz beim Polizeipräsidium in der Wilhelmstraße.
Arnaud verließ das Haus, bog links in die Jerusalemer Straße ein und lief quer über den Dönhoffschen Platz am Palais Hardenberg vorbei auf die Spittelbrücke zu. Der Morgen war noch kalt, aber der leicht faulige Geruch, der vom Festungsgraben her wehte, war bereits von einem ersten zaghaften Frühlingshauch unterwandert. Langsam regte sich in den Straßen das Leben: Fenster wurden geöffnet, hölzerne Läden zurückgeklappt, erste Karren rumpelten schwerfällig über die Pflastersteine. Arnaud mochte diese frühen Stunden, wenn das ungebärdige Riesenkind Berlin noch im Halbschlaf die Glieder reckte und lauthals gähnte. Die preußische Residenzstadt war zu schnell gewachsen, um wirklich zivilisiert zu sein. In den letzten hundert Jahren hatte sie sich verdreifacht; dabei hatte sie alle Grenzen gesprengt, war über die Festungsgräben gewuchert, hatte die Schutzwälle hinter sich gelassen und breitete sich wie Quecken weithin in der Fläche aus. Unter den drei deutschen Großstädten nahm sie bereits den zweiten Platz ein, aber anders als die gesitteten Konkurrentinnen Wien und Hamburg hatte sie bei ihrem ungestümen Wachstum nie Zeit gehabt, das zu entwickeln, was die anderen beiden auszeichnete: ein eigener Charakter. Berlin war Zwitter geblieben, halb Athen, halb Sparta, Kind einer zweifelhaften Mesalliance von Geist und Gehorsam. Es war die Stadt Humboldts, Fichtes und Schleiermachers, aber auch Blüchers, Scharnhorsts und Gneisenaus; es gab die Charité, die Universität und die Akademie der Wissenschaften, aber auch die Kasernen, die Exerzierplätze, die Zeughäuser und Pulvertürme. Unter den Linden flanierten modisch gekleidete Bürger zwischen Alleebäumen, die in Reih und Glied stramm standen, als würden sie jeden Augenblick einen Truppenaufmarsch erwarten. Berlin war im Grunde eine einzige Garnison: nirgends sonst in Europa sah man so viele Uniformierte auf den Straßen, und selbst der Volksmund war nachhaltig vom rauen Kasernenhofton unterwandert.
Arnaud hatte indessen die kleine Spittelkirche umrundet und überquerte den Marktplatz. Auf dessen linker Seite, im Schutz hochgiebeliger Bürgerhäuser, hatte ein Blumenhändler seine Bude aufgeschlagen. Ein Mädchen mit grüner Kittelschürze stand am Ladenfenster und schaute erwartungsvoll auf, als Arnaud sich näherte.
‚Morjen der Herr. Der Herr wünschen?‘
‚Ich hätte gern einen Strauß Lilien. Zwölf Stück.‘
Ein Hauch von Verunsicherung huschte über ihr Gesicht. ‚Ick weeß nicht, ob so viel da sind. Ick geh man kieken.‘ Einen Augenblick verschwand sie im Halbdunkel des Verschlags. Als sie wiederkam, erkannte Arnaud sofort, dass sie keine gute Nachricht für ihn hatte.
‚Bedaure sehr. Nur noch sieben Stück.‘
‚Dann nehme ich die sieben.‘
‚Ick könnte den Herrn ‘n bissjen Myrte zubinden. Det macht sich hübsch zu de weißen Blüten, und der Strauß sieht nach mehr aus.‘
‚Wie du meinst. Du wirst es schon richtig machen.‘
Das Mädchen errötete flüchtig und wendete sich ab. Offenbar war sie es nicht gewohnt, von Kunden Freundliches zu hören, dachte Arnaud. Sie war noch jung, höchstens dreizehn oder vierzehn. Ob Céline jetzt auch so aussehen würde, wenn sie gelebt hätte? Er konnte sich nur mit Mühe an ihr Aussehen erinnern. Ihre Bekanntschaft hatte immerhin nur wenige Tage gedauert.
Von seinem Standort aus konnte Arnaud schemenhaft erkennen, wie das Mädchen an einem Holztisch im Innenraum der Bude hantierte. Kurze Zeit später kehrte sie mit dem fertig gebundenen Strauß zurück. Zwischen den Stängeln der Lilien waren Zweige mit dunkelgrünen, fett glänzenden Blättern eingearbeitet.
‚Ist‘s recht so, der Herr?‘
‚Das hast du gut gemacht. Was bekommst du dafür?‘
‚Acht Groschen.‘
Arnaud holte eine Münze aus seiner Geldbörse und legte sie ihr in die Hand. Sie kramte in der Tasche ihrer Schürze nach Wechselgeld.
‚Schon gut‘, sagte er, vielleicht etwas zu schnell. ‚Der Rest ist für dich.‘
Das Mädchen hörte auf, in ihrer Tasche zu wühlen, und schaute freudig überrascht zu ihm hoch. Arnaud fiel auf, dass ihr ein Schneidezahn fehlte.
‚Lieben Dank, der Herr.‘
Er wendete sich ab und ging. Nein, so würde Céline bestimmt nicht aussehen, das stand fest. Schon die Augen, dieses preußische Wasserblau. Warum konnte er sich an die Augenfarbe seiner Tochter nur ungenau erinnern? Er hatte sie bestimmt einmal mit offenen Augen gesehen. Aber bei Säuglingen ist die Augenfarbe ohnehin nur vor- läufig. Sie hätte bestimmt die klugen kastanienbraunen Augen ihrer Mutter geerbt, wenn sie gelebt hätte.
Arnaud überquerte wieder den Festungsgraben und bog scharf links in die Neue Kommandanten- straße ein, vorbei an den niedrigen, einförmigen Kasernenbauten, die das Straßenbild prägten, bis er die kleine, eher unscheinbare Französische Kirche an der Einmündung der Lindenstraße erreichte. Damals, als er noch mit Marie in der Behrenstraße gewohnt hatte, waren sie mit größter Selbstverständlichkeit sonntags zum Gottesdienst in den Französischen Dom am Gendarmenmarkt gegangen. Da jedoch der Dom keinen eigenen Friedhof besaß, hatte Arnaud eine Grabstelle in dem kleinen Friedhof gegenüber den Kasernen gekauft, wo auch schon seine Eltern und seine Großeltern ihre letzte Ruhestätte gefunden hatten. So lange war es nämlich her, dass seine Familie preußisch geworden war. Sein Urgroßvater, Guillaume François Arnaud, war Uhrmachermeister und Instrumentenbauer in Grenoble gewesen, bis das Edikt von Fontainebleau, welches den französischen Protestanten die Ausübung ihres Glaubens verbot, ihn dazu bewog, mit seiner Familie und allem, was sie auf der Flucht mitnehmen konnten, ihre Heimat zu verlassen. Unter Gefahr ihres Lebens waren sie über Val d’Isère geflohen bis in die Schweiz und dann weiter über die deutsche Grenze nach Baden. Dort hatte er sich in Villingen niedergelassen und bis zu seinem Tod sein Handwerk wieder ausgeübt. Seinen Sohn jedoch, Arnauds Großvater Étienne Marcel, einen umtriebigen Geist, der aufgrund einer gewissen angeborenen Schneidigkeit gute Kontakte zu ausländischen Offizieren pflegte, zog es wieder in die Ferne, nach Brandenburg, wo der soeben zum König avancierte Kurfürst die begehrten hugenottischen réfugiés mit bedeutenden Privilegien nach Berlin zu locken trachtete. Der Großvater begriff schnell, was ein Staat benötigt, der gerade dabei ist, eine Armee von europäischem Format aufzubauen, und gründete eine Manufaktur für Vermessungsinstrumente, wie sie beim Militär verwendet werden. Dank seiner Kontakte zur Militärverwaltung und der Verfügbarkeit gut ausgebildeter französischer Arbeiter, die inzwischen ebenfalls den Weg nach Berlin gefunden hatten, brachte er es am Ende zum Königlich Preußischen Hoflieferanten und durfte sich ab 1782 von Arnaud nennen. Mit diesem schönen Namenszusatz ausgestattet war sein Sohn, Johann Philipp von Arnaud, zur Armee gegangen, wurde als Leutnant verabschiedet und durfte ein paar Jahre im Kriegsministerium seine Pfründe in Ruhe genießen, bis auch er das Zeitliche segnete. Dass sein älterer Sohn Charles Louis im sogenannten Befreiungskrieg sein Leben fürs Vaterland opferte, empfand der stolze Vater eher als Krönung einer Karriere, die ganz und gar dem Militärdienst gewidmet war. Was ihn weitaus eher betrübte, war die Weigerung seines jüngeren Sohnes, Johann Baptist, über den verpflichtenden Grunddienst hinaus irgendetwas mit dem Militärwesen zu tun zu haben. Stattdessen war der junge Arnaud in den Polizeidienst getreten, was der betresste Vater als schmählichen Abstieg empfand. Als Offizier, hoch zu Ross und aus sicherer Entfernung Befehle zu erteilen, die Hunderten das Leben kosten konnten, das war für seine Begriffe ein edles und ehrendes Handwerk. Ein Polizei-Commissarius habe es dagegen mit dem Auswurf der Gesellschaft zu tun, mit Dieben, Dirnen, Betrügern und Totschlägern; das war seiner Meinung nach etwas Unreines, vergleichbar mit der Tätigkeit eines Feldschers oder Abdeckers. Umsonst hatte Arnaud versucht, seinem Vater klarzumachen, dass er keineswegs dem Soldatischen abgeschworen habe, nur weil er kein Soldat geworden sei. Im Gegenteil, er, der KöniglichPreußische Polizei-Inspektor Johann Baptist von Arnaud, sah sich als Fähnrich der Rechtlichkeit im Kampf gegen eine feindliche Macht, die von unten her die Zivilisation allzeit und allerorts bedrohte. Dass er in den Kabinettskriegen des Hochadels nichts als den blutigen Auswuchs von Ruhmsucht und Eitelkeit erkennen konnte, behielt er lieber für sich. Dennoch blieb das Verhältnis zwischen Sohn und Vater bis zu dessen Tod angespannt.
Der Grabstein, den er suchte, stand nur wenige Schritte vom Eingang entfernt. Es war nicht zu übersehen, dass der kleine Friedhof bald keinen Platz mehr haben würde, frisch entstandener Trauer eine Heimstätte zu bieten. Egal, dachte Arnaud; für ihn würde der Platz noch reichen, und nach ihm wäre die Geschichte der preußischen Arnauds ohnehin zu Ende. Dem Steinmetz war es gelungen, mit wenigen Schriftzügen in schnörkelloser Garamond die ganze Tragödie seines Lebens in den Stein zu meißeln: Marie Clémence von Arnaud née Delacroix, geb. d. 3. Sept. 1784, gest. d. 25. März 1809; und gleich darunter: Céline Marie von Arnaud, geb. 19. März 1809, gest. 28. März 1809. Arnaud bückte sich und legte die mitgebrachten Blumen auf den Platz vor dem Grabstein. Es war ihm bewusst, dass er an dieser Stelle Trauer empfinden und ein Gebet sprechen sollte, in dem er sich ehrfürchtig vor der Allmacht und Güte Gottes verneigte. Aber mit jedem Jahr, das sich zwischen ihn und seinen Verlust schob, war ihm ein Stück Trauer gleichsam abhan-dengekommen. Was der Tod ihm nicht genommen hatte, raubte ihm anscheinend die Zeit; immer weniger gelang es ihm, das Gefühl des Verlustes in Erinnerung zu rufen. So wurde ihm nach und nach auch noch das Letzte genommen, was ihm von seinem einstigen Lebensglück übriggeblieben war.
Die Kirchglocken hatten schon halb neun verkündet, als Arnaud wieder den Dönhoffschen Platz erreichte. Daher zog er es vor, eine Droschke herbeizuwinken, die ihn in munterem Trab durch die Leipziger Straße zu seinem Dienstsitz im Polizeipräsidium in der Wilhelmstraße brachte. Dort wurde er, kaum dass er das Gebäude betreten hatte, von einem diensteifrigen Boten abgepasst: ‚Herr Inspektor! Verzeihen Sie, Herr Inspektor! Der Herr Polizeipräsident wünscht Sie umgehend zu sprechen!‘
Arnaud wunderte sich lediglich, dass der Herr Polizeipräsident zu dieser vergleichsweise frühen Stunde bereits anwesend war. Paul Louis Le Coq war im zwölften Jahr Präsident, und nicht wenige seiner Untergebenen hofften inständig, dass es sein letztes Amtsjahr werden würde. Obwohl hugenottischer Abstammung wie er selber, fehlte Le Coq die protestantische Gewissenhaftigkeit, die dieses Volk so oft auszeichnete. Vielmehr setzte er alles daran, sich nach oben zu empfehlen, beim Staatskanzler den Eindruck zu hinterlassen, er sei unermüdlich im Dienst des Rechtsstaates engagiert, während er in Wirklichkeit dem untergeordneten Polizeiapparat, angefangen bei den vier Inspektoren bis hin zum einfachen Sergeanten, die Kärrnerarbeit der Strafverfolgung überließ. Lediglich auf dem Gebiet der politischen Zensur, die seit einigen Jahren in seiner Zuständigkeit lag, hatte er sich hervorgetan, wohl zu Recht vermutend, dass Seiner Königlichen Majestät die wenigen Berliner Freigeister wesentlich ungeheurer waren als die vielen Taschendiebe und Schlagetots, die die Gassen seiner Residenz unsicher machten.
Die Diensträume des Präsidenten lagen im ersten Stock. Dort wurde Arnaud gebeten, im Vorzimmer Platz zu nehmen, bis er beim Herrn Präsidenten angemeldet sei. Außer ihm saß noch ein junger Mann im Straßenanzug im Vorzimmer. Als Arnaud zu ihm herüberschaute, lächelte dieser unsicher wie zum Gruß. Er hatte einen ungewöhnlich schmalen, länglichen Kopf, dessen Form durch lange Koteletten noch betont wurde, sowie tiefliegende, stechend blaue Augen. Arnaud überlegte, aus welchem Anlass der junge Mann hier vorgeladen war. Sein zuckendes Fingerspiel deutete auf innere Nervosität hin, doch sah er mitnichten wie ein Delinquent aus; im Gegenteil, er schien sich in gewisser Weise zu freuen, hier zu sein.
Endlich erschien der Bürovorsteher wieder in der Tür. Zu Arnauds Überraschung forderte er beide Anwesenden auf, ihm zu folgen.
Polizeipräsident Paul Le Coq saß hinter seinem großen, aus dunkel gebeiztem Nussbaumholz gefertigten Schreibtisch und tat so, als ob er in die Lektüre eines ihm vorliegenden Schriftstückes versunken wäre. Mit seinem zierlichen, von eng anliegenden feinen Locken umrahmten Kopf und seinen weichen, fast femininen Gesichtszügen ähnelte er verblüffend just jenem Korsen, der erst vor wenigen Jahren wie ein Orkan über Europa hinweggefegt war. Möglicherweise kultivierte der preußische Hugenotte bewusst dieses eigenartige Geschenk der Natur in Erinnerung an die überragende Bedeutung, die er aufgrund seines diplomatischen Geschicks und seiner Sprachkenntnisse während der französischen Besetzung Berlins genossen hatte. Dagegen war seine jetzige Stellung als Polizeipräsident, fernab der großen Politik, fast schon eine Demütigung, und der eitle kleine Mann ließ seine Untergebenen dies spüren durch die nachlässige Art, mit der er sie abfertigte.
‚Bon jour, Arnaud‘, sagte er, fast ohne ihn anzuschauen. ‚Eine schlechte Nachricht für Sie. Schon wieder ein Mord im fünften Revier.‘
Arnaud verstand sofort, was der Polizeipräsident ihm damit sagen wollte. Das fünfte Revier umfasste die südlichen Bezirke von Alt-Kölln. Von der Spree abgetrennt, drängten sich hier die Häuser dicht an dicht. Zeugung, Geburt und Sterben, alles lag hier näher beieinander als anderswo. Hier befand sich auch die berüchtigte Spenglergasse, das Viertel der Dirnen und Zuhälter, ein sagenumwobenes Reich, das erst nach Einbruch der Dunkelheit wie aus dem Nichts entstand und mit dem ersten schüchternen Strahl des Tages wieder in der Tiefe verschwand. Dass im Morgengrauen gelegentlich ein Toter zum Vorschein kam und behördlich erfasst werden musste, war an sich keine Seltenheit; denn wie sollte man in diesem Viertel alt werden? Vor rund drei Wochen war jedoch der Falsche gestorben, ein Herr aus den sogenannten besseren Kreisen, einer von denen, die nur besuchsweise und im Schutz der Dunkelheit in die Untiefen der Spenglergasse hinabstiegen. Dass Le Coq ihn wegen eines erneuten Mordfalls eigens zu sich zitierte, konnte nur die Bedeutung haben, dass sich dieser Vorfall wiederholt hatte.
‚Das Opfer ist Neffe eines Wirklichen Geheimen Rates. Mehr muss ich Ihnen nicht sagen. Eine alsbaldige Klärung des Falles wird erwartet.‘
‚Wo befindet sich jetzt die Leiche?‘
Le Coq schaute ihn an, als ob er ihn nicht verstanden hätte. ‚Ich wüsste nicht, was das für eine Rolle spielt.‘
‚Ich möchte den Leichnam in Augenschein nehmen. Die Art der Verletzung kann unter Umständen Aufschluss über den Täter geben.‘
‚Man hat das Opfer in das Leichenhaus des Luisenkirchhofs gebracht.‘ Le Coq zögerte, dann fügte er hinzu: ‚Sehen Sie zu, Arnaud, dass Sie kein Aufsehen erregen.‘
‚Sehr wohl, Herr Präsident. Sie hören von mir.‘ Arnaud wandte sich zum Gehen ab.
‚Klein Moment bitte.‘
Arnaud fiel in dem Augenblick auf, dass Le Coq den jungen Mann, der mit ihm zusammen den Raum betreten hatte, bislang mit keinem Wort erwähnt hatte.
‚Ich darf vorstellen—Polizei-Inspektor Johann Baptist von Arnaud, Kriminalassessor Carl Ephraim Böhm. Der Kriminalassessor bereitet sich auf die höhere Laufbahn in der Polizeiverwaltung vor. Ich habe mir überlegt, ihn in der gegenwärtigen Angelegenheit Ihnen zur Verstärkung zeitweilig zuzuteilen.‘
‚Sehr wohl, Euer Wohlgeboren. Sie hören von…uns.‘ Er drehte sich um und verließ das Dienstzimmer. Im Rücken spürte er, dass Böhm ihm stumm gefolgt war.
Das waren gleich zwei schlechte Nachrichten. Hätte man eine Dirne mit durchgeschnittener Kehle oder einen Loddel mit eingeschlagenem Schädel in der Gosse gefunden, hätte kein Hahn danach gekräht. Aber wenn es der feinen Kundschaft an den Kragen ging, gerieten die hohen Herren in Aufregung, denn wer könnte ihnen garantieren, dass nicht einer von ihnen als Nächster an die Reihe käme? Jetzt sollte er, Arnaud, gleich zwei Morde aufklären in einem Milieu, in dem Schweigen die erste Bürgerpflicht war. Und dass ihm dieser junge Schlaks an die Seite gestellt worden war, konnte nur die Bedeutung haben, dass man ihm an höherer Stelle nicht ganz traute und deswegen einen subalternen Aufpasser an die Fersen heftete.
Kaum hatten sie die Räumlichkeiten des Präsidiums verlassen, erwachte Böhm aus seiner Erstarrung. ‚Verzeihen Sie, Herr Inspektor, wenn mein Verhalten auf Sie irgend unhöflich gewirkt hat. Es war die Anwesenheit des Polizeipräsidenten, die mir die Zunge lähmte, sonst hätte ich Ihnen gegenüber gleich zum Ausdruck gebracht, wie geehrt ich mich fühle, ja, welche Freude es mir bereitet, das polizeiliche Handwerk von einem Mann lernen zu dürfen, dessen Ruf in Fachkreisen…‘
Arnaud legte seine Hand begütigend auf Böhms Arm. ‚Ist gut‘, sagte er, ‚lassen wir’s dabei. Zunächst einmal muss ich aufpassen, dass Sie mir nicht unter die Räder kommen. Unsere Arbeit ist nicht ungefährlich. Ich möchte Sie unversehrt wieder abgeben.‘
Sie hatten indessen das Gebäude verlassen und waren in die Leipziger Straße eingebogen.
‚Darf ich Euer Wohlgeboren etwas fragen?‘
‚Sie dürfen das „Wohlgeboren“ weglassen, Böhm. Wir sind jetzt Kollegen entre nous. Und fragen dürfen Sie jederzeit. Auch ohne vorherige Genehmigung. Fragen sind unser wichtigstes Werkzeug.‘
‚Sehen Sie? Da habe ich bereits etwas von Ihnen gelernt.—Also, wo gehen wir jetzt hin?‘
‚Zum Luisenkirchhof. Wir wollen uns die Leiche des Opfers näher anschauen. Ich hoffe, der Umgang mit Leichen bereitet Ihnen keine Unannehmlichkeiten? Sie sind leider unsere häufigsten Gesprächspartner.‘
Böhm antwortete nicht gleich. Dann sagte er zögernd: ‚Wenn ich ganz ehrlich sein soll, Herr Inspektor…einen Toten habe ich noch nie aus der Nähe gesehen.‘
‚Dann wird es für Sie höchste Zeit.‘
╬ ╬ ╬
Der Luisenkirchhof war—wie schon der Name vermuten ließ—der älteste der Luisenstadt. Unweit des Eingangs befand sich das Leichenhaus, in dem die Toten unter Aufsicht bis zum Begräbnis aufbewahrt wurden. Ursprünglich war diese Sitte dem Umstand geschuldet, dass die Ärzteschaft nicht immer zweifelsfrei zu erkennen vermochte, ob jemand tatsächlich tot war oder nicht. Um verfrühte Bestattungen auszuschließen, wurden die für leblos Erklärten mehrere Tage aufgebahrt, bis es als sicher galt, dass sie ihre Seele endgültig ausgehaucht hatten. Mittlerweile galt diese Vorsichtsmaßnahme als überflüssig, doch mit dem sprunghaften Bevölkerungswachstum wurde es für ärmere Familien—und das waren die weitaus meisten—zunehmend problematisch, ihre Verstorbenen zu Hause zu behalten, bis alle Verwandten Gelegenheit gefunden hatten, sich von ihnen zu verabschieden. So hatten die Leichenhäuser der Friedhöfe nach und nach eine neue Funktion erhalten.
Arnaud meldete sich beim Friedhofswärter an, der ihm bereitwillig das Leichenhaus aufschloss. Der Raum, der von vier hoch angesetzten Bogenfenstern beleuchtet wurde, war vollkommen leer bis auf die sechs steinernen Tische, auf denen die Toten aufgebahrt wurden. Zurzeit waren nur zwei besetzt: vorne lag ein junges Mädchen, dessen wächsernes Gesicht eine fast jenseitige Ruhe ausstrahlte, und weiter hinter ein Mann mittleren Alters. Arnaud fasste Böhm, der unwillkürlich bei dem Mädchen stehengeblieben war, am Arm und zog ihn sanft zu dem männlichen Leichnam hin.
‚Das ist unser Mann‘, sagte er zu seinem Assistenten. ‚Gestern um diese Zeit weilte er noch unter den Lebenden—Friede seiner Seele! Sie dürfen ihn jetzt entkleiden.'
‚Wie meinen Sie?‘, fragte Böhm verwirrt.
‚Wir wollen uns die Leiche anschauen. Mortui vivos docent. Sie sind doch Lateiner? Jeder Mord ist etwas ganz Persönliches—fast wie eine Handschrift. Man muss nur die Zeichen lesen lernen.‘