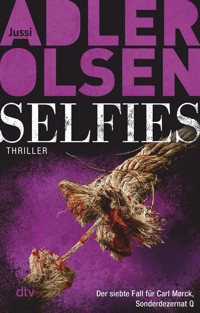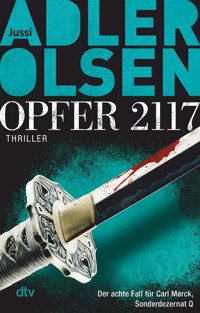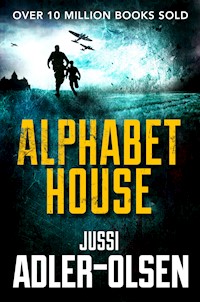9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Carl-Mørck-Reihe
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Ein obdachloser Teenager. Ein Teufel in Menschengestalt. Ein erbitterter Kampf ums Überleben. Der fünfte Fall für Carl Mørck und das Sonderdezernat Q der Kopenhagener Polizei für Cold Cases »Marco zitterte am ganzen Körper. Er zwang sich, ruhig und gleichmäßig zu atmen. Ihre Schritte kamen immer näher, er konnte hören, wie sie fluchten. Aber so wütend sie auch klangen, Marco hörte vor allem eines heraus: Angst.« Die große skandinavische Bestseller-Reihe – spannender geht es nicht Marco ist fünfzehn und hasst sein Leben in einem Clan, dessen Mitglieder von ihrem gewalttätigen Anführer Zola in die Kriminalität gezwungen werden. Als er flieht, stößt er ganz in der Nähe von Zolas Wohnsitz auf eine Männerleiche ... Die Suche nach dem Mörder führt Kriminalkommissar Carl Mørck, Assad und Rose tief hinein in das Netzwerk der Kopenhagener Unterwelt, in den Sumpf von Korruption und schweren Verbrechen in Politik und Finanzwelt – und zieht seine Kreise bis in den afrikanischen Dschungel. »Jussi Adler-Olsen gilt als Meister der skandinavischen Thriller.« Welt am Sonntag »Ein Page-Turner im besten Sinne des Wortes.« hr-online.de »Was mir an Jussi Adler-Olsen vor allem gefällt, ist die Mischung aus Humor, Spannung und Tiefgang.« Luzia Stettler ›SRF 1‹ Neben der Carl-Mørck-Reihe sind bei dtv außerdem folgende Titel von Jussi Adler-Olsen erschienen: - ›Das Alphabethaus‹ - ›Das Washington-Dekret‹ - ›Takeover‹ - ›Miese kleine Morde‹
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 745
Ähnliche
Der fünfzehnjährige Marco ist Mitglied eines Clans, an dessen Spitze sein Onkel, der eiskalte, zynische Zola steht. Zola verdient ein Vermögen damit, die Mitglieder seines Clans in die Kriminalität zu zwingen. Marco ist klug, fleißig, und er verabscheut sein Leben, das aus Bettelei, Taschendiebstahl und Einbruch besteht. Und er hasst seinen Onkel, der in der Kopenhagener Unterwelt ein mächtiges Netzwerk unterhält. Als Marco eines Tages entdeckt, dass die Familie ihn zum Krüppel machen will, bleibt ihm als einziger Ausweg die Flucht. Dabei stößt er auf eine Männerleiche und wird hineingezogen in ein Verbrechen ungeheuren Ausmaßes …
Die Suche nach dem Mörder führt Carl, Assad, Rose und Gordon, den Neuen im Sonderdezernat Q, mitten hinein in einen Fall, in dem es um Korruption und schwere Verbrechen auf Regierungsebene geht und der sich bis nach Afrika ausdehnt.
Jussi Adler-Olsen
Erwartung
Der Marco-Effekt
Der fünfte Fall für Carl Mørck,Sonderdezernat Q
Thriller
Aus dem Dänischenvon Hannes Thiess
Gewidmet meiner Schwiegermutter,
Anna Larsen
Prolog
Herbst 2008
Der letzte Morgen im Leben von Louis Fon begann wie ein sanftes Flüstern.
Er rieb sich die Augen, richtete sich schlaftrunken von der Pritsche auf, tätschelte die Kleine, die ihm die Wange gestreichelt hatte, wischte ihr den Rotz von der Nase und steckte die Füße in die Flipflops auf dem gestampften Lehmboden.
Blinzelnd reckte er sich. Der von der Sonne gewärmte Raum war erfüllt vom Gackern der Hühner und den entfernten Rufen der Jungs, die Bananenbüschel von den Stauden schnitten.
Wie friedlich, dachte er und atmete tief den würzigen Geruch des Dorfes ein. Nur der Gesang der Baka-Pygmäen auf der anderen Seite des Flusses, wenn sie um das Feuer tanzten, konnte ihn mehr erfreuen. Wie immer war es ein gutes Gefühl, in das Dja-Reservat und nach Somolomo, das entlegene Dorf der Bantus, zurückzukehren.
Hinter der Hütte rauften die Kinder miteinander und wirbelten rötlichen Staub auf, ihre schrillen Stimmen ließen einen Schwarm Webervögel von den Baumkronen aufsteigen.
Louis ging zum Fenster, durch das die Sonnenstrahlen fielen, stützte die Ellbogen aufs Fensterbrett und lächelte der Mutter des Mädchens zu, die vor der gegenüberliegenden Hütte stand und einem Huhn den Kopf abhackte.
Es war das letzte Lächeln im Leben des Louis Fon.
Gute zweihundert Meter entfernt tauchte ein drahtiger Mann auf dem Weg am Palmenhain auf, und ein Gefühl von nahendem Unheil beschlich Louis. Mbomos sehnige Gestalt kannte er aus Jaunde, aber den hellhäutigen Mann mit dem schlohweißen Haar, der ihn begleitete, hatte er noch nie gesehen.
»Was will Mbomo hier, und wen hat er da bei sich?«, rief er der Mutter des Mädchens zu.
Die zuckte nur die Achseln. Am Rand des Dja-Reservats waren Touristen kein ungewöhnlicher Anblick, was also scherte es sie? Vier, fünf Tage mit den Baka im undurchdringlichen Dickicht des Regenwalds – darum ging es den meisten doch, oder? Jedenfalls den Europäern mit gut gefüllter Brieftasche.
Aber Louis ahnte, dass etwas nicht stimmte. Das sah er an den ernsten Mienen der beiden Männer und an der Vertraulichkeit zwischen ihnen. Nein, dieser Weiße war kein Tourist, und Mbomo hatte ohne Vorankündigung in diesem Distrikt nichts zu suchen. Schließlich war er, Louis, der Leiter des dänischen Hilfsprojekts – Mbomo hingegen war nur ein Laufbursche für die Geschäftsleute in Jaunde. So waren die Spielregeln.
Hatten die beiden dort unten am Weg etwas am Laufen? Auf die Idee konnte man ja leicht kommen. In letzter Zeit hatte es allerlei Schwierigkeiten rund um das Projekt gegeben: Die Vorgänge zogen sich zunehmend in die Länge, der Informationsfluss war ins Stocken geraten, die Zahlungen gingen zu spät ein oder blieben völlig aus. Das alles entsprach ganz und gar nicht dem, was man ihm versprochen hatte, als er für die Aufgabe angestellt worden war.
Louis schüttelte den Kopf. Er selbst gehörte zu den Bantu, er stammte aus einer Region Kameruns, die Hunderte Kilometer nordwestlich von diesem Dorf hier lag. Dort oben, wo er herkam, wurde einem das Misstrauen allen und allem gegenüber in die Wiege gelegt, und das war letztlich vielleicht der Grund, weshalb Louis sich mit so viel Herzblut für die Baka, die Pygmäen des Dja-Reservats, engagierte. Diese sanften Menschen, die Wörter wie »Misstrauen« nicht kannten und deren Wurzeln bis tief in jene Zeit zurückreichten, als der Wald entstanden war, stellten für Louis die letzten Oasen wahrer Menschlichkeit in einer verfluchten Welt dar. Ja, die Verbundenheit mit den Baka und mit dieser Gegend im Grasland unten am Kongo war Louis’ Lebenselixier, sein Trost. Und dennoch schlich sich in diesem Moment das Misstrauen ein.
Konnte man denn nirgendwo Frieden finden?
Mbomos Geländewagen parkte hinter der dritten Hüttenreihe. Der Chauffeur im durchgeschwitzten Fußball-Shirt schlief hinterm Steuer.
»Sucht Mbomo nach mir, Silou?«, fragte Louis den massigen Mann, als der sich schließlich reckte und zu überlegen schien, wo zum Teufel er war.
Aber der schüttelte den Kopf. Offenbar hatte er keine Ahnung, wovon Louis redete.
»Wer ist der Weiße, den Mbomo mitgebracht hat? Kennst du ihn?«
Der Chauffeur gähnte.
»Ist er Franzose?«
»Nein«, antwortete der Mann achselzuckend. »Der spricht zwar ein bisschen Französisch, aber ich glaube, der kommt eher oben aus dem Norden.«
»Okay.« Langsam wurde er nervös. »Könnte er Däne sein?«
Der Chauffeur deutete mit dem Zeigefinger auf ihn.
Bingo.
Däne also. Nein, das verhieß nichts Gutes.
Wenn Louis nicht für die Zukunft der Pygmäen kämpfte, dann kämpfte er für die Tiere des Waldes. Jedes einzelne Dorf rings um den Dschungel der Pygmäen brachte unaufhörlich junge Bantus mit Gewehren hervor, denen täglich Dutzende Mandrills und Antilopen zum Opfer fielen.
Obwohl das Verhältnis zwischen diesen Jägern und Louis stets ein wenig angespannt war, scheute er sich jetzt nicht, eine Mitfahrgelegenheit auf einem ihrer Motorräder durch den Busch anzunehmen. Drei Kilometer auf schmalen Pfaden zum Dorf der Baka in nur sechs Minuten: Wer konnte da Nein sagen, wenn die Zeit knapp war?
Als die ersten Lehmhütten auftauchten, wusste Louis bereits, was geschehen war, denn ihm kamen nur kleine Kinder und hungrig bellende Hunde entgegen.
Louis fand den Pygmäenhäuptling auf einem Lager aus Palmblättern, umhüllt von schwerem Alkoholdunst. Rings um den halb bewusstlosen Mulungo lagen die leeren Whiskeytüten, die man auf der anderen Seite des Flusses bekam. Das Trinkgelage hatte zweifellos die ganze Nacht gedauert, und der Stille nach zu urteilen, hatten so gut wie alle Einwohner des Dorfs daran teilgenommen.
Er steckte den Kopf in die überfüllten Hütten und sah nur wenige Erwachsene, die überhaupt in der Verfassung waren, ihm träge zuzunicken.
So macht man sich Völker gefügig, dachte er.
Dann ging er zurück zu der muffig riechenden Häuptlingshütte und schüttelte Mulungo unsanft. Der zuckte leicht zusammen, und ein schuldbewusstes Lächeln gab den Blick auf nadelspitze Zähne frei. Aber so leicht war Louis nicht zu versöhnen.
Vorwurfsvoll deutete er auf die leeren Whiskeytüten.
»Wofür habt ihr Geld bekommen, Mulungo?«
Der Häuptling der Baka hob fragend den Kopf. Das Wort »wofür« war hier draußen im Busch nicht besonders verbreitet.
»Mbomo hat euch doch Geld gegeben. Wie viel hat er euch zugesteckt?«
»Zehntausend Francs«, kam prompt die Antwort. Exakte Summen – besonders in dieser Größenordnung – waren hingegen etwas, wofür sich die Baka durchaus interessierten.
Louis nickte. Mbomo, dieser Idiot, warum tat er das?
»Zehntausend also«, sagte er. »Und wie oft kriegt ihr die?«
Mulungo zuckte die Achseln. Was war schon Zeit im Denken und Leben der Baka.
»Wie ich sehe, habt ihr die neue Saat noch nicht ausgebracht. Warum nicht? Das war doch abgesprochen.«
»Das Geld ist nicht gekommen, Louis, das weißt du doch.«
»Wie bitte? Ich habe die Überweisungsbelege doch mit eigenen Augen gesehen. Die Zahlung wurde vor über einem Monat angewiesen.«
Was war denn da los? Stimmten bereits zum dritten Mal die Belege nicht mit den tatsächlichen Geldflüssen überein?
Louis hob den Kopf. Hinter dem Sirren der Zikaden vernahm er plötzlich ein Geräusch. Ein Motorrad, wenn er sich nicht täuschte.
Vielleicht war Mbomo ja schon unterwegs? Vielleicht kam er, um ihm eine Erklärung für diese Sauerei zu liefern. Na, da war er mal gespannt.
Er sah sich nach allen Seiten um. Nein, völlig klar, hier stimmte etwas nicht. Aber das würden sie rasch wieder in Ordnung bringen. Louis jedenfalls fürchtete Mbomo nicht, auch wenn der mindestens einen Kopf größer war und Arme hatte wie ein Gorilla. Wenn die Baka nicht auf seine Fragen reagierten, dann musste Mbomo sich äußern: Was trieb er hier? Wohin war das Geld verschwunden? Warum hatten sie noch nicht mit der Aussaat begonnen? Und wer war dieser weiße Mann, der ihn begleitet hatte?
Mit diesen Fragen würde er Mbomo konfrontieren, noch ehe dieser vom Motorrad abgestiegen war, und deshalb stellte er sich mitten auf den Platz und wartete, während sich die Staubwolke über dem Buschland langsam den Hütten näherte. Und falls Mbomo tatsächlich Gelder unterschlagen hatte, die den Baka zustanden und die ihre Existenz hier im Wald sichern sollten, würde er ihm mit Feuer und Hölle drohen – oder ihn ins Kondengui-Gefängnis bringen.
Kondengui – allein der Name stand für Angst und Schrecken.
Dann plötzlich übertönte Motorenlärm den Zikadengesang, und eine Kawasaki knatterte laut hupend auf den Platz. Louis stach sofort die schwere Kiste auf dem Gepäckträger ins Auge. Binnen weniger Sekunden regte sich in den Hütten ringsum Leben. Schlaftrunkene Gesichter erschienen in jeder Türöffnung, ein paar der Männer sprangen heraus, angelockt offenbar von dem schwappenden Geräusch, das aus der Kiste drang.
Mbomo drückte den Männern die Whiskeytüten in die Hände und warf Louis dabei einen feindseligen Blick zu. Auf seinem Rücken blitzte eine Machete.
Im selben Moment wusste Louis, was die Stunde geschlagen hatte. Er musste weg. Sofort. Denn die Pygmäen würden ihm sicher nicht zu Hilfe kommen, nicht in ihrem momentanen Zustand.
»Ich kann jede Menge Nachschub besorgen«, rief Mbomo, während er die restlichen Tüten auslud. Dann drehte er sich abrupt zu Louis um.
Louis rannte los, hinter sich die jubelnden Schreie der Baka. Seine Augen suchten das Dickicht ab nach Schlupflöchern oder zumindest nach irgendwelchen liegengelassenen Werkzeugen der Baka, die sich zur Verteidigung eigneten.
Louis bewegte sich im Urwald weitaus routinierter als Mbomo, der sein Leben lang in Douala und Jaunde gewohnt und nicht gelernt hatte, sich vor dem tückischen Wurzelgeflecht am Boden, vor unsichtbaren Löchern und Ameisenhaufen in Acht zu nehmen. Und so fühlte Louis sich schon beinahe sicher, als hinter ihm das Geräusch der schweren Schritte allmählich leiser wurde und sich vor ihm das Labyrinth der Nebenpfade hinunter zum Fluss auftat.
Er musste unbedingt vor Mbomo zu einer der Pirogen gelangen und über den Fluss setzen. Am anderen Ufer, in Somolomo, wäre er in Sicherheit. Die Leute dort würden ihn beschützen.
Ein faulig-feuchter Geruch hing im braungrünen Buschwerk, und als erfahrener Dschungelführer hätte Louis das Zeichen eigentlich erkennen müssen. Nur noch hundert Meter bis zum Fluss, dachte er – und im selben Moment steckte er bis zu den Knien im Sumpf.
Panisch versuchte er, eine der Pflanzen in seiner Nähe zu fassen zu bekommen. Viel Zeit blieb ihm nicht: Gleich würde sich der Morast über ihm schließen – und das Trampeln klang plötzlich wieder beängstigend nah.
Die Augen weit aufgerissen, holte er tief Luft, presste die Lippen aufeinander und machte sich so lang, dass die Wirbelkörper knackten. Endlich bekam er etwas zu fassen, kleine Zweige brachen ab, Blätter peitschten ihm ins Gesicht – doch er hatte die Liane fest in den Händen und zog sich mit aller Kraft aus dem Sumpf. Das Ganze hatte nur wenige Sekunden gedauert, aber es waren ein paar Sekunden zu viel. Ein Rascheln im Buschwerk, und der Machetenhieb drang tief in sein Schulterblatt. Blitzschnell und brennend.
Mit Mühe hielt sich Louis auf den Beinen und strauchelte weiter. Bloß raus aus dem Sumpf. Hinter sich hörte er Mbomo fluchen. Auch er war offenbar in den Morast geraten, jedenfalls wurden seine Flüche langsam leiser und verhallten schließlich in den Baumwipfeln.
Doch als Louis das rettende Flussufer erreichte, übermannte ihn der Schmerz, und er spürte, dass sein Hemd nicht nur vom Schlamm am Rücken klebte.
Schlagartig verließen ihn die Kräfte, und er sackte in sich zusammen. Jetzt wusste er, dass er sterben würde.
Während er langsam vornüberkippte und sich der Ufersand mit seinem Haar vermischte, bemühte er sich verzweifelt, sein Handy aus der Hosentasche zu ziehen, um mit letzter Kraft eine Nachricht zu senden.
Jeder Buchstabe, den er eintippte, wurde begleitet von einem rasenden Herzschlag, mit dem Blut aus seinem Körper gepumpt wurde. Als er seine SMS geschrieben und auf Senden gedrückt hatte, registrierte er schwach, dass kein Funkkontakt bestand.
Das Letzte, was Louis Fon spürte, waren schwere Schritte in nächster Nähe. Und wie ihm das Mobiltelefon aus der Hand gewunden wurde.
***
Mbomo Ziem war zufrieden. Das Geholpere des Jeeps über die dunkelrote, von Schlaglöchern übersäte Dschungelpiste bis zur Abzweigung der Hauptstraße nach Jaunde war bald überstanden. Der Mann neben ihm hatte es zum Glück unterlassen, die Ereignisse zu kommentieren. Und Louis Fons Leiche trieb im Fluss, die Krokodile würden den Rest übernehmen.
Alles war nach Plan verlaufen. Die einzige Person, die ihnen hätte gefährlich werden können, war eliminiert. Die Zukunft lag wieder in hellem Licht vor ihnen.
Mission accomplished, sagte man nicht so?
Mbomo sah auf das Mobiltelefon, das er dem sterbenden Louis abgenommen hatte. Ein paar Francs für eine neue SIM-Karte – die würde ja nicht die Welt kosten –, und schon hätte er ein Geburtstagsgeschenk für seinen Sohn.
Er stellte sich gerade dessen strahlendes Gesicht vor, als plötzlich das Display aufleuchtete und signalisierte, dass wieder Funkkontakt bestand.
Sekunden später zeigte die typische kleine Tonfolge an, dass soeben eine SMS abgeschickt worden war.
1
Herbst 2008
René E. Eriksen war nie ein übermäßig vorsichtiger Typ gewesen. Vielleicht hatte es deshalb in seinem Leben Niederlagen und Siege in unvorhersehbarer Abfolge gegeben. Dennoch war er, wenn er dieses Leben in seiner Gesamtheit betrachtete, mit dem Resultat recht zufrieden. Letztlich war das Glück doch immer auf seiner Seite gewesen.
Trotzdem zählte René sich zu den bedachtsamen Menschen. Schon als kleiner Junge hatte er bei großen und kleinen Problemen gern hinter der Schürze seiner Mutter Schutz gesucht. Und irgendwie hatte sich das fortgesetzt, auch als Erwachsenem war es ihm stets gelungen, eine Hintertür offenzuhalten, wenn er sich in Neues stürzte.
Aus diesem Grund hatte er auch reiflich überlegt, als ihn an jenem Nachmittag sein guter Freund und früherer Klassenkamerad Teis Snap, Direktor der Karrebæk-Bank, in seinem Büro im Außenministerium angerufen und ihm einen Vorschlag unterbreitet hatte. Einen Vorschlag, den ein Mann in Renés gehobener Position unter normalen Umständen als völlig inakzeptabel verworfen hätte.
Die Bankenkrise hatte gerade begonnen, ihr hässliches Gesicht zu zeigen: Es war die Zeit, in der sich die Konsequenzen aus dem fatalen Zusammenspiel von gieriger Börsenspekulation und verantwortungsloser Wirtschaftspolitik messerscharf abzeichneten.
Genau das war auch der Grund für Teis Snaps Anruf gewesen.
»Die Karrebæk-Bank ist in zwei Monaten insolvent, wenn wir nicht umgehend zusätzliches Kapital beschaffen«, hatte er damals unumwunden gesagt.
»Und was ist mit meinen Aktien?« Die Frage war René unwillkürlich herausgerutscht, als er mit deutlich erhöhtem Puls an sein Pensionärsdasein erster Klasse unter südlichen Palmen dachte, das ihm versprochen worden war. Ein Traum, der nun wie ein Kartenhaus in sich zusammenzufallen drohte.
»Tja, was soll ich dir sagen? Wenn wir nicht schnellstens Geldzuflüsse organisieren, verlieren wir alles. So sieht es aus«, antwortete Teis Snap.
Die nun folgende Pause war eine Pause unter Freunden. Eine dieser Pausen, in der es keine Möglichkeit für Protest oder theoretische Einwände gab.
René senkte den Kopf und atmete so tief durch, dass es wehtat. Das also war die Realität. Und von dieser Realität ausgehend, galt es nun zu überlegen und zu handeln. Natürlich rebellierte sein Magen, und natürlich bildeten sich Schweißperlen auf seiner Stirn. Aber als Leiter des Evaluierungsbüros für Entwicklungshilfe innerhalb des Außenministeriums hatte er gelernt, in Stresssituationen Ruhe zu bewahren.
»Zusätzliches Kapital, sagst du? Was bedeutet das? Geht das bitte etwas präziser?«
»Über die Summe, die insgesamt benötigt wird, will ich mich hier nicht auslassen, wir sondieren gerade in mehrere Richtungen. Aber um mal eine Hausnummer für dich zu nennen: zweihundert bis zweihundertfünfzig Millionen Kronen über vier bis fünf Jahre.«
René spürte, wie ihm der Schweiß in den Kragen lief. »Verdammt, Teis, das sind fünfzig Millionen im Jahr!«
»In der Tat. René, wir haben in den letzten vier Wochen zig Rettungspläne erarbeitet und keine Option ausgelassen, aber unsere Schuldner sind nun mal nicht in der Lage, ihre Kredite zu bedienen. Ja, okay, wir haben in den letzten Jahren zu schnell zu viele Darlehen ohne ausreichende Sicherheiten gewährt. Jetzt, da der Immobilienmarkt am Boden liegt, ist uns das allen klar. Aber gerade nützt uns diese Erkenntnis nichts mehr.«
»Verdammt, können wir nicht wenigstens noch unsere persönlichen Anteile verkaufen?«
»Dafür ist es zu spät, fürchte ich. Der Kurs unserer Aktie ist noch mal drastisch gefallen, und zwischenzeitlich wurde sie ganz aus dem Handel genommen.«
»Und was genau willst du von mir?« René merkte selbst, wie kalt seine Stimme auf einmal klang. »Was soll ich da tun? Du rufst ja nicht nur an, um mir zu sagen, dass du mein Vermögen verschleudert hast. Wie viele Schäfchen hast du eigentlich in der Zwischenzeit selbst ins Trockene gebracht? Komm schon, Teis, ich kenne dich doch.«
Sein alter Freund klang gekränkt, aber klar. »Nichts, René, absolut nichts. Ehrenwort. Die Wirtschaftsprüfer sind dazwischengekommen. Und leider sind nicht alle von denen in Notsituationen für kreative Lösungen zu haben. Nein, ich rufe an, weil ich glaube, einen ersten Ausweg gefunden zu haben. Einen Ausweg, der im Übrigen auch für dich recht lukrativ sein könnte.«
So hatte der Betrug begonnen. Inzwischen waren etliche Monate vergangen, und alles hatte ausgezeichnet funktioniert … bis vor einer Minute plötzlich William Stark, sein erfahrenster Mitarbeiter, vor ihm gestanden und mit einem Blatt Papier gewedelt hatte.
»Okay, William«, sagte René Eriksen. »Sie sagen also, dass Sie von Louis Fon eine konfuse SMS erhalten und anschließend vergeblich versucht haben, Kontakt mit ihm aufzunehmen. Aber Sie wissen so gut wie ich, dass Kamerun sehr weit weg ist und die Telefonverbindungen oft zu wünschen übrig lassen. Wie kommen Sie darauf, dass ihm etwas zugestoßen sein soll?«
Stark sah ihn bekümmert an. Und urplötzlich stieg ein ungutes Gefühl in René Eriksen auf – fast so etwas wie Panik vor einer bevorstehenden Katastrophe.
Oberregierungsrat Stark presste seine Lippen zusammen. Er senkte den Kopf und blickte zu Boden. Seine roten Haare fielen ihm in die Stirn und verdeckten die Augen. »Ich habe diese konfuse SMS etwa zu der Zeit erhalten, als Sie von Kamerun zurückgeflogen sind. Seither wurde Louis Fon nicht mehr gesehen. Von niemandem.«
»Hm. Aber wie gesagt gerade im Dja-Reservat, wo Fon unterwegs ist, sind doch die Telefonverbindungen hundsmiserabel.« René Eriksen streckte den Arm über den Schreibtisch. »Zeigen Sie mir mal, was in dieser SMS steht, William.«
Stark reichte ihm den Zettel mit der Nachricht, und René Eriksen gab sich größte Mühe, die Hand ruhig zu halten.
Dann las er:
Cfqquptiondae(s+l)la(i+l)ddddddvdlogdmdntdja.
Mit dem Handrücken wischte er sich über die feuchte Stirn. Das war ja der reinste Nonsens, Gott sei Dank.
»Sie haben recht, Stark, das sieht wirklich merkwürdig aus. Aber das allein finde ich jetzt noch nicht beunruhigend. Wahrscheinlich hat das Handy in Fons Hosentasche gesteckt, und er hat vergessen, die Tastatur zu sperren.« Er legte den Zettel vor sich auf den Schreibtisch. »Lassen Sie mal, ich kümmere mich selbst darum, ich werde jemanden bitten, einen Blick darauf zu werfen. Obwohl da sicher nichts ist: Mbomo Ziem und ich hatten in Somolomo noch am selben Tag Kontakt mit Louis Fon. Als wir nach Jaunde gefahren sind. Alles war wie immer. Er hat sich gerade auf seine nächste Expedition vorbereitet. Irgendwelche Deutschen, glaube ich.«
William Stark schüttelte den Kopf, die Sorge war ihm anzusehen.
»Gut, Sie sagen, ich soll mich nicht weiter darum kümmern. Aber schauen Sie sich die Nachricht doch noch mal genau an. Meinen Sie wirklich, die hat sich selbst versendet – und endet rein zufällig mit dem Wort ›Dja‹? Nein, ich glaube, Louis Fon wollte mir etwas mitteilen, irgendetwas Ernstes. Ganz ehrlich: Ich fürchte, dass ihm etwas zugestoßen ist.«
René Eriksen atmete tief durch. Er wusste, wie wichtig es in seiner Position war, in jeder noch so absurden Situation seinen Mitarbeitern gegenüber verbindlich zu bleiben.
»Nein, nein, Sie haben natürlich recht. Die Sache ist schon merkwürdig«, antwortete er deshalb ruhig und griff nach seinem Sony Ericsson, das hinter ihm auf der Fensterbank lag. »›Dja‹ steht da, sagen Sie.« Er blickte prüfend auf die Handytastatur und nickte. »Na ja, ich finde, das könnte durchaus zufällig zustande gekommen sein. Schauen Sie mal! D, J und A sind jeweils die ersten Buchstaben ihrer Taste. Man muss nur einmal aus Versehen auf die Tasten 3, 5 und 2 kommen, und schon steht da ›dja‹. Also, wenn Sie mich fragen, kann das schon mal passieren, wenn man die Tastatur nicht sperrt. Lassen Sie uns vielleicht noch ein paar Tage abwarten, ob Louis nicht wieder auftaucht. Ich werde es derweil über Mbomo versuchen.«
Als William Stark sein Büro verließ, sah René Eriksen ihm nach, bis sich die Tür hinter ihm geschlossen hatte, dann wischte er sich den Schweiß von der Stirn. Herr im Himmel! Das war also Louis Fons Handy gewesen, mit dem Mbomo neben ihm im Landrover auf dem Rückweg in die Hauptstadt herumgespielt hatte. Was für ein verdammter Idiot!
Er ballte die Fäuste und schloss für einen Moment die Augen. Wie konnte man nur so bescheuert sein, einer Leiche das Handy zu klauen! Dabei hatte er noch nach dem Handy gefragt. Warum hatte Mbomo da nicht zugegeben, dass es von Louis stammte? Und warum hatte dieser Trottel nicht sofort überprüft, ob auf dem Handy Mitteilungen lagen, die noch nicht abgeschickt waren? Wieso hatte er nicht sofort den Akku herausgenommen und den Speicher vollständig geleert?
Er schüttelte den Kopf. Mbomo war ein Schwachkopf. Aber im Augenblick war nicht er das Problem, sondern William Stark. Nein, im Grunde war er das schon die ganze Zeit. Hatte er, René, das im Übrigen nicht von Anfang an zum Ausdruck gebracht? Auch Teis Snap gegenüber?
So eine verdammte Scheiße! Keiner war so blitzgescheit und hatte einen solchen Überblick über die Absprachen und die Budgets der Abteilung wie William Stark. Und keiner war so sorgfältig bei der Evaluierung der Projekte des Außenministeriums. Wenn es also jemanden gab, dem etwas auffallen konnte, dann war er das.
René Eriksen holte tief Luft und dachte über die nächsten Schritte nach. Die Möglichkeiten standen nicht unbedingt Schlange.
Falls du in dieser Geschichte jemals Probleme bekommen solltest, hatte Teis Snap gesagt, dann ruf an, und zwar umgehend.
Eriksen nahm sein Handy und wählte.
2
Herbst 2008
Es gab nicht viele Kollegen, an die sich Oberregierungsrat William Stark in fachlichen Fragen wenden konnte. Im grauen Ozean der Behörde war er so etwas wie der Verwalter eines Inselchens, das anzusteuern nicht viele Lust hatten. Wen konnte er also ansprechen, wenn – wie in diesem Fall – sein direkter Vorgesetzter nicht in Frage kam? Im Grunde gab es nur noch den Staatssekretär. Aber wer wandte sich schon mit einem Verdacht dieser Art und vor allem dieser Größenordnung an den Staatssekretär, wenn er keine greifbaren Beweise vorlegen konnte? Er jedenfalls nicht.
Denn in der Behörde hatten rangniedere Mitarbeiter, die auf eigene Initiative hin Alarm schlugen wegen des Verdachts auf Unregelmäßigkeiten oder sogar Amtsmissbrauch, den Spitznamen »Whistleblower«. Das klang freundlicher, als es gemeint war. Jedenfalls konnte es Mitarbeitern, die zu genau und hartnäckig nachfragten, recht übel ergehen im Dänemark dieser Tage. So wie erst jüngst einem Mitarbeiter des militärischen Nachrichtendiensts, der eine Gefängnisstrafe erhielt, weil er nachgewiesen hatte, dass der Staatsminister der Bevölkerung elementare Informationen verschwiegen und auf dieser Grundlage sein Land in den Irakkrieg geführt hatte. So etwas beförderte nicht unbedingt die Lust auf Transparenz.
Außerdem war sich Stark seiner Sache nicht hundertprozentig sicher, das Ganze war bisher nur ein Gefühl, wenn auch ein hartnäckiges.
Nachdem er seinen Vorgesetzten, den Ministerialdirektor René E. Eriksen, über Louis Fons SMS informiert hatte, hatte er mindestens zehn Telefonate mit verschiedenen Personen in Kamerun geführt, die seines Wissens in Kontakt zu Fon standen. Sie alle hatten sich tatsächlich höchst verwundert gezeigt, dass es seit Tagen kein Lebenszeichen von diesem zuverlässigen Bantu-Aktivisten gab.
Am Vormittag war es Stark endlich gelungen, eine Verbindung zu Fons Frau in Sarki Mata herzustellen, die immer wusste, wo sich ihr Mann gerade aufhielt.
Sie bestätigte sofort Starks Verdacht und erzählte von ihrer Befürchtung, dass womöglich Jäger ihren Mann erwischt haben könnten. Der Regenwald war groß und gefährlich, das war allen Menschen klar, die dort lebten, auch William Stark. Und deshalb war er nach dem Telefonat alles andere als beruhigt.
Natürlich konnte es diverse Gründe geben, warum sich Louis Fon nicht meldete. Kamerun bot viele Versuchungen, und wer wusste schon, was einem Mann im besten Alter, der auch noch einigermaßen gut aussah, einfallen mochte? Warum sollte Louis Fon nicht in irgendeiner Hütte liegen, sich die Seele aus dem Leib huren und die Welt draußen sich selbst überlassen?
Aber dann dachte er wieder an die zurückliegenden Ereignisse, bevor sich diese neue Situation überhaupt ergeben hatte. Daran, wie das Baka-Projekt begonnen hatte und wie die erste Phase verlaufen war. Daran, wie urplötzlich und per Eilantrag eine Summe von jährlich fünfzig Millionen durch das Ministerium bewilligt worden war, um die Existenz der Pygmäen in einem so weit entfernten Gebiet wie dem Dja-Reservat zu sichern. Alles sehr sonderbar: Warum gerade dieses Volk und kein anderes? Und warum so hohe Geldbeträge?
Doch ja, William Stark hatte von Anfang an seine Zweifel gehabt.
Natürlich waren zweihundertfünfzig Millionen auf fünf Jahre verteilt keine Summe, die bei einem Auslandsbudget von fünfzehn Milliarden pro Jahr besonders auffiel. Und dennoch: Wann hatte man zum letzten Mal so viel Geld in ein regional so eng begrenztes Projekt gepumpt? Mit einer so massiven Finanzspritze hätte man wahrscheinlich sämtliche Pygmäenstämme im gesamten Kongobecken schützen können.
Nachdem die Summe einmal beschlossene Sache war, hätte jeder Idiot im Amt mit verbundenen Augen erkennen können, dass in mehreren Punkten vom regulären Prozedere abgewichen wurde. Stark war sofort hellhörig geworden: Man hatte sich bis vor Kurzem tatsächlich damit begnügt, einem Geschäftsmann in Jaunde Geld zu überweisen, das der dann vor Ort zu verteilen hatte. Und das in einem Land, das zu den korruptesten der Welt gehörte.
William Stark war Beamter aus Überzeugung, wenn auch mit einigen Verfehlungen im Lebenslauf. Doch die Entwicklungen der letzten Tage ließen ihn seinen Chef mit sehr wachen Augen beobachten.
Hatte René E. Eriksen jemals zuvor ein so großes persönliches Engagement gezeigt? Wann hatte er eigentlich zuletzt eine Reise angetreten, um höchstselbst in Augenschein zu nehmen, wie sich ein Projekt vor Ort entwickelte? Das war Ewigkeiten her.
Doch dann durchfuhr es Stark: Konnte nicht auch gerade Eriksens plötzliches Engagement der Beweis dafür sein, dass alles korrekt lief, aber eben einer sorgfältigen Kontrolle bedurfte? Stark seufzte. Das eine war genauso möglich wie das andere. Und er wusste nur zu gut, was da alles aufgewühlt werden konnte … Nein, das durfte nicht geschehen. Schon zu seiner eigenen Sicherheit.
»Hey, Stark, was sitzen Sie hier und brüten?«, hörte er unerwartet eine Stimme hinter sich.
Es lag Monate zurück, dass sich sein Vorgesetzter in seinem Büro hatte blicken lassen. Stark sah René Eriksen erstaunt an. Er wurde nicht wirklich schlau aus dessen seltsam freundlichem Gesichtsausdruck.
»Ich habe gerade mit unseren Kontaktpersonen in Jaunde gesprochen, und denen geht es wie Ihnen«, sagte Eriksen. »Irgendetwas stimmt da nicht, sagen die. Sie liegen also mit Ihren Annahmen ganz richtig. Die Leute da unten halten es für durchaus denkbar, dass sich Louis Fon mit einem Teil des Geldes abgesetzt hat. Deshalb bitten sie darum, dass jemand hier aus dem Ministerium runterfliegt und vor Ort sämtliche Zahlungsflüsse im Rahmen des Projekts überprüft, und zwar von Anfang an. Natürlich wollen die Leute dort so rasch wie möglich vom Vorwurf der Veruntreuung entlastet werden.«
»Ich?« William Stark glaubte seinen Ohren nicht zu trauen. Hatte Eriksen tatsächlich die Absicht, ihn nach Afrika zu schicken? Das war nicht gerade eine Entwicklung nach seinem Geschmack. »Was vermutet man denn: Wie viel könnte Louis Fon abgezweigt haben? Wissen Sie das?«
Eriksen schüttelte den Kopf. »Nein, das weiß im Moment niemand. Aber Fon verfügt für den aktuellen Abrechnungszeitraum über zirka zwei Millionen Euro. Vielleicht ist er ja auch nur auf Einkaufstour, und alles ist okay. Vielleicht hat er herausgefunden, dass anderswo Saatgut und Pflanzen billiger oder von besserer Qualität angeboten werden als dort, wo er sonst immer kauft. Aber wir müssen die Angelegenheit unter allen Umständen klären.«
»Hm.« William Stark nickte. »Allerdings fürchte ich, dass ich von dieser Aufgabe Abstand nehmen muss.«
Eriksens Lächeln verschwand. »Aha? Und mit welcher Begründung, wenn ich fragen darf?«
»Das Kind meiner Freundin liegt im Krankenhaus.«
»Aha? Und weiter?«
»Wissen Sie, ich unterstütze sie beide, so gut ich kann. Sie leben bei mir.«
Eriksen nickte. »Dass Sie als Erstes daran denken, ist sehr sympathisch, William. Aber wir sprechen über zwei, drei Tage, da werden Sie doch wohl eine Lösung finden, oder? Wir haben Ihren Gabelflug über Brüssel bereits gebucht. Das ist Teil Ihrer Arbeit. Sie fliegen nach Douala, der Flug nach Jaunde war leider schon ausgebucht. Deshalb holt Mbomo Sie dort am Flughafen ab, und Sie fahren mit dem Auto weiter in die Hauptstadt, das sind dann noch mal ein paar Stunden Fahrtzeit.«
William Stark sah seine Stieftochter in ihrem Krankenhausbett vor sich. Das Arrangement passte ihm überhaupt nicht.
»Muss ich das übernehmen, weil ich Louis Fons SMS empfangen habe?«
»Nein, William. Sie übernehmen das, weil Sie unser bester Mitarbeiter sind.«
***
Mbomo Ziem ging der Ruf eines äußerst zupackenden Mannes voraus. Vor dem Douala International Airport stellte er das gleich unter Beweis, als sechs oder sieben zudringliche Männer nach William Starks Koffer griffen und sich lauthals als Gepäckträger anboten. »Taxi wartet, komm, komm!«, riefen sie und zerrten an seinem Gepäck.
Mit finsterem Blick gelang es Mbomo binnen Sekunden, sie wegzuscheuchen. Er ließ keinen Zweifel daran aufkommen, dass er es notfalls mit ihnen allen gleichzeitig aufnehmen würde, um für seinen Chef ein paar Francs zu sparen.
Er war groß, dieser Mbomo. Stark hatte zwar schon Fotos von ihm gesehen, aber nur solche, auf denen er neben den kleinen Baka stand, und neben denen wirkten alle erwachsenen Nicht-Pygmäen wie Riesen. Doch auch in der Realität ragte dieser Mann wie ein Fels aus der Menschenmenge heraus. In dieser absurden Situation – Männer, die um einen Koffer kämpfen, um sich ein bisschen Geld für eine Mahlzeit zu verdienen – vermittelte Mbomo tatsächlich ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit.
»Sie werden im Aurelia Palace wohnen«, sagte Mbomo, nachdem das Taxi die fluchenden Träger und zwei aufdringliche Schmuckverkäufer abgehängt hatte. »Morgen früh nehmen Sie an einem Treffen im Ministerium teil. Ich hole Sie um neun Uhr ab. Anders als Douala ist Jaunde eine ziemlich sichere Stadt, aber man weiß nie.« Ein lautloses Lachen ließ seinen Oberkörper erbeben.
Die glühende Sonne senkte sich schon über die Baumwipfel. Einheimische liefen in Gruppen am Straßenrand, etliche von ihnen hielten Macheten in ihren müden Händen. William Stark nahm das mit einiger Beunruhigung wahr.
Überfüllte Minitaxen, schnelle Geländewagen, verschrammte Pritschenwagen und ramponierte, schwer beladene Lastwagen mit kaputten Scheinwerfern – sie alle überholten sich unablässig gegenseitig mit waghalsigen Manövern. Dass ein Großteil des Schrotts, der links und rechts am Straßenrand lag, den Fahrzeugen zum Verwechseln ähnelte, erstaunte Stark nicht.
Er fühlte sich sehr weit weg von zu Hause.
Nachdem er vorsichtig sein Essen gewählt hatte, nahm William Stark in einer Ecke der Lounge Platz. Ein Sessel und ein Sofa, dessen Bezug lebhaft an die Siebziger erinnerte, luden zum Sitzen ein. Auf dem Couchtisch standen bereits zwei stark beschlagene Gläser Bier.
»Ja, ich bestelle immer gleich zwei auf einmal, wenn ich hier unten bin«, erklärte ihm sein korpulenter Sitznachbar auf Englisch. »Das Bier ist so dünn, dass es aus den Poren sickert, kaum dass man es runtergespült hat.« Er lachte.
Auf William Starks Halskette mit den beiden kleinen geschwärzten Masken-Anhängern deutend, meinte er: »Ich sehe, Sie sind gerade erst in Afrika angekommen und am Flugplatz gleich ein paar Schmuckhändlern auf den Leim gegangen.«
»Ja und nein.« Stark griff nach dem Schmuck. »Ich bin gerade angekommen, das stimmt, doch die Kette habe ich nicht hier gekauft. Aber Sie haben recht, sie ist afrikanisch. Ich habe sie in Kampala erstanden, wir hatten dort auch mal ein Projekt, das ich inspizieren musste.«
»Ah, Kampala, ja, eine der interessanteren Städte Ugandas.« Er sah William an und erhob sein Glas. Seinem Diplomatenkoffer nach zu urteilen, war der Fremde ebenfalls dienstlich unterwegs.
Stark nahm seine Aktenmappe aus der Ledertasche und legte sie auf den Tisch. Er musste sich jetzt auf seinen Auftrag konzentrieren. Schließlich ging es um den Verbleib von fünfzig Millionen für das Baka-Projekt. Etliche Papiere mussten durchgesehen und eine Reihe von Fragen vorbereitet werden. Er öffnete die Mappe und legte die Unterlagen in drei Stapeln auf den Tisch. Einen mit den Rechnungen, einen mit den Projektbeschreibungen und einen mit diversem Schriftverkehr, Nachrichten und E-Mails. Auch den Zettel mit Louis Fons SMS hatte er mitgenommen.
»Ich hoffe, es stört Sie nicht, wenn ich hier arbeite«, sagte er auf Englisch zu seinem Sitznachbarn. »Oben in meinem Zimmer gibt es nämlich keinen Schreibtisch.«
Der Mann nickte freundlich.
»Dänemark?«, fragte er und deutete auf den Briefkopf mit dem Logo des Außenministeriums.
»Ja. Und Sie?«
»Stockholm.« Er streckte Stark die Hand hin und wechselte ins Schwedische. Sie stellten sich kurz vor.
»Zum ersten Mal in Kamerun?«
Stark nickte.
»Na, dann mal herzlich willkommen«, sagte der Stockholmer und schob sein zweites Glas Bier zu Stark hinüber. »Eines müssen Sie wissen: An die Verhältnisse hier in Kamerun gewöhnt man sich nie ganz. Zum Wohl!«
Sie hoben die Gläser, und der Schwede leerte seins in einem Zug. Mit erhobener Hand signalisierte er dem Kellner sofort, dass er Nachschub wollte. Verbeamtete Alkoholiker waren eine Spezies, die in den warmen Ländern gut gedieh, das wusste Stark. Er hatte genug Mitarbeiter gesehen, die sie entsandt hatten und die in ziemlich übler Verfassung zurückgekommen waren.
»Na, Sie halten mich jetzt womöglich für einen Alkoholiker, aber das bin ich nicht«, sagte der Schwede, als könnte er Starks Gedanken lesen. »Ich tue nur so.«
Diskret deutete er zu einer Ecke, wo zwei Schwarze saßen, bekleidet mit hellen Anzügen.
»Die gehören zu der Firma, mit der ich morgen verhandeln muss. Im Moment beobachten sie mich, und in einer Stunde erstatten sie ihrem Chef Bericht.« Er lächelte. »Es ist nur gut, wenn die glauben, dass ich bei dem Treffen etwas angeschlagen aufkreuze. Unterschätzt zu werden, ist immer von Vorteil.«
»Sie sind Geschäftsmann?«
»Eine Art. Ich schließe Verträge für Schweden ab. Ich bin Controller, und ich bin gut.« Er nickte dem Kellner zu, der die nächste Runde brachte, und erhob dann wieder sein Glas. »Deshalb: Skål!«
Stark versuchte mitzuhalten, aber bei dem Tempo des Schweden, Flüssigkeit aufzunehmen, brauchte er sich keiner Illusion hinzugeben. Gut, dass er nicht dessen Spiel spielen musste. Darauf war sein Magen nicht geeicht.
»Ah, ich sehe, Sie haben eine codierte Nachricht erhalten.« Der Schwede deutete auf den Zettel, der vor Stark lag.
»Tja, ob das so ist, weiß ich nicht. Es handelt sich um eine SMS von einem unserer Kooperationspartner hier vor Ort, der seit einer knappen Woche verschwunden ist.«
»Eine SMS?« Der andere lachte. »Sollen wir um ein Glas Bier wetten, dass ich die Nachricht in weniger als zehn Minuten geknackt habe?«
Stark runzelte die Stirn.
Der Schwede nahm den Zettel, legte sich ein leeres Blatt Papier zurecht, zog sein Nokia-Handy aus der Tasche und platzierte es daneben.
»Das ist sicher kein Code, falls Sie das glauben«, erklärte Stark. »Mit so etwas befassen wir uns im Ministerium nämlich nicht. Aber ehrlich gesagt, wissen wir tatsächlich nicht, was es mit dieser Nachricht auf sich hat. Ob es überhaupt eine ist und warum sie so aussieht.«
»Okay. Die wurde also womöglich unter schwierigen Umständen geschrieben?«
»Vielleicht. Wir können den Mann nicht fragen. Er ist wie gesagt verschwunden.«
Daraufhin nahm der Schwede seinen Stift zur Hand und notierte:
Cfqquptiondae(s+l)la(i+l)ddddddvdlogdmdntdja.
Unter jeden Buchstaben schrieb er, nach einem prüfenden Blick auf seine Handytastatur, einen anderen Buchstaben.
So vergingen ein paar Minuten, dann blickte er auf und sah Stark an.
»Okay, wir gehen also davon aus, dass die SMS unter schwierigen Umständen verfasst wurde. Zum Beispiel im Dunkeln. Wenn die Worterkennungsfunktion nicht aktiviert ist, steht ja jede Taste für mehrere Buchstaben. Taste drei zum Beispiel für D, E und F. Ein Tippen, dann steht da ein D, doppeltes Tippen ein E, dreifaches ein F. Mit noch mehr Tippen kommen die Buchstaben als Großbuchstaben oder auch als Sonderzeichen. Schließlich gibt es noch die Möglichkeit, dass man versehentlich auf die verkehrte Taste drückt, in der Regel wird das die Taste direkt über, neben oder unter der beabsichtigten sein, was zweifellos eine Unmenge an Kombinationsmöglichkeiten ergibt. Aber mir macht so was Spaß. Stoppen Sie doch mal die Zeit.«
Wieder runzelte Stark die Stirn, aber um den anderen nicht zu kränken, nickte er. Wie lange der Schwede brauchte, war ihm völlig egal. Käme er der Lösung des Rätsels näher, würde er ihm auf alle Fälle ein Bier spendieren.
Es schien allerdings doch nicht ganz so einfach zu sein. Aber als sich nach einigem Kombinieren und Berücksichtigen der jeweiligen Nachbartasten andeutete, dass der zweite Buchstabe statt des »F« durchaus ein »O« sein könnte und dass statt des doppelten »Q« möglicherweise ein doppeltes »R« gemeint war – hier lagen sogar beide Buchstaben auf derselben Taste –, da ergab sich mit dem »C« vom Anfang und dem nachfolgenden »uption« auf einmal das Wort »Corruption«.
William Starks Stirnrunzeln vertiefte sich.
Nach einer weiteren Viertelstunde – Stark hatte noch zweimal Bier bestellen müssen – schien der Schwede das Rätsel gelöst zu haben.
»Hm, ja, klingt plausibel«, meinte er mit einem letzten prüfenden Blick auf seine Notizen.
Dann reichte er Stark das Blatt. »Sehen Sie das? Da steht ›Corruption dans l’aide de development Dja‹. Kein ganz korrektes Französisch, aber immerhin. ›Betrug bei der Entwicklungshilfe in Dja‹. Eine meiner leichtesten Übungen.«
Stark lief es eiskalt über den Rücken.
Er sah sich um. Wen observierten die Männer dort in der Ecke eigentlich, seinen Sitznachbarn oder ihn? Und waren da noch andere?
Als der Schwede den Kellner rief, senkte er den Blick auf den Zettel. »Betrug bei der Entwicklungshilfe in Dja«, hatte ihm Fon per SMS mitgeteilt, und seither war er verschwunden.
Stark sah zum Fenster und versuchte, sich gegen die unendliche Schwärze dort hinter den Scheiben zu schützen. Das Gefühl, das sich in diesem Moment in ihm breitmachte, kannte er schon von früheren Geschäftsreisen, aber jetzt fühlte es sich beängstigender an als je zuvor: Er war wahrhaftig sehr weit weg von zu Hause. Viel zu weit.
***
»Was sagst du da, Mbomo?« René E. Eriksen begann zu schwitzen, seine Hand umklammerte den Hörer.
»Ich sage, dass William Stark heute Morgen nicht im Hotel war, als ich ihn abholen wollte. Und eben gerade habe ich erfahren, dass er zurückgeflogen ist.«
»Wie in aller Welt konnte das passieren? Es war verdammt noch mal dein Job, dich um ihn zu kümmern!«
René Eriksen versuchte, sich zu konzentrieren. Die Absprache hatte gelautet, dass Mbomo oder einer seiner Handlanger William Stark am Morgen im Hotel abholen sollte und dass man dann nichts mehr von ihm hören würde. Wo und wie Stark verschwand, war zweitrangig, es musste nur sang- und klanglos vonstattengehen. Und jetzt war Stark plötzlich auf dem Weg zurück nach Dänemark! Was war da passiert? War Stark auf eine Spur gestoßen, womöglich auf eine, die zu ihnen führte?
»Was zum Teufel kann denn seit gestern Abend passiert sein? Ich dachte, du hättest die Situation unter Kontrolle, Mbomo. Stark muss irgendetwas herausbekommen haben.«
»Keine Ahnung«, antwortete Mbomo. Er wusste nicht, dass Eriksen in den letzten Tagen Höllenqualen gelitten hatte bei dem Gedanken, einen weiteren Menschen in den Tod zu schicken – und nun, da er endlich zu der Überzeugung gelangt war, dass es keine Alternative gab, begann der Albtraum von Neuem.
Dennoch war René Eriksen sofort klar, was nun zu geschehen hatte. Mbomo musste nicht nur vom Baka-Projekt abgezogen werden, nein, er musste vollständig verschwinden. Dieser Trottel hatte allen nur Unglück gebracht. Und: Er wusste zu viel.
»Ich melde mich wieder bei dir, Mbomo. Verhalte dich bis auf Weiteres ruhig. Geh nach Hause und bleib dort. Wir schicken später am Tag jemanden zu dir, der dich über den weiteren Ablauf informieren wird.«
Dann legte René E. Eriksen auf.
***
Die Räume in der Karrebæk-Bank, in denen sonst der Vorstand tagte, konnten nicht gerade als bescheiden bezeichnet werden. Die Lage, die Möblierung und die Bürotechnik ließen nur einen Schluss zu: Man befand sich am Hauptsitz eines der führenden Geldinstitute des Landes. Alles hier war teuer und extravagant, und die Erscheinung des Vorstandsvorsitzenden Teis Snap verstärkte diesen Eindruck noch.
»Ich habe unseren guten alten Aufsichtsratsvorsitzenden Jens Brage-Schmidt gebeten, sich zu unserer kleinen Besprechung dazuzuschalten. Schließlich sitzt er mit uns in einem Boot.«
Snap hatte hinter seinem imposanten Schreibtisch Platz genommen.
»Jens, hörst du uns klar und deutlich?«
Eine bekräftigende Antwort war aus den Nussbaumlautsprechern zu hören. Die Stimme drückte Autorität aus, auch wenn sie im Moment etwas pfeifend klang.
»Gut, beginnen wir.« Teis Snap wandte sich an René. »Es tut mir leid, das so unumwunden sagen zu müssen, René. Aber nach deinem Gespräch mit Mbomo heute sind Jens und ich zu dem Ergebnis gekommen, dass es nur eine Lösung für das Problem gibt: William Stark muss unter allen Umständen gestoppt werden. Dafür ist jedes Mittel recht. Und du musst garantieren, dass das Baka-Projekt in Zukunft nie mehr in die Nähe eines Mitarbeiters mit Starks ausgeprägtem Pflichteifer kommt.«
»William Stark aufhalten? Der ist in Kürze wieder in Dänemark, darüber seid ihr euch im Klaren?«
»Es geht nicht anders. Wir müssen alle tickenden Zeitbomben entschärfen. Louis Fon haben wir schon gestoppt, Mbomo ist als Nächster dran, dann William Stark. Danach läuft alles wieder nach Plan. Die Beamten im Ministerium in Jaunde sind safe, die stecken viel zu tief drin. Du wirst auch in Zukunft regelmäßig Berichte von irgendeinem Beamten dort unten erhalten, der eine Zeit lang bereit ist, als Louis Fon zu unterschreiben, und der dein Ministerium umfassend darüber informieren wird, wie erfolgreich das Projekt voranschreitet. Alles wieder in bester Ordnung. Wie das so ist bei diesen afrikanischen Hilfsprojekten. Dann und wann die eine oder andere positive Nachricht, viel mehr erwartet man doch gar nicht.«
Aus dem Lautsprecher war ein zustimmendes Knurren zu vernehmen. René war Brage-Schmidt nie begegnet, aber sein Tonfall ließ erahnen, dass er es gewohnt war, Menschen herumzukommandieren. Dieser Mann duldete keinen Widerspruch. Wenn man ihm zuhörte, drängte sich einem das Bild eines kolonialen Plantagenbesitzers oder eines Schiffsreeders auf. Brage-Schmidt galt als exzellenter Kenner Afrikas. Jahrelang war er Konsul verschiedener zentralafrikanischer Staaten gewesen, und mindestens ebenso lange hatte er sich als Geschäftsmann in diesen Ländern nicht eben die beste Reputation erworben. Gerüchte kursierten, er habe in all den Jahren seine Kammerdiener immer nur mit »Boy« angesprochen. Und das war noch das Harmloseste, was man ihm nachsagte.
Für René Eriksen gab es kaum einen Zweifel, dass Brage-Schmidt hinter der Idee für diesen Betrug steckte. Er hatte eine Zeit lang erfolgreich Holz aus Äquatorialafrika importiert und dann laut Teis Snap sein gesamtes Vermögen in der Karrebæk-Bank angelegt. Im Laufe der folgenden Jahre war er zu deren größtem Aktionär aufgestiegen. Insofern war es auch nicht verwunderlich, dass er nun sein Vermögen erbittert verteidigte. René konnte das durchaus nachvollziehen. Aber jetzt ging es nicht mehr nur um Betrug, jetzt schwebte plötzlich über zwei weiteren Männern das Todesurteil. Warum hörte sich René nicht protestieren gegen das, was da vorging?
Unwillkürlich schüttelte er den Kopf. In Wahrheit verstand er diese graue Eminenz nur allzu gut, da gab es gar nichts schönzureden. Und: Gab es denn eine Alternative?
»Ja«, sagte Brage-Schmidt. »Solche Entscheidungen treffen zu müssen ist hart. Aber denken Sie doch auch mal an all die Arbeitsplätze, die verloren gehen würden, und an all die Kleinanleger, die ihre gesamten Sparguthaben verlieren würden, wenn es uns nicht gelänge, das Ruder herumzureißen. Wir haben auch eine Verantwortung gegenüber unseren Kunden. Natürlich ist es bedauerlich, dass Opfer gebracht werden müssen. Aber ist das nicht immer so? Einige wenige müssen sich für die Masse opfern. Und in ein paar Jahren ist alles wieder im Lot, die Bank konsolidiert, Investitionen werden wieder getätigt, Arbeitsplätze bleiben erhalten, und die Aktionäre haben keine Verluste mehr zu verzeichnen. Und wer, Herr Eriksen, glauben Sie wohl, wird in der Zwischenzeit die Energie aufwenden und kontrollieren, ob die Plantagenwirtschaft der Pygmäen in Dja Fortschritte gemacht hat? Wer wird sich die Mühe machen und überprüfen, ob sich Schulsystem und Gesundheitsversorgung wesentlich verbessert haben, seit das Projekt angestoßen wurde? Wer wäre überhaupt imstande dazu, wenn die, die für das Projekt zuständig waren, nicht mehr am Leben sind? Herr Eriksen, ich bitte Sie.«
Ja, wer außer mir. Dieser Gedanke fuhr René Eriksen wie ein Messer durchs Hirn. Er sah hinüber zu den hohen Sprossenfenstern. Sollte das heißen, dass auch er …?
Nein, ihn würden sie nicht überrumpeln, so viel war sicher. Er wusste, wie er sie drankriegen konnte, und er dachte überhaupt nicht daran, sich von ihnen bedrohen zu lassen. Er holte tief Luft, dann sagte er: »Ich kann nur hoffen, dass ihr wisst, was ihr tut. Und dass ihr es dann schön für euch behaltet, denn ich will nichts weiter darüber wissen.« Nach kurzer Pause fuhr er fort: »Und dann wollen wir hoffen, dass William Stark noch nicht angefangen hat, diese Geschichte von Anfang an zu dokumentieren und seine Aufzeichnungen in einem Bankschließfach zu deponieren, so wie ich es getan habe.«
Er sah Teis Snap an und lauschte angespannt auf das Rauschen aus dem Lautsprecher. Wenn sie schockiert waren, ließen sie es sich zumindest nicht anmerken.
»Okay«, fuhr er fort. »Mag sein, dass es tatsächlich nicht auffallen wird, dass Louis Fons Berichte nicht von ihm selbst erstellt wurden. Aber wie steht es mit William Starks Verschwinden? Das wird Schlagzeilen machen.«
»Ja und?« Die Stimme des Aufsichtsratsvorsitzenden wurde einen Hauch dunkler. »Solange Starks Verschwinden nicht mit uns in Verbindung gebracht werden kann, passiert doch nichts, oder? Wie ich es sehe, reist er nach Afrika, erscheint nicht zu einem Termin, fliegt ohne Erklärung zurück nach Hause und verschwindet dann. Zeugt das nicht von einer gewissen Labilität? Könnte man nicht auf den Gedanken kommen, dass sein Verschwinden selbstverschuldet ist? Ich glaube schon.«
Snap und Eriksen sahen sich an. Brage-Schmidt war mit keinem Wort auf Renés Unterlagen im Bankschließfach eingegangen. Vermutlich hatten er und auch Snap verstanden, dass sie auf Gedeih und Verderb aufeinander angewiesen waren. Freundlich konnte man das auch »gegenseitiges Vertrauen« nennen.
»Hören Sie, René«, fuhr Brage-Schmidt fort. »In Zukunft wird es so laufen, wie wir es besprochen haben. Sie sorgen weiterhin dafür, dass jährlich fünfzig Millionen nach Kamerun überwiesen werden. Und dann schreiben Sie jedes Jahr auf der Basis der sogenannten Louis-Fon-Berichte eine hübsche Zusammenfassung darüber, wie vorzüglich es dort unten ausschaut.«
Hier ergriff Teis Snap das Wort. »Derweil empfangen wir in der Karrebæk-Bank wie gehabt einige Wochen später die Summe, die unsere gegenwärtige Finanzsituation erfordert. Das Geld geht den üblichen Weg: Unsere Verbündeten in Jaunde leiten es über die ›Investorengruppe‹« – hier malte er Anführungszeichen in die Luft – »in Curaçao an die Bank weiter, nachdem die anderen Teilhaber der vom Vorstand vorgeschlagenen Kapitalerhöhung zugestimmt haben, was sie zuverlässig tun werden: Die haben ja auch ein Interesse daran, die Bank und ihre Anteile zu erhalten. Und das restliche Geld platzieren wir in nicht börsennotierten Aktien in unserem Depot in Curaçao, als Puffer für unvorhergesehene Entwicklungen im Bankensektor. Auf diese Weise bleibt die Karrebæk-Bank weiterhin stabil, unsere bestehenden Anteile sind also einerseits gesichert, andererseits erwerben wir weitere Vorzugsaktien, die offiziell der Investorengruppe gehören. Und zugleich wächst auch unser Aktiendepot in Curaçao von Jahr zu Jahr an. Wir drei haben also mehr als einen guten Grund zur Freude.«
So viel Schönfärberei konnte René dann doch nicht ertragen. »Ja, wirklich ein guter Grund zur Freude.« Er markierte seine Worte ebenfalls mit Anführungszeichen in der Luft. »Außer vielleicht für Louis Fon. Und Mbomo und William …«
Teis Snap unterbrach ihn. »René, jetzt hör mal auf, dir über Mbomo und Fon den Kopf zu zerbrechen. Wenn etwas Zeit verstrichen ist, zahlen wir deren Witwen eine Art ›Rente‹. Die Behörden sind so sehr daran gewöhnt, dass Menschen dort unten verschwinden, da wird nicht viel Aufhebens drum gemacht. Und was Stark betrifft, der hat doch gar keine Familie, oder?«
»Nein, aber eine Lebensgefährtin und eine kranke Stieftochter.« René sah Snap direkt an.
»Gut«, sagte Snap nur. »Also keine Familie, nur zwei lose mit ihm verbundene Personen. Die beiden Frauen werden bestimmt eine Weile trauern, aber dann geht das Leben weiter.«
René atmete langsam aus. Eine Antwort erübrigte sich wohl.
Wieder übernahm die Stimme aus dem Lautsprecher.
»Was die zweihundertfünfzig Millionen aus dem Baka-Projekt betrifft, kann man wohl mit einiger Berechtigung vorbringen, dass es sich dabei um eine Art getarnte staatliche Unterstützung für den dänischen Bankensektor handelt. Und ist es nicht nur recht und billig, dass der Staat die ertragreiche Privatwirtschaft Dänemarks, zu der auch die Karrebæk-Bank gehört, unterstützt? Die Unternehmen, die den Menschen Arbeit geben, sind für das Funktionieren einer Gesellschaft schließlich unerlässlich, nicht nur für die Zahlungsbilanz und unseren Lebensstandard. Nein, direkt oder indirekt, die Räder würden stillstehen, wenn gute Banken wie die Karrebæk-Bank zusammenbrächen – und das will doch niemand, oder?«
René war mit seinen Gedanken weit weg. Würde irgendetwas schiefgehen, dann wären die beiden Männer hier unter Garantie blitzschnell über alle Berge, und er säße allein da – mit der Verantwortung und mit der Strafe. Nein, das durfte nicht passieren.
»Ich sage es noch einmal: Egal, was ihr auch unternehmen werdet, es geschieht, ohne dass ich Kenntnis davon erhalte, klar? Ich will von alledem nichts mehr wissen. Aber solltet ihr tatsächlich die nächsten Schritte einleiten, dann sorgt dafür, dass ich umgehend Starks Laptop bekomme.«
»Selbstverständlich, René. Und ja. Ich verstehe sehr wohl, dass es dir schwerfällt, das Ganze zu begreifen, ich kenne dich doch. Du bist ein rechtschaffener Mann. Aber denk bitte auch an deine Familie, ja?« Nach kurzer Pause fuhr Snap fort: »Lass Jens Brage-Schmidt und mich das hier erledigen und hör auf, dir Sorgen zu machen. Wir werden einen Mittelsmann einschalten, der sich auf das Lösen solcher Probleme versteht. Er wird dafür sorgen, dass William Stark am Flughafen von jemandem abgeholt wird. Unterdessen kannst du dich freuen, dass deine Aktien Tag für Tag steigen.«
3
Herbst 2010
Pünktlich um siebzehn Uhr holte der gelbe Lieferwagen sie auf der Tivoli-Seite des Rathausplatzes ab, direkt beim H.-C.-Andersen-Schloss, neben dem großen Baugerüst, genau wie immer. Marco hatte sicherheitshalber zwanzig Minuten gewartet, denn wenn der Wagen kam und man nicht dastand, fuhr der einfach ohne einen los. Wenn man dann die S-Bahn und den Bus nehmen musste, setzte es Prügel. Das wollte er nicht riskieren, und um auf einer feuchten Kellertreppe zu schlafen, war es zu kalt.
Er nickte den anderen zu, die schon vorher eingesammelt worden waren und an den Innenwänden des Lieferwagens lehnten. Keiner nickte zurück, aber daran war er gewöhnt – schließlich waren sie alle todmüde. Müde vom Tag, müde von diesem Leben.
Marco sah in die Runde. Zwei von ihnen zitterten ein bisschen, sie waren völlig durchnässt, und sie alle sahen aus, als wären sie krank, so mager, so verzagt.
»Was hast du heute eingenommen?«, fragte Samuel, mit dem Rücken ans Fahrerhaus gelehnt.
Marco dachte nach. »Ich hab insgesamt viermal Geld abgeliefert, beim zweiten Mal waren es über fünfhundert Kronen. Dreizehn- oder vierzehnhundert Kronen, glaube ich, alles zusammen, wenn man die dreihundert dazuzählt, die ich jetzt in der Tasche habe.«
»Ich habe ungefähr achthundert«, sagte die Älteste aus der Runde. Miryam bekam immer viel, aber sie hatte ja auch ein verkrüppeltes Bein.
»Ich hab nur sechzig«, sagte Samuel leise. »Mir gibt keiner mehr was.«
Zehn Augenpaare sahen ihn mitleidig an. Zola damit unter die Augen zu treten würde kein Vergnügen werden.
»Dann nimm die hier«, sagte Marco und gab ihm zwei Hundertkronenscheine. Er war der Einzige, der Samuel etwas abgab, und er konnte davon ausgehen, dass er dafür noch bei Zola verpetzt würde.
Marco wusste, warum Samuel kaum Einnahmen hatte. Wenn man nicht mehr wie ein Kind aussah, konnte man das Betteln gleich bleiben lassen. Er selbst war fünfzehn, wirkte aber noch immer wie dreizehn. Er hatte große kindliche Augen und war klein für sein Alter, sogar ungewöhnlich klein, und anders als bei Samuel, Pico oder Romeo war seine Haut noch immer weich und das Haar seidig. Deren Haut war irgendwie gröber, und man sah schon Ansätze von Bartwuchs. Zwar hatten sie bereits erste Erfahrungen mit Mädchen gemacht, aber trotzdem beneideten sie Marco, weil der sich so langsam entwickelte.
Marco war das durchaus bewusst.
Schon möglich, dass er klein war für sein Alter. Aber sein Verstand war der eines Erwachsenen, und er wusste ihn zu gebrauchen.
»Papa, darf ich in die Schule gehen?« Mit sieben hatte er darum gebettelt. Damals lebten sie noch in Italien. Marco liebte seinen Vater, doch der war auch damals schon zu schwach gewesen. Denn sein Bruder Zola, Marcos Onkel, verlangte, dass die Kinder auf die Straße gingen. Und Zolas Wille war Gesetz, er war der Anführer des Clans.
Aber Marco wollte etwas lernen, und da es in fast allen Dörfern Umbriens eine kleine Schule gab, stellte er sich, sobald die Morgensonne ein bisschen Kraft hatte, dicht vor die geöffneten Klassenfenster und saugte alles auf, was er hören konnte. Erst dann marschierte er los, um seiner »Arbeit« nachzugehen.
Gelegentlich kam ein Lehrer heraus und lud ihn ins Klassenzimmer ein, aber dann rannte Marco sofort davon und ließ sich nie wieder blicken. Wäre er der Aufforderung gefolgt, hätte man ihn zu Hause grün und blau geprügelt. So gesehen war es ein Vorteil, dass sie immerzu weiterzogen und dass die Schulgebäude und Lehrer wechselten.
Einem Lehrer gelang es schließlich trotzdem, ihn sich zu schnappen. Aber statt ihn zu überreden, mit hineinzukommen, drückte er ihm eine schwere Leinentasche in die Hand.
»Da, ich schenk sie dir – vielleicht helfen sie dir!«, sagte er und ließ Marco laufen.
Fünfzehn Schulbücher lagen in der Tasche, und wo auch immer sie sich aufhielten, Marco fand stets einen Ort, an dem er sie studieren konnte, wenn die Erwachsenen beschäftigt waren.
Nach zwei Jahren hatte er sich das Rechnen und das Lesen und Schreiben auf Italienisch, Englisch und ein wenig auch auf Dänisch beigebracht.
Denn inzwischen waren sie schon drei Jahre in Dänemark, und in dieser Zeit hatte er als Einziger aus der Gruppe die Sprache nahezu fließend zu sprechen gelernt.
»Erzähl, erzähl!«, rief Miryam oft. Sie mochten sich sehr.
Zola und dessen engere Vertraute hingegen betrachteten Marcos Ambitionen mit Misstrauen. Sie brauchten keine Denker, sie brauchten Werkzeuge.
An diesem Abend lagen sie in ihren Etagenbetten und mussten mitanhören, wie Samuel windelweich geprügelt wurde. Wie ein Echo all der Ungerechtigkeiten, die Zola schon an ihnen begangen hatte, pflanzten sich die Geräusche von Zolas Zimmer bis zu ihrem Schlafraum fort. Marco selbst fürchtete sich nicht vor Prügel, denn in der Regel fiel sie bei ihm weniger schlimm aus als bei den anderen, so groß war der Einfluss seines Vaters dann doch. Dennoch lag er im Bett und knetete die Decke. Es war auch das schlechte Gewissen gegenüber Samuel. Schließlich wurde es still. Die Bestrafungsaktion war vorbei, denn Marco hörte, wie die Haustür ging. Einer von Zolas Gorillas musste sie geöffnet haben, um einen Blick in die Nachbarschaft zu werfen. Erst wenn dort alles ruhig war, schleppte er den gedemütigten und übel zugerichteten Samuel zum Nachbarhaus hinüber, wo dieser sein Zimmer hatte. Die Mitglieder des Clans waren sehr darauf bedacht, Gerede in dem gutbürgerlichen Viertel zu vermeiden und mit den dänischen Nachbarsfamilien auf freundschaftlichem Fuß zu stehen. Nach außen hin gab Zola schließlich den zurückhaltenden, eleganten Mann, und dieses Bild sollte unter keinen Umständen getrübt werden. Zola wusste nur zu gut, dass ein Weißer wie er, noch dazu, wenn er stattlich, attraktiv und englischsprachig war und aus den USA kam, zuverlässig als »einer von ihnen« betrachtet wurde. Er wusste, dass sich die Dänen vor so einem nicht fürchteten.
Aus diesem Grund verlegte er die Bestrafungsaktionen stets in den Schutz der Dunkelheit und hinter Schallschutzfenster mit zugezogenen Gardinen. Und aus diesem Grund wurde immer sorgfältig darauf geachtet, dass die Schläge keine sichtbaren Spuren hinterließen. Dass es Samuel am nächsten Morgen schwerfallen würde, sich die Fußgängerzone hinunterzuschleppen, das sahen die Nachbarn ja nicht. Abgesehen davon war so was ja immer gut fürs Geschäft. Mitleid ließ sich gut in bare Münzen umwandeln.
Marco richtete sich im Dunkeln auf, schlich sich am Zimmer seiner Cousins vorbei und klopfte an die Tür zum Wohnzimmer. Kam sofort eine Antwort, war es gut. Wurde gezögert, musste man auf der Hut sein.
Dieses Mal verging sicher eine Minute, ehe Marco hineingerufen wurde, und er war bereits auf alles gefasst.
Wie ein König residierte Zola am Teetisch, umgeben von seinem Hofstaat. Auf einem riesigen Flachbildschirm lief das Fernsehprogramm in voller Lautstärke.
Vielleicht hellte sich seine Miene ein wenig auf, als er sah, dass es Marco war. Aber noch immer zitterten seine Hände. Es gab Clanmitglieder, die behaupteten, dass Zola es liebte zuzusehen, wenn anderen Gewalt zugefügt wurde. Marcos Vater hingegen beteuerte, das Gegenteil sei der Fall: Zola liebte die Seinen, so wie Jesus seine Jünger geliebt hatte.
Marco war sich da nicht so sicher.
Gerade dröhnten die Spätnachrichten aus dem Fernseher: »Drei Tage und Nächte saß Vizepolizeikommissar Carl Mørck vom Sonderdezernat Q, der Ermittlungseinheit der Kopenhagener Mordkommission für unaufgeklärte Fälle von besonderem Interesse, in diesem hermetisch verschlossenen Raum mit den mumifizierten Leichen und hatte …«
»Chris, mach den Scheiß aus«, befahl Zola seinem Handlanger und deutete mit einem Nicken auf die Fernbedienung. Sofort war Ruhe.
Zola tätschelte seine Neuerwerbung, einen dünnbeinigen Jagdhund, den niemand außer ihm anrühren durfte. Dabei sah er Marco entgegen. »Ganz schön mutig von dir, Samuel Geld abzugeben, Marco. Es ist dir ja wohl klar, dass es das letzte Mal war.«
Der Junge nickte.
Zola lächelte. »Du hast heute gut gearbeitet, Marco, setz dich.« Er deutete auf den Stuhl ihm gegenüber. »Was willst du denn, mein Junge? Du bist ja wohl nicht gekommen, um mir zu sagen, Samuel habe das nicht verdient.«
Dann änderte sich sein Gesichtsausdruck, und mit einer knappen Geste bedeutete er Chris, Marco Tee einzuschenken.
»Entschuldige, Zola, dass ich dich störe, aber ich wollte tatsächlich etwas zu Samuel sagen.«
Zola ließ sich nichts anmerken, aber Chris richtete sich mit einem Ruck auf und wandte sich langsam zu Marco um. Er war größer und hellhäutiger als die anderen aus dem Clan. Wenn er sich zu voller Größe aufrichtete, zogen sich die meisten zurück, aber Marco hielt den Blick fest auf seinen Onkel gerichtet.
»Aber du weißt doch, Marco: Samuel geht dich nichts an. Seine heutigen Einnahmen waren absolut unbefriedigend, weil er sich nicht angestrengt hat. Nicht so wie du.« Zola schüttelte den Kopf und ließ sich schwer gegen das Lammfell sinken, das über dem Stuhlrücken hing. »Misch dich nicht ein, Marco. Hör, was dein Onkel dir sagt.«
Marco sah ihn einen Augenblick an. Samuel hat sich nicht so angestrengt wie du, hatte Zola gesagt. Hieß das tatsächlich, dass Samuel indirekt seinetwegen Prügel bezogen hatte? Dann war es ja sogar noch schlimmer.
Marco senkte den Kopf und sagte so leise, wie er konnte: »Das weiß ich. Aber Samuel ist inzwischen zu alt, um in der Fußgängerzone zu betteln. Die meisten Passanten schauen ihn nicht mal an, und die, die es tun, scheinen sich vor ihm zu fürchten und machen einen Bogen um ihn. Tatsächlich sind es nur die, die …«
Marco bemerkte, wie Zola mit einem Finger in Chris’ Richtung deutete. Er hob genau in dem Augenblick den Kopf, als Chris auf ihn zutrat und ihm eine so schallende Ohrfeige versetzte, dass es im Ohr pfiff.
»Ich sagte, Samuel geht dich nichts an, Marco, hast du mich verstanden?«
»Ja, Zola, aber …«
Chris schlug noch mal zu, und die Botschaft war endgültig angekommen. Marco verzog keine Miene. Wegen so etwas heulte man nicht, wenn man in diesem Milieu aufgewachsen war.
Langsam stand er auf, nickte Zola zu und ging zur Tür. Dabei versuchte er zu lächeln. Zwei Ohrfeigen, und die Audienz war vorbei. Trotzdem nahm er noch einmal all seinen Mut zusammen, als er die Hand schon auf der Klinke hatte.
»Dass du mich geschlagen hast, ist okay«, sagte er und hob den Kopf. »Aber es ist nicht okay, dass du Samuel bestraft hast. Und wenn du noch mal prügelst, haue ich ab.«
Marco sah, wie Chris Zola einen fragenden Blick zuwarf, aber sein Onkel schüttelte nur leicht den Kopf und signalisierte seinem Neffen mit einer raschen Geste, ihm aus den Augen zu gehen.