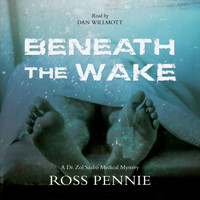6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dp DIGITAL PUBLISHERS GmbH
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Eine unsichtbare Bedrohung zieht auf – und sie ist absolut tödlich
Der packende Fall von Epidemieforscher Dr. Zol Szabo
Der Epidemieforscher Dr. Zol Szabo und sein Team werden zu einer High School im Herzen Ontarios gerufen, an der verängstigte Jugendliche aus unerklärlichen Gründen an Leberversagen sterben. Das Team vermutet einen Zusammenhang mit kontaminierten Billigzigaretten, die in der Nähe hergestellt werden. Als Zol schließlich dem millionenschweren Hauptakteur des illegalen Tabakhandels selbst gegenübersteht, wird ihm von ganz oben nahe gelegt, seine Ermittlungen einzustellen, bevor seine eigene Familie in Gefahr gerät … Kann Zol tief genug graben, um eine Lösung zu finden oder ist die unsichtbare Bedrohung bereits zu nah?
Erste Leser:innenstimmen
„Ich konnte den Roman nicht mehr zur Seite legen, ein echter Wegleser!“
„Ein Medizin-Thriller, der mich von Anfang bis Ende begeistern konnte.“
„atemberaubend, fesselnd und großartig geschrieben“
„Sehr spannende Grundidee, perfekt und authentisch umgesetzt!“
„Überraschende Wendungen und viele Möglichkeiten zum Miträtseln – super!“
Über den Autor/die Autorin
Nachdem Ross Pennie in den 1970er Jahren sein Medizinstudium in Kanada mit Bestnoten abgeschlossen hatte, arbeitete er zwei Jahre lang im entlegenen Papua-Neuguinea in einem Krankenhaus. Zurück zu Hause in Kanada wurde er nach einer Weiterbildung zu Infektionskrankheiten und Intensivmedizin Universitätsprofessor und betreute Patienten, die an HIV/AIDS, Tropenkrankheiten und Infektionen im Zusammenhang mit Krebs, Diabetes und Organtransplantationen litten. Er wandte sich der Belletristik zu, um den Herzschmerz zu verstehen, den er so oft am Krankenbett sah, und um die kleinen Triumphe zu feiern, die er täglich im Krankenhaus erlebte. Jetzt genießt Dr. Pennie nach einer erfolgreichen medizinischen Karriere seinen Ruhestand und lebt mit seiner Frau im Süden von Ontario, Kanada.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 592
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Über dieses E-Book
Der Forscher Dr. Zol Szabo und sein Team werden zu einer High School im Herzen Ontarios gerufen, an der verängstigte Jugendliche aus unerklärlichen Gründen an Leberversagen sterben. Das Team vermutet einen Zusammenhang mit kontaminierten Billigzigaretten, die in der Nähe hergestellt werden. Doch als Zol dem millionenschweren Kopf des illegalen Tabakhandels selbst gegenübersteht, wird ihm von ganz oben nahe gelegt, seine Ermittlungen einzustellen … bevor seine eigene Familie in Gefahr gerät.
Dies ist eine überarbeitete Neuauflage des bereits erschienenen Titels Ein letzter Atemzug.
Impressum
Erstausgabe 2013 Überarbeitete Neuausgabe Oktober 2021
Copyright © 2024 dp Verlag, ein Imprint der dp DIGITAL PUBLISHERS GmbH Made in Stuttgart with ♥ Alle Rechte vorbehalten
E-Book-ISBN: 978-3-96817-926-1 Hörbuch-ISBN: 978-3-96817-930-8 Taschenbuch-ISBN: 978-3-96817-927-8
Copyright © 2013, Ross Pennie Titel des englischen Originals: Up in Smoke
Copyright © 2020, dp Verlag, ein Imprint der dp DIGITAL PUBLISHERS GmbH Dies ist eine überarbeitete Neuausgabe des bereits 2020 bei dp Verlag, ein Imprint der dp DIGITAL PUBLISHERS GmbH erschienenen Titels Ein letzter Atemzug (ISBN: 978-3-96817-193-7).
Übersetzt von: Tobias Eckerlein Covergestaltung: Buchgewand unter Verwendung von Motiven von depositphotos.com: © o_april, © spaxiax stock.adobe..com: © Lukas Gojda shutterstock.com: © schankz, © milart Korrektorat: Anke Wendt
E-Book-Version 19.09.2024, 11:53:47.
Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Sämtliche Personen und Ereignisse dieses Werks sind frei erfunden. Etwaige Ähnlichkeiten mit real existierenden Personen, ob lebend oder tot, wären rein zufällig.
Abhängig vom verwendeten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Unser gesamtes Verlagsprogramm findest du hier
Website
Folge uns, um immer als Erste:r informiert zu sein
TikTok
YouTube
Es bleibt die Asche
Jetzt auch als Hörbuch verfügbar!
Eine unsichtbare Bedrohung zieht auf – und sie ist absolut tödlichDer packende Fall von Epidemieforscher Dr. Zol Szabo
Anmerkung des Autors
Als Spezialist für ansteckende Krankheiten in Brant County im südlichen Ontario habe ich mich um unzählige Raucher gekümmert. Immerhin ist das Land nördlich des Lake Erie zweitausend Jahre lang das Zentrum der kanadischen Tabakindustrie gewesen. Viele meiner Patienten – die Lungen durchlöchert und die Beine amputiert, nachdem sie diese jahrelang Teer und Nikotin ausgesetzt haben – hatten immer Geld für Kippen. Warum? Weil Zigaretten in diesem Teil der Erde billig sind. Spottbillig. Hergestellt in den örtlichen Reservaten der indigenen Bevölkerungsgruppen (auch Rez genannt), unversteuert und frei von jeglicher Qualitätskontrolle.
Sind unversteuerte Zigaretten aus den Reservaten einfach zu bekommen? Definitiv. Mindestens 40 % des in Ontario konsumierten Tabaks landet hier über geheime Kanäle. Schadet das irgendjemandem außer dem Steuereintreiber? Lesen Sie Der letzte Atemzug, ein fiktives Werk (die Handlung und die Charaktere entspringen ausnahmslos meiner Fantasie), und finden Sie heraus, wie wir alle dieser Plage möglicherweise zum Opfer fallen könnten.
Ich bedanke mich bei den vielen Menschen, die dieses Buch möglich gemacht haben, vor allem bei meinen Patienten, die so offen und ehrlich über ihre Sucht nach Rez-Zigaretten gesprochen haben; bei Claire Pennie für ihren Enthusiasmus und ihre Hilfe bei der Recherche; bei Larry Kramer, der mir einen Einblick in die Welt der Tabakfarmen gewährt hat; bei Edna Barker, die mich in die richtige Richtung gelenkt hat; bei Jack David und Crissy Calhoun für die Leitung eines Hingebungsvollen und talentierten Teams bei ECW Press; bei Cat London, die dem Manuskript neues Leben eingehaucht hat; bei Jen Knoch, die mit ihrem vielseitigen Wissen eine unverzichtbare Korrektorin war; bei Jenna Illies, die die Ankündigung dieses Buches gekonnt umgesetzt hat; bei Tania Craan, deren Cover-Designs die Neugier in meinen Leserinnern und Lesern erweckt; bei jenen Leserinnen und Lesern, dafür, dass sie mich ermutigen, weiterzuschreiben… und bei meinem Schatz Lorna, die immer hinter mir steht und mich anfeuert.
Ross Pennie, Juni 2013
Kapitel 1
Er liegt zitternd in seinem Schlafsack, dreht sich nach rechts und stöhnt. Es ist schon eine Weile her, dass er seine Rolex beim Pokern verloren hat, doch sein Körper weiß genau, dass es drei Stunden nach Mitternacht ist. Der Bürgersteig der Bloor Street hat absolut kein Erbarmen mit seiner Schulter. Er hat keine Zigaretten mehr übrig und der Canadian Club Whiskey floß schon seit einer ganzen Weile nicht mehr durch seine Adern, als er realisiert, dass er, als er noch Gelegenheit dazu hatte, ein paar Oxycodon hätte einschmeißen und sich die Flanelljacke überziehen sollen, die sich am Boden seiner Einkaufstüte befanden. Unter dem guten Zeug. Wenigstens ist er windgeschützt, dank des wilden Metallkonstrukts, das sich über ihm auftürmt; dieses gigantische Eitergeschwür, das aus der Vorderseite ihres Museums hervorragt. Sie nennen es den Kristall, und wenn er besoffen wäre, würde ihm die verworrene Konstruktion den Magen umdrehen. Doch heute Nacht ist er absolut nüchtern, und er will sich nicht beklagen. Nicht hier, wo ihre Kreatur der Extravaganz über den Gehsteig wacht und die verrückte geometrische Form einen Unterschlupf bieten, wo jemand wie er für einige Stunden die Augen schließen kann. Zumindest, bis die mit Schulkindern vollgestopften Busse am nächsten Morgen auftauchen. Er hört Schritte und öffnet die Augen einen Spalt weit. Zwei Jugendliche in Jeans und Kapuzenpullovern gehen im großen Bogen an ihm vorbei und tun so, als würden sie ihn nicht anstarren. Der größere trägt eine Sporttasche, die schwer anmutet; schwer genug, um eine Flasche Sherry und zwei Flaschen Rye zu beinhalten. Wahrscheinlicher sind jedoch Werkzeuge wie eine Brechstange, Glasschneider und ein paar Vorschlaghämmer. Jungs auf dem Weg zu einem Job, ohne große Bemühungen, es zu verbergen.
Er kratzt das verdammte Ding an seiner Lippe auf und es fängt wieder an, zu siffen. Er kann das Blut schmecken. Diese verfluchten Wunden weigerten sich bereits seit Wochen, zu verheilen. Er zittert und rollt sich auf die eine Seite, saugt an seiner Lippe und rollt sich erneut herum.
Einige Minuten später, vielleicht auch mehr, kommen die beiden Kids aus dem Seiteneingang des Museums, die Kapuzen jetzt über ihre Köpfe gezogen. Ein dritter, etwas älterer Kerl, folgt ihnen nach draußen. Er hat nun die Sporttasche, die jetzt noch schwerer aussieht, als es auf dem Weg in das Gebäude denn Anschein hatte. Der ältere Kerl bleibt stehen und schaut sich kurz um. Er sieht nur einen Säufer, der seinen Rausch ausschläft und bedeutet den anderen beiden mit einem Winken, dass sie weitergehen sollen. Das Licht über der Tür lässt den Aufdruck seines T-Shirts sichtbar werden NATION DER ANISHINAABEG. UNSER MOMENT WIRD KOMMEN.
Echt jetzt? Und was dann?
Die drei bewegen sich in Richtung der Begrenzungsmauer, die eigentlich keine richtige Barriere ist, vielmehr ist sie eine Art Dekoration zwischen dem Museum und der Musikfakultät nebenan. Sie rennen nicht, aber sie gehen im Laufschritt, erregt nicht sonderlich viel Verdacht. Jeder in Toronto geht oder fährt Fahrrad oder Auto auf diese Weise – zielgerichtet. Die wenigsten sind jedoch selbst das Ziel.
Er dreht sich auf den Bauch und überprüft die Straße. Niemand anderes in Sicht. Er greift in seinen Schlafsack und holt die geladene Glock heraus. Dann streckt er die Jungs mit drei Schüssen nieder, bevor sie die Mauer auch nur erreicht haben.
Er windet sich aus dem Schlafsack und entreißt die Sporttasche aus der Faust des Toten. Er nimmt die Brechstange und die Hämmer heraus und wirft die Glock in die Tasche, bevor er den Reißverschluss zuzieht. Dann hievt er sich über die Mauer und lässt sich in die Schatten des Campus hinter dem Museum fallen, während er sich einredet, dass es insofern okay ist, als dass er nicht in ihre Gesichter gesehen hat.
Auf der Hoskin Avenue, zwei Blocks weiter südlich, lässt der Ford-150 seine Scheinwerfer aufleuchten. Er springt hinein und verstaut die Sporttasche im Fußraum vor sich. Sein Zwillingsbruder reicht ihm das Wegwerfhandy. Er wählt die Nummer; zehn Ziffern, die ihnen zeigen werden, wer hier das Sagen hat. Er drückt auf Absenden und sie warten ab.
Eins, zwei…
Der Kristall explodiert zusammen mit einem befriedigenden Donner. Rauch wirbelt weit über den Straßenlaternen durch die Luft.
Das Museum muss in Trümmern liegen, kein Zweifel. Zu schade, dass er es verpasst; all das zersplitterte Glas und der verbogene Stahl. Wahnsinn! Der Boss wird zufrieden sein. Vielleicht kauft er ihm sogar eine neue Rolex.
Als sich die Rußwolke über dem Royal Ontario Museum legt, begräbt sie die Ruinen, die Werkzeuge, die blutbespritzten Kapuzenpullover und die sauberen Löcher in den drei Schädeln unter sich.
Alles, was von der Einkaufstüte übrigbleibt, ist zerstreute Asche.
Kapitel 2
Zol Szabo füllte zwei Löffel kenianischer Bungoma-Bohnen – Schattenanbau und Fair Trade – in die Mühle. Ein Morgen ohne einen großen Becher Kaffee zum Frühstück und eine kleine Auffrischung um circa zehn Uhr dreißig war unvorstellbar, und Nachmittage ohne einen kleinen Muntermacher um drei, und meist noch einen um fünf, ebenso. Der Arzt in ihm fragte sich hin und wieder, wie schuldig er sich mit seiner Koffeinabhängigkeit fühlen sollte.
Er drückte den Knopf und zählte fünf Mississippis, während er sich selbst ins Gedächtnis rief, dass er in seinem ganzen Leben weniger als einhundert Zigaretten geraucht hatte, dass seine halbherzigen Experimente mit Marihuana bereits mehr als ein Jahrzehnt zurücklagen und dass ein einziger Single-Malt Scotch, den er pro Abend genoss, noch keine zusätzliche Sucht darstellte. Oder?
Er schüttete den Kaffee in einen Filter und hielt ihn über seine Lieblingstasse. Dann goss er die sechshundert Milliliter Wasser hinein, die er, wie von dem Barista empfohlen, der ihm gestern die Bohnen im Detour Café verkauft hatte, bis kurz vor den Siedepunkt erhitzt hatte. Es war das erste Mal in fast zehn Jahren, dass er auf der Norfolk Avenue im guten alten Simcoe eingekauft hatte.
Um das verträumte Städtchen, in dem er geboren war, zu erreichen, brauchte man eine knappe Stunde mit dem Auto. Nicht weit davon entfernt lag die Farm, auf der er aufgewachsen war und wo seine Eltern noch heute lebten. Trotzdem hatte es ihn nie dahin zurückverschlagen. Bis vor zwei Wochen. Jetzt waren Simcoe und das angrenzende Norfolk County seine oberste Priorität, zumindest was seinen Beruf anging. Ein heftiger Schlaganfall hatte den amtierenden Amtsarzt, der für das Gesundheitsamt zuständig gewesen war, vorübergehend arbeitsunfähig gemacht. Zol wurde daraufhin hastig zum Stellvertreter befördert. Sein Boss in Hamilton, Peter Trinnock, hatte Zol klar zu verstehen gegeben, dass es sich bei seiner Abberufung nach Simcoe um eine zeitlich begrenzte Stelle handelt und er hatte ihn gewarnt, dass seine Arbeit unter der minutiösen Aufsicht Torontos, genauer gesagt eines gewissen Dr. Elliott York, dem Boss der Bosse des öffentlichen Gesundheitssektors der Provinz, stand. Es war kein Geheimnis, dass York auf einen Kabinettsposten hinarbeitete und keine Patzer von seinen Untergebenen tolerieren würde. Trinnock hatte Zol gewarnt: Komm gar nicht erst auf die Idee, dein schickes Haus drüben in West Mountain zu verkaufen, es sind genug gute Kandidaten im Rennen für den Posten unten in Simcoe. Wir werden dir dein Büro hier im Hammer schön warm und kuschelig halten. Trinnock würde es vermissen, Zol unter seiner Fuchtel zu haben; es wäre nicht untypisch für ihn gewesen, wenn er es irgendwie in die Wege geleitet hätte, dass Zol früher würde zurückkehren müssen.
Zol hielt kurz inne, als sich der aufsteigende Dampf des Kaffees mit dem heiteren Tröpfeln des durchlaufenden Wassers vereinte und ihm an diesem grauen Oktobersonntag ein Gefühl der Geborgenheit schenkte. Draußen vor dem Fenster verdeckten tiefe Wolken die glitzernden Türme Torontos; eine Aussicht, welcher dieses Viertel des Hammers, wie die Bewohner Hamiltons ihre Stadt liebevoll nannten, seine hohen Immobilienpreise zu verdanken hatte.
Er dachte über Simcoe nach und fand, dass es schon immer ein etwas schräger Ort war. Simcoe lag etwas abgeschieden von Allem nördlich des Lake Erie und verdankte seine Gründung den Tabakfarmen, die einst jeden Zentimeter der umliegenden sandigen Lehmlandschaft bewirtschaftet hatten. Jetzt, wo das Nikotinkraut nicht länger wie Gold gehandelt wurde, eroberten Fair Trade-Kaffee, pestizidfreies Gemüse und steingemahlenes Getreide den Markt, und prägten damit, neben Fast Food–Läden, Tattoo-Studios und Geschäften für Farmzubehör, auch das Straßenbild. Wie gut sich diese hippen Etablissements in der Bier– und Weißbrot-Stadt halten würden, stand in den Sternen; doch durch seinen neuen Posten würde er es schon bald aus nächster Nähe erfahren.
Das kenianische Aroma stieg von dem Filter auf und kitzelte seine Nasenhöhlen. Er machte sich bereit. Einen Sekundenbruchteil später hörte er sie. Pünktlich wie immer.
Kein Audiogerät im Haus war eingeschaltet. Kein Radio, kein CD-Spieler, kein iPod. Und dennoch, Céline Dion sang den Titelsong von Titanic – so klar und deutlich, als stünde sie direkt neben ihm. Sein Neurologe hatte eine Erklärung für dieses Phänomen: Eine Synästhesie, die durch eine Gehirnerschütterung hervorgerufen wurde. Ein Schlag auf seinen Kopf einige Monate zuvor hatte die Leitungen in seinem Gehirn durcheinandergebracht und dadurch auf bizarre Weise eine Verbindung zwischen seinem Hör– und Geruchsinn hergestellt. Starke Gerüche brachten nun Musikschnipsel in seinem Kopf hervor, die so echt wie das Original klangen. Beinahe jedes Mal, wenn er frisch gekochten Kaffee roch, tauchte Céline auf und performte zehn bis fünfzehn Strophen von My Heart Will Go On für ihn. Es war unmöglich, sie zu unterdrücken; und gleichermaßen verdammt schwierig, sich an sie zu gewöhnen. Er bevorzugte Amanda Marshall, Ray LaMontagne oder Royal Wood, doch wann immer es Zeit für einen Kaffee war, war er Céline und der Titanic ausgeliefert.
Er hätte die von Glatteis überzogene Stelle damals im April bemerken sollen, stattdessen war er dem letzten Atemzug des Winters zum Opfer gefallen. Es hatte ihm sofort die Füße weggerissen und er schlug ungebremst mit dem Kopf auf dem Gehweg der Concession Street vor dem Gebäude des Gesundheitsamtes auf. Er verlor das Bewusstsein und blieb mit abgewinkelten Gliedmaßen vor den Augen seiner Kollegen und dem vorbeifließenden Verkehr liegen. Stunden später kam er auf der Intensivstation des Caledonian University Medical Centre wieder zu sich, als er den Geruch des Desinfektionsmittels vernahm, das die zuständige Krankenschwester an ihren Händen haften hatte. Sofort erschienen The Tragically Hip neben seinem Bett und spielten die ersten Strophen von Wheat Kings. Er hatte gedacht, dass er entweder den Verstand verloren haben oder aber im Jenseits aufgewacht sein musste; insbesondere, weil das Lied mit dem gespenstischen Ruf eines Seetauchers begann.
Céline beendete ihr Frühstückskonzert und Zol nahm, erleichtert über die Stille, die heutige Ausgabe der Globe and Mail vom Küchentisch. Mit weit aufgerissenen Augen sah er das Foto auf der Titelseite und wandte seinen Blick für eine ganze Weile nicht mehr davon ab. Er hatte gestern bereits in einem kurzen Bericht im Radio davon gehört, doch er hatte nicht erwartet, dass es so schlimm sein würde.
Das Royal Ontario Museum, kurz: R.O.M., lag in Schutt und Asche; sein ultramoderner Eingang glich dem Maul eines großen weißen Haies mit abgebrochenen Zähnen. Der Michael-Lee-Chin-Kristall, Torontos neustes Wunder der Ingenieurskunst – sowohl hochgelobt als auch zutiefst verflucht für seinen Wert, seine Eleganz und seine Extravaganz – war nun ein Trümmerhaufen aus verbogenen Stahlträgern, zerbrochenem Glas und Absperrband.
Er überflog den Artikel. Ab der Mitte wurde es immer schlimmer und schlimmer. „Colleen!“, er drehte sich um und rief sie erneut aus der Küche heraus, „komm und schau dir das an.“ Seine immerwährend fuchtelnden Hände, die jetzt wie aufgeschreckte Krähen flatterten, beförderten das Kaffeegedeck quer über den Küchentisch und auf den Boden. Er starrte gerade die Kaffeepfütze und die zersplitterte Keramik an, als sie hereingeschneit kam. Sein marineblauer Bademantel – über ihrem schmalen, zierlichen Körper wirkte er riesig – wehte um ihre Knöchel. „Oh je, das war deine Lieblingstasse“, sagte sie und riss ein Knäuel Küchenpapier von der Rolle. „Aber mach dir nichts draus, du hast einen ganzen Schrank voll mit anderen schönen, die du nie benutzt. Dann suchst du dir eben eine neue Lieblingstasse aus. Die eine von Scott Barnim, die du von deiner Mutter bekommen hast, ist doch sehr hübsch.“
Er war sich nicht sicher, ob ihm im Moment danach war, sich eine neue auszusuchen, als er sich neben sie hockte, um ihr beim Aufwischen zu helfen. Seine Nase sog den Duft seines Bergamotte-Duschgels auf ihrer Haut auf. Augenblicklich begann Marvin Gaye I Heard It Through The Grapevine zu singen. Bergamotte-Öl im Zusammenspiel mit ihrer Haut beschwor immer Marvin herauf. Als sie die letzten Reste des Kaffees aufwischten und Colleen zu sprechen begann, dröhnte Marvin noch immer in voller Lautstärke. Zol fasste sich an das rechte Ohr.
Ihre haselnussbraunen Augen schimmerten verständnisvoll und sie steckte das Handtuch wieder fest, welches sie um ihren hüftlangen Pferdeschwanz gewickelt hatte. Sie schenkte ihm ein Lächeln, das nur kurz anhielt, bevor es wieder einer ernsten Miene wich. „Also gut, genug jetzt. Du bist kreidebleich. Erzähl mir nicht, dass das nur mit deiner Lieblingstasse zu tun hat. Was ist los?“
Er zeigte auf die Titelseite der Zeitung. „Das.“
Es brauchte gerade einmal zwei Schlagzeilen, um die Story zu erzählen. Drei Leichen aus R.O.M.-Trümmern geborgen und UrtümlicheArtefakt der Irokesen vermisst.
Sie schnalzte in Anbetracht der Zerstörung und der sinnlosen Vergeudung von Leben unmutig mit der Zunge. „Außergewöhnlich. Wer sind die Opfer? Irgendjemand, den du kennst?“
Normalerweise ließ ihr südafrikanischer Akzent alles – selbst die abscheulichsten Details, die sie gelegentlich nach einer nächtelangen Observierung ausplauderte – irgendwie heiter und harmonisch klingen. Die Nachrichten in der Zeitung machten ihn jedoch zu wütend, um das jetzt wertzuschätzen.
„Keinen Schimmer.“
„Sicherlich wird die Polizei eine Vermutung haben. Und deinem Gesichtsausdruck nach zu urteilen, hast du die auch.“
Er schüttelte den Kopf. „Steht da nicht.“
„Du meinst, da steht nicht, ob die Opfer identifiziert wurden, oder da steht nicht, wie die Opfer heißen, obwohl die Polizei weiß, wer sie sind?“
Er schaute den Artikel an und wünschte sich, dass sie ihn sich einfach selbst durchlesen würde. Eine solches Verhör war für ihn vor seinem ersten Kaffee unzumutbar. „Ob jemand weiß, wer sie sind, das steht da nicht.“
„Aber sicherlich spekuliert man. Wird vermutet, dass die Opfer unschuldige Passanten, Angestellte des R.O.M. oder die verdächtigen Attentäter selbst sind?“
Er gab ihr die Zeitung. „Lies es dir selbst durch. Du bist hier der Privatdetektiv.“
Sie strafte ihn mit einem Blick, der sagte, dass seine Bemerkung unnötig gewesen war, und warf lediglich einen kurzen Blick auf die Schlagzeilen. „Schreiben sie wenigstens, was für Artefakte gestohlen wurden?“
„Ein paar Holzkeulen, ein zeremonielles Beil und…“
„Und was? Was guckst du denn plötzlich so beklagenswert?“
Er fühlte sich nicht beklagenswert. Kein bisschen. Doch was er ihr erzählen würde, würde ihr entweder den Atem verschlagen oder eine Reihe weiterer Fragen nach sich ziehen. „Meins.“
„Deins? Was willst du mir sagen?“
„Ja, meins. Meine antike steinerne Pfeife.“
Sie hielt mit weit geöffneten Augen inne und ihr Mund stand so weit offen, dass er ihr Gaumensegel sehen konnte. Einige Sekunden später fand sie ihre Stimme wieder, sie war generell nie lange sprachlos. „Du fängst besser ganz von vorne an.“
Er holte tief Luft. „Ich habe dem Royal Ontario Museum meine unschätzbar wertvolle Pfeife der Hopewell-Kultur gegeben, die vor zweitausend Jahren in Form eines Seetauchers aus Stein gefertigt wurde. Sie sollten eigentlich auf sie aufpassen. Doch jetzt hat sie jemand direkt unter ihrer Nase gestohlen.“
„Das ist außergewöhnlich, Zol. Doch du musst noch etwas weiter vorne anfangen. Ein ganzes Stück weiter vorne sogar. Von was für einer Art Pfeife reden wir?“
Er blätterte zu Seite 4 und zeigte ihr das Foto seines vermissten Schatzes. „Tabak. Du weißt schon, Teer und Nikotin.“
„Und wann hast du besagte Pfeife an das R.O.M. gespendet?“
Er ließ sie, das Foto betrachtend, stehen und ging zum Küchenschrank, um eine Dose Maxwell House Kaffee herauszuholen. Er hatte für heute genug von dem Gourmetzeugs. Er schaltete den Wasserkocher wieder ein und gab das Kaffeepulver in einen neuen Filter. Colleen wedelte mit der Zeitung und runzelte die Stirn. „In der Bildunterschrift steht, dass diese außergewöhnliche Darstellung eines Seetauchers möglicherweise der wertvollste Gegenstand in der Ausstellung indigener Objekte des R.O.M. gewesen ist. Ist das eine Übertreibung?“
„Wahrscheinlich nicht.“
„Du hast mir immer noch nicht erzählt, wie du zu dieser Pfeife gekommen bist und wann du sie weggegeben hast.“
„Ich hätte nicht auf meinen Vater hören sollen. Ich hätte sie verdammt nochmal behalten sollen.“
„Das meinst du nicht ernst.“
„Warum nicht? Wer es findet, darf es behalten.“
„Aber sicherlich… “
„Das R.O.M. hat augenscheinlich nicht gerade die beste Arbeit geleistet, was das Aufpassen angeht.“
Neben der Wut über den Diebstahl konnte er spüren, wie die Aufregung über seinen damaligen Fund seinen Puls erhöhte, als ob es gestern gewesen wäre und nicht schon fünfzehn Jahre her. Er hatte etwas beinahe Perfektes besessen – diesen kleinen Vogel, der auf einem ovalen Steinblock saß und gerade einmal so groß war wie ein halbes Kartendeck. Die ganze Pfeife war aus einem einzigen Stück anthrazitgrauem Pfeifenstein gefertigt.
Er formte seine rechte Hand zu einer Schale, um Größe und Form zu imitieren. „Als ich den kleinen, geschmeidigen Burschen das erste Mal in der Hand hielt, fühlte er sich… das ist schwer zu erklären, aber er fühlte sich so anschmiegsam und… lebendig an. Ja, lebendig. Ich könnte schwören, dass ich seinen Herzschlag spüren konnte, und seine granatroten Augen durchbohrten mich.“
Colleen schaute auf, verdutzt über diesen untypischen Ausbruch von poetischem Enthusiasmus. „Wurde sie täglich geraucht oder war sie nur zur Zierde?“
„Ich habe nicht den Hauch einer Ahnung.“
„Herrgott, Zol. Sicherlich hat irgendein Anthropologe eine Doktorarbeit über dieses Thema geschrieben. Hast du dich denn nie erkundigt?“
Er zuckte mit den Schultern und fühlte sich wie ein ungebildetes kleines Kind, das auf einer Tabakfarm am Rande der Zivilisation aufgewachsen war. Sein Vater hatte ihm reichlich über Geschichte und Anbau von Tabak beigebracht, doch Kulturanthropologie war nie sein Ding gewesen.
„Mein Tipp wäre“, fuhr sie fort, „dass etwas so Exquisites nicht jeden Tag zum Rauchen genutzt wurde. Vielleicht nur bei Schamanen? Um mit der spirituellen Welt zu kommunizieren?“
Er goss das kochende Wasser über den Maxwell House. „Alles, was ich weiß, ist, dass das British Museum fast einhundert weitere ähnliche Pfeifen hat. Eine Menagerie aus Steinbildnissen – Sperlinge, Frösche, eine Katze, ein Otter. Aber keine Seetaucher.“
„Außergewöhnlich! Wie sind sie an die herangekommen?“
„Ausgegraben.“
„Wo?“
„Ohio.“
„Sie haben sie von Ohio nach London verschifft? Aus irgendjemandes Garten in Cleveland den ganzen Weg nach Bloomsbury??“
Als professionelle Privatdetektivin war Colleen stets fasziniert von dem Sonderbaren und hatte einen natürlichen Riecher für das Absurde; man überlebte die Kindheit während der Apartheid in Südafrika nicht – wo sie im Fahrerhaus des Trucks ihres Vaters saß, während ihre schwarzen Spielkameraden hinten auf der ungeschützten Ladefläche mitfuhren – ohne eine gewisse Sensibilität für die Ironie des Lebens zu entwickeln.
„Eine lange Autofahrt von Cleveland entfernt“, erwiderte er, „fast bis runter zum Ohio River. In zwei Grabstätten der Aborigines.“
„Und dort hast du auch deine gefunden? Im Outback von Ohio? Und sie dann hierher geschmuggelt?“
Er schüttelte den Kopf, dann begann er, zu erzählen.
Er hatte die Seetaucherpfeife begraben in einer entlegenen Ecke auf dem Farmgelände seiner Familie gefunden. Er war ungefähr zwanzig Jahre alt gewesen und hatte mit dem Metalldetektor seines Vaters gespielt. Sein Vater benutzte das selbstgebaute Gerät, um alte Münzen und ähnliches an den Ufern des Lake Erie zu finden. Zol hatte sich nie für dieses Hobby begeistern können; doch eines Samstagabends, als er von der Kochschule nach Hause kam, hatte er nichts Besseres zu tun. Die Tabaksaison war vorüber und er hatte jede Aufgabe auf der Liste der Hausarbeiten abgehakt, die sein Vater immer für ihn bereithielt. Zol alberte mit dem Detektor herum, als dieser plötzlich über einem Flecken Erde zu piepsen begann. Er holte eine Schaufel aus der Scheune und grub etwas aus, das sich als ein rostiger Tresor herausstellte. Er brach ihn auf und fand den Seetaucher, eingewickelt in ein Tuch. Er hatte keine Ahnung, was er in der Hand hielt, doch sein Highschool-Lehrer an der Simcoe Composite erkannte die signifikante Bedeutung des Gegenstandes sofort und vermittelte Zol an das Royal Ontario Museum in Toronto.
„Die Briten haben etliche Pfeifen, die so ähnlich sind wie diese?“, fragte Colleen und zeigte auf das Foto in der Zeitung. „Und sie alle sind zweitausend Jahre alt?“
Er hat nie verstanden, wie die Briten es geschafft haben, einen Haufen unbezahlbarer Artefakte zusammenzuschaufeln und nach London zu bringen, ohne dass die Amerikaner einen riesigen Aufstand gemacht haben.
„Und aus einem Material namens Pfeifenstein gehauen“, erklärte er. Die Verarbeitung der antiken Pfeife war so ausgezeichnet wie die besten modernen Inuit-Schnitzereien, die in den nobelsten Kunstläden verkauft wurden. „Die Pfeife passt in deine Handfläche. Ihr seid Angesicht zu Angesicht und seine Augen bohren sich in deine, wenn du einen Zug durch das Loch nimmst.“
„Hast du es jemals probiert?“
„Ein paar Mal.“
Sie musterte das Foto noch einmal und sagte dann: „Beeindruckend, sich vorzustellen, dass die Indianer seit zweitausend Jahren Tabak rauchen.“
Er zuckte zusammen. Trotz ihres melodischen Akzentes überkam ihn ein unangenehmes Schaudern. Er vermied es, das Wort Indianer zu verwenden, insbesondere jetzt, wo er eine Person der Öffentlichkeit war und dementsprechend die Interessen einer multi-ethnischen Gesellschaft vertrat und unter dauerhafter öffentlicher Beobachtung stand. Nur die Regierung klammerte sich noch an diesen veralteten Begriff und benutzte ihn weiterhin zur Benennung der indigenen Bevölkerungsgruppen Kanadas. Die Behörden nannten die Landabschnitte, die für eben diese Bevölkerungsgruppen bestimmt waren, Indianerreservate. Den kanadischen Bürgern war dieses Thema so unangenehm, dass keiner wusste, wie man sie sonst nennen sollte. Political Correctness sabotierte einen konstruktiven Dialog und strangulierte den gesunden Menschenverstand. Am Ende nannte man sie indigene Völker, Ureinwohner, Aborigines, First Nations, Métis, Inuit, Mohawk, Algonkin, Ojibwa, Anishinaabeg, Cree, Dene, Haida – oder man verwendete den Namen irgendeines anderen Stammes. Spielte das überhaupt eine Rolle, solange man respektvoll war?!
„Die ursprüngliche Tabaksorte war Nicotiana Rustica“, sagte er, um bei dem weniger heiklen Thema der Biologie des Tabaks zu bleiben, wie es ihm sein Vater beigebracht hatte. Gaspar Szabo war im Anbau überaus erfolgreich, denn er nutzte die Wissenschaft, um ertragreiche Ernten seines Produktes von höchster Qualität einzufahren. „Die damalige Pflanze war stärker als die modernere Version und höchstwahrscheinlich Schamanen und Stammesältesten vorbehalten.“
Er erklärte, dass der Tabak der Ureinwohner vor der ersten Begegnung mit den Weißen eine beinahe tödlich hohe Nikotinkonzentration und eine ungewisse Anzahl an Halluzinogenen beinhaltete. Es musste ein ziemlich heftiger Trip gewesen sein, diesen Tabak zu rauchen: psychedelische Visionen in Begleitung von rasendem Herzschlag, geweitete Pupillen und triefender Schweiß. Europäer fanden eine schwächere Sorte, als sie auf Bermuda landeten, vielleicht war es auch Bolivien – je nachdem, welches Geschichtsbuch man las. Wie dem auch sei, Nicotiana Tabacum war weitaus weniger belastend für das Herz und das Nervensystem und nicht halluzinogen, doch genauso süchtig machend. Die Europäer eigneten sich diesen uralten Brauch bald an und machten daraus eine weltweite Megaindustrie. Und die Regierungen versteuerten sie wie verrückt.
„Kein Wunder, dass die Schamanen der Ureinwohner wie von Geistern besessen schienen“, sagte Colleen, „mit all dem starken Dope und der zusätzlichen Sucht nach Nikotin, mussten sie ja quasi die ganze Zeit halb zugedröhnt durch die Gegend gelaufen sein.“ Sie hob ihre Tasse und nahm einen Schluck von dem Maxwell House; ihre Augen leuchteten vor Befriedigung. Sie stand ihm in Punkto Koffeinabhängigkeit in nichts nach. Nach einem Moment der Überlegung fragte sie: „Aber wie ist dein Seetaucher von Ohio nach Ontario gekommen?“
„Gestohlen und dutzende Male gehandelt, würde ich tippen. Erst zwischen Ureinwohnern, dann haben sich die Europäer eingemischt.“ Sie schenkte ihm dieses Lächeln des Verständnisses, dass er anfing, so sehr zu lieben.
Nach der turbulenten Zeit mit seiner Ex Francine und den darauffolgenden Jahren erfolglosen Datings war es wundervoll, eine bezaubernde, smarte, liebevolle und starke Frau an seiner Seite zu haben, die ihn so gut verstand und die ihre Wertschätzung sowohl innerhalb, als auch außerhalb des Schlafzimmers zum Ausdruck brachte. Es stimmte zwar, dass er es ermüdend fand, wenn sie ihn mit bohrenden Fragen löcherte, doch wenn das ihr größter Makel sein sollte…
Max, der mittlerweile zehn war, hatte vor einigen Wochen gefragt, ob er Colleen einen besonderen Namen geben dürfe, da sie ja nun fast ein Teil der Familie war. Nicht Mutter oder Mama, hatte Max gesagt, denn er hätte ja bereits eine richtige Mutter, die auf den richtigen Moment für einen Besuch wartete. Vor Sorge, in einem Traum zu leben, der gewiss bald irgendwie enden würde, hatte Zol das Thema gewechselt. Woran lag es, dass sich die Frauen von ihm abwandten, sobald sie ihn besser kannten? Sollte er sich jemals daran erinnern, wie man betete, würde er auf die Knie fallen und Gott anflehen, dass es dieses Mal mit Colleen anders sein wird.
„Wenn ich so darüber nachdenke“, fuhr sie fort, „hatte der kleine Seetaucher einige Jahrtausende Zeit für seine Reise. Scheint, als hätte man sich währenddessen gut um ihn gekümmert. Außergewöhnlich. Keine Sprünge im Schnabel und sein Schwanz ist ebenfalls heil.“
„Das hat mein Geschichtslehrer auch gesagt. Man hat ihn wohl mit dem selben Respekt behandelt wie die britischen Kronjuwelen.
„Hast du den Besitzer des Tresors ausfindig machen können?“
„Hergestellt in Sheffield, England. Mitte des 18. Jahrhunderts. Das ist alles, was wir herausfinden konnten.“
Sie drehte ihren Kopf, um einen Blick auf die Zeitung zu werfen.
„Was hat es mit dieser Legende auf sich? Eine zweite, beinahe identische Pfeife befindet sich irgendwo dort draußen und wartet darauf, Großes zu vollbringen, wenn die beiden wieder vereint werden?!“
Die Eingangstür öffnete sich und schloss mit einem Knall. Zol hörte es zweimal poltern, als jemand seine Schuhe auszog. Das Parkett quietschte unter sich nähernden Schritten. Einige Sekunden später platzte Hamish Wakefield durch die Küchentür. Er war durchnässt und mit Seifenblasen übersät.
Kapitel 3
Bei dem ersten Anflug des Geruchs von Seifenblasen, den Zol vernahm, stimmten die Beatles gefühlt zehn Strophen von Hey Jude an, und er schaute zu, wie Hamishs Jacke und Hose auf dem Boden eine Wolke aus Schaum bildeten. Der Duft des Reinigungsmittels des Maxi-Wash drei Blocks weiter auf der Garth Street war unverwechselbar.
Der eifrige Assistenzprofessor der Caledonian University – und einer von Hamiltons Top-Diagnostikern – sah aus, als hätte man ihn aus den Niagarafällen gefischt.
„Gütiger Gott, Hamish“, sagte Colleen und half ihm beim Ausziehen seiner durchnässten Jacke, „wo in aller Welt hast du dich herumgetrieben?“ Sie holte zwei Handtücher aus einer Schublade, warf Hamish eines davon zu und wickelte seine triefnasse Jacke in das andere. „Bitte erzähl mir nicht, dass du mit offenen Fenstern durch die Waschstraße gefahren bist?!“
Hamish warf ihr einen Blick zu der sagte: Mach mal halblang, so dämlich bin ich nun auch wieder nicht. „Die Schiene hat geklemmt“, sagte er durch blaue Lippen und klappernde Zähne hindurch.
Zol presste eine Hand auf den Mund, um das aufkommende Lachen zu unterdrücken. Er traute sich nicht, auch nur ein Wort zu sagen; Hamish fühlte sich schnell angegriffen und sein minimalistischer Sinn für Humor schloss seine Person selbst eh niemals mit ein.
„Du warst also im Saab eingesperrt?“, fragte Colleen, „während die Wasserstrahlen und Walzen eingeschaltet waren?“
Hamish rollte mit den Augen und wandte sich von Colleen ab, die gerade versuchte, ihn von seinem durchweichten Hemd zu befreien. „Ich habe gehupt und gehupt.“ Er warf einen Blick auf seine Uhr. „Ich saß dort dreißig Minuten und niemand kam. Also bin ich letztendlich ausgestiegen.“ Er fasste sich mit der Hand in den Nacken und verzog das Gesicht beim Anblick des pinken Seifenschaums. „Ultrawax.“ Er fuhr sich nervös durch seinen Flattop. Ausnahmsweise waren seine Haare einmal nicht perfekt. Er tastete seine Hosentaschen ab und sein Gesichtsausdruck wurde starr vor Schreck. „Die Schlüssel! Shit! Sie stecken noch in der Zündung!“
„Ich bin sicher, man wird sich gut um dein Auto kümmern“, besänftige Colleen ihn, „ich meine, es ist ja schon beinahe ein Mitglied der Familie.“
Erkannte Hamish die Ironie dieser misslichen Lage? Wahrscheinlich nicht – er war viel zu sehr außer sich, um darüber lachen zu können – doch er war Maxi-Washs bester Kunde. Wer sonst ließ sein Auto ein halbes Dutzend Mal pro Woche in einer Waschanlage reinigen?! Natürlich war Hamish`s Angst, was sein Auto anging, nachvollziehbar. Der Saab wurde erst vor ein paar Monaten draußen vor einer Schwulenbar gestohlen, während er seine ersten Erfahrungen mit exzessivem Alkoholkonsum machte. Als die Polizei das Fahrzeug gefunden und zurückgebracht hatte, ließ er es umlackieren, die Polster reparieren und den Teppich desinfizieren.
Zol verkniff sich das Lachen und biss konzentriert die Zähne zusammen, dann überredete er Hamish dazu, mit nach oben zu kommen und trockene Klamotten anzuziehen. Wie zu erwarten war, scheute sich Mr. Penibel, bis Zol ihm versicherte, dass das Karo-Hemd, das blaue Jays-Sweatshirt und die Hose, die er ihm anbot, frisch gewaschen waren. Zol räumte ein, dass die Hosenbeine etwas zu lang seien, doch versicherte er Hamish, dass man sie sicher ganz leicht hochkrempeln könnte.
Zurück in der Küche, gab Colleen Hamish eine Tasse heißen Kaffees und entschuldigte sich, bevor sie ging, um sich umzuziehen. Hamish ließ sich auf einen Stuhl fallen und trank wortlos; die glühende Röte auf seinen Wangen verriet seine Scham. Es gab zwei Dinge, die Hamish mehr als alles andere auf der Welt hasste: falschzuliegen und dämlich auszusehen. In sozialer Hinsicht war er der Zinnmann; größtenteils ahnungslos gegenüber den Gefühlen seiner Mitmenschen und unbeholfen, was heiteres Geplänkel anging. Manchmal machte er taktlose Witze, die wirklich saßen. Er hatte keine Ahnung, dass sie verletzend waren. Zol erklärte sich dieses Verhalten mit seiner einsamen Kindheit als Streber – keine Geschwister, nur wenige Freunde, Eltern, die sich durchgehend zankten...
Hamish trank seinen Kaffee aus und stellte die leere Tasse mit einem Klirren auf dem Tisch ab. Er schaute finster. „Du hättest rangehen sollen, als ich dich angerufen habe.“
„Mal langsam“, erwiderte Zol. Der Ton dieses Kerls klang etwas zu fordernd dafür, dass er Zols Lieblingssweatshirt trug und sich in der Wärme seiner Küche aalte. Doch er musste zugeben, es war eine Erleichterung, Hamish wieder mit seiner normalen Stimme sprechen zu hören. Dieses krächzende Flüstern, mit dem er einige Jahre lang geplagt gewesen war, war auf ebenso mysteriöse Weise verschwunden, wie es gekommen war. Colleen hatte wahrscheinlich recht – die gebrechliche Stimme war so eine Art psychosomatische Manifestation seiner Angst bezüglich der unter Verschluss gehaltenen Homosexualität. Jetzt, wo er geoutet war und er und Al Mesic offiziell liiert waren, war Hamish’ Stimme in vollem Umfang zurückgekehrt.
„Gestern, den ganzen Tag“, sagte Hamish, „und nicht ein einziges Wort von dir.“
„Ich war in Simcoe und bin erst spät wieder nach Hause gekommen.“ Hatte Hamish seinen neuen Job vergessen? Er hatte jedenfalls nicht im Büro in Simcoe angerufen, so viel stand fest. Seine neue Sekretärin, effizient und zuvorkommend, hätte es nicht versäumt, eine Nachricht weiterzugeben.
Hamish kratzte an dem gelben Fleck am Ärmel des Sweatshirts, dann rollte er den Bund zurück, um den Schandfleck zu verstecken. Das Blue Jays-Logo auf seiner Brust wirkte fehl am Platz. Er war aller Wahrscheinlichkeit nach noch nie bei einem Baseballmatch gewesen und hatte einen senftriefenden Hot-Dog dazu gegessen.
„Nächstes Mal“, sagte Zol zu ihm, „kontaktiere mich über mein BlackBerry. Das Ding findet mich überall.“
Das BlackBerry war das Gerät, mit dem Sergeant Major Peter Trinnock Zol auf Trab hielt. Ihr dreijähriges Arbeitsverhältnis war eine Pandora-Box komplizierter, stiller Übereinkünfte. Beide waren sich der Tatsache bestens bewusst, dass Trinnock ohne einen Untergebenen mit dreißig Jahren weniger Berufserfahrung, der seinen Kopf hinhielt, nicht weiterkommen würde. Trinnock geriet jedes Mal in Panik, wenn der Bürgermeister, die Presse oder ihr politisch ambitiöser Boss Elliot York anrief. Zol blieb ruhig – zumindest nach außen hin – und versuchte, so gut es ging den Fettnäpfchen auszuweichen. Er musste kichern, wenn er daran dachte, dass Trinnock seine Drei-Martini-Mittagessen aufgeben musste, jetzt, wo Zol in Simcoe feststeckte. Aber würde er das wirklich tun?
Hamish stand auf und begann, zwischen dem Herd und dem Küchentisch auf und abzugehen. „Es gibt da ein paar Dinge, die ich dir unbedingt erzählen wollte. Als erstes wären da meine fünfzehn Fälle atypischer Hautläsionen.“ Es ging ihm offensichtlich besser. Ein spannendes medizinisches Dilemma stimmte ihn immer heiter. „Hiermit erstatte ich darüber Bericht… du weißt schon, offiziell. Ein faszinierender Krankheitsausbruch für dich und dein Team.“
Wie jeder andere Zuständigkeitsbereich auch, verlangte die Provinz Ontario von ihren Medizinern, dem lokalen Gesundheitsamt vom Auftreten bestimmter ansteckender Krankheiten zu berichten. Zol hatte spezielles Personal – Inspektoren und Krankenpfleger –, die die Anrufe von Ärzten und Laboratorien entgegen nahmen. Hamish bestand jedoch darauf, Zol direkt Bericht zu erstatten. Obwohl Zol sich von solch einer Loyalität geehrt fühlte, wäre es ihm am liebsten gewesen, Hamish würde ganz einfach eine Nachricht auf seinem Anrufbeantworter hinterlassen, wie jeder andere auch.
„Also, was hast du?“, fragte Zol.
„Ich nenne es Lippen – und Fingerausschlag.“
„Du meinst wie die Hand-Fuß-Mundkrankheit? Coxsackievirus?“
Infektionen, wie beispielsweise Syphilis, Influenza und Meningitis, hatten oberste Priorität, denn sie konnten, wenn nicht rechtzeitig behandelt, schwerwiegende Folgen haben. Diese Lippen– und Fingersache klang nicht allzu ernst. Warum war Hamish also so besorgt? Vor allem an einem Samstagmorgen?
„Nein, das habe ich ganz und gar nicht gemeint.“ Hamish wedelte mit seinem nervigen Zeigefinger, als wäre er ganz im Professoren-Modus. „Viel größere Blasen, die länger bleiben als beim Coxsackie. Wochen über Wochen.“ Er winkte Zols Vermutung ab, sichtbar pikiert über dessen Abwetung. „Ich habe die Kulturen gleich am Sonntagmorgen auf Coxsackie getestet, und sie sind negativ.“
„Könnten die Blasen herpetisch sein?“, fragte Zol.
„Daran habe ich als erstes gedacht. Herpes Simplex: negativ.“
„Vielleicht Gürtelrose?“
„Das meinst du nicht ernst! Läsionen an den Fingern und Lippen gleichzeitig? Unmöglich. Wie auch immer, die Kulturen sind negativ auf VZV getestet worden.“
Hamish’ Auftreten hatte sich in den letzten paar Minuten transformiert. Aus Smalltalk wurde Ernst, und der sozial unbeholfene Zinnmann war verschwunden. Jetzt lief eine kleinere, blonde Version von Oscar Wilde mit überschwänglichem Selbstbewusstsein in der Küche auf und ab. Zol stellte sich vor, wie Professor Hamish Wakefield die Straßen im viktorianischen London entlangstolzierte, einen Gehstock in der Hand und einen Umhang über den Schultern.
„Selbstverständlich, du hast Recht“, beschwichtigte Zol, „was ist mit einer allergischen Reaktion? Kontaktdermatitis. Eine Pflanze vielleicht?“
„Komm schon, Zol. Die Saison für Gift-Efeu oder -Eiche ist schon lange vorüber.“
„Immer mit der Ruhe.“ Hamish musste daran erinnert werden, dass er nicht der einzige kompetente Arzt im Raum war. „Hast du Feuerholz in Betracht gezogen?“
Zol hatte vor einiger Zeit eine Infektion mit Gift-Efeu diagnostiziert, obwohl es eigentlich die falsche Jahreszeit dafür gewesen war. Es war mitten im Winter und der Patient ein Bauer mit einem Ausschlag auf seinen oberen Gliedmaßen; Blasen, die Wochen brauchten, um zu verheilen, und für die keiner der hinzugezogenen Ärzte eine Erklärung hatte. Zol diagnostizierte, dass es sich um Gift-Efeu handelte, welcher während des Feuerholzhackens in Kontakt mit der Haut des Patienten geraten war. Der Holzstapel des Mannes war im Sommer mit Ranken des Efeus bedeckt gewesen und hatte sein toxisches Harz zurückgelassen, bevor er im Herbst einging. Er war noch immer stolz auf diesen kleinen Triumph.
„Nein“, fauchte Hamish, „das habe ich nicht. In den meisten Fällen handeltet es sich um dürre Teenagerinnen. Ich bezweifle, dass die sich mit Äxten auf Holzstapel gestürzt haben.“
„Was ist mit Herkuleskraut? Dem Zeug haben wir schließlich dutzende Anrufe auf unserer Hotline zu verdanken.“
Herkuleskraut oder auch Riesen-Bärenklau – ein relativ neuer Eindringling aus China – sah aus wie eine gigantische Version der Spitze der Königin Anne, einer filigranen Wildblume, bei der niemand dem Drang widerstehen konnte, sie zu pflücken. Wenn der Saft des Herkuleskrauts mit der Haut in Kontakt kam, verursachte er große, schmerzhafte Blasen, sobald die betroffene Stelle dem Sonnenlicht ausgesetzt war. Das örtliche Gesundheitsamt hatte die Öffentlichkeit aufgerufen, sich von der Pflanze fernzuhalten, und hatte auch auf ihrer Website die Bürger darum gebeten, sich bei Sichtung des Krautes bei ihrem jeweiligen Rathaus zu melden.
„Ich habe eure Poster und Merkblätter gesehen“, erwiderte Hamish, „aber ein Ausschlag, der durch Herkuleskraut verursacht wurde, bricht an den Stellen aus, die mit dem Kraut in Berührung gekommen sind. Nicht lokal konzentriert an Lippen und Fingerspitzen. Außerdem lassen sich die Symptome des Herkuleskrautes mit Steroiden lindern. Diese Läsionen reagieren auf gar nichts.“
Zol schaute auf seine Uhr. Es wurde langsam Zeit, Max abzuholen. Er hatte bei Travis übernachtet, und die beiden hatten garantiert einen Videospiele-Marathon bis spät in die Nacht hinter sich.
„Hast du es mit einer isolierten Personengruppe zu tun?“, fragte Zol. Er hoffte nicht. Mitarbeiter des Gesundheitsamtes waren verpflichtet, unverzüglich zu handeln, wenn es um Wohn-, Alten –, Pflegeheime oder ähnlich eingegrenzte Bereiche ging. Ungeachtet ihrer privaten Wochenendpläne.
„Isoliert nicht, nein. Aber einige ihrer Postleitzahlen liegen dicht bei einander.“
„Ach ja?“
Hamish strahlte. Er liebte es, Diagnosen hinterherzujagen; sei es ein einzelner Patient mit Symptomen, bei denen andere Ärzte nicht weiterwussten, oder eine Ansammlung von Fällen, die drohten, sich zu einer Epidemie auszuweiten. „Einige Fälle kommen aus Hamilton, die anderen leben direkt in deinem neuen Zuständigkeitsbereich, Dr. Szabo. Simcoe und ein paar Dörfer in den Provinzen Brant und Norfolk. Klasse, oder?
„Oh, großartig.“
„Ich würde sagen, jetzt, wo du der Boss bist, können wir beide den Startschuss für eine großangelegte Untersuchung geben.“
Zol schüttelte den Kopf. Ausbrüche von Kontaktdermatitis waren auf der Liste seiner Zuständigkeiten zu weit unten angesiedelt, um auch nur darüber nachzudenken. Hamish sollte sich dessen bewusst sein.
„Warum nicht?“, fragte Hamish.
„Um Himmels Willen, ich bin ein Beamter, kein Magier. Deine vermeintliche Epidemie steht nicht auf der Liste meldepflichtiger Erkrankungen, und es gibt nichts, was mein Personal bei einem nicht infektiösen Ausschlag, der kein Risiko für die öffentliche Gesundheit darstellt, tun kann. Das Ministerium hat sowieso schon einen dicken Hals, weil wir unsere Nase in jede noch so irrelevante Gesundheitsangelegenheit stecken, die uns über den Weg läuft. Wir haben dafür einfach nicht die notwendigen Ressourcen.“
Hamish riss sich Zols blaues Jays-Sweatshirt herunter und schmiss es über die Lehne eines Stuhls. Dann, als wäre er misstrauisch gegenüber des geliehenen Hemdes, das er darunter trug, richtete er den Kragen und überprüfte die Knöpfe. Als er seinen Kopf hob, traf er Zols Blick. „Würde es einen Unterschied machen, wenn zwei der Fälle, beides Teens aus Norfolk County, gestern Morgen gestorben wären?“ Die Pupillen in seinen babyblauen Augen weiteten sich. „Gelb von Kopf bis Fuß aufgrund akuten Leberversagens.“
Kapitel 4
Colleen huschte in die Küche. Sie sah umwerfend aus in ihrer weißen Bluse, einer flippigen, mehrfarbigen Strickweste, Designerjeans und ihrer Lieblingskette mit einem silbernen Elefantenanhänger, der über ihrer Brust baumelte. Die durchdringende Intelligenz in den Augen des Tieres war Zol zuvor noch nie aufgefallen. Normalerweise führte ihn der Rüssel direkt in ihr Dekolleté und dessen erhabenes Versprechen von warmer Geborgenheit und duftenden Jasmins. Doch in diesem Moment fühlte er nicht die übliche glühende Leidenschaft, sondern viel mehr das kalte Empfinden einer undefinierbaren Furcht.
Hamish’ fünfzehn Fälle einer mehr oder weniger harmlosen Hautkrankheit waren halb so wild. Es war vielmehr die zweite Hälfte der Geschichte, die Hamish mit dem für ihn typischen Feuers erzählte, die Zols Hände in Eisblöcke verwandelte. Bei fünf Teenagern aus vier verschiedenen Dörfern in Norfolk County, Zols neuem Zuständigkeitsbereich, war innerhalb der letzten Tage akutes Leberversagen festgestellt worden. Zwei von ihnen waren gestorben. Die drei anderen waren auf dem besten Wege dahin. Vorläufige Tests hatten die üblichen Ursachen infektiöser Hepatitis ausgeschlossen, also war es wahrscheinlich kein Virus oder Parasit. Es klang nach einer Vergiftung. Doch was kam infrage? Designerdrogen? Die Wasserversorgung? Hatten die Jugendlichen möglicherweise mit Pflanzenschutzmitteln herumprobiert? Mit Pestiziden?
„Ist er weg?“, fragte Colleen.
„Maxi-Wash hat angerufen. Der Saab ist okay. Sie haben ihn abgeholt und sich tausendfach entschuldigt.“
„Die sollten ihm besser einen Haufen Gratiswäschen ausgeben.“
„Ich kann mir nicht vorstellen, dass er jemals wieder dorthin gehen wird. Du weißt doch, wie er ist.“
Hamish hatte ein bemerkenswertes Gedächtnis. Er konnte sich nicht nur an die lateinischen Namen einer Vielzahl von Mikroorganismen erinnern, er vergaß es außerdem niemals, wenn ihm Ungerechtigkeit widerfuhr oder er gekränkt wurde.
Colleen berührte Zols Arm. „Bist du okay? Du siehst… “
„Hamish hat gerade zwei seiner diagnostischen Rätsel mit mir geteilt.“ So nannte Hamish sie. In der Öffentlichkeit würde er sie „Herausforderungen signifikanter Natur in Bezug auf die öffentliche Gesundheit“ nennen müssen. Hier, in seiner Küche, fühlten sie sich wie Feuerproben an. „Und sie beide scheinen Bezug zu Simcoe zu haben.“
„Deine ersten großen Fälle da unten.“
Er erzählte ihr das bisschen, das er von Hamish über die Kinder mit den zerstörten Lebern wusste, ihre Augen und Haut leuchtend gelb.
„Was nun?“, fragte sie.
Er wischte sich den Schweiß aus dem Nacken. „Es ist schwer zu sagen, wo am besten anzufangen ist. Natasha ist das Wochenende über nicht in der Stadt.“
Natasha Sharma war mit noch nicht einmal dreißig Jahren das hellste Licht beim Hamilton-Lakeshore-Gesundheitsamt. Zol hatte der Entsendung nach Simcoe nur unter der Bedingung zugestimmt, dass Natasha ihm zugeordnet werden würde und zur Verfügung stand, wann immer er sie brauchte. Mit einem Master in Epidemiologie und einem detektivartigen Riecher für fallrelevante Details, war sie eine brillante Epidemie-Jägerin. Sie hatte Charme und Hingabe, außerdem war sie in der Lage, unabhängig zu arbeiten und sich um sich selbst zu kümmern.
„Die Arme ist irgendwo in Toronto, bei so einer Hindu-Hochzeit der Art, wie ihre Mutter es sich auch partout für sie wünscht.“
„Hat sie nicht etwas mit einem Griechen am Laufen? Einem Assistenzarzt?“
Der attraktive Dr. Kostos Stefanopoulos war dunkelhäutig genug, um ihn zu Anfang vor Natashas Eltern als verwestlichten Punjabi durchgehen zu lassen, ein Waise ohne Anschluss an seine Hindufamilie, in Kanada gestrandet. Das klappte eine Weile, doch ihre Mutter hatte einen Nervenzusammenbruch, als Kostos rausrutschte, dass er Messdiener in der griechisch-orthodoxen Kirche in East Toronto gewesen war. „Ja, aber das hält ihre Mutter nicht davon ab, dafür zu beten, dass Natasha eines Tages zur Vernunft kommen und mit einem netten Punjabi-Ingenieur sesshaft werden wird.“
„Irgendetwas sagt mir“, erwiderte Colleen, „dass ihre Mutter enttäuscht sein wird.“
„Ich habe Hamish auf die Lebersache angesetzt, bis Natasha am Montag zurückkommt.“ Hamish war genauso leidenschaftlich wie Natasha, wenn es um Epidemiebekämpfung ging, und da das offiziell nicht Teil seines Jobs an der Caledonian University war, war er jedes Mal entsprechend aufgeregt, wenn Zol ihn darum bat, als sein Sonderberater bei einem Fall des Gesundheitsamtes zu fungieren. „Er gibt mir in ein paar Stunden ein Update. Vielleicht hat er dann etwas, mit dem wir arbeiten oder zumindest brainstormen können.“
Sie schenkte beiden ein Glas Orangensaft ein und bedeutete ihm, sich zu setzen. „Hier“, sagte sie, „nimm einen Schluck davon.“ Sie nickte in Richtung der Globe and Mail, die noch immer ausgebreitet auf dem Küchentisch lag. „Du warst gerade dabei, mir von deinem Seetaucher und der Legende zu erzählen, dass es noch einen zweiten geben soll, der dazu passt.“
„War ich das?“ Sollte in der uralten Geschichte auch nur ein Funken Wahrheit stecken, würde das unvorstellbare Auswirkungen haben. Es war besser, nicht weiter darauf einzugehen. „Es ist nichts. Nur ein alberner Hype.“
„Komm schon.“
Er runzelte die Stirn und schüttelte den Kopf. Obwohl ihm die Legende von dem enthusiastischen Kurator des R.O.M. erzählt wurde, dem er fünfzehn Jahre zuvor seinen Seetaucher überlassen hatte, fühlte es sich irgendwie entwürdigend an, dieses außergewöhnliche Artefakt mit Aberglauben in Verbindung zu bringen. Abgesehen davon war diese uralte Geschichte in Anbetracht des Ausbruchs einer Krankheit, die bei diversen Teenagern in Norfolk Leberversagen verursacht hatte, absolut nebensächlich.
„Meine Güte, Zol. Alles, das zweitausend Jahre alt ist, ist gezwungenermaßen in irgendeiner Art und Weise sagenumwoben. Das ist doch Teil des Zaubers.“ Sie blickte über den Rand ihres Saftglases. „Komm schon, du musst doch vor mir nichts geheim halten.“
Wenn man es so sah, wurde mit dieser Erzählung dem Werk eines uralten Künstlers vielleicht wirklich nur ein wenig harmlose Mystik verliehen. Er trank sein Glas in drei großen Schlucken aus und erzählte ihr von den zwei Seetaucherpfeifen, denen nachgesagt wurde, dass sie als Paar gefertigt worden waren.
„Aus demselben Block Pfeifenstein?“
„So behauptet man jedenfalls. Ein Männchen und ein Weibchen. Einer mit Augen aus Granat, der andere mit Augen aus schwarzem Onyx. In der Natur haben männliche und weibliche Seetaucher die gleiche Gefiederfarbe. Und ihre Augenfarbe verändert sich mit der Jahreszeit. Der Legende nach sind die beiden Pfeifen absolut identisch, bis auf ihre Augen.
„Seetaucher bleiben bis zu ihrem Lebensende treue Partner, stimmt’s?“
Er schüttelte den Kopf. „Ein beliebter Irrglaube. Vielmehr sind es mehrere aufeinanderfolgende Phasen der Monogamie, in denen sie leben.“ In der siebten Klasse hatte er an einem Projekt gearbeitet, das sich mit Seetauchern beschäftigte. Sein Interesse wurde durch das Paar geweckt, welches Jahr für Jahr an dem kleinen See brütete, der an die Tabakplantage seiner Familie angrenzte. Als Kind hatte er dort am Teich von Smith Mill zwei Seetaucher bis zum Tode kämpfen sehen. Das eine Männchen verteidigte sein Nest gegen einen Eindringling, der ein Auge auf das Nest und dem dazugehörigen Weibchen geworfen hatte. Der Gewinner gewann alles. Zol fand nie heraus, wer der Sieger war; der Nestbesitzer oder der Eindringling. Doch das war nicht weiter wichtig, Mutter Natur hatte in den Augen des Dreizehnjährigen eine neue Form von Brutalität angenommen.
„Und die Legende?“
„In der Erzählung heißt es, dass die beiden Pfeifen vereint eine Art Macht verleihen, die verschwindet, sobald sie getrennt werden.“
Colleen lächelte. Ein verträumter Blick funkelte in ihren Augen und wich dann rasch einer vor Konzentration gerunzelten Stirn. „Wer hatte sie zuletzt? Und wann?“
„Wer weiß?“
„Und von welcher Natur ist diese Macht?“
Zol antwortete nicht.
„Komm schon, ist es eine spirituelle? Eine politische? Eine sexuelle?“
Er zuckte mit den Schultern und schwieg, während er sich wünschte, er hätte die Geschichte nie erwähnt. Er hasste Aberglauben. Jahrhundertelang basierte die angewandte Medizin nicht auf logischen Schlussfolgerungen, sondern auf Mythen und Altweibergeschichten. Sein Mentor und medizinisches Idol war der berühmteste Physiker des Planeten im neunzehnten Jahrhundert, Sir William Osler. Wohin dieser auch immer ging, brachte er Medizinstudenten bei, kranke Menschen systematisch zu beobachten und Schlussfolgerungen aus den Krankheitssymptomen ihrer Patienten zu ziehen, indem sie rationales Denken anstatt Aberglauben anwendeten. Sir William, der bekannt war für seine Empathie und seinen Scharfsinn, wuchs in Dundas auf, dieser Quinoa-Hipster-Stadt, die sich in dem schmalen Tal unterhalb von Zols Wintergarten erstreckte. Wann immer er sich in einer Zwickmühle des Gesundheitswesens befand, sah er von seinem noblen, aber einsamen Hochsitz an der Stirn des mit Primärwald bewachsenen Steilhangs aus Kalkstein, den man hier The Escarpment nannte und der sich durch die Stadt schlängelte wie die Türschwelle eines Riesen, herab, und stellte sich vor, wie Dr. Osler an seinem Schreibtisch saß und bei Kerzenschein Erkenntnisse für die Ewigkeit niederschrieb. Mit dem Geld seines ersten Gehaltsschecks hatte Zol Dr. Oslers Parker-Fountain-Kugelschreiber aus dem Jahre 1895 in einem Antiquitätengeschäft in Montreal gekauft. Jedes Mal, wenn er mit seinen Fingern über den Schaft aus Ebonit und den Clip aus Sterlingsilber fuhr, war es, als ob dieser großartige Mann beinahe zum Leben erwachte. Das einzigartige Stück war ihm bei einer Auseinandersetzung mit einem verrücktgewordenen Metzger gestohlen worden. Die Polizei hatte den Stift zwar sicherstellen können, doch danach für eine Ewigkeit in der Asservatenkammer aufbewahrt, obwohl sie ihm kontinuierlich versicherten, dass er ihn bald zurückbekommen würde. Gott, hatte er diesen Kugelschreiber vermisst! Und er konnte gerade jetzt definitiv etwas von Dr. Oslers Weisheit gebrauchen.
„Um Himmels Willen, Zol. Deinem Gesichtsausdruck nach zu urteilen, geht es dabei um mehr als ein paar Seetaucher aus Stein mit irgendeiner absurden Macht.“
Er wühlte in seiner Hosentasche nach einem Loonie, der Ein-Dollar-Münze, die er immer in seiner Tasche mit sich führte, um damit herumzuspielen, wenn er nervös wurde. Die Rückseite der Münze bildete seinen Namensgeber ab, einen Seetaucher, Loon, der auf dem Wasser trieb. Er ließ die Münze durch seine eiskalten Finger rollen, warf sie von einer Hand in die andere und wieder zurück. Der Rhythmus beruhigte ihn immer. Er atmete tief durch. „Die Legende besagt, dass, wer auch immer im Besitz der beiden Seetaucher ist, über die Macht verfügen wird, alles Land zu erobern, das er mit seinem Kanu zwischen den Tagundnachtgleichen erreichen kann.“
Colleen dachte einen Moment nach. „Du meinst zwischen März und September?“
„Vor zweihundert Jahren konnten Reisende zwischen dem Frühlingstau und dem Winterfrost einen flächenmäßig sehr großen Bereich abdecken.“
„Die Franzosen?“
„Europäer und Ureinwohner. Die Entdecker und Fellhändler, die das Land geöffnet haben.“ Er dachte einen Moment lang über das nach, was er gerade gesagt hatte. Europäer, die das Land öffneten, das klang irgendwie so, als wenn der Kontinent vor ihrer Ankunft geschlossen gewesen war. Wenn geschlossen jedoch unverdorben hieß, dann hielt er es für in Ordnung, so darüber zu denken. Als Amtsarzt, dessen neuer Zuständigkeitsbereich das größte Reservat indigener Volker des Landes miteinschloss, versuchte er, sich allmählich von dem alten, eurozentrischen Kurs zu distanzieren.
„Aber wir reden vom Jetzt und Hier“, sagte Colleen, „keine Regierung wird die Macht zweier uralter Pfeifen anerkennen.“
„Natürlich nicht. Aber wenn ein Anführer irgendeines Stammes die Pfeifen jemals in die Finger kriegen sollte, könnte er sie in einer Propagandakampagne zu seinem Vorteil nutzen.“
„Wie denn?“
„Ohne selbst an die Legende zu glauben, könnte sich jemand die vermeintliche Macht der Seetaucher aneignen und zu einem pseudolegitimen Krieg aufrufen. Er könnte quer durch das Land reisen, von Reservat zu Reservat, mit den Seetauchern vor ihren Nasen herumfuchteln und indigene Stämme dazu inspirieren, sich gegen fünfhundert Jahre Unterdrückung aufzulehnen.“
„Stämme? Ernsthaft?“
„Soziologisch gesehen. Warum nicht? Guerilla-Kriegsführung, Kanada-Style. Womöglich wird es nicht viel brauchen, um sie wachzurütteln.“ Er spürte, wie er in Fahrt kam und seine Stimme lauter wurde. „Sie könnten Brücken abreißen. Highways blockieren. Kraftwerke lahmlegen. Fabriken und Regierungsgebäude sprengen.“
„Sicherlich nicht.“
„Unsere Position in diesem Land ist um einiges fragiler, als sich irgendein Politiker oder Weißer eingestehen möchte.“
Colleen umschloss den Elefantenanhänger mit ihrer Faust. Er konnte sehen, dass sie sich daran erinnerte, warum sie und ihr verstorbener Ehemann Liam, beide europäischer Abstammung, Südafrika nach der Apartheid verlassen hatten. Malte sie sich den Albtraum eines ähnlichen Szenarios hier aus, in ihrer Wahlheimat?
„Sollten indigene Gruppen den Schienenverkehr oder die Highways lahmlegen, kommen Pendler nicht mehr zur Arbeit, und Güter können nicht mehr ausgeliefert werden. Große Automobilhersteller wie Toyota oder General Motors werden die Produktion einstellen. Die USA wird die Grenzen dichtmachen. Banken, Schulen, Büros werden schließen. Keine Autoteile. Keine Cornflakes. Keine Artischocken oder Avocados.“
„Okay, okay. Schon verstanden.“ Sie überlegte einen Moment. „Also, wo ist die andere Pfeife?“
„Das weiß niemand. Wurde sie im Laufe der Jahrhunderte zerstört, oder ist sie irgendwo dort draußen und wartet darauf, wieder mit ihrem Partner vereint zu werden?“
Sie deutete auf die Zeitung. „Ist es das, worum es bei dem Bombenattentat ging? Jemand wollte die zweite Seetaucherpfeife in seinen Besitz bringen, weil er die andere hat?“
„Oder es war jemand indigener Abstammung, der glaubt, zu wissen, wo sie sich befindet.“
„Aber warum dann die Zerstörung des Kristalleingangs des Museums? So abgrundtief hässlich, wie die Kritiker behaupten, war er nun auch nicht. All das Glas und Aluminium hatten doch etwas Majestätisches.“
Zol begutachtete die Fotos der Trümmer. „Die Sprengung macht, was den Raub angeht, keinen Sinn. Die Galerie der First Nations, von wo sie die Artefakte gestohlen haben müssen, befindet sich vom Kristall aus auf der gegenüberliegenden Seite des R.O.M..“ Er kannte die Galerie gut; er hatte Max dort mit hingenommen, um ihm den Seetaucher zu zeigen.
„Du meinst“, antwortete Colleen, „sie haben den Seetaucher und einige andere Artefakte gestohlen und dann den Kristall aus reiner Bosheit in die Luft gejagt?“
Er dachte eine Weile darüber nach. „Nicht ganz“, entgegnete er dann, „Es war ein Manifest: Wir haben uns die Pfeife zurückgeholt, wir verfügen über Sprengstoff, und wir scheuen nicht davor zurück, ihn auch einzusetzen.“ Er spürte, wie sich die Furcht in ihm ausbreitete. „Sie könnten sich auf die nächste Phase vorbereiten. Züge und Brücken.“ Er umschlang die Kaffeetasse mit seinen Händen gegen den Schauder in seinen Knochen. „Das Eisenbahnnetz war schon immer ein kraftvolles Symbol europäischer Repression. Es machte das ganze Land zugänglich für Pocken und Masern. Millionen von Ureinwohnern starben durch Infektionen, ohne dass ein einziger Schuss fiel.“ Er erzählte ihr von den Prärie-Malereien aus dem neunzehnten Jahrhundert in seinem Geschichtstext in der Grundschule. Er hatte die blutigen Bilder noch genau vor Augen. „Die Züge brachten ganze Fluten von Siedlern ins Land, die den Bestand der Bisons in der Prärie beinahe vollständig auslöschten. Die Ureinwohner verhungerten zu Tausenden, da ihre komplette Lebensgrundlage von der Jagd auf Bisons abhängig war.“
Colleen erschauderte und machte die obersten Knöpfe ihrer Weste zu. „Wir sollten nichts überstürzen“, sagte sie in vorsichtigem Ton, „es gibt nichts, was du tun könntest, um den gestohlenen Seetaucher wiederzubekommen. Ist ja schließlich nicht so, als wärest du noch für ihn verantwortlich.“ Sie nahm ihr Glas in die Hand, schaute es an, als würde sie dessen Inhalt analysieren, und stellte es wieder ab. „Wie sieht es heute mit Max aus? Soll ich ihn von Travis abholen? Um wie viel Uhr sollten wir – “
Das Telefon klingelte. Zol nahm beim dritten Klingeln ab. „Hi, Papa. Ich wollte dich gerade anrufen.“ Seit seine Mutter vor zwei Monaten die Diagnose bekommen hatte, versuchte er sein Bestes, um positiv zu klingen, wenn er mit seinen Eltern telefonierte; doch schon der Anblick der Nummer auf dem Display traf ihn jedes Mal wie ein Schlag in die Magengrube. Eines Tages würde der Anruf kommen, in dem man ihm mitteilte, dass die Chemo aufgehört hatte, zu wirken, dass der Lungenkrebs außer Kontrolle geraten war. „Hast du die Zeitung von heute gelesen?“
„Deine Mutter sagt, es ist Zeit.“
Zol quetschte den Hörer in seiner Faust. Seine Knie gaben nach und er sackte in seinen Stuhl. „Oh, Papa. Nein. Wirklich?“
Gestern hatte sie noch ziemlich gut ausgesehen. Ihr Onkologe hatte buchstäblich versprochen, dass die Chemo und die Bestrahlungen gut anschlugen und sie von einer Stagnierung ausgehen könnten, die achtzehn bis vierundzwanzig Monate anhalten würde. Sie hatte immer noch sechzehn gesunde Monate vor sich. Vielleicht sogar mehr. Sie hatte bereits ausführliche Pläne für Weihnachten mit Max gemacht. Würde sie es nicht einmal mehr bis Halloween, ihrem zweitliebsten Feiertag, schaffen?
„Sie mit dir sprechen wollen“
„Worüber?“
„Sie mir nicht sagen.“
Das war kein gutes Zeichen. Seine Eltern teilten alles miteinander: ihre mitternächtliche Flucht aus Ungarn in ihrer frühen Kindheit 1956, Jahre der harten, schlecht bezahlten Arbeit auf dem Land, ihre zusammengesparten Pennies für die Anzahlung einer Farm, ihre Sorgen um Ernteschäden und Preiseinbrüche auf dem Tabakmarkt.
„Sie nur sagen, es ist Zeit, Zollie.“
Er wollte fragen, Zeit für was?, doch er bekam keinen Ton heraus. Er wollte die Antwort sowieso nicht hören. Er wusste, dass es darauf hinauslaufen würde. Seine Mutter hatte die letzte Chemotherapie schon beinahe abgelehnt. Sie war der Meinung, dass die Rückenschmerzen, die unerträgliche Übelkeit, die Erschöpfung und die Wunden in ihrem Mund sie ihrer Würde berauben würden. Der Haarverlust war für sie nicht weiter tragisch, doch sie hatte geschworen, niemals ihre Selbstachtung aufzugeben. Sie hatte sich ihren Platz in der neuen Welt eigenständig erkämpft, und sie würde ihn ausschließlich unter ihren eigenen Bedingungen verlassen, voller Stolz auf ihre Familie und deren Errungenschaften. Er dachte an den Morphium-Vorrat hinter der Bibel in ihrem Nachttisch. Sie beide taten so, als wüsste er nichts davon. „Kann sie ans Telefon gehen?“
„Sie sagen, du musst kommen. Muss dich persönlich sehen.“
„Aber können wir nicht ganz kurz reden?“
„Nein, Zollie. Du jetzt kommen.“
Kapitel 5
Zol warf einen Blick zu seiner Mutter hinüber, die neben ihm im Minivan saß. Katalin Szabo – Kitti für ihre Familie, ihre Freunde bei der Catholic Women’s League und für den ehrenamtlichen Verein des Krankenhauses – fuchtelte mit dem Taschentuch herum, das sie mit ihren knöchrigen Fingern umschloss. Ihre Augen weiteten sich bei dem Anblick der näher kommenden Schlaglöcher, und sie hielt sich an der Armlehne fest. Er bremste so sachte wie möglich ab und rollte auf die Robinson Street. Das Simcoe General Hospital ragte am Ende des Blocks auf und sah dabei aus, wie aus nicht zusammenpassenden Legosteinen zusammengebaut. Kitti umklammerte ihre Handtasche vor der Brust und beugte sich nach vorne. Verdammt, noch ein Hustenanfall. Er schluckte schwer, bremste auf Schrittgeschwindigkeit herunter und legte seine Hand auf die Schulter seiner Mutter. Als er ihren Rücken streichelte, konnte er durch den schweren Stoffmantel spüren, wie sie zitterte. Als der Anfall vorüber war, wurde es in dem Fahrzeug gespenstisch still. Mit herzzerreißender Anmut presste sie das Kleenex gegen ihre Lippen und spuckte etwas zweifellos Scheußliches hinein.