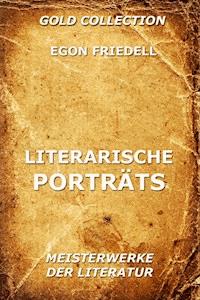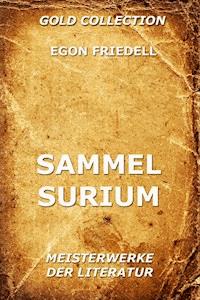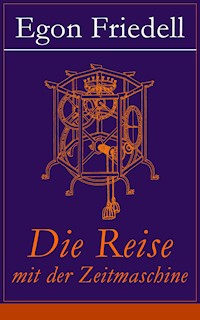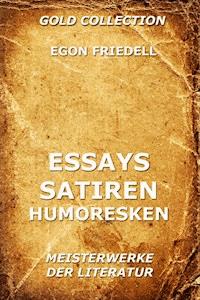
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Inhalt: Egon Friedell - Biografie und Bibliografie Essays - Satiren - Humoresken - Vom Unfug des Theaters Der Hund von Baskerville Als ich Regisseur war Was ist eine Tournee? Meine Nestroy-Vorstellung Zur Psychopathologie des Schauspielers Defekte Rezept für Kritiker Kritik an der Vorkritik Wozu noch Theaterkritik? - Theater und mehr Das deutsche Lustspiel Die Tragödie der Anpassung Das Ende der Tragödie Die steckengebliebene Poesie Kunst und Mache Kunst und Kino Nestroy Hebbel Wedekind Kainz Devrient - Kapazitäten... Die Welt im Drama Penthesilea Die Duse Tagebuch im Stile Bahrs Haresu Wie ich zu Haresu kam Aus meiner geistigen Werkstatt Das Burgtheater Kabarett Fledermaus Die Theaterstadt Wien Kitsch-Produkte Aphorismus gegen die Germanisten Goethe Der Schwager des Vulpius Drei Passanten und eine Gasröhre Pologie - Das Leben als Spiel Die Überwindung des Theaters Originalität Boheme Phantasie Büberei Die Verlängerung des Lebens Körper und Seele Das Lebensrezept Das Leben als Spiel Statt eines Epilogs
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 307
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Essays – Satiren – Humoresken
Egon Friedell
Inhalt:
Egon Friedell – Biografie und Bibliografie
Essays – Satiren – Humoresken
Vom Unfug des Theaters
Der Hund von Baskerville
Als ich Regisseur war
Was ist eine Tournee?
Meine Nestroy-Vorstellung
Zur Psychopathologie des Schauspielers
Defekte
Rezept für Kritiker
Kritik an der Vorkritik
Wozu noch Theaterkritik?
Theater und mehr
Das deutsche Lustspiel
Die Tragödie der Anpassung
Das Ende der Tragödie
Die steckengebliebene Poesie
Kunst und Mache
Kunst und Kino
Nestroy
Hebbel
Wedekind
Kainz
Devrient
Kapazitäten...
Die Welt im Drama
Penthesilea
Die Duse
Tagebuch im Stile Bahrs
Haresu
Wie ich zu Haresu kam
Aus meiner geistigen Werkstatt
Das Burgtheater
Kabarett Fledermaus
Die Theaterstadt Wien
Kitsch-Produkte
Aphorismus gegen die Germanisten
Goethe
Der Schwager des Vulpius
Drei Passanten und eine Gasröhre
Pologie
Das Leben als Spiel
Die Überwindung des Theaters
Originalität
Boheme
Phantasie
Büberei
Die Verlängerung des Lebens
Körper und Seele
Das Lebensrezept
Das Leben als Spiel
Statt eines Epilogs
Essays – Satiren - Humoresken, Egon Friedell
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849614546
www.jazzybee-verlag.de
Frontcover: © Vladislav Gansovsky - Fotolia.com
Egon Friedell – Biografie und Bibliografie
Österreichischer Schriftsteller, Kulturphilosoph, Religionswissenschaftler, Historiker, Dramatiker, Theaterkritiker, Journalist, Schauspieler, Kabarettist und Conférencier, geboren am 21. Januar 1878 in Wien, verstorben am 16. März 1938 ebenda. Eigentlicher Name Egon Friedmann. Friedell war das dritte Kind des jüdischen Seidentuchfabrikanten Moriz Friedmann und seiner Ehefrau Karoline, geborene Eisenberger. Die Mutter verließ die Familie, als Friedell ein Jahr alt war, und ließ mit ihrem Mann auch die drei Kinder zurück. Die Ehe der Eltern wurde 1887 geschieden. (Am 50. Geburtstag Friedells tauchte die Mutter bei dem nun wohlhabenden und renommierten Sohn auf und verlangte Alimentezahlungen, die dann per Gerichtsurteil erzwungen wurden.) Nach dem Tod seines Vaters 1891 lebte Egon bei einer Tante in Frankfurt am Main. Dort ging er zur Schule, wurde aber wegen ungebührlichen Benehmens nach zwei Jahren vom Unterricht ausgeschlossen. Schon in Frankfurt galt Friedell als Störenfried und Querdenker. Es folgten diverse Schulen in Österreich und Deutschland, bis er im September 1899 im vierten Anlauf in Bad Hersfeld das Abitur bestand. 1897 hatte er sich als Gasthörer an der Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin für Germanistik, Naturwissenschaften und Philosophie eingeschrieben. Nach dem Abitur wechselte er an die Universität Heidelberg, um bei dem Hegelianer und Philosophiehistoriker Kuno Fischer zu studieren. 1897 konvertierte er zum evangelisch-lutherischen Glauben. 1899 erhielt er das Erbe seines Vaters zugesprochen, so dass er nun in Wien in finanzieller Unabhängigkeit seinen Interessen leben konnte, die in alle Bezirke des Wissens hineinreichten. Von 1900 bis 1904 studierte Friedell in Wien neun Semester Philosophie. Er stieß während dieser Zeit zum Literatenkreis im Café Central und zählte bald zum engsten Bekanntenkreis von Peter Altenberg. 1904 wurde er mit einer Dissertation über das Thema Novalis als Philosoph promoviert, um anschließend Kabarettist zu werden. Daneben schrieb er Essays für Zeitschriften wie die „Schaubühne“ oder „März". Gemeinsam mit Alfred Polgar veröffentlichte er ab 1908 Parodien wie Der Petroleumkönig, Goethe, Die Musteroperette und Goethe im Examen, die ihn bald im deutschsprachigen Raum bekannt machten. In der Folge wurde er künstlerischer Leiter des Cabaret Fledermaus. Mit Polgar brachte er 1910 als zensurgerechtes Militärstück („in das jede Offizierstochter ihren Vater ohne Bedenken führen kann“) die Komödie Soldatenleben im Frieden heraus. Im selben Jahr beauftragte ihn der Verleger Samuel Fischer damit, eine Biografie über Peter Altenberg zu schreiben. Mit dem kulturanalytischen und -kritischen Buch, das 1912 unter dem Titel Ecce poeta erschien, war Fischer, der leichte Kost erwartet hatte, höchst unzufrieden. Es wurde deswegen nicht weiter beworben und blieb ohne Erfolg; aber es markierte den Beginn von Friedells kulturgeschichtlichem Interesse. Mit dem Journalisten Felix Fischer gründete er 1910 das „Intime Theater“ in der Praterstraße. Hier wurden Werke von Strindberg, Wedekind und Maeterlinck erstmals in Wien auf die Bühne gebracht, die Unzulänglichkeiten bei den Aufführungen verhinderten aber den Erfolg dieses Theaters; Friedell war zugleich Regisseur, Bearbeiter, Beleuchter und Darsteller. 1912 gastierte der Schriftsteller in Berlin; 1913 war er kurzzeitig bei Max Reinhardt als Schauspieler beschäftigt. Ab 1914 machten sich immer größere Alkohol- und Gewichtsprobleme bemerkbar, so dass er sich in ein Sanatorium in der Nähe von München zu einer Entziehungskur begeben musste. Von dem beginnenden Ersten Weltkrieg war Friedell ebenso begeistert wie die meisten seiner Zeitgenossen. Er veröffentlichte chauvinistische Schriften gegen die Kriegsgegner und meldete sich als Kriegsfreiwilliger, wurde aber als untauglich abgelehnt. 1916 ließ er seinen Familiennamen „Friedmann“ amtlich in „Friedell“ ändern, nachdem er zuvor des öfteren schon den Künstlernamen „Friedländer“ benutzt hatte. 1916 schrieb Friedell die Judastragödie, 1922 erschien Steinbruch – Vermischte Meinungen und Sprüche. Von 1919 bis 1924 arbeitete Friedell als Journalist und Theaterkritiker bei verschiedenen Zeitschriften und Zeitungen, darunter auch beim „Neuen Wiener Journal“. Daneben nahm er ein Angebot von Max Reinhardt an und arbeitete bis 1927 als Dramaturg, Regisseur und Schauspieler am Deutschen Theater in Berlin und am Theater in der Josefstadt in Wien, wo er 1924 etwa in der Wiener Erstaufführung von Hofmannsthals „Der Schwierige“ mitwirkte. Ab 1927 nahm er wegen gesundheitlicher Probleme keine festen Stellen mehr an; stattdessen arbeitete er in Wien als Essayist, freier Schriftsteller und Übersetzer. In einem genau geregelten Tagesablauf widmete sich Friedell seinem Lebenswerk, der Kulturgeschichte der Neuzeit, deren drei Bände 1927 bis 1931 veröffentlicht wurden. Nachdem 1933 die Nationalsozialisten in Deutschland an die Macht gekommen waren, wurde von allen deutschen und österreichischen Verlagen die Veröffentlichung von Friedells Werken abgelehnt. Im Februar 1938 wurde Friedells Kulturgeschichte schließlich in Deutschland verboten. Nach dem „Anschluss“ an das „Dritte Reich“ schrieb Friedell am 11. März 1938 an Ödön von Horvath: „Jedenfalls bin ich immer in jedem Sinne reisefertig“. Friedell dachte nun häufiger über die Anschaffung von Gift oder einer Pistole nach. Am 16. März 1938 erschienen gegen 22 Uhr zwei Männer der SA vor dem Haus von Egon Friedell, Wien 18, Gentzgasse 7, um, wie jedenfalls er meinte, den „Jud Friedell“ abzuholen (einigen Quellen zufolge war das - noch - nicht Grund für das Auftauchen, sondern ein „Besuch“). Während sie mit seiner Haushälterin diskutierten, nahm sich Friedell das Leben, indem er aus einem Fenster der im 3. Stock gelegenen Wohnung sprang. Verbrieft ist, dass er dabei nicht verabsäumte, die Passanten umsichtig mit dem Ausruf „Treten Sie zur Seite!“ zu warnen. Friedell, von dem Hilde Spiel sagte: „In ihm stand noch einmal die berauschende Fiktion vom universalen Menschen vor uns auf“, wurde auf dem Wiener Zentralfriedhof, evangelischer Teil, Tor 3, beigesetzt. Anlässlich seines Todestages 2005 wurde es zum ehrenhalber gewidmeten Grab.
Der Text ist unter der Lizenz „Creative Commons Attribution/Share Alike“ verfügbar; zusätzliche Bedingungen können anwendbar sein. Im Original ist dieser Text zu finden unter http://de.wikipedia.org/wiki/Egon_Friedell.
Essays – Satiren – Humoresken
Der Philosoph weiß, daß nichts ganz wichtig und ganz ernsthaft ist: daher kann er sich über alles hinwegsetzen und über alles lachen.
Aber ebensogut weiß er, daß nichts ganz unwichtig und ganz lächerlich ist: daher nimmt er wieder eigentlich alles ernst und setzt sich über nichts hinweg.
›Ecce poeta‹
Vom Unfug des Theaters
Der Hund von Baskerville
Als Herr Fischer, der Direktor des Wiener ›Intimen Theaters‹, mir den Vorschlag machte, mich gegen eine kleine, aber unsichere Gage an der Leitung seiner Bühne zu beteiligen, sagte er ungefähr folgendes: "Sie sind dazu berufen, eine große Lücke auszufüllen. Wir haben ganz nette Schauspieler und Schauspielerinnen, einen sehr gewalttätigen Regisseur und einen ungemein langmütigen Dekorationslieferanten. Nur eines fehlt uns noch: ein Literat. Jedes moderne Theater hat jetzt einen oder mehrere Menschen von dieser Sorte. Denn bloß mit Schauspielkräften kann man heutzutage keine Bühne mehr führen. Die Schauspieler verstehen immer nur etwas von ihren Rollen, aber von dem ganzen Stück verstehen sie nichts. Sie wissen nicht, in welchem Jahr es geschrieben wurde, welche Erlebnisse der Dichter vorher gehabt hat und nach welchen ästhetischen Gesetzen es gearbeitet ist. Und überhaupt: sie sind so äußerlich, so effekthascherisch. Und nun, lieber Doktor, entwickeln Sie mir bitte Ihr Programm."
"Mein Programm ist sehr einfach", erwiderte ich. "Es lautet: Für das ›Intime Theater‹ ist das Beste gerade gut genug. Dabei dürfen wir aber nicht engherzig sein. Wir werden nicht nur in die graue Vergangenheit zurückgreifen und verschüttete Schätze der Weltliteratur ans Tageslicht heben, sondern wir werden auch den verkannten zeitgenössischen Talenten, den Aschenbrödeln der modernen Dramatik zum Wort verhelfen. Das ist unsere literarische Ehrenpflicht. Ich habe mir eine Liste solcher Perlen der ältern und neuern Literatur bereits angelegt, und diese Liste lassen wir durch die Zeitungen gehen. Das Publikum wird sich freuen, wenn es das liest, und wird sich sagen: ›Na, wenigstens ein Theater in Wien, das etwas für die Kunst tut.‹ Ansehen würde es sich diese Stücke natürlich nicht. Aber wir werden sie ja auch gar nicht spielen, sondern eine Detektivkomödie."
"Eine Detektivkomödie?" fragte der Direktor. "Nun ja, aber doch auch Strindberg –"
"Strindberg ist einer der hervorragendsten Psychologen unserer Zeit. Der gehört nicht auf die Bühne."
"Aber Maeterlinck –"
"Maeterlinck ist einer der subtilsten modernen Impressionisten. Außerdem hat er eine ganz neuartige und originelle Note. Wir dürfen ihn nicht spielen."
"Aber doch wenigstens Ibsen –"
"Ibsen kommt im Rang gleich nach Shakespeare. Aber er hat eine entsetzliche Schwäche: er ist ein tiefer Philosoph. Seine Dramen sind voll von profunden Gedanken. Wir können ihn nicht aufführen. Aber ich habe Ihnen hier ein Buch mitgebracht. Es heißt ›Der Hund von Baskerville‹. Sehen Sie sich es einmal an. Sie werden Verschiedenerlei daran bemerken. Erstens: es ist voll von groben Unwahrscheinlichkeiten oder, deutlicher gesagt, es ist von A bis Z erlogen. Das ist wichtig. Denn die Wirklichkeit, das natürliche Leben, das psychologisch Mögliche hat das Publikum ja zu Hause. Dafür braucht es nicht sein gutes Geld auszugeben und mehrere Stunden auf einem unbequemen Sitz zu verbringen. Sondern es bringt diese Opfer, weil es etwas sehen will, was es noch nie gesehen hat, womöglich etwas, was es gar nicht gibt. Zweitens: es treten in diesem Stück fast lauter hochelegant gekleidete Menschen auf, und einer von ihnen hat sogar acht Millionen. Das ist auch wichtig. Denn die abgetretenen Stiefel und den leeren Geldschrank hat das Publikum wiederum zu Hause, und wenn es ins Theater geht, so will es, daß Geld auf der Bühne keine Rolle spielt. Ferner: alle Menschen schweben in beständiger Lebensgefahr, und das ist sehr angenehm anzusehen, wenn man sich dazu sagen kann: ›Ich sitze hier ganz geschützt und zu Hause ist vom Mittag Lungenbraten für mich gewärmt.‹"
Der Direktor, ein Mann von hohem Gedankenflug, schüttelte den Kopf und sagte: "Ist das denn wirklich Ihr Ernst, was Sie da sagen?"
"Ganz gewiß. Und ich glaube aus guten Gründen. Jede Institution hat doch schließlich, wie jeder Mensch und jedes Volk, einen bestimmten Entwicklungsweg und eine begrenzte Lebensdauer. Im Altertum war das Theater ein künstlerischer und religiöser Andachtsort. Im Mittelalter überwog das Religiöse das Künstlerische, aber ein Andachtsort war die Mysterienbühne noch immer. In der Neuzeit hat sich das vollständig geändert. Das Theater ist für uns nichts Heiliges mehr, auch im profan-künstlerischen Sinne nicht mehr. Wir erfanden die Theaterform, die unserer Zeit gemäß ist. Wir erfanden eine eigene Theaterpsychologie, die aber gar keine Psychologie war, sondern eine Zusammenfassung der oberflächlichen und unzutreffenden Beobachtungen, die der Normalmensch für gewöhnlich an den Menschen und Ereignissen macht. Wir erfanden eine eigene Theaterethik, die aber gar keine wissenschaftliche oder philosophische Ethik war, sondern ein Auszug aus dem Katechismus und der bürgerlichen Moral. Wir erfanden die Theatergedanken, die noch gerade so viel von der Form des Gedankens hatten, daß man sie für Gedanken halten konnte, und doch flach und konventionell genug waren, daß jeder Zuhörer sie mit Stolz sich zu eigen machen konnte. Ja, wir erfanden sogar eine eigene Theaterlogik, gewiß eine der erstaunlichsten Leistungen.
Das Merkwürdigste aber ist, daß im Theater alle Zuschauer ganz gleich funktionieren. Ich glaube an kein ›Theater der Auserwählten‹. Im Theater wird jeder Mensch zum ›Publikum‹, auch der tiefste und feinste. In dem Augenblick, wo er den Parkettsitz niedergeklappt hat, ist er ein anderes Wesen. Wenn Sie daher statt Theater subtile Stimmungen, bedeutende Gedanken, tiefe Psychologie, mit einem Wort: Kunst bieten, so ist das direkter Betrug. Es ist eine unanständige Geschäftsgebarung, die sich damit bestraft, daß die Kunden ausbleiben. Der Theaterschriftsteller unterscheidet sich von den übrigen Schriftstellern dadurch, daß er ein nützliches Mitglied der Gesellschaft ist. Er schafft etwas Praktisches, während die andern im besten Fall kostbare Spielereien herstellen. Ein richtiges Theaterstück ist ein handlicher Gebrauchsgegenstand, eine Sache, die den Menschen dazu dient, sich drei Stunden lang auf eine ganz bestimmte Weise zu erholen. Lyrik oder Philosophie sind für die wenigsten Menschen unentrinnbare Lebensbedürfnisse, aber das Theater ist für den modernen Großstädter eine Notwendigkeit, genauso wie schwarzer Kaffee und Zigarren. Die Kunst ist ein Luxusartikel. Das Theater ist eine Utilität. Ein Theater ist ein Automat, in den man oben Geld hineinwirft, damit unten falsche Rührung (Theaterrührung), falsche Lustigkeit (Theaterlustigkeit) und falscher Schauder (Theaterschauder) herauskommen. Ein honetter Theaterunternehmer wird daher seinem Publikum nicht Kunst bieten.
Aber auch der Künstler muß wünschen, daß die Kunst dem Theater fernbleibe. Denn wenn man einen modernen Künstler zwingt, in theatralischer Form zu dichten, so zwingt man ihn, seine eigene Höhe zu verlassen, seine Gedanken abzuplatten, seine psychologischen Beobachtungen zu unterdrücken und seine originellen Einfälle in eine altertümliche konventionelle Form zu pressen. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Leben in seinen zartesten, fast unsichtbaren Regungen zu verfolgen, und nun verlangt man von ihm ein hastiges, rohes Hin und Her und die Schilderung von leidenschaftlichen, aufregenden, gewaltsamen Vorgängen, die es im Leben des modernen Menschen gar nicht mehr gibt. Je künstlerischer einer denkt, je besser er es mit der zukünftigen Kunst und Kultur meint, desto mehr muß er also wünschen, daß Kunst und Theater zwei scharf getrennte Wirkungsgebiete werden.
Spielen Sie daher den ›Hund von Baskerville‹."
"Aber wenn das Stück durchfällt?"
"Ja, darüber habe ich auch schon meine Bedenken gehabt. Es ist nämlich vielleicht immer noch zu künstlerisch und zu modern. Der Verfasser hat leider hie und da ganz merkwürdige Anfälle von Schamgefühl. Ich habe es also ein wenig überarbeitet. Aber es ist möglich, daß auch das nichts nützt. Ich habe daher für alle Fälle telegrafisch den ›Schinderhannes‹ bestellt."
Als ich Regisseur war
Ich habe oft erzählt, wie ich von der Direktion des ›Intimen Theaters‹ in Wien als Literat engagiert wurde. Weil ich aber nun einmal die Literatur nicht mag, so machte man mich eines Tages zum Regisseur, um irgendwie meine Kraft nutzbringend zu verwenden. Ich war damit einverstanden, denn ich hatte mir unter einem Regisseur einen Menschen vorgestellt, der fast nichts weiter zu tun hat, als mit den Damen liebenswürdig und mit den Herren grob zu sein, und beides ist ja ein großes Vergnügen. Als ich aber einige Wochen diesen Beruf ausgeübt hatte, erschien der eine der beiden Direktoren – es gab nämlich zwei, mit getrennten Ressorts, der eine für das ›Artistische‹, das heißt: für Verweigerung von Kostümen; der andere für das ›Administrative‹, das heißt: für Vereitelung von Pfändungen –, der ›Artistische‹ also kam und sagte: "Sie müssen einen Maeterlinck inszenieren!" Wir gingen nun alle Stücke von Maeterlinck durch und berieten, welche künstlerisch geeignet wären, das heißt: welche ›geschützt‹ sind und welche nicht, und einigten uns auf ›Interieur‹. Dann wurde der Theatermaler herbeigerufen, ein barscher Mensch, der sich nach einigem Zögern bereit erklärte, vier Pappstreifen grün zu tünchen, um dem Publikum einen grünen Wald vorzutäuschen, ferner in eine Papplatte ein Viereck zu schneiden und dadurch im Zuschauer den Eindruck zu erwecken, er sehe ein Haus mit Fenster. Nach ihm wurde der Beleuchter gerufen, ein schüchterner Mensch, der sich ohne weiteres bereit erklärte, eine große Glühlampe mit außerordentlicher Geschwindigkeit auf- und abzudrehen, indem er versicherte, niemand im Zuschauerraum werde sich weigern, in dieser Lichterscheinung einen grellen Blitz zu erkennen. Ferner erschienen noch der Theatermeister, der bereits einen Papiersack mitgebracht hatte, in den er blies, welches Geräusch dem Sturmwind durchaus nicht unähnlich war, der Inspizient, in dem ich ohne Mühe den Beleuchter wiedererkannte, und der Requisiteur, der wieder in seiner äußeren Erscheinung an den Theatermeister erinnerte. Alle diese versicherten, indem sie mich ›Herr Oberregisseur‹ nannten, daß sie es in der Täuschung und Irreführung des Publikums an nichts fehlen lassen würden.
Nun kamen die Proben. Proben bestehen lediglich darin, daß einige Leute aus Heften allerlei Reden ablesen, unter der Versicherung, diese Hefte seien nur ein Hilfsmittel ›für heute‹, das ›morgen‹ bereits überflüssig sei. Dieser ›morgen‹ hat offenbar den Charakter eines bloßen Grenzwertes, es hat nur die rein negative und einschränkende Bedeutung von ›nicht heute‹.
Dagegen ist wissenschaftlich nicht das geringste einzuwenden, denn die Mathematik und die Mechanik, gerade die exakten Wissenschaften, arbeiten bekanntlich schon seit langem mit solchen Grenzwerten.
Nach mehreren Proben mußte ich erkennen, daß das Ganze von trostloser Langweile war, auch der Dialekt der Schauspieler war nicht komisch genug, um nur einigermaßen zu amüsieren. Indes, als ich gerade mit dem Theatermeister über Regengeräusche verhandelte, kam mir eine jener blitzartigen genialen Erleuchtungen, die in meinem Leben nichts Seltenes sind. Er wollte mich gerade von der illudierenden Kraft trockener Erbsen in Trommeln überzeugen, als mir plötzlich einfiel: wie, wenn wir dem akustischen Sinnesreiz auch den optischen hinzufügten, mit einem Wort: wenn wir wirklich regneten, wirklich, richtig, mit echtem Wasser? Gesagt, getan, und schon bei der nächsten Probe prasselte unaufhörlich rauschender Regen hernieder, eine prächtige Naturerscheinung, die noch den Vorteil hatte, daß sie die Reden der Künstler völlig verschlang.
Es kam die Generalprobe. Eine Generalprobe unterscheidet sich von den übrigen Proben in sehr wesentlicher Weise: Bei diesen wird nur gebrüllt, aber bei der Generalprobe wird gebrüllt und geohrfeigt. Als ich kam, ohrfeigten sich gerade die beiden Herrn Direktoren, wobei der Kneifer des einen zerschellte und das rechte Ohr des anderen zu bluten begann.
Inzwischen war jedoch der Kapellmeister mit vier Tonkünstlern erschienen, um eine Musikprobe abzuhalten, denn zur Einleitung sollte ein düsteres Tonstück gespielt werden. Er weigerte sich jedoch, diese Probe abzuhalten, es sei denn, man gebe ihm zehn Kronen Vorschuß. Daraufhin versöhnten sich sofort die beiden Herrn Direktoren und ohrfeigten gemeinsam den Kapellmeister. Infolgedessen bekam eine Schauspielerin einen hysterischen Schreikrampf. Man führte sie jedoch auf die Bühne, und unter der erfrischenden Wirkung des kühlen Regens beruhigte sie sich.
Jetzt konnte die Generalprobe beginnen, denn auch die beiden Herren Direktoren hatten sich inzwischen mit dem Kapellmeister versöhnt. Ich weiß nicht, wen sie dann gemeinsam ohrfeigten. Im übrigen wäre ich beinahe auch geprügelt worden, denn am Schluß hielt ich an die Darsteller eine Ansprache, in der ich ihnen dafür dankte, daß sie trotz der ungünstigen Witterung so tapfer auf der Bühne ausgehalten hätten, und die Hoffnung aussprach, daß am Abend alles vortrefflich gehen werde, worauf vier Leute von der Bühne sprangen und mich bedrohten, weil das, was ich gesagt hätte, ein böses Omen sei. Zum Glück blieb ich beim Hinausgehen an einem Nagel hängen und zerriß mir meinen neuen Rock, was wieder ein gutes Omen war.
Und es ging auch wirklich abends vortrefflich. Als der Vorhang gefallen war, klatschte Peter Altenberg wie besessen, was sechs Hervorrufe zur Folge hatte. Auch die Kritik am nächsten Tage war im ganzen recht günstig. Die meisten erkannten an, daß es eine gutinszenierte Wasserpantomime gewesen sei. Einige andere waren freilich weniger freundlich. So schrieb einer, bloße Pracht der Inszenierung genüge noch lange nicht, solch protzige Ausstattung sei unkünstlerisch, und einer behauptete sogar, der naturalistische Regen habe die symbolische Maeterlinck-Stimmung zerrissen.
Man sollte nun meinen, meine Regietätigkeit wäre damit erledigt gewesen. O nein, denn nach einiger Zeit kam ein Journalist und sagte, dieser Regen sei so natürlich gewesen, fast wie wirklich, und wie denn das gemacht werde, und er wolle darüber einen Artikel schreiben. Ich konnte ihm doch nicht sagen, daß ich mir bloß über einem durchlöcherten Blechstreifen den Mund ausgespült hatte, und erwiderte daher: "Ja, die Sache ist ziemlich kompliziert, aber ich will sie ihnen verraten. Also, Sie wissen doch, daß wir transversale Erdleitung haben? Wenn also der Schaltstrom in das obere Relais eintritt, so geht er nicht, wie gewöhnlich, gleich in den Kommutator, sondern wird vorher über eine Primärspule geleitet. Hierdurch entsteht eine Stromschleife. Das Ganze ist eine Verbindung mit einem longitudinalen Gestänge, das aus neutralem Kupfer hergestellt ist und daher wie ein Rezeptor wirkt. In dem Augenblick nun, wo der Transmitter den Empfängerdraht berührt, entsteht im Schließungskreis ein gleichgerichteter Polarisationsstrom, der Kollektor intermittiert: Und es regnet. Haben Sie alles begriffen?" – "O ja", sagte der Journalist und verschwand.
Er scheint aber doch nicht alles begriffen zu haben, denn er schrieb nur ganz allgemein, im ›Intimen Theater‹ werde jetzt durch mehrere verwickelte Apparate ein elektrischer Regen erzeugt.
Was ist eine Tournee?
Eines Tages wurde die Tür zu meinem Arbeitszimmer aufgerissen und herein stürmte der mir nur flüchtig bekannte Impresario Herr Fritz Schieber und rief statt jeder weiteren Begrüßung: "Wollen Sie viertausend Mille verdienen?"
"Ja", erwiderte ich schlagfertig.
"Famos!" rief Schieber, "dann ist die Tournee perfekt."
"Welche Tournee?" fragte ich.
"Nun, die Tournee! Die Tournee Ihres Kabaretts! Die Tournee des Kabaretts ›Fledermaus‹! Das Geld liegt auf der Straße! Ich sage Ihnen, Sie werden scheffeln! Scheffeln! Wir machen zuerst Deutschland: München, Augsburg, Ulm, Nürnberg, Stuttgart, Frankfurt, Wiesbaden, Limburg (Limburg hat überhaupt kein Kabarett. Da werden wir scheffeln!), dann: Köln, Düsseldorf, Dortmund, Münster, Hannover, Bremen, Hamburg, Dover, Liverpool, Southhampton, Chikago, Uruguay –"
"Das geht nicht", sagte ich.
"Was sagen Sie? Uruguay geht nicht? – Ja, Mist! Mist geht natürlich nicht in Uruguay! Aber wenn man in Uruguay etwas Gutes bietet, etwas wirklich Klassisches, nicht Pikanterien – die ziehen in Uruguay nicht – sondern etwas Dezentes, Künstlerisches, Vornehmes! Wie? Was? Uruguay, sagen Sie, geht nicht? Ich sage Ihnen: Uruguay ist der beste Boden für Kabaretts!"
"Ja, aber ich vertrage die Überfahrt nicht."
"So? Nun, dann brechen wir also in Calais ab. Aber es ist Ihr Schaden! Ich sage Ihnen: es ist Ihr Schaden! Wie sind übrigens Ihre Bedingungen? Wollen Sie Anteil oder feste Gage?"
"Ich wünsche feste Gage", erwiderte ich schlicht.
"Also gut! Aber mehr als viertausend Mark monatlich kann ich Ihnen nicht geben, das sage ich Ihnen gleich!"
"Das genügt", erwiderte ich.
"Also perfekt! Ich schicke Ihnen noch heute den Kontrakt!" rief Schieber, schon in der Tür. "Aber das sage ich Ihnen: Sie sind ein Esel! Sie werden sich schön ärgern, wenn alle übrigen auf Anteil gehen und das Vier- und Fünffache scheffeln!"
"Nun", sagte ich stolz, "mein Leben ist der stillen Meditation gewidmet. Ich habe keine Bedürfnisse. Viertausend Mark monatlich genügen mir. Ich –"
"Also gut! Aber es ist ökonomischer Selbstmord! Selbstmord, sage ich Ihnen! Wir sind jetzt in Form! Sie können zehn, zwanzig, dreißig Mille per Monat scheffeln! Aber wie Sie wollen!"
"Meinen Sie wirklich?" sagte ich irritiert.
"Also auf Anteil!" rief Schieber und verschwand.
Von diesem Zeitpunkt an wich er mir nicht mehr von der Seite. Wenn er ausnahmsweise nicht leiblich gegenwärtig war, so kamen unzählige Depeschen, Rohrpostkarten, Expreßbriefe und Eilboten an, mit unverständlichen Mitteilungen. Ein Wort kehrte jedoch mit größter Regelmäßigkeit in allen Reden und Briefen Schiebers wieder, es hieß: ›Zusammenstellung des Ensembles‹. Was dies bedeuten sollte, verstand ich, und hätte ich es nicht verstanden, so wäre ich hierüber genügend aufgeklärt worden durch den Besuch zahlloser Menschen, die alle behaupteten, daß sie ›etwas könnten‹, z. B. Zentnerstemmen. Bauchredner waren besonders viele da.
Allmählich rundete sich das Ensemble. Es bestand aus einem musikalischen Leiter, der mich täglich in Theorie und Geschichte der Musik unterrichtete. (Dies hatte sich schon am Anfang unserer Beziehungen als nötig erwiesen, denn ich gab mir manche Blöße.) Sodann aus einem Tenor, der schon durch seinen Körperumfang jedermann imponieren mußte und, wenn man es ihm erlaubte, einen solchen Lärm vollführte, daß man auf die Vermutung kommen mußte, er sei gar kein Mensch, sondern eine ›Dampftonwerk GmbH‹. Er war früher Opernsänger gewesen, und seine Glanzrolle war der Lohengrin. Aber als er immer dicker wurde, glaubte schließlich niemand mehr daran, daß ihn ein Schwan ziehen könne. Die befreundete Presse verwies zwar darauf, daß der ›Lohengrin‹ eine Märchendichtung sei, und da seien Verstöße gegen die Naturgesetze erlaubt, aber es nützte nichts: die Illusion war weg. Man telegrafierte an Frau Cosima Wagner, ob sie ausnahmsweise für diesen Spezialfall drei Schwäne gestatten wolle. Vergebens. So sank denn der vortreffliche Sänger durch fremde Schuld immer tiefer, und schließlich wurde er Kabarettist. Nun fehlte nur noch eine Dame. Es war indes schwer, ein weibliches Wesen aufzutreiben, das nach Schiebers Ansicht in unseren streng künstlerischen Rahmen gepaßt hätte. Jede hatte irgendeinen Defekt: entweder sie wollte durchaus ›Drah' ma um und drah' ma auf, es liegt nix dran‹ singen, oder sie wollte als nackte Plastik auftreten, oder sie wollte fixe Gage oder sonst was Unkünstlerisches.
Es kam jedoch in unseren Kreis seit einiger Zeit eine vornehme junge Dame, die an unserem fröhlichen Künstlerleben Gefallen fand. Sie war durch Peter Altenberg eingeführt worden, der von ihr behauptet hatte, sie sei der einzige ›wirklich auf der Höhe stehende moderne Frauenorganismus‹. Sie trug eine Cleo-de-Mérode-Frisur mit dicken Zopfschnecken um die Ohrmuscheln und eine Art Pallas-Athene-Helm als Kopfbedeckung. (Andere behaupteten, es sei ein Schiffsmodell.) Im übrigen war sie jedoch sehr hübsch und außerdem begütert und aus guter Familie, was sie durch die lässig hingeworfene Bemerkung: ›Die Prostitution ist schließlich eine soziale Einrichtung wie jede andere auch‹ zu kaschieren suchte. Diese also wurde unser Star. Sie hieß Mizi, weswegen sie allgemein Maja gerufen wurde.
Nun waren wir komplett, und so war es denn nicht zu vermeiden, daß ich eines Tages ein Telegramm von Schieber bekam, in welchem stand: ›Abfahrt München heute Abend 8 Uhr 50 Westbahnhof.‹
Ich sagte Schieber: "Ich kann unmöglich bei Nacht reisen. Ich leide auf der Bahn an Schlaflosigkeit." – "Kenne ich, kenne ich", rief Schieber. "Aber ich überwinde jede Schwierigkeit! Kommen sie mit!" Wir gingen in eine Bodega. Schieber bestellte sogleich eine Flasche Whisky und einen Wagen. Wir tranken. Allmählich wurde mir alles gleichgültig, sogar die Tournee. Selbst Schiebers helles Organ hörte ich nur mehr wie aus gedämpfter Ferne. Ich vernahm noch einige Male die Worte "scheffeln", "neunzig Mille" und "Kassel perfekt".
Und dann sagte plötzlich ein Mensch in der Uniform eines bayerischen Schaffners: "In zehn Minuten sind wir in München."
Für München waren acht Tage in Aussicht genommen. Wir taten alles, um diese alte Kunstmetropole für uns zu gewinnen. Aber es war nicht unsere Schuld, daß uns das nicht vollständig gelang.
Nach der ersten Vorstellung sagte Schieber zu mir: "Lieber Doktor, wissen Sie denn nicht, daß das große Publikum absolut niemals zu Premièren geht, sondern sich abwartend verhält? Aber bei dem unerhörten moralischen Erfolg, den wir heute gehabt haben, sollen Sie mal sehen, wie sie morgen strömen werden!"
Nach der zweiten Vorstellung sagte Schieber zu mir: "Lieber Doktor, Sie haben ganz recht. Ganz recht! Aber wer trägt die Schuld? Der Idiot vom Plakatierungsbüro. Vier Stunden vor der Vorstellung läßt dieser Trottel die Zettel ankleben! Wo alles schon vor die Stadt gefahren ist! Ja sollen die Leute riechen, daß wir gastieren? Damit sie hineingehen, müssen sie doch wenigstens wissen, daß wir spielen! Ja oder nein? Nun, es ist schließlich nicht mehr als ein verlorener Tag. Was will das heißen gegen die Wochen und Wochen, die wir von morgen an überfüllt sein werden!"
Nach der dritten Vorstellung sagte Schieber zu mir: "Ja, lieber Doktor, worüber wundern Sie sich denn? Ohne Presse ist nichts zu machen, das sollten Sie sich als intelligenter Mensch doch selbst sagen! Die Kritiken erscheinen aber doch erst morgen früh! Morgen haben wir ausverkauft."
Nach der vierten Vorstellung sagte Schieber zu mir: "Ja, lieber Doktor, sind Sie denn so theaterfremd, daß Sie nicht einmal wissen, daß der Freitag der schlechteste Theater-Tag ist? Freitag macht nicht einmal ›Alt-Heidelberg‹ was! Aber morgen ist Samstag: Da passen Sie mal auf!"
Nach der fünften Vorstellung sagte Schieber zu mir: "Ja, lieber Doktor, gehen Sie denn blind durchs Leben? Wissen Sie denn nicht, daß heute in zwei andern Theatern Premièren sind? Das Publikum rennt doch in seiner dummen Neugierde immer zunächst zu den Premièren! Aber warten Sie mal: morgen, wenn diese zwei Machwerke durchgefallen sein werden, kommen alle reuig zu uns. Denken Sie an mich!"
Nach der sechsten Vorstellung sagte Schieber zu mir: "Nein, Doktor, Sie sind wirklich köstlich! Wissen Sie denn nicht, daß am Sonntag nur Schuster ins Theater gehen? Zu einer feinen, noblen Sache, wie es die unsrige ist, kommt doch kein Sonntagspublikum! Der Tag für das elegante Publikum ist morgen, Montag. Das weiß jeder Bühnenarbeiter, und Sie, ein akademisch gebildeter Mensch, wissen es nicht?"
Nach der siebenten Vorstellung sagte Schieber zu mir: "Lieber Doktor, ich bitte Sie, machen Sie sich nicht lächerlich! Jede Sache muß sich herumsprechen. Dazu gehören genau sieben Tage. Ich bin ein alter Theaterhase, glauben Sie mir, ich weiß das! Es ist ein Theatergesetz. Sieben Tage! Statt mir Vorhaltungen zu machen, sollten Sie sich freuen! Denn die sieben kritischen Tage sind um, und morgen beginnt die Völkerwanderung!"
Nach der achten Vorstellung sagte Schieber zu mir: "Ja, lieber Doktor, sagen Sie mir, was haben Sie sich eigentlich von diesen Bierphilistern erwartet! Haben Sie im Ernst geglaubt, daß München ein Boden für vornehme Kabarettkunst ist? Hätte man auf mich gehört, wir wären längst in Frankfurt!"
Für Frankfurt waren vierzehn Tage in Aussicht genommen. Ehe wir in den Bahnhof einfuhren, zog mich Schieber beiseite und sagte: "Lieber Doktor, ich will nicht wieder nach jeder Vorstellung mit Ihnen Auseinandersetzungen haben wie in München. Und daher sage ich Ihnen gleich: wir werden in Frankfurt unerhörte Erfolge feiern. Aber unter einer Bedingung: daß es nämlich regnet. Bei schönem Wetter geht im Sommer niemand ins Theater. Es sind jedoch für die nächsten zwei Wochen andauernde heftige Niederschläge mit vollster Bestimmtheit vorauszusetzen. Darum Mut! Sie betreten die Stätte Ihrer Triumphe!"
Ich begab mich infolgedessen sogleich zu einem hervorragenden Frankfurter Meteorologen, schilderte ihm unsere Lage und bat ihn um eine Prognose. Der Professor, ein freundlicher alter Herr, hörte mir wohlwollend zu und sagte: "Ja, lieber junger Freund, ich sehe leider aus Ihren Reden, daß Sie eines der vielen Opfer der irreführenden Theorie des Professor Larsen in Köln sind. Welches Unglück hat dieser Mensch schon gestiftet! Und man glaubt ihm, weil er in Mode ist." Ich sagte: "Herr Professor, es ist nicht so sehr die mir gänzlich unbekannte Theorie des Herrn Professor Larsen als unsere Münchener Erfahrung, welche –"
Doch der Gelehrte unterbrach mich erregt: "Soll ich Ihnen sagen, was dieser Herr Larsen ist? Ein wissenschaftlicher Hochstapler, ein verbrecherischer Dilettant! Wie? Die Trockenheit dieses Sommers soll auf Äquinoktialstürme zurückzuführen sein? Warum nicht gleich auf Passatwinde? Ich sage Ihnen, es sind ganz einfach Golfströme und sonst nichts! Übrigens" – er zog ein Zeitungsblatt hervor – "wie liederlich dieser angebliche Forscher arbeitet, zeigt sein letzter Artikel. Da steht wörtlich: ›Die völlige Trockenheit dieses Sommers, die ihresgleichen seit dem Jahr 1895 nicht gehabt hat, wird bis in den September währen.‹ Das ist ganz einfach falsch."
"Bravo", rief ich begeistert.
"Sehen Sie", sagte der Gelehrte triumphierend,"also sogar Sie als Laie wissen es! Nur Herr Larsen nicht! Nur Herr Larsen, der angebliche Fachmann, weiß nicht, daß der letzte vollkommen trockene Sommer im Jahre 1719 stattfand!"
Ich sagte: "Jawohl. Indes die Trockenheit –"
"– ist, theoretisch betrachtet, gar nicht vorhanden. Im Gegenteil: jeder Fachmann muß diesen Sommer als einen der feuchtesten empfinden. Die Trockenheit bezieht sich nämlich nur auf die atmosphärische Hülle der Erde. Die Erdschicht im eigentlichen Sinne dagegen, jene, die für den Geologen allein in Betracht kommt, ist von solcher Feuchte, daß –" Ich fragte, ob Aussicht bestehe, daß auch die Hülle feucht werde. "Gewiß", erwiderte der Professor, "wissenschaftlich ist sie sogar feucht. Übrigens kann jeden Moment eine Feuchtigkeit eintreten, die auch jeder Laie sofort empfindlich bemerken müßte. Dazu brauchen bloß die kleinen Golfströme, die um die Äquatorialzone gelagert sind, sich nach Nordnordost zu wenden."
Die Hitze blieb so bedeutend, daß am Presse-Abend kein Vertreter einer Zeitung erschien. Dafür hatten wir aber auch am nächsten Tag in manchen Blättern lobende Kritiken.
Von da an spielten wir mit wechselndem Erfolg. Der Besucher des dritten Abends zum Beispiel war ein gewöhnlicher Mensch von ganz ordinärem Geschmack, der nur bei den groben Pointen lachte und für die feinkomischen oder gar ernsten Nummern kein Verständnis zeigte. Dagegen war der Besucher des fünften Abends ein feingebildeter Mann, der gerade die künstlerisch wertvollen Einzelheiten unseres Programms vollauf würdigte. Der Besucher des sechsten Abends war ein Einbrecher.
Am neunten Abend bekam unser musikalischer Leiter einen Hitzschlag. Zum Glück habe ich jedoch in Frankfurt das Gymnasium besucht, und so erschien denn am elften Abend meine ganze Klasse fast vollständig im Theater. (Nur zwei hatten sich von ihren Eltern wegen Nasenbluten entschuldigen lassen.) So unglaublich es klingen mag, an diesem Abend waren tatsächlich mehr Leute im Zuschauerraum als auf der Bühne.
Am zwölften Abend fuhr eine hochelegante Gesellschaft in zwei Automobilen vor und kaufte zwei Parterrelogen. Es stellte sich jedoch heraus, daß die Herrschaften gemeint hatten, es werde die Operette "Die Fledermaus" aufgeführt.
Unter diesen Umständen verließ ein Mitglied nach dem andern die Tournee. Quartette schmolzen auf Terzette, Terzette auf Duette zusammen. Schließlich bestand das Ensemble nur mehr aus mir und dem dicken Tenor. Der war aber infolge des Geschäftsganges allmählich so mager geworden, daß er wieder den Lohengrin spielen konnte und alsbald nach Bayreuth wegengagiert wurde.
Ich ging daher zu Schieber und sagte: "Ich finde, es wäre das Beste, wenn wir das ganze Künstlerensemble entlassen würden. Denn ich glaube, die Sache hört auf, sich zu lohnen. Wieviel beträgt denn überhaupt mein Anteil bis jetzt?" – Schieber holte ein großes Kassenbuch, rechnete einige Posten zusammen und erwiderte: "Wenn wir den heutigen Abend mitrechnen, 823 Mark und 40 Pfennig."
"Wie?" sagte ich, aufs höchste erstaunt, "das ist aber viel mehr, als ich erwartet hätte!"
"Ja", sagte Schieber, "ich hätte auch nicht gedacht, daß es so viel ist. Aber ich will Ihnen gern entgegenkommen. Sie können es ja in monatlichen Raten abzahlen."
Infolge dieser Mitteilung beschloß ich, das Ensemble-Gastspiel des Kabaretts "Fledermaus" abzubrechen. Ich berief mich also ein, löste mich auf und ging auseinander.
Auf der Rückreise nach Wien war ich gezwungen, in Nürnberg auszusteigen, um mir wegen plötzlichen Witterungsumschlags eine warme Mütze mit Ohrenklappen zu kaufen. Die um die Äquatorialzone gelagerten kleinen Golfströme hatten sich nach Nordnordwest gewendet.
Meine Nestroy-Vorstellung
Infolge meiner persönlichen Beziehungen zu einigen einflußreichen Redakteuren besitze ich jederzeit die Möglichkeit, mich über meine schauspielerische Tätigkeit öffentlich lustig zu machen.
Dies ist ein Trick von ganz unberechenbarem Nutzen, den ich hiermit freimütig aufdecke (wie das ja auch neuerdings die modernen Taschenspieler tun).
Es wird nämlich dadurch erstens den Kritikern, die ja eigentlich die hierzu berufenen Persönlichkeiten sind, das Vergnügen am Verhöhnen erheblich reduziert, weil Selbstironie den Verdacht erweckt, daß man wenig empfindlich sei; zweitens aber wird jede eigene Lächerlichkeit dadurch, daß man sie selber konstatiert, ganz bedeutend verringert. Ein Kunstgriff, der überhaupt für alle erdenklichen Lebenslagen zu empfehlen ist. Wenn jemand dick ist, so versuche er nur ja nicht, diese Tatsache durch enge Kleider zu kaschieren, sondern trage seine Dicke möglichst deutlich und heiter zur Schau. Wenn jemand auf dem Eislaufplatz oder im Tanzsaal der Länge nach hinschlägt, so erhebe er sich vor dem anwesenden Damenflor nicht mit ärgerlicher, sondern mit möglichst belustigter Miene, und er wird dadurch zwei Drittel seiner Lächerlichkeit einbüßen.
Zum Thema. Es ist wohl überflüssig, zu erwähnen, daß meine Nestroy-Vorstellung einer Anregung des Herrn Siegfried Meyer vom ›Residenzblatt‹ zu verdanken ist, denn die meisten Dinge, die sich ereignen, sind einer Anregung des Herrn Siegfried Meyer vom ›Residenzblatt‹ zu verdanken. Ich bin sehr im Zweifel, ob nicht schon die Erschaffung der Welt auf eine Anregung des Herrn Siegfried Meyer vom ›Residenzblatt‹ zurückzuführen ist; jedenfalls muß er dabei irgendwie seine Hand im Spiel gehabt haben. Ich vermute dies deshalb, weil auch im Kosmos bekanntlich Verschiedenes ganz und gar nicht klappt, wenngleich keine so haarsträubende Unordnung herrscht, wie bei meiner Nestroy-Aufführung; auch hat man die verschiedenen Schlampereien, die in der Natur vorkommen, nicht – wie dies in unserem Fall geschah – damit zu entschuldigen versucht, daß dies alles absichtlich so gemacht und ›parodistisch‹ gemeint sei. Und schließlich und endliche hoffe ich im Interesse der Menschheit, daß bei der Schlußbilanz die Schöpfung ein wesentlich besseres Geschäft bedeuten wird als meine Nestroy-Vorstellung.
Immerhin hatte ich doch gedacht, daß die intimen Beziehungen, die Herr Siegfried Meyer zu sämtlichen Wiener Redaktionsdienern unterhält, auf die Kritik günstiger einwirken würden. Die Genialität, die in dem Gedanken des Regisseurs lag, mit schlechten, aber billigen Dekorationen und Schauspielern und keinerlei Proben, sondern einigen angsterfüllten Beratungen eine Vorstellung zustande zu bringen und alle daraus erfolgenden Defekte dann als ein Füllhorn satyrischen Feuerwerks darzustellen, wurde nirgends genügend gewürdigt.