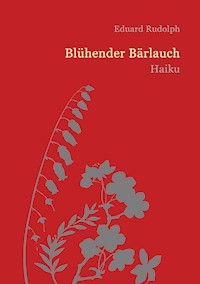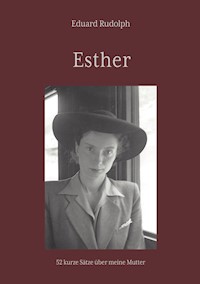
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eduard Rudolph setzt sich in 52, innerhalb eines Jahres verfassten, kurzen Kapiteln, die wie die Sätze eines Musikstücks Themen der Nähe, Loslösung, Verletzung und Entfremdung aufscheinen lassen, mit dem Leben seiner zwanzig Jahre zuvor verstorbenen Mutter auseinander. Dabei begegnet er sich immer wieder selbst, und längst vergessene Erinnerungen, Gefühle, Hoffnungen, Fragen und Ängste treten während des Schreibens zutage.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 42
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Eduard Rudolph
Esther
52 kurze Sätze über meine Mutter
Die Sätze
I – Die jüdische Krankenschwester
II – Dein Wille geschehe
III – Mysterium
IV – Hexenkind
V – Die Puppe
VI – Die Pistole
VII – Die Stiefmutter
VIII – Emmys Geschwister
IX – In den Ferien
X – Das Zyankalifläschchen
XI – Diplompräparat
XII – Esther und Max
XIII – Marie Curie
XIV – Totentrompeten
XV – Ehrfurcht vor dem Leben
XVI – Der Seerosenteich
XVII – Weihnachtsgebäck
XVIII – Der Reiter
XIX – Die Leidende
XX – Taschentücher
XXI – Die gerettete Hand
XXII – Garten Eden
XXIII – Die Seele der Tiere
XXIV – Höflich, unhöflich
XXV – Der Trauerknopf
XXVI – Lesezirkel
XXVII – Der Maharadscha
XXVIII – Die Unbeherrschten
XXIX – Elfriede
XXX – Im Steinbruch
XXXI – Warum nur?
XXXII – Die gefälschte Unterschrift
XXXIII – Pubertät
XXXIV – Erziehungsfragen
XXXV – In Berlin
XXXVI – Vorwürfe
XXXVII – Die Kunstsammlung
XXXVIII – Genealogie
XXXIX – Im Stoßverkehr
XL – Reise nach Russland
XLI – Gefiederte Freunde
XLII – Schalk
XLIII – Die Urnen
XLIV – Requiem
XLV – Symbiose
XLVI – Eine Familientradition
XLVII – Doppelspat
XLVIII – Das Schweigen
XLIX – Zweifel
L – Licht und Dunkelheit
LI – Fürbitten
LII – Ein Traum
I
Die jüdische Krankenschwester
Esther war das dritte Kind und – mein Großvater Fritz konnte es kaum fassen – das dritte Mädchen in der Familie. Er hatte nur einen männlichen Vornamen ausgesucht, weil er fest davon überzeugt war, dass seine Frau Emmy ihm diesmal einen Sohn gebären würde. Wie sollten sie das Baby nun nennen? Damals habe im Bethanienheim in Zürich eine jüdische Krankenschwester gearbeitet, erzählte mir meine Mutter einmal, und die schlug Fritz und Emmy vor, das Kind Esther zu taufen. Das sei ein schöner, alttestamentarischer Name.
Esther trug ihren Vornamen mit Stolz und er verband sie lebenslang in geheimnisvoller Weise mit dem Judentum. Sie gestand mir, dass sie in ihrer Jugend einen jüdischen Verehrer hatte, einen Fotografen, der ihr schöne, weiche Lederhandschuhe schenkte: Sie sei sich durch das teure Präsent aber bedrängt vorgekommen, habe die Bekanntschaft deshalb abgebrochen und später Max genommen.
Mit einem Sohn des Fotografen, der am Goldbrunnenplatz wohnte, bin ich als Jugendlicher ins Gymnasium gegangen. Nur vage kann ich mich daran erinnern, wie wir einmal zusammen auf dem Boden der Empfangshalle im Hauptbahnhof Zürich saßen und inmitten der Menschenmassen, die sich an uns vorbeiwälzten, Schach spielten.
II
Dein Wille geschehe
Sie mochte das Gebet nicht, das sie mir beibrachte, das merkte ich als Kind mit der Empfindsamkeit, mit der ich jede Regung meiner Mutter spürte. Sie lehrte mich das Unser Vater, das ihr doch offenbar zuwider war. Warum nur? Ich wusste es damals nicht, und sie verriet es mir erst viele Jahre später. Als ihre Mutter Emmy starb, war Esther neun Jahre alt. Ich hätte damals eine Mutter gebraucht, sagte sie mir, und die nie überwundene Tragik dieses Todesfalls schwang in der Modulation ihrer Stimme mit.
Sie mochte keine Nelken, die brauchte man ihr nicht zu schenken, und sie pflanzte auch keine in ihrem Garten, denn Nelkensträuße standen einst am Sarg ihrer Mutter, und deren Duft verband sich mit dem süßlichen Geruch der Verstorbenen zu einer unauslöschlichen Erinnerung. Und sie mochte das Gebet Unser Vater nicht, denn sie haderte ein Leben lang mit der Unterwerfung Dein Wille geschehe. Nein, nicht immer sollte Gottes Wille geschehen.
Der Gedanke hat auch mich geprägt. Und vielleicht auch meinen Vater. Als er alt war, pflegte er zu sagen: Gott ist ein Stümper. Welch ein kraftvolles Auflehnen gegen Gottes Willen und welch tröstlicher Ausdruck des Glaubens.
III
Mysterium
Die Zwingli-Bibel mit dem schwarzen Ledereinband, der ein wenig muffig riecht, stammt aus dem Jahr 1913, als mein Großvater Fritz und meine Großmutter Emmy im Berner Münster heirateten. Das steht auf einer der leeren, für persönliche Eintragungen reservierten Seiten am Anfang des Buches. Und unter der Rubrik Sterbefälle hat mein Großvater geschrieben:
Meine Emmy, unser Liebstes, die Sonne unseres Lebens, heimgegangen am 10. Dezember 1933.
In jener Nacht wachten Esther und ihre beiden älteren Schwestern Gertrud und Katharina miteinander auf. Sie trafen sich draußen im Gang ihrer Wohnung und sprachen lange über ihre Mutter, die krank im Spital lag. Wie mochte es ihr gehen? Da läutete die Hausglocke. Weil die Familie noch kein eigenes Telefon besaß, überbrachte ein Nachbar die Nachricht, dass Emmy im Sterben liege.
Alle drei Schwestern waren ihr Leben lang davon überzeugt, dass ihre Mutter vor dem Tod intensiv an sie gedacht hatte und sie deshalb zur gleichen Zeit wach geworden waren.
IV
Hexenkind
Meine Mutter verbrachte 1934 mehrere Monate in Oberägeri in einem von Nonnen geleiteten Kindererholungsheim. Sie erzählte mir später, dass sie dort sehr litt, denn es herrschten unerträgliche Zustände: Die jungen Patienten, die sich, wie meine Mutter auch, von der Tuberkulose erholten, waren täglich körperlicher und psychischer Gewalt ausgesetzt. Auch die Hygiene im Heim sei mangelhaft gewesen und das Essen schlecht. Esther begann zu fasten und nahm immer mehr ab.