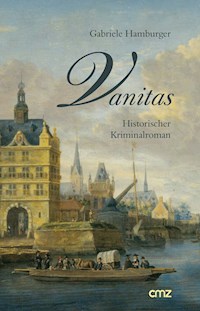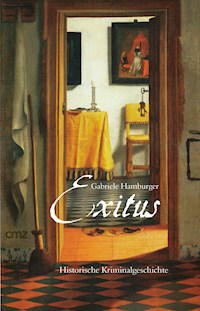
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: cmz
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein verschlüsselter Brief und das Verschwinden seines Sohnes reißen 1673 Christoph Salentin Sechem von Merhoffen aus seinem beschaulichen Landleben. Unter Lebensgefahr versucht er mit ungewöhnlichen Mitteln, die von kaiserlichen, spanischen und holländischen Truppen belagerte Residenzstadt Bonn vor dem Exitus zu retten, ohne zu wissen, dass er bald selbst eine Figur in einem Kriminalfall sein wird, der 1674 Europa bestürzte. Spannend und so nah an den historischen Ereignissen wie möglich erzählt Gabriele Hamburger vom Leben im 17. Jahrhundert und von weltbewegender Geschichte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 456
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Autoreninfo
Gabriele Hamburger, geboren 1953 in Karlsruhe, ist verheiratet und lebt in Königswinter. Sie ist promovierte Juristin mit wissenschaftlichem Interesse an frühneuzeitlicher Geschichte. Nach »Vanitas« ist »Exitus« ihr zweiter historischer Roman.
Haupttitel
Gabriele Hamburger
Exitus
Historische Kriminalgeschichte
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Originalausgabe
© 2013 by CMZ-VerlagAn der Glasfachschule 48, 53359 RheinbachTel. 02226-9126-26, Fax 02226-9126-27, [email protected]
Alle Rechte vorbehalten.
Umschlagbild:Samuel van Hoogstraten (1627–1678), Die Pantoffeln, 1654/62;Öl auf Leinwand, 103 × 70 cm; Musée du Louvre, Paris
Umschlaggestaltung(nach einem Entwurf von Raphaela Rutschke, Ulm):Lina C. Schwerin, Hamburg
eBook-Erstellung:rübiarts, Reiskirchen
ISBN Paperback 978-3-87062-147-6ISBN epub 978-3-87062-269-5ISBN mobi 978-3-87062-270-1
20131105
www.cmz.de
Motto
Sey dennoch unverzagt. Gieb dennoch unverloren.Weich keinem Glücke nicht. Steh’ höher als der Neid.Vergnüge dich an dir / und acht es für kein Leid /Hat sich gleich wider dich Glück / Ort / und ZeitVerschworen …
Paul Fleming (1609–1640)
Inhalt
Juni 1673
August 1673
September 1673
Oktober 1673
November 1673
Christmonat 1673
Januar 1674
Hornung 1674
März 1674
April 1674
Historischer Hintergrund
Historische Personen
Glossar
Danksagung
Ohne einen Blick auf die Linie des Ufers zu werfen, könnte ich sie zeichnen: die weitschwingende Ausbuchtung im Süden, den Fels, der im Osten das Land eine Armlänge in das Wasser verlängert und das die Konturen der eiartigen Form des Sees störende Schilffeld im Norden, einen Steinwurf von dem Steg entfernt, auf dem ich sitze.
Die Form ist beständig, die Farbe wechselt. Wolkengrau, aufblitzendes Silber im Dämmerlicht, Meerblau im Sonnenschein, schillerndes Blaugrün, unsicher, als wisse der See nicht, was er ist oder werden wolle. Farben erfrischen, beglücken, lassen die Gedanken bis ins Paradies wandern, doch sie sind flüchtig wie die Zeit. Bei Nacht verlieren sie alle Kraft. Nicht die Farbe, nur die Form ist verlässlich. Selbst Verformungen erzählen eine Geschichte. Man kennt die Ursache der Verbiegungen und Makel, die Erinnerungen wecken, weshalb altes Wertloses einem manchmal mehr am Herzen liegt als neue Kostbarkeiten.
Der See ist jedoch so geblieben, wie er immer war. Da, in der Bucht, lernte ich die Schwimmkunst, die ich meinem Sohn Alexander ebenfalls dort lehrte. Wie ich liebt er das Wasser. Mit einer Angel sitzt er am Ende des Stegs und singt unentwegt: »Ich fange schöne Fischlein, Fischlein.« Für einen Siebenjährigen ist er zu verspielt, zu verträumt. Er reitet zwar gut, ansonsten verspinnt er sich lieber in die Musik, als sich im Fechtkampf zu üben.
Am Rande eines Rieds fischt eine Ente nach Nahrhaftem. Den Hals hochgereckt hält sie hin und wieder Ausschau nach Feinden oder beobachtet ihre fünf Jungen, die in perfekter Übereinstimmung ihr jede Wendung nachmachen. Nur das kleinste Küken, bei dem noch gelber Flaum zu sehen ist, hat Mühe Anschluss zu halten. Wieder wendet die Ente ihren Kopf. Länger als bisher beäugt sie ihre Brut, macht dann so schlagartig kehrt, dass die Jungen ihr nicht folgen können, stürzt auf das Jüngste zu, hackt auf es ein und verjagt es. Danach setzt sie sich wieder an die Spitze der Kinderschar und schwimmt weiter. Das vertriebene Küken gesellt sich zu den anderen, als sei nichts geschehen. Vielleicht ist auch nichts geschehen. Die Gewalt entlud sich so jäh, dass sie mir eher traumhaft als wirklich erschien. Doch der nächste Angriff lässt nicht auf sich warten. Blindwütiger als zuvor hämmert die Alte auf das Kleinste ein, drückt es mit Schnabelhieben unter Wasser. Die übrigen Jungen fliehen, bleiben jedoch als ungeordneter Haufen in der Nähe der Mutter, die nach der Attacke empört quakend zu ihnen zurückkehrt. In gehörigem Abstand folgt das misshandelte Entlein der Gruppe. Trotz der Gefahr schließt es sich den Geschwistern erneut an. Das duldet die Alte nicht. Flügelschlagend greift sie den Nachzügler mit solcher Gewalt an, dass er völlig unter der Wasseroberfläche verschwindet. Das Küken will fliehen, aber gegen die entfesselte Kraft ist es nur ein schwächliches Ausweichen. Unerbittlich presst die Alte das Entlein immer wieder unter Wasser. Als es sich nicht mehr wehrt, lässt sie von ihm ab.
Der kleine Vogel hebt den Kopf nicht mehr. Der helle Fleck im Wasser, einem flauschigen gelben Tuch ähnlich, schaukelt im Rhythmus der Wellen.
Ich habe den Atem angehalten. Nicht die Grausamkeit erschreckt mich, sondern das absonderliche Verhalten der Ente. Tiere lachen und weinen nicht. Sie besitzen weder Seele noch Ich-Empfinden, sondern folgen ihrem auf Fressen, Verteidigung und Brunftkämpfe ausgerichteten Instinkt so zwangsläufig wie ein Mühlrad dem Fließen des Wassers. Kein Tier tötet aus Mordlust. Wenngleich ich nicht wie die heidnischen Römer aus dem Flug oder den Innereien von Vögeln die Zukunft herauslese, sehe ich doch im Unerklärlichen ein beunruhigendes Omen. Meinem Sohn entging dieses seltsame Ereignis. So muss ich keine Begründung für ein mysteriöses Phänomen suchen. Bisher blieb ich ihm selten eine Erklärung schuldig. Eine meiner Eitelkeiten ist es, seine bewundernden Blicke zu genießen und ich freue mich, ihm Sicherheit geben zu können in einer gefährlichen Welt. Er kommt zu mir. Missmutig sieht er mich an. Die Smaragdaugen hat er von seiner Mutter, während die braunen Locken und dichten Wimpern von mir stammen.
»Kein Fisch da!«, sagt er und setzt sich neben mich.
»Dein Singsang war zu laut. Wie bei der Jagd muss man leise sein, um die Fische zu überlisten.«
Grübelnd blickt er über den See und fragt: »Wenn man groß ist, ist man dann ein anderer Mensch?«
»Nein, zweifellos nicht. Eine kuriose Frage!«
»Aber ich … ich kann doch nicht das können, was ein Mann tut. Deshalb muss ich doch ein anderer Mensch werden.«
Ja, was hatte ich, Freiherr Sechem von Merhoffen, Grundherr einer stattlichen Anzahl von Bauernhöfen, mit dem einstigen Kind Christoph Salentin noch gemeinsam? Wenig! Und doch – manchmal fühle ich die Hilflosigkeit des Kindes und setze die Maske des selbstsicheren Erwachsenen auf. Manchmal denke ich, erst gestern zehn Jahre alt gewesen zu sein, so bildhaft stehen alte Erlebnisse mir vor Augen, die allerdings in einer ganz anderen Welt eingebettet sind, als gehörten sie zu den Memoiren eines anderen Menschen. Um meinen Sohn nicht zu irritieren, antworte ich schulmeisterlich: »Die Seele bleibt gleich, nur äußerlich verändert man sich. Wenn du dich im Fechtkampf übst, wird dein Leib stark und wenn du fleißig Latein und Mathematik lernst, wächst dein Geist.«
Angewidert kraust er die Nase. Fechten ist ihm ein Gräuel. Lesen und Schreiben hatte er so leicht erlernt, als wiederhole er Bekanntes. Seitdem ihn aber ein Präzeptor unterweist, legt er eine halsstarrige Abneigung gegen jede Wissensvermehrung an den Tag. Gut, wie alle Lehrer ist auch sein Präzeptor ein Hirnschleifer. Dennoch, warum er sich nun verweigert, sagt er nicht. Überhaupt ist er schweigsam und wenn er redet, äußert er gern Absonderliches, so dass meine Frau Felicitas schon an seinem Verstand zweifelte. Obwohl sie ihn lange übermäßig verzärtelte, findet sie jetzt mehr an ihm auszusetzen, als sich über seine Fortschritte zu freuen. Zu weltabgewandt, zu eigenbrötlerisch bekrittelt sie ihn, wobei sie mich vorwurfsvoll ansieht, in dem sie die Ursache der Schrullen unseres Kindes vermutet. Seitdem ich den Siebenjährigen unter meine Fittiche genommen habe und das, was sie für sonderbar hält, still als eine Eigenart akzeptiere, ist er lebhafter.
»Dort drüben tanzen die Vögel.« Er deutet zum Himmel. »Sie feiern Hochzeit!«
»Vögel feiern nicht Hochzeit mit vielen Gästen.«
»Nein?«
»Nein, etwas hat sie dort aufgescheucht!«
»Dann sehen wir nach, was da ist«, drängt er.
»Es wird ein Wanderer sein oder ein Fuhrwerk, dort verläuft ja die Landstraße.«
»Vielleicht eine Kutsche? Tante Sophia und Ari!«
Ari ist der Sohn meiner Schwester Sophia, die in Bonn lebt. Er heißt eigentlich Anton Heinrich. Seine Eltern nannten ihn aber Henri, das sie stets französisch aussprachen, woraus ein Ari wurde. Alexander hängt sehr an Ari und überredet mich, zurück nach Merhoffen zu gehen. Doch weder im Wirtschaftshof noch vor dem Herrenhaus steht eine Kutsche. Alexanders Besorgnis, Ari könnte etwas zugestoßen sein, ist ansteckend. Meine Gattin Felicitas ist am Vortag mit unserer neunjährigen Tochter nach Köln gefahren, obwohl die Wege unsicher sind. Krieg liegt in der Luft. König Ludwig XIV. von Frankreich, Herr des mächtigsten und glanzvollsten Hofes Europas will seinem Ruhm nun auch den militärischen Glorienschein hinzufügen. Mit Ludwig XIV. ist unser Kurfürst Maximilian Heinrich verbündet und unterstützte ihn tatkräftig im letzten Jahr die Republik der Niederlande anzugreifen. Nach dem verzweifelten Widerstand der völlig überraschten Holländer, die in ihrer Not die Deiche durchstachen, so dass viele der eingefallenen Franzosen jämmerlich ersoffen, verlagerte sich der Krieg ins Reich hinein. Seit Januar 1672 sichert die Residenzstadt Bonn eine französische Besatzung, die allerdings Feinde anzieht und das sind inzwischen neben Kaiser Leopold fast alle deutschen Fürsten. Kurioserweise ist unsere Hauptstadt Köln kaisertreu und ein kaiserliches Regiment unter dem Marquis Grana schützt sie. Das Gerücht geht um, der Kurfürst wolle die freie Reichsstadt mit Hilfe der Franzosen gewaltsam in das Kurfürstentum eingliedern. Die Franzosen eroberten im Februar dieses Jahres Soest und Höxter wie zuvor schon Wesel, Rheinbergen, Emmerich und Rees. Was hindert sie daran, den Wunsch unseres Kurfürsten zu erfüllen und Köln anzugreifen? Nur ungern habe ich Felicitas und meine Tochter nordwärts ziehen lassen. Vielleicht sind sie zurückgekehrt und in Not geraten. Bevor ich mit meinem Sohn zur Landstraße laufe, lade ich eine Pistole, die ich seit letztem Jahr im Torturm versteckt habe.
Gleich hinter der Zufahrt zu Merhoffen macht die Straße eine Biegung. Dahinter liegt, vielleicht einen Musketenschuss entfernt, ein auf die Seite gekippter schwerer Reisewagen, glücklicherweise nicht Felicitas’ Kalesche. Drei Männer in dunklen Mänteln stehen breitbeinig neben der Karosse, den Rücken uns zugewandt. Sie verdecken weitere Personen. Die drei Burschen machen mich stutzig. Sie stehen so frontal den anderen gegenüber, als gehörten sie nicht zu der Reisegruppe. Meinen Sohn mitziehend verstecke ich mich hinter Gebüsch. Einer der Burschen tritt zur Seite und gibt den Blick auf eine Dame und eine Jungfer frei. Mit der Pistole in der Hand könnte man mich für einen Freibeuter halten. Nach dem Unfall will ich den Leuten einen weiteren Schrecken ersparen.
»Bleib hier«, flüstere ich Alexander zu und lege die Waffe neben ihm nieder, die er gleich von sich wegschiebt.
Er weiß zwar, wie man feuert, war aber bisher zu ängstlich, das zu tun. Ich pirsche mich an die Reisenden heran. Die Frauen stehen wie Salzsäulen. Die Dame nestelt an ihrer Halskette herum und nimmt sie ab. Ich begreife, verstecke mich hinter einem Baum und ziehe den Degen.
»Merci, Madame, der liebe Gott wird’s Euch lohnen. In der Bibel steht ja, wer zwei Perlenketten hat, gibt denen eine, die keine haben«, dankt einer der Männer für das Kleinod.
»Mir wär’ der Siegelring angenehm«, fordert ein anderer.
Ein Herr streckt ihm seine Hand entgegen und der Kerl zieht ihm den Ring ab.
»Sehet, Gottes Brünnlein hat nicht nur Wasser die Fülle«, sagt der Bibelfeste mit dem 65. Psalm. Er deutet auf einen anderen Herrn: »Den Mantel mit der goldenen Schließe!«
Der Angesprochene zögert. Sofort richtet der Wegelagerer die Pistole auf die Dame und erhält das Gewünschte.
»Ja, sorgt Euch nicht um die Kleider! Ist nicht der Leib mehr wert als die Kleidung«, spottet der Halunke.
»Zum Henker, du kriegst noch deinen gerechten Lohn, verfluchter Schnapphahn!«, schimpft der Beraubte.
»Ha, den hab ich schon!« Der Strauchdieb hält den Mantel hoch und schwenkt ihn. Der dritte Gauner nähert sich der Dame. Er will sie wohl als Geisel nehmen. Jetzt muss ich handeln. Ein paar Schritte, ich packe den Burschen mit dem Mantel, halte ihm den Degen an die Gurgel und rufe: »Die Pistolen fort! Sonst schneid ich ihm die Kehl durch!«
Mein Opfer lässt die Waffe fallen, nicht die beiden anderen.
»Topp, stich ihn ab!«, sagt einer der Räuber und grinst.
Ich drücke die Klinge fester gegen den Hals meines Gefangenen, der einen Angstlaut von sich gibt.
»Gleich verreist der in eine andere Welt. Also, die Waffen nieder!«, drohe ich den Mann zur Seite zerrend, damit er seine Gefährten ansehen kann.
»Erbarmen, so helft doch!«, bettelt er seine Kumpane an.
Die Kerle sind hartleibig. Einer richtet die Pistole auf die Reisenden, der andere auf mich. Das habe ich nicht erwartet.
»Ein Schuss und von meiner Burg Merhoffen gleich hinter der Wegbiegung kommen meine Knechte! Einer lauert schon im Hinterhalt«, warne ich und hoffe, dass mein Sohn vielleicht doch einen Pistolenschuss abgibt.
Die beiden Wegelagerer wechseln Blicke, gehen rückwärts und einer ruft mir zu: »Behalt deinen Gefangenen!«
Im Nu ist erst der eine Halunke, dann der andere auf einem Pferd. Einer der Überfallenen hebt die Pistole auf, die mein Gefangener fallen ließ. Er schießt. Einem der Gauner fliegt der Hut vom Kopf. Durch den Knall müssen die Lumpen die Gäule nicht einmal mehr antreiben und galoppieren davon. Der Schütze dreht sich zu mir um und brüllt auf Italienisch: »Ch’io faccia in pezzi, questo ladrone!« Davon verstehe ich nur »in Stücke« und »Halunke«. Was das bedeutet, erfahre ich sofort. Die Pistole auf mich gerichtet kommt er heran, fasst die Waffe am Lauf, holt aus und schlägt das Griffstück meinem Gefangenen auf den Kopf, der in meinen Armen zusammensackt. Um ein Haar hätte meine Klinge ihm die Gurgel aufgeschlitzt. Ich lasse den Bewusstlosen zu Boden gleiten.
»Das verdanken wir dir!«, schreit der aufgebrachte Kavalier und zielt auf meine Brust; dann fällt ihm ein, dass die Waffe entladen ist und lässt sie sinken.
»Ja, der Herr kann mir danken, dass Er hier nicht nackend steht«, sage ich. »Sein Mantel ist sogar gerettet.«
»Bravo, dafür ist mein Pferd weg und das ist mehr wert als der Mantel!« Er schleudert die Pistole von sich.
Ein Kleinkind weint. Blut rinnt über das Gesicht des niedergeschlagenen Mannes. Ich knie neben ihm nieder und lege die Hand auf seine Brust. Der Atem ist schwach spürbar.
»Der ist hin«, sagt ein Mann, der wohl der Kutscher ist.
»Stellen wir die Kaross’ auf, damit wir fortkommen! In dieser Burg Merhoff gibt’s gewiss einige Knechte, die das zuweg bringen, ohne uns gleich ganz auszurauben!«, schlägt der jähzornige Kavalier mir im Befehlston vor.
»Ja, ich kann die Kutsche aufrichten lassen«, sage ich ruhig, »aber der Mann hier gibt wohl bald den Geist auf, von dir erschlagen, du Grobian! Und der arme Mensch liegt mir, weiß Gott, mehr am Herzen als deine Bequemlichkeit!«
»Pah, armer Mensch, dieser verfluchte Rappschnabel?« Er blickt den Verletzten wie einen stinkenden Kadaver an. »Der verdient Grausameres, als nur erschlagen zu werden.«
Ich schüttle den Kopf über diese barbarische Rede. Vielleicht habe ich die letzten Jahre zu abgeschieden gelebt und meine Zeit zu oft mit Büchern zugebracht, um die raue Wirklichkeit noch zu verstehen, in der solche Rohheiten üblich sind. Der vornehme Rüpel beordert den Kutscher, einen Diener und einen bisher stillen Herrn zu der Karosse, zieht seinen Rock aus und krempelt die Ärmel seines Hemdes auf. Alle folgen seinem Beispiel. Dabei bemerke ich, dass der linke Arm des schweigsamen Herrn ungewöhnlich dünn ist. Er schont sich aber nicht und stemmt sich mit dem Rücken gegen den Wagen, um mit den anderen die Kutsche in Schwingung zu bringen. Der Verletzte liegt immer noch reglos in meinen Armen. Ich wische das Blut weg. Die Wunde zieht sich vom Haaransatz bis zur Nasenwurzel. Wenn sie nicht zu tief ist, kann er überleben. Ich sehe mich um. Der Schuss hat Hennes, meinen Stallmeister, einen Knecht und den Pferdejungen angelockt. Hennes holt Alexander aus dem Gebüsch. Mein Sohn schreit, reißt sich los, rennt in Richtung Merhoffen. Die Wut kocht in mir hoch über die unnötige Flucht dieses verweichlichten Knaben.
»Wenn der Herr dem Galgenvogel hier endlich die letzte Ölung gäb und uns den Gefallen erwiese, die Kutsch hochzubringen, uns würd’s freuen«, spricht mich der noble Rüpel erneut an.
»Meine Knechte werden helfen!«
»Er ist sich wohl zu fein auch Hand anzulegen?«
»In Gesellschaft eines ungehobelten Übeltäters, gewiss!«
»Cane cattivo, was erlaubst du dir!« Er beugt sich zu mir hinunter, packt mich am Hemd und schlägt mir ins Gesicht.
Das ist zu viel. Der Kerl kann nur wenige Jahre jünger als ich sein und sollte seine Flegeljahre hinter sich haben. Ich springe auf, ziehe den Degen. Flugs hat er auch den seinen in der Hand, den die Wegelager beiseite geworfen hatten.
»Nein! Nicht!« Der stille Herr mit dem dünnen Arm tritt zwischen uns. »Die Herren sollten sich nicht an die Kehl gehen, nachdem wir gerade so glücklich dem Raubgesindel entkommen sind.« Da ich der Beleidigte bin, sieht er mich bittend an. »Mein Freund hier ist ein wenig hitzig«, fügt er hinzu.
»Wenn sich der feurige Kavalier entschuldigt, will ich sein ungebührliches Benehmen vergessen«, erwidere ich.
»Pah, ungebührliches Benehmen? Einen Marchese Obizzi ungehobelter Übeltäter zu nennen, das ist ungebührlich, sonst nichts!«, schimpft der Grobian, dem jede Entschuldigung wohl so nahe liegt wie die Erde der Sonne.
»Wegen der Dame und der Jungfer, bitt ich auf weiteres Blutvergießen zu verzichten«, besänftigt uns der Vermittler.
Der junge Mann kommt mir bekannt vor, aber die Gedanken schleichen zu träge durch mein Hirn, als dass sie mir eine Erinnerung eingeben könnten. Jedenfalls hat er Recht, nach der gerade überstandenen Leib- und Lebensgefahr sollte man sich nicht noch gegenseitig an die Gurgel gehen.
»Bereinigen wir es später!«, schlage ich meinem Kontrahenten vor, der seinen Degen senkt und nickt.
Meine Knechte kommen heran. Den Pferdejungen schicke ich zurück, damit er eine Leiter für den Verletzten holt, die beiden anderen nimmt Obizzi in Beschlag. Wie zu erwarten war, bringen aber auch die sechs Männer das Gefährt nicht auf die Räder. Mit Stangen, Seilen und Pferden wäre das keine allzu schwere Aufgabe. Das sieht nun auch Obizzi ein. Als der Junge und sogar mein Küchenmeister Melchior mit einer Leiter kommen, um den Verletzten wegzutragen, schlage ich den Reisenden vor, sich in Merhoffen zu erholen. Die Dame nimmt das Angebot freudig an. Obizzi will bei der Kutsche bleiben, aber auch die Frauen nicht alleine lassen und versucht die Dame durch überbesorgtes Reden zurückzuhalten. Schroff bittet sie ihn, ihr ein wenig Ruhe zu gönnen. Sie ist wohl von höherem Stand als er, denn der Raufbold schlägt Harfenklänge voller Liebenswürdigkeiten an, die schon etwas Kriecherisches haben. Die Jungfer nimmt das wimmernde Kind auf den Arm und folgt meinen Knechten, die den Verletzten auf der Leiter nach Merhoffen tragen. Die Dame schließt sich an. Notgedrungen begleitet Obizzi seine Schutzbefohlenen. Der Kavalier mit dem schwachen Arm sucht auch nicht gerade meine Gesellschaft. Meine Einladung nach Merhoffen lehnt er höflich ab. Sein flüchtiges Lächeln demonstriert eher erzwungene Freundlichkeit als echtes Wohlwollen. Ich sehe mir die Karosse an. Der Kutscher kommt mir nach.
»Wenn sie wieder auf den Rädern steht, wird sie fein rollen!«, sage ich mehr zu mir als zu ihm.
»Nein«, widerspricht der Kutscher. »Seht, am hinteren Rad sind zwei Speichen angebrochen und wenn wir die Kaross aufstellen, wird’s Rad ganz und gar zerbersten.«
Seine Voraussage könnte sich bewahrheiten. Der Kavalier, der sich den Schaden nun ebenfalls betrachtet, kommt wohl zum gleichen Ergebnis.
»Herr Jesus«, stöhnt er auf, »da hab ich der Marquise einen schlechten Dienst erwiesen, als ich die Abkürzung vorschlug.«
»Ach, das Rad stellen meine Knechte so wieder her, dass es bis Holland kullert«, versuche ich ihn zu trösten.
Himmel, woher kenne ich den sehnigen Mann mit dem lahmen Arm? Ein leichter Nieselregen geht nieder. Der Kutscher versichert, die Karosse aufs Beste zu bewachen und ermuntert den Kavalier ebenfalls zu gehen. Der aber setzt sich unter einen Baum und erwidert, hier von größerem Nutzen zu sein. So mache ich mich allein auf den Weg. Im Wirtschaftshof läuft mir mein Sohn entgegen. Schlechtgelaunt herrsche ich ihn an: »Warum bist du eben wie ein Has’ davongelaufen?«
»Ich hatte Angst vor den Männern und dem Schießen!«
»Du bist ein Hosenscheißer!«
»Ja, Herr Papa«, sagt er so beschämt, dass ich auf weitere Zurechtweisungen verzichte.
Gemeinsam gehen wir an dem Ziehbrunnen vorbei zum Herrenhaus. Es ist ein zweistöckiger einfacher Backsteinbau, der im Vergleich zu den niedrigen Wirtschaftsgebäuden aus Fachwerk sich allerdings recht nobel ausnimmt. Der altertümliche Wehrturm auf der linken Seite des Hauses sollte schon seit Jahren abgerissen sein. Aber die Welt dreht sich schneller als Geld einkommt und so steht dieses baufällige Gemäuer aus alter Ritterzeit immer noch. Im Speisezimmer treffe ich auf meine ungeliebten Gäste. Obizzi steht am Fenster neben dem mannshohen Kamin aus schwarzem Stein und blickt in den Regen. Die Dame hat es sich in einem Armstuhl vor einem mageren Feuer gemütlich gemacht, während die Jungfer, das schlafende Kleinkind auf dem Schoß, am Tisch sitzt. Ein friedvolles Bild, obwohl kein Friede herrscht. Die Dame sieht mich freundlich an.
»Ich danke für die gütige Aufnahme, Herr von Merhoffen. Wir werden bald weiterfahren, um nicht weitere Unannehmlichkeiten und Unruh ins Haus zu bringen«, sagt sie leise.
»Nein, keine Eil! Gesellschaft ist für mich stets ein Gewinn und keine Last, Madame, sofern man mich nicht bedroht.«
Obizzi dreht sich langsam um und verschränkt die Arme.
»Ich bitt herzlich, die Hitzigkeit meines Begleiters zu entschuldigen«, bittet die Dame, »aber wir sind doch sehr ins Unglück gekommen. Da tut mancher Dinge, die er hernach bereut.«
Obizzis Miene drückt eher Rache als Reue aus. Auch ich habe die Ohrfeige nicht vergessen, bin aber bereit, ihm zu verzeihen, sofern er sich entschuldigt. Das ist allerdings eine hoffnungslose Hoffnung! Mein Diener Jost bringt Milch für das Kind, stellt Gläser sowie eine Karaffe Wein auf den Tisch. Brot, Schinken und Käse folgen – kein Fürstenmahl, aber ein stärkender Imbiss. Um Obizzi und mir das bissige Anschweigen zu ersparen, lasse ich meine Gäste alleine speisen und gehe zu dem Verletzten. Ich habe ihn in einer Kammer im Herrenhaus unterbringen lassen, zwar zu viel der Ehre für einen Strauchdieb, doch in den Wirtschaftsgebäuden hätte ich es seinen Kumpanen zu leicht gemacht, ihn zu befreien. Der Kerl ist weiterhin ohnmächtig, sein Gesicht bis zur Unkenntlichkeit blutverschmiert. Warum man den Menschen wie ein Stück Vieh abgeladen und noch nicht verbunden habe, will ich von meinem Diener Jost wissen, der mir gefolgt ist. Er verzieht schuldbewusst das Gesicht und macht eine Geste der Hilflosigkeit, die ich nicht recht zu deuten vermag. Ende des Dreißigjährigen Krieges haben ihm Soldaten den Großteil seiner Zunge abgeschnitten, deshalb ist er stumm. Ich weise ihn an, mir warmes Wasser, Branntwein und Verbandszeug zu bringen, damit ich das nachhole, was bisher alle versäumten. Entsetzt schüttelt er den Kopf und zeigt auf sich.
»Nein, ich verbinde ihn«, sage ich, »du hättest dies christliche Werk schon lange tun können. Nun mach ich’s!«
Er deutet wieder auf sich und schlägt bittend die Hände zusammen, damit ich so niedrige Arbeit nicht verrichte. Doch ist mir dieses Zeichen des Erbarmens gegen die Grausamkeit der Welt, die nun auch in mein Haus eingedrungen ist, ein Bedürfnis. Die Küchenmagd bringt mir das Gewünschte.
»Mit Verlaub«, sagt die Magd, »der vornehme Gast verlangt dringlich nach Euch. Jost und ich verbinden den Mann gern.«
»Der Gast mag sich gedulden. Der hier wartet nun schon lang genug, dass sich jemand bequemt ihm beizustehen!«
»Herr, ich hab für die Gäst’ den Imbiss bereitet«, sagt sie.
»Gut, so kümmere dich weiter um die Gäste. Geh!«
Vorsichtig wische ich angetrocknetes Blut von der Stirn und den Wangen des Verletzten. Es ist ein derbes junges Gesicht, zu jung, um schon mit Erde bedeckt zu werden. Hellbraune Locken umrahmen es und geben den männlichen Zügen etwas kindlich Zartes. Als ich die Wunde säubere, schlägt er die Augen auf. Sie sind bernsteinfarben. Sein Blick verirrt sich in der ungewohnten Umgebung. Er stöhnt.
»Noch immer bei der letzten Ölung?«, höre ich Obizzis Stimme hinter mir.
Breitbeinig steht er in der Tür. Ich wische die Hände an dem Lappen ab, den ich in die Waschschüssel gleiten lasse.
»Der Herr kann Gott danken, dass Er nicht zum Mörder geworden ist«, sage ich gelassen.
»Das Aas lebt noch?«
»In meinem Haus ist kein Aas!« Ich drehe ihm den Rücken zu und nehme das Verbandszeug zur Hand.
»Vergebung, ich wollt den Herrn nicht wieder erzürnen!« Diese kleinlauten Worte passen zu dem herrischen Menschen wie Hirsebrei auf eine Fürstentafel. Ich ignoriere ihn und verbinde zusammen mit Jost die Kopfwunde des Opfers. »Ich bitte um eine Unterredung«, fährt Obizzi fort, und da ich schweige, fügt er gereizt hinzu: »Soll ich noch einen Kniefall machen, damit mir die Ehr einer Antwort zuteil wird?«
»Ein Kniefall wär angemessen, aber nicht hier, sondern in der Kirche«, fauche ich ihn an, »in meinem Haus dulde ich keine Rüpelworte. Will der Herr fortan meine Gastfreundschaft in Anspruch nehmen, sollte Er einen gesitteten Ton gegenüber allen Leuten unter meinem Dach anschlagen.«
»Hier geht’s wohl ein wenig klösterlich zu«, spottet er.
»Dagegen habe ich nichts einzuwenden!«
Ich stehe auf und bedeute ihm, mit mir zu kommen. Die Jagdkammer ist der beste Ort für eine ungestörte Unterredung, wobei ich hoffe, dass der Heißsporn nicht ein Jagdmesser vom Haken reißt, um es mir in den Leib zu rammen. Er ist kräftig, aber kleiner als ich. Sein italienischer Akzent gibt seiner Rede eine weich klingende Melodie, während sein grobschlächtiges Auftreten raumfüllend maskulin wirkt. Dennoch liegt in seiner Leidenschaftlichkeit etwas von der Unreife eines Kindes, das mit Radau aus seiner Kleinheit heraus will. Diese Unausgegorenheit seines Wesens nötigt mich, ihn trotz seiner unflätigen Worte nicht vor die Tür zu setzen, sondern mich wie ein Vater um ihn zu kümmern, obwohl er das dreißigste Lebensjahr schon erreicht haben müsste. Wir setzen uns an den Tisch, auf dem Ölflecke und verkohlte Pulverreste noch von der letzten Reinigung meines Waffenarsenals zeugen. Das stört den Marquis nicht. Seine Finger streichen sogar über das Holz, als gefiele ihm die Unsauberkeit.
»Monsieur, ich bitt all die Verdrießlichkeiten zu entschuldigen, die unser Missgeschick verursachte. Erst das Umwerfen der Kaross, was noch glimpflich abging und dann kamen diese furfanti, die erst so artig taten, als wollten sie helfen, nur um uns im rechten Moment zu überrumpeln. Zum Henker mit ihnen! Und dem Kerl musst ich die Pistol über den Schädel schlagen, sonst wären alle hingemordet …«
»Halt, bleiben wir doch bei der lieben Wahrheit!«, schneide ich ihm das Wort ab, »der Mann war ohne Waffen und für niemanden eine Gefahr. Ich halt dem Herrn Marquis zugute, dass Er, gerade aus großem Schrecken befreit, die Umständ wohl verkannte.«
»Bene, so einen Puff hat der Schindhund verdient. Aber das ist nicht die Ursach, warum ich um ein Gespräch bat. Die Marquise ist erschöpft und es wär uns lieb, die Nacht hier Quartier nehmen zu dürfen, wenn’s genehm ist?«
»Es ist mir eine Freude zu helfen. Die Marquise von … pardon, wie ist ihr Name?«
»Ja, da bitt ich um Verständnis, wenn der Name im Dunkeln bleibt. Madame reist inkognito und wenn wir auch sonst in Herbergen Marquise von A oder B angaben, so will sie jetzt den freundlichen Gastgeber in der Not ungern belügen.«
»Kurios!« Befremdet schüttle ich den Kopf. »Aber gut, wenn’s der Wunsch von Madame ist.«
»Gewiss! Es wär’ uns auch lieb, wenn unser Erscheinen hier und das Unglück nicht gar so an die große Glock gehängt würden. Wir wollen möglichst wenig Aufsehen erregen.«
»Hei, das ist ja eine ominöse Gesellschaft.«
»Mag sein!« Er lächelt verlegen. »Wir führen aber nichts Böses im Schild. Es geht um eine Erbschaft der Marquise im Bergischen. Einige Missgünstige wollen sie sogar gewaltsam daran hindern, ihre Ansprüch durchzusetzen. Daher sind wir in Eil und bitten um Diskretion.«
»Gut, von mir erfährt’s keiner, allerdings steh ich für die Plappertaschen unter meinem Gesinde nicht ein.«
»Das Schwatzen so niederer Leut schert keinen. Ich danke für das Obdach und bitt, mich jetzt zu entschuldigen.«
Ich nicke; er verbeugt sich, bevor er gemessenen Schrittes die Jagdkammer verlässt. Seltsam, alles sehr seltsam! Das Einzige, was ich glaube, ist, dass Obizzi tatsächlich so heißt. In der Wut nannte er bestimmt seinen wahren Namen. Er macht ganz den Eindruck eines Soldaten. Die Erbschaftsgeschichte ist absonderlich. Wozu gibt es Advokaten? Und dann die Eile? Solche Streitigkeiten ziehen sich oft über Jahrzehnte hin und die wenigsten Gerichte haben Lust, solche Sachen zu forcieren. Nein, hinter dieser wunderlichen Geschichte steckt etwas anderes. Was es ist, überlasse ich aber meinen Gästen.
Da die Kutsche immer noch nicht im Hof steht, mache ich mich auf den Weg, um meine Knechte anzutreiben. Kaum bin ich zum Tor hinaus, sehe ich den Kavalier mit dem lahmen Arm die Landstraße hinuntergehen. Ich rufe ihn an, er dreht sich um und wartet auf mich. Während ich auf ihn zugehe, blickt er zu Boden, so als wolle er mich nicht sehen.
»Warum geht ein vornehmer Herr wie ein armer Wandergesell zu Fuß?«, frage ich ihn.
»Das wisst Ihr doch, mein Pferd ist gestohlen.«
»Gewiss, aber ein Pferd kann ich noch erübrigen.«
»Ich danke für die Freundlichkeit, aber so ist’s mir lieber.«
»Bei meiner Seel, ich hab noch nie so seltsame Gäste gehabt, die bald jedes Hilfsangebot als Beleidigung auffassen.«
»Mit Verlaub, Ihr wisst wohl nicht, wer ich bin?«
»Nein!«
»Florian von Kolff!«, sagt er und schaut mich gespannt an.
Florentin! Sprachlos trete ich einen Schritt zurück. Alte Geschichten kommen mir blitzartig in den Sinn: Marisa, Florentins Schwester, die ich heiraten wollte, es aber nicht konnte, weil ihr Vater die Hochzeit so geschickt hintertrieb, dass sein jüngster Sohn Florentin dachte, ich hätte seine in mich verliebte Schwester im Stich gelassen. Er zwang mich zu einem Duell, dann lag er blutüberströmt vor mir, überlebte nur knapp und sein linker Arm ist seither halb gelähmt. Inzwischen hat er sich so verändert, dass ich ihn nicht wiedererkannte. Die strengen Linien zwischen Nase und Mund, die Augen, die tiefer in ihren Höhlen liegen als früher, die schmal gewordenen Lippen verwischen die einstige, für ihn so charakteristische Unbekümmertheit. Scharfe, eckige Züge haben die Frische verzehrt. Es fällt schwer, die richtigen Worte zu finden, sofern es sie überhaupt gibt, wenn man vor einem Mann steht, dessen Lebensfreude man vor 12 Jahren mit einem Degenstich zerstörte, der zugleich Ursache eines eisernen Hasses zwischen meinem Haus und unseren Nachbarn, den Kolffs, ist, mit denen uns früher eine enge Freundschaft verband.
»Florentin, vergib!«, bitte ich leise.
»Das hab ich schon seit Langem getan. Ja, wir sind die Einzigen, die wahrhaft wissen, wie’s dazu kam. Aber keiner hört auf uns.« Er zuckt die Achseln: »Es liegt schon so lang zurück.«
»Hat jedoch bis heute seinen unseligen Effekt«, ergänze ich. Resignierend nickt er. Wir beide sind zu schwach, den tiefverwurzelten Hass zu überwinden. Florentins älterer Bruder Ernst von Kolff wird mich bis in alle Ewigkeit als widerwärtigen Rivalen sehen. Meine Heirat mit einer Kaufmannstochter brachte mich in eine gute kommerzielle Lage, was seinen Neid erregte. Gleichzeitig verachtet er mich, da ich unter meinem Stand eine Schönheit heiratete und – wie er meint – meinen Adel verkaufte, er hingegen eine hässliche, wenig begüterte Gräfin zur Frau nahm und ein wahrer Edelmann blieb. Seit Jahren bemüht er Himmel und Hölle, um mich in Verruf zu bringen. Jeder kennt inzwischen unsere Fehde, was mir insofern hilft, da man seinen marottenhaften Angriffen auf mich weniger Beachtung schenkt und mich in Ruhe mein zurückgezogenes Leben führen lässt. Florentin und ich verlieren darüber kein Wort. Ein Abschiedsgruß, dann läuft er stundenlang zu Fuß nach Hause, weil es die Familienehre so fordert.
Ohne Radbruch haben meine Knechte die Kutsche aufgestellt. Dennoch rollt sie erst am nächsten Tag zum Tor hinaus. Obizzi reitet ein Pferd, das er mir abkaufte. Er ist höchst verärgert. Bis zum Schluss suchte er ein versiegeltes Schreiben, das er jemanden überbringen soll. Mein gesamtes Gesinde verdächtigt er des Diebstahls, mich wohl eingeschlossen, obwohl selbst sein Geifermaul es nicht wagt, mir das ins Gesicht zu sagen.
Juni 1673
Die Verletzung des Wegelagerers, der die Reisenden auf gut biblisch ausrauben wollte, ist nicht so schwer, wie sie aussah. Trotzdem ist er lange matt oder genießt es, seine Zeit auf faule Weise zuzubringen, nachdem ich ihm versichert hatte, ihn nicht dem Henker auszuliefern. In meinen Augen hat er seine Untat bereits abgebüßt. Da Gott sein Leben bewahrte, sollen es ihm die Menschen nun auch nicht mehr nehmen. Er heißt Paul Schneegaß und kommt der Sprache nach aus Oberdeutschland. Obwohl weder ich noch die Überfallenen etwas von dem Gewaltstreich der Wegelagerer verlauten ließen, behandelt mein Gesinde den Mann, der für sie eigentlich nichts weiter als ein Unfallopfer sein kann, wie einen Aussätzigen. Wahrscheinlich hetzt mein Stallmeister Hennes bei jeder guten oder schlechten Gelegenheit gegen diesen »schelmischen Gesellen«, dessen Kleider und Manieren nicht vornehm genug sind, um ein ins Unglück geratener Edelmann zu sein. Die Leute von der Straße hält Hennes allesamt für liederliche Bettler, Diebe oder Mordbrenner. Ich hingegen führe die Tradition meines Vaters weiter, dessen Herz diesen Menschen gegenüber sanfter gestimmt war. Einigen von ihnen gab er sogar Arbeit und Brot. Einmal sagte er mir: »Man weiß nie, warum jemand in Armut gekommen ist. Oftmals sind die Leut von der Straß ihrem Herrn treuer ergeben und halten eher ihr Maul als das Gesinde aus dem nächsten Dorf.«
Schneegaß hatte mit Lauten- und Geigenspiel sein Brot verdient, bis eines bösen Tages seine Musikinstrumente abhandenkamen. Vom Betteln war der Weg kurz zur Fluchthilfe für Hühner und Gänse, die er so gern hatte, dass er sie sich einverleibte. Später verlegte er sich auf das Herauskitzeln mildtätiger Gaben, wie er seine Räubereien umschrieb. Er traf auf zwei Halunken, die dieses Handwerk professioneller betrieben und sein ewig hungriger Magen belehrte ihn, sich ihnen anzuschließen. Die umgestürzte Kutsche bot eine gute Gelegenheit, fette Beute zu machen. Mir in geradezu kindlicher Weise vertrauend erzählt er vieles aus seinem Lotterleben, das er so ausziert, dass seine Gaunereien als gottgefällige Liebestaten erscheinen. Dieser findige Bursche zieht auch meinen Sohn an, der die Geschichten von der Straße verlockender findet als die Lektionen seines Präzeptors. Der empörte Lehrer steht wieder einmal in meinem Schreibkabinett, weil er seinen Schüler nicht finden kann. Zu dem Schneegaß wolle er nicht gehen, das sei unter seiner Würde, wie es – mit Verlaub – auch unter der Würde eines wohlgeborenen jungen Herrn sei, sich mit Spielleuten abzugeben – ein sittenloses, ja fast ehrloses Völklein, das nicht mehr im Kopf habe, als mit dem Kling-Klang von auf Holz gespannten Schafsdärmen die Leute zum Müßiggang anzuregen. Ich solle endlich für Disziplin sorgen, er sei nun am Ende seiner Kraft und seines guten Willens. Halb klagend, halb tadelnd spricht der geplagte Mann, wobei er Vorwurfsvolles in gebotener Unterwürfigkeit vorbringt. Das nährt meinen Groll gegen meinen Sohn. Denkt der Bursche, seine Heimat heiße Schlaraffenland? Mit dem Präzeptor gehe ich zur Kammer des Schneegaß. Schon von Ferne höre ich Lachen – eine hohe und eine tiefe Stimme und dann – ja, dann folgen Lautenklänge, hoch und tief wie zuvor das Lachen. Die hohe Stimme beginnt fragend, als überlege sie, was zu tun sei. Ihr folgend teilt die tiefe sehr bestimmt und ruhig den Beschluss mit. Nach einer Wiederholung sind beide Stimmen gleichzeitig zu hören. Im satten Ton bewegt sich die untere Stimme auf die höhere zu, bis sich die Töne aneinander reiben und auf eine harmonische Auflösung hindrängen. Diese Reibung der Stimmen berührt mich schmerzlich-schön. Die Melodie schwingt sich weiter in die Höhe, die tiefere der höheren folgend, immer in diesem seelenspaltenden Wohlklang. Die Hand auf der Klinke höre ich zu. Gestikulierend fordert mich der Präzeptor zum Handeln auf. Ich lege den Zeigefinger an den Mund. Das traurige Moll gleitet in ein sich in Jubel auflösendes Dur, ich aber trauere der in die Seele schneidenden Moll-Tonfolge der Passacaglia nach.
»Nimm dir, was das Leben der Jugend beschert, denn dieses Füllhorn gibt nicht ewig«, »Spring und lach, von diesen Stunden gibt’s immer zu wenig!« – Stimmen der Vergangenheit, die meines Vaters und die eines Lehrers. Ich lasse die Klinke los und drehe mich um. Der Präzeptor stöhnt auf und warnt: Es gehe nicht an, den jungen Herrn so zu verzärteln; bald habe er weder Saft noch Kraft für Studien.
August 1673
Die Ereignisse, die ich so ganz aus dem Erleben heraus schilderte – was ich auch im Folgenden so weiter tun werde, nicht allein um Vergangenes lebendig zu machen, sondern um den Nachgeborenen zu zeigen, wie vieles im anderen Anstrich wiederkehrt – nun, diese Geschehnisse waren nur der Auftakt mehrerer harter Monate. Immerhin schwand die Kriegsgefahr. Der katholische Kaiser Leopold zögert, sich gegen seinen raubgierigen, aber ebenso katholischen Verwandten in Paris auf die Seite der ketzerischen Niederländer zu schlagen. Er löste sogar sein Regiment in Köln unter Obrist Otto di Grana, Marchese del Carreto auf, damit dort ein von Schweden initiierter Friedenskongress stattfinden kann. Im Juni kamen Gesandte aus Schweden, Frankreich, England, Spanien, Kurköln, Münster sowie des Kaisers im Karmeliterkloster in Köln zusammen, um vor allem zwischen den Niederländern und Frankreich zu vermitteln. Meine Gemahlin Felicitas wird nicht müde, in ihren Briefen von Banketten, Bällen, Jagden und Komödien, die man für die hohen Herren anstelle, zu erzählen. Meine Bitten zurückzukommen, stoßen bei ihr auf taube Ohren. Sie sei nun ganz sicher, schwanger zu sein und wolle lieber bei erfahrenen Hebammen, Doctores und Apothekern in Köln bleiben. Deshalb solle ich zu ihr kommen. Seit acht Jahren habe ich keinen Fuß mehr in diese Stadt gesetzt. Dass die Kölner mich 1665 gegen alles Recht verstoßend in den Turm warfen, verzeihe ich ihnen bis zu meinem seligen Ende nicht. Diese Krautkrämer, die nie ein Wort der Entschuldigung für diese schändliche Misshandlung fanden, mag der Teufel holen, wobei ich meinen Schwiegervater Herrn von Beywegh und meine beiden Schwager Arnold und Gerwin selbstredend ausnehme. So schreibe ich Felicitas, Köln weiterhin nicht betreten zu wollen. Dafür bringt sie wenig Verständnis auf. Sie meint, die meisten für mein Unrecht Verantwortlichen seien tot oder nicht mehr im Amt und einer Stadt könne man Bosheiten ebenso wenig vorwerfen wie einem Dachziegel Niedertracht, weil er einem auf den Kopf gefallen sei. Dieser Streitpunkt lässt sich nicht bereinigen.
Dem Kölner Friedenskongress hingegen wünsche ich von Herzensgrund Erfolg. Nur nicht überrannt, beraubt und erschlagen werden, das ist nach dem Dreißigjährigen Krieg das Credo unserer Zeit, obzwar die abenteuerlustige Jugend sich bereits wieder zum Soldatenleben verführen lässt. Leider hindert der Friedenskongress die Franzosen nicht, weitere Angriffskriege zu führen. Mitte August nahmen sie Colmar ein und belagern nun Trier, die Hauptstadt des kaisertreuen Kurfürsten Carl Caspar von der Leyen. Und der Kaiser? Er zeigt Frankreich immer noch nicht die Grenzen auf. Das beunruhigt mich. Obzwar Köln wegen des Kongresses auch gegenüber den Franzosen Immunität vor kriegerischen Gewalttaten besitzt, will ich nun dorthin reiten, um Felicitas zur Heimkehr zu bewegen. Mein Sohn soll mich begleiten, damit er auf andere Gedanken kommt, als sich in die Musik zu vergraben. Während der Fechtlektionen, die ich ihm gebe, ist er unwilliger als sonst und sein Präzeptor klagt bald jeden Tag über die Zerstreutheit seines Schülers, gegen die auch Schläge nicht mehr helfen. Letzte Woche verbot ich den Lautenunterricht bei Schneegaß. Da sich weder Schüler noch Musikmeister daran hielten, befahl ich Schneegaß sein Bündel zu schnüren und seiner Wege zu gehen. Der jedoch bettelte um Aufschub, es gäbe viel Arbeit im Hausgarten, was mein Küchenmeister Melchior, der auch den Garten beaufsichtigt, bestätigte und Schneegaß’ Fleiß lobte. Eine Gnadenfrist von drei Wochen gewährte ich dem Musikus unter der Bedingung, sich von meinem Sohn fernzuhalten. Am nächsten Tag kommt mein Sohn nicht zur Fechtstunde, stattdessen spielt er in seiner Kammer selbstvergessen Tanzstücklein. Wütend gebe ich ihm Ohrfeigen. Prompt umschlingt er die Laute, um sie zu schützen und ruft immerzu: »Nicht, nicht! Sie geht sonst entzwei!«
Bisher habe ich ihn selten geohrfeigt, trotz des gängigen Gebots, wer seinen Sohn liebt, spart nicht mit der Rute. Ich hingegen verabscheue Gewalt insbesondere Schwachen gegenüber. Aber wie sonst kann ich ihm den richtigen Weg zeigen? Ich nehme ihm die Laute weg, gebe sie ihm aber nach drei Tagen zurück. Er darf sie behalten, sofern er nur noch einmal täglich kurz vor dem Nachtmahl spielt. Zu meiner Freude hält er sich daran. Doch nach einer Woche steht der Präzeptor wieder in meinem Kabinett, weil sein Schüler weder zur Mathematiklektion erschien noch überhaupt auffindbar ist. Er versichert, alle Räume im Haus abgesucht zu haben einschließlich des Stalls, in dem Schneegaß seit einiger Zeit haust. Ich schicke meine Knechte aus, um ihn zu suchen. Kaum sind sie weg, laufe ich selbst zur Landstraße. Sie ist menschenleer. Ausnehmend Schönes wie Hässliches haben die Magie, unseren Blick zu fesseln. Die Straße hat nichts von beidem, sondern ist gewöhnlich, über die Maßen gewöhnlich, dass selbst die Phantasievollsten nichts Besonderes an ihr entdecken könnten. Mich aber erschreckt der dunkle Fahrweg mit seiner wuchernden Grasnabe in der Mitte, obgleich er im herrlichsten Sonnenlicht liegt und Wiesenblumen ihn säumen. Zurück in meinem Kabinett fällt mein Blick auf den alten Holzstich der apokalyptischen Reiter über meinem Kabinettschränklein: der personifizierte Krieg, der klapperdürre Tod, die Pest und die Teuerung, den Hunger im Gepäck. Dieser unmodische Stich, der mir bereits in der Kindheit Angst einjagte muss weg! Ein Gemälde, auf dem Kostbarkeiten, Blumen oder Nymphen zierlich dargestellt sind, ist ein anmutigerer Schmuck als dieses Schauerbild. Jost soll es gleich abnehmen! Ich läute, doch der sonst so aufmerksame Diener kommt nicht. Er ist noch auf der Suche nach meinem Sohn.
Wo bleiben sie alle?
Nicht die apokalyptischen Reiter, nicht die Landstraße peinigen meine Seele, es ist eine Unruhe, eine Unzufriedenheit, die mich bereits lange plagt. Vielleicht ließ ich die Dinge zu lange gehen, wie sie wollten, war zu nachgiebig. Und jetzt mache ich mich auf die Suche nach meinem Sohn. In seiner Kammer ist er immer noch nicht. Auf einen Blick erfasse ich aber sogleich etwas, was anderen gewiss entging, nämlich das, was nicht zu sehen ist: die Laute. Ich bin tief enttäuscht. Mein Sohn hintergeht mich und huldigt seiner Musikleidenschaft außerhalb Merhoffens, obwohl er alleine Haus und Hof nicht verlassen darf. Wer weiß, was der Bursche noch alles verheimlicht. Ich durchwühle seine Siebensachen in der Truhe. Zwischen Hemden finde ich Notenblätter. Ein zusammengefaltetes Papier fällt heraus – ein Brief, dessen Siegel gelöst und so zerbröckelt ist, dass man das Wappen nicht erkennen kann. Kostbares Papier! Ich lese:
»1673 Aprilis 19, Wien
Meinen Gruß, edelgeborener Herr,die zuvorn mit dem Herrn deliberierte Sach soll ohne Eil und mit größter Vorsicht weiter verfolget werden, die Pestbeul mus abgeschnüret und ausgeschnitten werden. Im Vertrauen auf Eure Klugheit, die Ihr bereits in vortrefflich geleisteten Diensten gezeiget habt, verbleibe ich
Johann P. von H., s.s.«
Den Namen Johann schmücken energische Unterstreichungen. Darunter stehen Zahlen, also ein chiffrierter Text. Wie kommt ein Schreiben aus Wien über die Behandlung der Pest hierher? Mir fällt Obizzi ein, der einen Brief schmerzlich vermisste. Mein Sohn hat ihn gestohlen! Gott, das spanische Rohr ist da noch zu wenig für ein Vergehen, für das manche gehenkt werden. Wo ist er jetzt nur? Ich nehme Degen, Mantel und Hut und laufe zu dem Verschlag im Pferdestall, in dem Schneegaß sein Strohlager hat. Im spärlichen Licht, das durch die Stalltür fällt, sehe ich Schneegaß’ alten Ranzen. Schritte! Gott sei gelobt, sie sind zurück! Hennes kommt mir entgegen und erschrickt, als ich ihn aus dem Halbdunkel anspreche.
»Hast du ihn gefunden?«
»Nein! Es ist mir herzlich leid, lieber Herr.«
»Verflucht, ihr Lumpenhunde, hier ist auch keiner von Nutz!«
Ich dränge mich an ihm vorbei.
»Mit Verlaub!« Hennes hält mich am Ärmel fest. »Mit Verlaub, ich hab etwas gefunden – seine Laute!«
»Die Laute? Wo?«
»Am Holzweg, der von der Landstraß in den Großen Busch führt.«
»Auf, zeig mir die Stell!«
»Ja, aber die Laute ist in tausend Stücke zersprungen.«
Nur das Zaumzeug lasse ich meinem Pferd anlegen, dann jage ich den Rappen hinaus, während Hennes seinen Gaul sattelt. Vor dem Tor treffe ich auf die anderen Knechte, die den Weiher abgesucht haben, doch vergeblich, wie mir ihre Gesten zu verstehen geben. Ich galoppiere den Holzweg entlang bis zu seinem Ende. Die Laute ist nirgends. Das Pferd am Zügel laufe ich zurück. Und da finde ich sie! Unweit der Straße liegt sie auf der Wiese, der Hals gebrochen, die Saiten stehen wirr nach oben, ihre Decke ist gespalten. Im Handumdrehen ist das Instrument, das seit meiner Kindheit ein mir vertrauter Anblick war, zu einem unbrauchbaren Gemenge aus Holz und Darmsaiten geworden. Trauer über die sinnlose Zerstörung überlagert sogleich die Angst. Die so brutal vernichtete Laute zeigt, dass rohe Gewalt meinen Sohn fortgerissen hat. Er hätte alles getan, eine solche Barbarei zu verhindern und wenn er es nicht konnte, wäre er vor dem Übeltäter weg sofort nach Hause gelaufen. Ich sinke auf die Knie, greife nach dem Hals der Laute. Drei Saiten sind noch heil, an denen ich die kümmerlichen Reste zu mir ziehe. Die Rippen des Resonanzkörpers sind zersplittert, so als habe jemand das Instrument einem anderen auf den Schädel geschlagen. Hennes reitet heran und steigt ab.
»Was Neues?«, frage ich.
»Nein! Böses Zeichen!« Er deutet auf die Laute.
»Hast Du nicht gesehen, wie er damit zum Tor hinaus ist?«
»Der junge Herr?« Ich nicke und er senkt schuldbewusst den Kopf. »Heut nicht, aber die Tage zuvor war er draußen.«
»Verflucht, Hennes, wie konntest du ihn allein gehen lassen, wo doch jetzt genug Soldatengesindel auf der Straß ist!«
»Es war ja nicht weit. Nur zum Schneegaß in den Garten ist er gelaufen, der sollt ihm noch ein paar Griff auf der Laute zeigen. So hat er’s mir gesagt!«
»Und weiter als in den Garten ist er nicht gegangen?«
»Einmal bin ich ihm nachgegangen. Da redete er mit dem Schneegaß. Er und dieser Tagedieb steckten doch dauernd zusammen.«
»Ha, just das hab ich ihm verboten.«
»Herr, das wusst ich nit!«
»Holla, du wusstest das nicht?« Ich springe auf, packe ihn am Hemd. »Du wusstest das sehr genau! Ich kann keinen Furz lassen, ohne dass darüber das ganze Haus sich’s Maul zerreißt. Verdammt! Wenn Du nicht so ein alter Narr wärst, würd ich dich grün und blau schlagen. Sag jetzt alles! Alles! Es geht um Leben und Tod!«
Bei dem Wort Tod wird mir der Hals eng und Hennes stehen die Augen mit einem Mal voll Wasser. Er fällt auf die Knie.
»Ja, lieber Herr, ich bereu alles aufs Ärgste. Doch der junge Herr bestürmte mich so, als ging’s um die Seligkeit, dass ich nicht das Herz hatte, ihm das abzuschlagen. Lasst mich nur gut durchklopfen, ich hab’s wahrhaft verdient, ich Narr.«
»Weiß Gott, ich tät’s, wenn es meinen Sohn zurückbringen würd! Aber jetzt hilf mir. Wo ist der Schneegaß?«
»Auch fort!«
»Was? Der vermaledeite Hurenhund hat ihn entführt?«
Hennes zuckt erst mit den Achseln, widerspricht dann aber redselig. Er glaube nicht, dass der Schneegaß den jungen Herrn auch nur ängstigen könne, zu freundlich sei er mit ihm umgegangen, zu sehr habe er den Knaben geachtet. Während Hennes plappert, gehe ich zu meinem Pferd.
»Herr, Ihr wisst, ich mag diese losen Bettler, Landläufer und Hausierer viel weniger wie Ihr. Aber der Schneegaß war nit so übel und erzählte viel aus der Bibel.«
Oh ja, mit Bibelversen auf den Lippen ging er rauben, warum sollte er nicht auch ein Kind entführen?
»Der Kerl ist mit meinem Sohn ohn’ Adieu auf und davon, was soll ich anderes denken, als dass er ihn als Geisel nahm?«, sage ich.
»Ja, vielleicht? Vielleicht waren’s auch andere und er selbst ist gleich mit entführt worden! Seht da, da gehen zwei Spuren durchs hohe Gras zur Laute!«
Ich kneife die Augen zusammen. Gegen das Licht sehe ich das niedergetretene Gras – Fährten, die parallel von der Landstraße quer über die Wiese zur Laute führen. Es sind frische Spuren. Jetzt nur keine Zeit verlieren, um die Galgenbrüder noch zu erschnappen. Auf der Landstraße finde ich Haufen frischer Pferdeäpfel und von dort aus führen die Spuren im Gras zu dem Ort, wo die Laute liegt. Im Boden sind die Abdrücke mehrerer Pferde gut sichtbar. Die Reiter sind die Straße in der Richtung wieder zurückgeritten, aus der sie kamen. Eindeutig eine Entführung! Ich treibe mein Pferd an.
»Halt, nicht allein hinter den Rabenäsern her!«, ruft Hennes.
Ich kümmere mich nicht darum. Er bleibt mir aber auf den Fersen und fleht mich an, nur mit meinen Knechten zusammen die Missetäter zu verfolgen. Jede Verzögerung bedeutet jedoch Vorsprung für die Entführer und bis zur Dunkelheit sind es nur noch vier Stunden. Ich kann nicht warten. Wir tauschen die Pferde, denn Hennes hat seinen Braunen gesattelt und noch eine Reiterpistole, Kugeln und Pulver eingesteckt. Er will mit den anderen mir nachkommen. Im Trab reite ich die Straße entlang. Schneller geht es nicht, um die Spuren im Auge zu behalten. Mit vielleicht vier Reitern, aber ein oder zwei Geiseln war es geraten, abseits der Straße sein Heil zu suchen, was lichtscheues Gesindel ohnehin gern tut. Nach einer Meile scheint mir, als wären weniger frische Spuren vorhanden. Ich steige ab und laufe zurück. Tatsächlich, nach zweihundert Schritten vermehren sich die Huftritte wieder. Sie sind so schlau gewesen, nicht im Pulk die Straße zu verlassen. Ein Teil der Gesellschaft hat mit meinem Sohn ihren Weg in ein steiniges, trockenes Gelände genommen, während die anderen mögliche Verfolger ablenken sollten. Eingetretene Gräser, verrutschte Steine und Hufabdrucke ziehen mich lange vollkommen in ihren Bann, bis ich in den Wald gelange. Dort durchpflügten die Pferde das Laub und kehrten die feuchten modrigen Blätter nach oben. Diese Fährte ist wieder so leicht erkennbar, dass ich reiten kann. In einem Moment nüchterner Überlegung kommt es mir vor, wie ein Irrer Hirngespinsten nachzujagen, doch mehr als die Hufspuren habe ich nicht. Irgendwann vereinigen sie sich mit zwei anderen Fährten. Ich pfeife durch die Zähne. Nach den Zweifeln schenkt mir dieser kleine Erfolg schon ein fast rauschhaftes Glück und eine, eigentlich immer noch illusorische, Gewissheit, auf der richtigen Spur zu sein. Ich sporne den Braunen an. Sobald die Blätter trocken werden oder ein Regen alles durchfeuchtet, kann der kostbare Wegweiser aufgewühlten Laubes wie eine Sternschnuppe verschwinden. Jetzt sehe ich die Furchen noch klar vor mir, das feuchte sattfarbene Braun gegen das hellere trockene der Millionen Blätter, die den Boden bedecken. So reite ich ohne zu wissen wohin. In meiner Vorstellung gehen die Spuren nach Süden – nach Koblenz, zumindest in das Gebiet Kurtriers. Die Fährte endet an einer Straße. Auf der anderen Seite liegt eine Wiese, über die eine Schafherde gezogen ist. Überall kurzes Gras. Der Weg ist zertrampelt und mit den Hinterlassenschaften der Tiere übersät. In der Ferne höre ich das Horn des Hirten und das leise »Bäh, bäh« der Schafe. Mein Pferd tut sich an dem Gras gütlich, das die gierigen Tiere übersehen haben. Da ich annehme, dass sich die Galgenbrüder bald wieder in die Büsche geschlagen haben, suche ich rechts und links vom Weg nach Pferdespuren. Die Straße führt durch Gehölz und gleich am Anfang geht eine Fährte in einen Niederwald hinein, ein Zeichen, dass ein Dorf in der Nähe ist, dessen Bewohner sich hier mit Brennholz versorgen. Mir ist unwohl, mich weiter in unbekanntes Terrain locken zu lassen. Doch da liegt die vertraute dunkle, vom Untergang bedrohte Bahn – der Stock des Blinden im Irrgarten hoher Bäume und wenn ich ihn aus der Hand lege, waren alle Mühen vergebens.
Wieder reite ich der dunklen Linie nach. Durch raschelndes Laub trottet mein Gaul immer tiefer in den Wald. Oft halte ich an, horche, ob Hufschlag oder Menschenstimmen zu hören sind. Nichts! Allmählich verschwimmen die Konturen meines Wegweisers. Das Licht ist zu schwach, um noch Feinheiten des Bodens deutlich zu machen. Ich laufe, dennoch werden die Spuren matter, bald ahne ich sie nur noch. Mein müder Leib und meine erschöpfte Seele, die in kurzer Zeit alle Niederungen und Höhen durchlitten haben, denen ein Mensch im Laufe eines Jahres ausgesetzt sein mag, lassen mich jetzt an meinem Vorhaben zweifeln. Ich bleibe stehen. Nur das Schnauben meines Pferdes ist zu hören. Unendlich hoch über mir blitzt Dämmerlicht durch hunderttausend schwarze Blätter. Ich lehne mich an eine Buche, rutsche mit dem Rücken den glatten Stamm entlang zu Boden. Alle Vernunft spricht für ein Aufgeben, wogegen mein auf Verfolgung ausgerichtetes Innerstes rebelliert. So bleibe ich sitzen, bis mir die Nacht die Entscheidung abnimmt. Es hat keinen Zweck, blind durch den Wald zu irren. Ich raffe mich auf, binde mein Pferd fest und wickle mich in meinen Mantel. Hennes und die Knechte sind gewiss nur die Straße entlang geritten. Abermals schnürt mir der Schmerz über meinen verschwundenen Sohn die Kehle zu. In meinem verwirrten Hirn wandern die Gedanken um Weitersuche, Aufgabe und Trauer im Kreis herum und verweigern hartnäckig das Schmieden irgendeines Planes. Mein Nachtgebet spreche ich in der Hoffnung, Gott werde mir morgen den Weg zu meinem Sohn zeigen. Die Augen fallen mir zu. Nach einer Weile – lang oder kurz, ich weiß es nicht – weckt mich ein Laut. Der Braune wiehert. Ist es das Zauberlicht des Mondes, das selbst in tiefster Nacht die Tiere nicht schlafen lässt? Das kalte Licht formt schwarze Schatten. Die Frostigkeit und die Geräusche des nächtlichen Waldes lassen mich das Ausgeliefertsein in die Hände böser Mächte spüren.
»Maria, heilige Muttergottes hilf!«, sage ich laut.
Meine Stimme ist etwas Irdisches, das die böse Magie der unsichtbaren Höllenkräfte der Nacht stört. Doch der Wald, in dem vom Wind bewegte Schatten um mich tanzen, Blätterrascheln zum Rauschen wird, gibt mir keine Ruhe. Wieder schnaubt und wiehert mein Gaul. Ich lausche, versuche mit den Augen die Finsternis zu durchdringen. Nein, es ist nichts zu hören oder zu sehen, nur der verfluchte Klepper nimmt etwas wahr. Ich erhebe mich. Nach einigen Schritten glaube ich zu wissen, was den Braunen ängstigt. Rauch! Nur ein Hauch, so fein, dass ich ihn sofort wieder verliere. Wie ein Hund wittere ich in alle Himmelsrichtungen, laufe hierhin und dorthin, bis ich den zarten Duft wiederfinde und die Richtung, aus der er kommt, bestimmen kann, in die ich vorsichtig Fuß vor Fuß setzend gehe. Der Rauch wird stärker, riecht wie das Herdfeuer eines Hauses. Ein Glücksgefühl steigt in mir auf. Das Versteck des Raubgesindels muss in der Nähe sein! So gut es geht bemühe ich mich, das Knacken alter Äste und Laubgeraschel zu vermeiden. Die Kerle schlafen gewiss wohlig. Vielleicht gönnt sich auch ihre Schildwach ein Nickerchen. Der Brandgeruch ist inzwischen so stark, dass das Wachfeuer zu sehen sein müsste. Mir fällt ein, dass ich die Pistole zurückgelassen habe. Einerlei! Ich bleibe stehen. Stochern und Kratzen sind zu hören. Der Waldboden ist hier wie leer gefegt – kein Laub, keine Äste. So kann ich mich unbemerkt heranpirschen. Im Mondlicht wird hinter Gebüsch ein Hausgiebel sichtbar. Es ist eine ärmliche Kate, nicht mit Stroh, sondern nur mit Zweigen und Moos gedeckt. Jemand stöhnt. Ich schleiche an die Ecke des Hauses und sehe einen Mann mit einer Lanze und einer Laterne auf und ab gehen – die Schildwache der Schindhunde. Ein paar Schritte. Ich packe den Kerl, halte den Degen an seine Kehle und flüstere ihm ins Ohr: »Keinen Laut, sonst bist du tot! Den Spieß weg!«
Er lässt den Spieß fallen. Ich frage ihn nach meinem Sohn. Da er schweigt, frage ich ein zweites Mal schärfer.
»Was willst du, keinen Laut oder Antwort?«, brummelt er.
»Antwort!«
»Hier sind nur mein Weib und mein Knecht.«
»Was machst du hier mitten in der Nacht?«
»Närrische Frag! Mein Tagwerk muss ich, Gott erbarm’s, auch nachts tun. Und mir gefällt’s übel, wenn mir dabei noch einer auflauert und mir die Gurgel aufschlitzen will.«