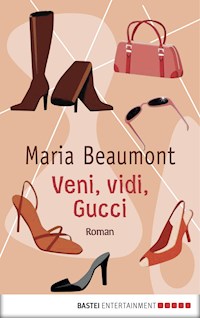4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Turbulent, schlagfertig und ausgesprochen temporeich!
Bei Charlie läuft alles rund: Sie leitet einen exklusiven Bodystylingtempel (ein Sportstudio ...), wo Promis und Normalos ihre Kilos purzeln lassen. Die Dinge (und vor allem Profitänzer Karl) sehen ausgesprochen gut aus. Doch leider möchte Charlies griechischer Daddy gern eine Hochzeit für sie ausrichten - mit einem von ihm ausgesuchten, reichen (nicht somit nicht zwangsläufig hübschen) Griechen. Und Charlie fühlt sich ziemlich belämmert ...
Ein etwas anderes Schäferstündchen ... Das perfekte Workout für Ihre Lachmuskeln!
Weitere Romane von Maria Beaumont:
Marsha Mellow und ich
Nullnummern
Veni, Vidi, Gucci
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 555
Ähnliche
Inhalt
CoverInhaltÜber das BuchÜber die AutorinTitelImpressumTeil I : DAS ERSTE BISSCHENDas bisschen, in dem ich mich in Lydia verwandleDas bisschen, in dem Sie meinen Vater kennen lernen (viel Glück)Das bisschen, in dem ich meinen ersten Tag als Managerin spielend schaffe (in meinen Träumen)Das bisschen, in dem Sie feststellen werden, wie schlau meine Mutter istDas bisschen, in dem Sie feststellen werden, wie dämlich ich binDas bisschen, in dem ich herausfinde, wofür die Griffe auf einem Behinderten-WC gut sindDas bisschen mit dem langen AbschiedImmer noch das bisschen mit dem langen AbschiedDas bisschen, in dem ich es definitiv nicht tun werdeDas bisschen mit den langen, glänzenden StangenDass bisschen mit den griechischen GeschenkenDas bisschen, in dem Daniel es mit dem Regisseur treibt und ich mit fünfundvierzig NordwesteuropäerinnenDas bisschen, in dem ich mich fürchterlich, gemein und unverzeihlich aufführeDas bisschen mit dem NagetierDas bisschen mit den SternchenDas bisschen, in dem Karls Welt einstürztDas bisschen, in dem meine Mutter umschaltet (und damit ist ausnahmsweise nicht die Glotze gemeint)Das bisschen, in dem meine Welt einstürztTeil II: DAS BISSCHEN IN DER MITTEDas bisschen, in dem ich Streit bekomme und Soulla ihr BabyDas bisschen, in dem ich hoffe, dass alles ein gutes Ende nehmen wirdIch sagte nichts von einem langen bisschen, oder?Das bisschen, in dem sich herausstellt, dass Jesus ein waschechter Grieche warDas bisschen, in dem wir endlich eine Familie sind (und ich mit meiner Schwester durch dick und dünn gehe)Das unvermeidbare bisschen in jeder Geschichte, das von Mord und Totschlag handeltDas bisschen, in dem ich herausfinde, dass Daniel die Sonne aus dem Hintern scheintTeil III: DAS LETZTE BISSCHEN (DAS HABEN SIE SICHER BEREITS GEAHNT, NICHT WAHR?)Das bisschen, in dem ich meine Kampftechnik anwendeDas bisschen, in dem ich mir die Haare wascheDas bisschen, in dem Inspektor Columbo eine Rolle spieltDas definitiv allerletzte bisschen vom letzten bisschenÜber das Buch
Turbulent, schlagfertig und ausgesprochen temporeich! Bei Charlie läuft alles rund: Sie leitet einen exklusiven Bodystylingtempel (ein Sportstudio ...), wo Promis und Normalos ihre Kilos purzeln lassen. Die Dinge (und vor allem Profitänzer Karl) sehen ausgesprochen gut aus. Doch leider möchte Charlies griechischer Daddy gern eine Hochzeit für sie ausrichten – mit einem von ihm ausgesuchten, reichen (nicht somit nicht zwangsläufig hübschen) Griechen. Und Charlie fühlt sich ziemlich belämmert ... Ein etwas anderes Schäferstündchen ... Das perfekte Workout für Ihre Lachmuskeln! Weitere Romane von Maria Beaumont: Marsha Mellow und ich Nullnummern Veni, Vidi, Gucci
Über die Autorin
Maria Beaumont galt früher als das rosa Schaf der Familie, war sie doch die ungezogene Tochter eines einfachen, schlecht Englisch sprechenden griechischen Einwanderers. Dann wurde sie kreativ und verschaffte sich selbst eine neue Identität. Seitdem lebt sie als respektable Mittelklasse- Mutter-und-Gattin-und-Bestsellerautorin in einem noblen Vorort von London.Maria Beaumont hat es großen Spaß gemacht, »Nullnummern « zu schreiben. Auch wenn sie im richtigen Leben das große Los schon gezogen hat. Sie lebt mit ihrem Mann Matt und ihren beiden Kindern in London. Dort arbeitet sie gerade an ihrem sechsten Roman.
Maria Beaumont
ExtraScha(r)f
Roman
Aus dem Englischen vonClaudia Geng
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2005 by Maria Beaumont
Titel der englischen Originalausgabe: »MissFit«
Originalverlag: Published by Arrow Books,a division of Random House, London
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2006/2015 by Bastei Lübbe AG, Köln
Covergestaltung: Jeannine Schmelzerunter Verwendung von Motiven von Shutterstock:© shutterstock/Deliza, © shutterstock/Studio_G,© shutterstock/M.Stasy, © shutterstock/Vasya Kobelev,© shutterstock/tatishdesign
Datenkonvertierung E-Book:
hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7325-1704-6
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Teil I
DAS ERSTE BISSCHEN
Das bisschen, in dem ich mich in Lydia verwandle
Pssssssst!«, zischt Daniel mir in der Lautstärke einer Luftschutzsirene zu. »Dein Gekicher kann man noch eine Meile entfernt hören.«
Was soll ich sagen? Ich bin aufgeregt. Und wenn man aufgeregt ist, kommt es schon mal vor, dass man kichern muss, oder nicht? Ist es nicht Eminem, der sich vor jedem Auftritt vor Aufregung fast in die Hosen macht? Falls nicht Eminem, dann garantiert Gareth Gates.
»Okay, du darfst alles tun, nur nicht niesen«, flüstert Daniel mir zu.
Oh mein Gott. Die Macht der Suggestion. Ich drücke meine Nase mit beiden Händen zu. Es klappt, aber bloß, weil ich keine Luft bekomme. Ich ersticke mich praktisch selbst, aber ich kann die Hände nicht wegnehmen aus Angst, niesen oder kichern oder beides gleichzeitig zu müssen und so das kostbare weiße Pulver in den Orbit zu blasen. Oh Mann, ich sterbe gleich … brauche … Sauer… stoff … Entweder ich oder das Kokain. Einfache Wahl, nicht? Der Koks sieht aus wie Puderzucker, eingefaltet in eine abgerissene Ecke aus einer Illustrierten von vergangener Woche, wohingegen ich ein empfindsames und schönes menschliches Wesen bin (jedenfalls wenn man von dem bisschen Speck auf meinen Hüften absieht). Die Wahl fällt wirklich nicht schwer. Ich gewinne. Ich nehme die Hände von der Nase und sauge geräuschvoll und anhaltend den Sauerstoff im Raum ein, bis es durch den abfallenden Luftdruck in meinen Ohren knackt.
»Wenn du so viel Schiss hast, dann vergessen wir die Sache besser, Charlie«, zischt Daniel mich an. »Und atme gefälligst leiser. Wenn uns jemand hört, sind wir tot.«
»Ach, übertreib doch nicht immer so. Von Sterben kann keine Rede sein. Wir werden höchstens gefeuert … und verhaftet … und in den Knast gesteckt. Bitte, sag mir auf der Stelle, dass du die Tür abgeschlossen hast.«
»Klar habe ich abgeschlossen. Halt jetzt um Himmels willen endlich die Klappe, damit ich mich konzentrieren kann.«
Ich halte die Klappe und beobachte, wie Daniel sich konzentriert. Das habe ich schon in Dutzenden Filmen gesehen. Man nehme ein kleines Häufchen weißes Pulver und verwandele es mithilfe einer geschickten Hand und einer goldenen Kreditkarte in zwei kerzengerade Linien. Daniel besitzt keine goldene Kreditkarte. Er besitzt nicht einmal eine ordinäre Kundenkarte. Stattdessen nimmt er den Zeigefinger, der stark zittert (sodass seine Lines eher sich krümmenden Würmern ähneln) und schweißnass ist (sodass der Koks an seinem Finger kleben statt auf dem Tisch liegen bleibt). Offenbar hat Daniel genauso viel Schiss wie ich.
Es ist so uncool, wenn man keinerlei Erfahrung mit Drogen hat. Ich bin jetzt vierundzwanzig und habe noch kein einziges Mal an einem Joint gezogen – nicht einmal an einer Zigarette. Daniel ist mir einen Tick voraus. Aber nur einen klitzekleinen Tick. Gestern Abend hat er zum ersten Mal gekokst, wie er mir heute Morgen direkt bei Arbeitsbeginn begeistert erzählt hat. Außerdem hatte er die abgerissene Ecke aus der Illustrierten dabei und lag mir den ganzen Vormittag in den Ohren, den Inhalt mit ihm zusammen auszuprobieren. Aus diesem Grund haben wir uns im Büro des Chefs eingeschlossen.
Wir befinden uns im siebten Stock von The Zone, Londons angesagtestem Fitnessstudio. Und zwar so angesagt, dass wir uns nicht als Fitnessstudio bezeichnen. Nein, wir sind das Zentrum der totalen körperlichen Vervollkommnung. Abgesehen von meinen Atemzügen ist das einzige Geräusch, das hier zu hören ist, das Klaviergeklimper, das sich aus dem Ballettsaal durch den Korridor schlängelt. Die totale körperliche Vervollkommnung, klassische Klaviermusik, Ballett – alles Dinge, die nichts mit Drogen zu tun haben. Dazu kommt die Null-Toleranz-Geschäftsordnung im The Zone … Daniel und ich müssen den Verstand verloren haben.
Daniels Lines werden immer krummer, und er macht einen gestressten Eindruck. Dabei dachte ich immer, Drogen heben die Stimmung (außer natürlich man endet als Junkie und ist gezwungen, alles für den nächsten Schuss zu verkaufen, vom Discman bis zum eigenen, zerstochenen Körper). Eine kleine Aufheiterung könnte jetzt nicht schaden. Prompt fällt mir ein witziger Spruch ein, und ich gebe ihn zum Besten. »Hey, hör dir den an: Was habe ich mit Cheech und Chong außer den Anfangsbuchstaben gemeinsam? Na?« Mein Lachen klingt leicht hysterisch, da ich mir, wie bereits erklärt, vor Angst fast in die Hosen mache.
»Still«, fährt Daniel mich an, sichtlich unbeeindruckt von meinem geistreichen Witz. »Mach schon, gib mir Geld.«
»Ich sagte doch, dass ich meinen Anteil später bezahle.«
»Das meine ich doch nicht, du Dummkopf. Wir brauchen einen Geldschein, um das Zeug in die Nase zu ziehen.«
»Ach so … Ja … weiß ich doch.« Ich krame in meiner Hosentasche und ziehe einen Fünf-Pfund-Schein hervor, der schon bessere Tage gesehen hat. Er ist schon ganz weich und abgegriffen, und als ich ihn auseinander falte, sehe ich, dass er mit Tesafilm geklebt ist. Ich gebe den Schein meinem Co-Sniffer.
»Hast du keinen anderen?«
»Tut mir Leid. Ich habe dir doch gesagt, dass ich zur Bank muss.«
Mit zitternden Händen versucht Daniel den Geldschein zu einem schmalen Röhrchen zusammenzurollen, aber nach mehreren missglückten Versuchen ist klar, dass es ihm nicht gelingen wird.
»Wie wäre es mit einem Post-it?«, frage ich, als ich den gelben Notizblock auf dem Schreibtisch erspähe.
»Blöde Idee. Der Koks würde an der Gummierung kleben bleiben.«
Wir blicken uns gegenseitig enttäuscht an. Sieht so aus, als wäre der siebte Stock das höchste an Gefühlen, was wir heute erwarten dürfen. »Jetzt weiß ich«, flüstert Daniel, durch den plötzlich ein Ruck geht. »Wir reiben uns das Zeug einfach auf das Zahnfleisch.«
Spitzenidee … nein, doch nicht. Schließlich ist mir bekannt, wie das Zeug ins Land geschafft wird. Im Fernsehen habe ich gesehen, wie verängstigte Afrikanerinnen auf Toiletten gesetzt werden, um mit Kokain gefüllte Kondome auszuscheiden. Erwartet Daniel allen Ernstes von mir, dass ich das Zeug in den Mund nehme?
Er wartet meine Antwort nicht ab. Er taucht den Zeigefinger in das Pulver, aber im Gegensatz zu gerade eben, als es hartnäckig an seinem Finger kleben blieb, will es jetzt nicht haften.
»Versuch’s mal mit etwas Spucke«, schlage ich vor, da mir eingefallen ist, dass ich auf diese Art mit Brausepulver verfuhr, als ich noch ein Kind war. (Na schön, heute auch noch.)
Daniel befeuchtet seinen Zeigefinger und startet einen neuen Versuch, wobei dieses Mal ein ordentlicher Batzen von dem Zeug hängen bleibt. Ohne einen Augenblick zu zögern, steckt er sich den Finger in den Mund und reibt vehement über sein Zahnfleisch – als würde er bei einem Freund übernachten und hätte seine Zahnbürste vergessen.
»Bäh!«, stößt er plötzlich hervor und zieht rasch den Finger aus dem Mund.
»Was ist?«, frage ich und erschrecke ebenfalls, als ich sein entsetztes Gesicht wahrnehme.
Er kann nicht sprechen. Er steht da wie gelähmt, und in seinen Mundwinkeln bilden sich weiße Bläschen. Oh verdammte Scheiße, er hat eine Überdosis erwischt. Oder pures, ungestrecktes Zeug oder so. Oder … Oder … Ich habe nicht den leisesten Schimmer. Schließlich habe ich null Erfahrung mit Drogen. Aber was auch immer hier geschieht, ich bin sicher, es ist nur eine Frage von wenigen Minuten – vielleicht sogar nur von Sekunden –, bis Daniel bewusstlos zusammenbricht und sein Herz zu schlagen aufhört, sodass die Statistik einen weiteren Drogentoten zu verzeichnen hat. Ich muss handeln! Sofort! Immer mehr Schaum quillt aus Daniels Mund, und die Bläschen explodieren praktisch aus seinem Mund heraus. Aber was soll ich tun? Ich habe zwar einen staatlich geprüften Erste-Hilfe-Kurs abgelegt, aber, glauben Sie mir, geeignete Maßnahmen gegen Schaum vor dem Mund gehörten nicht zum Programm. Daniels Arme fuchteln Hilfe suchend umher, um gleich darauf schlaff herunterzuhängen. Ich meinerseits fuchtele ebenfalls Hilfe suchend mit den Armen. Daniel versucht zu sprechen, aber er bekommt lediglich ein unverständliches Gurgeln heraus. Ich beuge mich zu ihm vor, denn sollten dies seine letzten Worte sein, würde ich es mir nie verzeihen, sie verpasst zu haben.
»Wichser«, bringt er schließlich hervor.
»Komm schon, Daniel«, sage ich energisch und packe ihn an der Schulter. »Rede mit mir. Sprich weiter.«
»Dieser verdammte Wichser«, sprudelt er mit einem neuen Schwall Schaum hervor. »Das ist kein Koks –«
Wusste ich es doch. Wahrscheinlich hat man ihm Rattengift angedreht!
»– Das ist beschissenes Alka-Seltzer.«
»Wuä?« Wenn ich nervös bin, muss ich kichern. Und wenn ich durcheinander bin, bringe ich nur noch komische Laute heraus.
»Dieser miese Betrüger. Fünfzig Mäuse habe ich hingeblättert … für ein beschissenes Mittel gegen Kater. Charlie, das ist Alka-Seltzer«, stößt Daniel mit lustigen Schaumbläschen hervor, die seinen Standpunkt unterstreichen. Bevor ich meine Erleichterung zeigen und über ihn lachen kann, erstarren wir beide, weil hinter uns ein Geräusch zu hören ist, ein Klicken an der Tür, die Daniel angeblich abgeschlossen hat.
»Was zum Teufel habt ihr zwei hier zu suchen?«
Wir fahren herum und erblicken Lydia, die Hände in die Hüften gestemmt. Ihr linkes Auge starrt mich an, während das rechte Daniel fixiert. Lydia schielt geradezu Furcht erregend, was im Moment allerdings ein Vorteil für sie ist, da sie uns so beiden gleichzeitig Angst einjagen kann. Glücklicherweise stehen wir vor dem Schreibtisch und verdecken das weiße Pulver darauf.
Oh Mann, das gibt Ärger.
»Sorry, Lydia, aber Philip hat sich beschwert, dass das Klavier verstimmt ist«, sage ich unterwürfig. »Ich wollte mich selbst davon überzeugen.«
Wow, das nennt man Schlagfertigkeit. Ich bin die Königin der spontanen Ausreden. Man nehme einfach Philip, den Ballettlehrer, der ständig wegen des Klaviers herumjammert, zusammen mit der Tatsache, dass man das Geklimper bis hier ins Chefbüro hören kann, und – bingo! – haben wir eine mögliche Ausrede.
»Falls es dir noch nicht aufgefallen sein sollte, Charlotte, das Klavier steht im Ballettsaal und nicht hier in Jamies Büro.«
Nun ja, ich habe lediglich von einer möglichen Ausrede gesprochen.
Daniel neben mir schluckt, wie er noch nie zuvor geschluckt hat, um den Schaum in seinem Mund herunterzuwürgen, bevor er ihn aufmacht: »Aber hier ist die Akustik am besten.«
»Daniel, was versteht du schon von Ak-«
»Pst … Hörst du das?«, meint er, während eine neue Tonkaskade durch den Korridor strömt. »Ein astreines Dis. Ist das nicht der schönste Ton auf der gesamten Tonleiter?«
Daniel kann zwar nicht einmal Dur und Moll unterscheiden, aber er hat Lydia dennoch aus dem Konzept gebracht. Zumindest für einen Augenblick.
Wir sollten uns jetzt schleunigst verziehen. Wir sollten einfach schnurstracks den Raum verlassen und an unseren Platz gehen. Aber wenn wir das tun, wird Lydia das Pulver auf dem Schreibtisch entdecken, und dann müssen wir uns neue Ausreden einfallen lassen. Also rühren wir uns nicht vom Fleck. Nervös starren wir Lydia an, die zu uns zurückstarrt, wobei ihre gruselig schielenden Pupillen sich unabhängig voneinander bewegen wie Überwachungskameras in einem Kaufhaus. Während ihr rechtes Auge mich fixiert, schielt ihr linkes Auge auf Daniels Unterleib. Obwohl der für Frauen tabu ist, wundert mich das nicht, da ich Daniels Unterleib heute ebenfalls schon ausgiebig angestarrt habe. Er trägt nämlich hautenge, glänzende Shorts, unter denen sich eine Salami, eingequetscht zwischen zwei Grapefruits, abzeichnet. Geschäftswagen, betriebliche Gesundheitsvorsorge und Firmenaktien? Pah. Daniel hat das, was ich ein beeindruckendes Gesamtpaket nenne. Sollten einmal Außerirdische auf der Erde landen, werden sie sicher ebenfalls staunen. »So, und nun das Skalpell ansetzen und … Was zum Teufel hat der da zwischen den Beinen?«
Jammerschade, dass dieses Prachtstück uns Frauen verwehrt bleibt.
Mit einem Mal macht Lydia große Augen. »Was, bitte schön, ist das denn?«, fragt sie in strengem Ton.
»Was?«, entgegnen wir beide unisono.
»Das Zeug da auf Jamies Schreibtisch … Ist es das, wofür ich es halte?«
Scheiße, verflucht. Nun haben wir die Bestätigung dessen, was wir stets vermutet haben. Jetzt ist es amtlich: Lydia kann mit ihren schielenden Augen um Ecken gucken. Ein Normalsichtiger hätte das Zeug hinter unseren eng zusammenstehenden Körpern niemals entdeckt.
Daniel und ich drehen uns um und blicken mit gespieltem Erstaunen auf den Tisch. Daniel beugt sich sogar vor, um das Pulver genauestens zu examinieren. »Wollt ihr wissen, was ich denke?«, sagt er kurz darauf. »Das ist Alka-Seltzer. Offenbar hat Jamie gestern Abend ein wenig zu viel gebechert.«
Lydia zwängt sich zwischen uns hindurch und zieht eine glitzernde Nagelfeile aus ihrer Hosentasche. Mit einer Bewegung, die sie sich aus einer Kriminalserie abgeschaut haben muss, schaufelt sie etwas von dem Pulver auf deren Spitze und führt sie zum Mund. Das Pulver landet auf ihrer Zunge, wo es leise prickelt.
»Hmm«, murmelt sie, ohne ihre Enttäuschung verbergen zu können, dass der Kick ausbleibt. Aber sie ist noch nicht fertig, da ihre Augen bereits das nächste Vergehen erspäht haben. »Meine Güte, Charlotte! Was trägst du da für Socken?«, sagt sie entsetzt.
Ihre Augen bewegen sich wie immer in verschiedene Richtungen, sodass ich mich mit einem kurzen Schulterblick vergewissere, dass nicht eine zweite Charlotte hinter mir steht. Dabei weiß ich genau, worum es geht.
Ich habe nämlich die erste Regel gebrochen: Das Personal darf ausschließlich Kleidung tragen, die mit dem Zone-Logoversehen ist. Im Grunde weiß ich das, aber das war das einzige frische Paar Socken, das ich heute Morgen finden konnte. Ich habe mir sogar zehn Minuten Zeit genommen, um das unerlaubte Nike-Logo an der Seite in meinen Turnschuhen zu verstecken, aber nach fast acht Stunden Arbeit war es das Logo offensichtlich leid und rutschte heimlich an meinem Knöchel hoch – jaja, Just Do It.
Was für eine Ironie, nicht? Lydia kann mich nicht zur Schnecke machen, weil ich irgendein verdächtiges Pulver auf Jamies Schreibtisch verstreut habe, aber dafür könnte ich meinen Job verlieren, weil ich die falschen Socken anhabe. Ich spüre, wie Lydias Augen (zumindest eines davon) mich durchdringen, und ich kann nur hoffen, dass sie keinen Röntgenblick hat und somit nicht die Adidas-Streifen auf meinem Bustier unter dem Top erkennen kann. Vor Panik bricht mir der Schweiß aus. Zittern etwa meine Beine? Das schafft nicht einmal mein eigener Vater – ein einsfünfundsechzig Meter großes, am ganzen Körper behaartes Muskelpaket, der Herrscher meines Universums –, aber mein Vater ist auch nicht mit Lydia zu vergleichen. Sie sieht alles. Sogar die Geister von Verstorbenen wie dieser Junge in diesem Film mit Bruce Willis. Und sie sieht unerlaubte Logos auf Socken.
»Vergiss nicht, Charlotte, ich behalte dich im Auge –« Im Auge, Singular, richtig ausgedrückt. »– Ihr beide geht sofort zurück an euren Arbeitsplatz, während ich diese Sauerei hier beseitige.«
Als sie auf den Schreibtisch zumarschiert, ergreifen wir die Flucht.
»Dieses hässliche Schielauge«, sagt Daniel, als wir außer Hörweite sind.
Das ist nicht fair. Lydia ist nicht hässlich. Sie ist einsachtzig groß, hat die Figur von Beyoncé Knowles und ein sehr markantes Gesicht. Mit anderen Worten, sie sieht perfekt aus … bis auf dieses Schielen. Das leider nicht zu ignorieren ist. Das Lydia so unheimlich wirken lässt.
Vor dem Ballettsaal bleiben wir kurz stehen und spähen durch die Scheibe. Philips Klavierspieler intoniert gerade ein ziemlich schnelles Stück – eine Art klassischen Techno –, und die Tänzer wirbeln umher wie Mäuse auf Amphetamin. Philip selbst hält kurz inne, um Daniel kokett zuzuwinken.
»Bitte, sag mir, dass du nichts mit ihm hattest!«
Daniel setzt ein unergründliches Lächeln auf – was nur bedeuten kann, ja, er hatte etwas mit Philip –, und wir gehen weiter in Richtung Aufzug.
Wir nähern uns dem Empfang. Rebecca steht noch genauso da, wie wir sie vor einer halben Stunde zurückgelassen haben. Wie angewurzelt. Bevor wir hinauffuhren, meinte Daniel zu ihr: »Wir sind kurz oben, Becks. Rühr dich nicht vom Fleck.« Das hat Rebecca offenbar wörtlich genommen. Wahrscheinlich hat sie nicht einmal mit der Wimper gezuckt. Ich mustere ihre Augen, ob sie verquollen sind. Nein, sie sehen aus wie immer. Offenbar sind größere Katastrophen ausgeblieben. Mit ihren siebzehn Jahren ist Rebecca nämlich Stresssituationen nicht gewachsen.
»Alles okay, Becks?«, frage ich sie.
Sie nickt und sagt: »Da hat jemand angerufen und wollte wissen, ob wir Steps im Programm haben … Ich glaube, die haben sich mittlerweile aufgelöst.«
»Und ich glaube, der meinte nicht die Band, sondern Stepptanz, Herzchen«, sagt Daniel.
»Oh, natürlich, Steppaerobic und so«, erwidert sie und wird rot, da ihr plötzlich wieder einfällt, was wir hier machen.
»Macht nichts«, bemerke ich. »Du hast ja seine Angaben notiert, oder?«
(Das zweite Gebot: Adresse und Telefonnummer jedes Interessenten erfragen, um diesen mit Infomaterial über eine Mitgliedschaft zu versorgen. Dies gilt für jeden Anrufer, selbst für jene, die uns etwas verkaufen wollen.)
»Ich fürchte nein«, murmelt sie. »Ich habe ihm geraten, es bei Tower Records zu probieren.«
Rebecca arbeitet seit einem halben Jahr bei uns, und Daniel und ich waren mit ihrer Einarbeitung betraut. Offenbar hat Rebecca nicht viel davon behalten, wobei mich der Gedanke beschleicht, dass das vielleicht gar nicht ihre Schuld ist – schließlich haben Daniel und ich diese Aufgabe nicht besonders ernst genommen.
»Mach dir nichts draus«, tröste ich Rebecca. »Hör zu, du gehst jetzt in die Bar und besorgst uns was zu trinken. Ein Tango und eine Co- nein, bring zwei Tangos.«
»Okay«, murmelt sie, froh darüber, eine Aufgabe zu haben, die sie bewältigen kann.
Während Rebecca davoneilt, sagt Daniel: »Sie wird es wieder vermasseln.«
»Ich weiß. Ich hätte es ihr aufschreiben sollen.«
Wenige Sekunden später schwingt die automatische Tür auf, und Jamie stolziert herein, als würde ihm der Laden gehören. Das ist nicht weiter verwunderlich. Schließlich gehört er ihm tatsächlich.
»Hi«, begrüße ich Jamie. »Ich dachte, Ihr Meeting dauert den ganzen Tag.« (Nur deswegen haben Daniel und ich es überhaupt gewagt, sein Büro in einen Konsumraum zu verwandeln.)
»Eine Änderung im Plan«, entgegnet er knapp. »Wo ist Lydia?«
»Vor ein paar Minuten war sie noch oben in Ihrem Büro«, sagt Daniel, aus dessen Mund trotz aller Bemühungen ein letztes Bläschen hervorquillt.
»Gut, ich muss nämlich mit ihr sprechen.«
Während Jamie den Fahrstuhl betritt, wirft Daniel mir einen Blick zu. »Oh Mann, jetzt dämmert mir erst, wie dicht wir vor einem Rauswurf standen. Ein Glück, dass es nur Alka-Seltzer war. Ich sollte mir diesen abgezockten Dealer schnappen und ihn zum Dank küssen … mit Zunge.«
Ich lasse mich auf einen der Stühle hinter dem Empfangstisch plumpsen, schnüre meine Turnschuhe auf und ziehe die unerlaubten Socken aus. Dann lehne ich mich zurück und lege meine leicht verschwitzten Füße auf den Tisch. Mein Blick wandert hoch zu den drei breiten Plasmafernsehern an der Wand, auf denen mtv läuft. Nelly lässt auf allen drei Bildschirmen die Hüften kreisen. Mhm. Nelly ist echt zum Anbeißen. Ich wünschte mir, er würde in diesem Moment hier anrufen, um sich nach den Zeiten der Pilates-Kurse zu erkundigen. Das ist der Grund, weshalb ich meinen Job hier liebe. Okay, es ist zwar eher unwahrscheinlich, dass Nelly anrufen wird, aber noch vor wenigen Wochen war Craig David hier. Und Daniel Bedingfield ist bei uns Mitglied. Das ist nicht gerade A-Prominenz, aber welcher andere Job bietet mir die Gelegenheit, echte Popstars kennen zu lernen und zwischendurch die Beine hochzulegen und mtv zu schauen? Sogar der Umstand, dass ich während der Arbeit nur Klamotten mit dem Zone-Logo tragen darf, ist positiv zu bewerten. Es handelt sich nämlich um coole Sport-Outfits, genauso flippig wie die Markenklamotten von Adidas und Nike. Na schön, es ist zwar immer noch eine Arbeitskleidung, aber sie ist nicht mit den Plastikschürzen bei McDonald’s zu vergleichen. Ja, an sich der perfekte Job.
Wenn nur Lydia nicht wäre.
Daniel und ich zerbrechen uns täglich circa eine Stunde lang den Kopf wegen ihr. Bis jetzt ist uns noch keine Lösung eingefallen, aber das ist bestimmt nur eine Frage der Zeit.
»Hattest du wirklich was mit Philip?«, frage ich, da ich es einfach nicht glauben kann.
»Ja, sogar zweimal«, entgegnet Daniel. »Einmal in Lydias Büro und das andere Mal in der Mile High Club Lounge.«
Die Mile High Club Lounge befindet sich im siebten Stock – der einzige Raum dort neben dem Ballettsaal und Jamies Büro. Man kann die Lounge eigentlich kaum als Raum bezeichnen, eher als Besenkammer. Lediglich Daniel und das Reinigungspersonal halten sich darin auf, ich nehme an, Daniel häufiger als das Reinigungspersonal. Mir ist ein Rätsel, wie er das anstellt. Schließlich ist die Kammer ohne Licht und voll gestopft bis an die Decke, aber vor allem ist sie nur wenige Meter von Jamies Büro entfernt.
»Und ich hätte gedacht, Philip ist zu anspruchsvoll für deine dreckige, alte Besenkammer.«
»Machst du Witze? Du müsstest ihn mal auf allen vieren sehen. Wie ein kleiner, scharfer Köter.«
»Welcher Köter?«, fragt Rebecca, die in diesem Moment mit den Getränken zurückkehrt.
»Lassie«, antwortet Daniel.
»Oh, ja, stimmt … Für wen ist die Sprite?«
»Für keinen von uns«, erwidert Daniel, der Rebecca die Getränkedosen abnimmt und mir das Lucozade reicht.
Ich hasse Lucozade. Ich wünschte, ich hätte es ihr aufgeschrieben.
»Schalte mal auf ein anderes Programm«, sagt Daniel und reißt die Sprite-Dose auf. »Ich hasse den Sound.«
Er spricht von dem Kelis-Videoclip, der gerade begonnen hat.
Ich greife nach der Fernbedienung und schalte um. Schon wieder Nelly. Der ist heute auf allen Kanälen. Wie ein endlos hüftkreisender Virus. Ich zappe weiter durch die fünfzehn Musikkanäle. Kurze Szenen von Girls Aloud …
»Brrr, Girlies«, kommentiert Daniel.
… Marilyn Manson …
»Leuten, die so hässlich sind, sollte man verbieten, Videoclips zu drehen.«
… Evanescence …
»Igitt! Grufti-Braut.«
… Limp Bizkit …
»Aaagh!«, kreischt Daniel.
Ich höre auf zu zappen, weil das Telefon klingelt. Ich gehe dran und halte den Hörer gleich darauf einen halben Meter von meinem Ohr weg. Selbst so kann ich noch jedes einzelne Wort verstehen, dass Mr Motzki in voller Lautstärke brüllt, sogar lauter als Limp Bizkit.
Mr Motzki, das ist Steve, einer unserer Fitnesstrainer. Dieser Mann kann sich nur durch Brüllen verständigen und ist im Nu auf hundertachtzig. Daniel schiebt es auf die Anabolika. Ich schiebe es auf den Umstand, dass Steve ein unbeherrschter Idiot ist. Einmal habe ich ihn dabei beobachtet, wie er mit einem leeren Stuhl in der Cafeteria kämpfte.
Ich muss gar nicht hinhören, ich weiß auch so, weshalb Steve anruft. Er kann es auf den Tod nicht ausstehen, wenn Daniel oder ich durch die Programme zappen. Das hat damit zu tun, dass es im The Zone nicht nur die drei Plasmafernseher im Empfangsbereich gibt. Es wimmelt hier von Bildschirmen. Allein in Steves riesigem Fitnessraum hängen zehn, die alle mit der Fernbedienung verbunden sind, die in meiner Hand liegt. Vor einigen Wochen verlangte eines unserer Mitglieder seinen Monatsbeitrag zurück mit der Begründung, er sei beim Spinning völlig aus dem Tritt geraten, weil Daniel von irgendeiner schnulzigen Will-Young-Ballade auf eine schnelle Technonummer umgeschaltet hatte.
»Sorry, Steve«, sage ich und nehme den Hörer wieder an mein Ohr. »Sollen wir Nu Rock drinlassen oder lieber auf ein anderes Programm umschalten?«
»Das ist mir völlig schnurz«, blafft er. »Von mir aus könnt ihr auch auf qvc schalten. Hauptsache, ihr hört auf, ständig die Programme zu wechseln.«
Als ich den Hörer auflege, erspähe ich Lydia, die sich uns entschlossenen Schrittes nähert.
Scheiße.
Bestimmt war sie gerade bei Steve, als dieser mit mir telefoniert hat. Das riecht nach Ärger.
Ich wappne mich innerlich, doch als Lydia auf unserer Höhe ist, bleibt sie nicht stehen. Stattdessen stürmt sie an uns vorbei und weiter durch den Korridor, und wenig später hören wir, wie die Tür ihres Büros zugeknallt wird. Daniel und ich starren uns sprachlos an. Normalerweise lässt Lydia keine Gelegenheit zu einem Rüffel aus. So mussten wir uns von ihr sagen lassen, wir würden uns zu langsam bewegen, zu schnell atmen, im falschen Moment beziehungsweise zu selten lächeln. Was auch immer wir tun und auf welche Art, wir können es Lydia nie recht machen. Gerade eben hätte es zum Beispiel gut passieren können, dass sie unsere Körperhaltung kritisiert. Wenn nicht viel los ist, zwingt sie uns hin und wieder zu leichten Dehnübungen oder lässt uns gerade stehen, als würden wir für die Olympiade im Weitsprung üben. Das dritte Gebot: Das Personal soll stets einen professionellen, durchtrainierten Eindruck machen. Meine leicht verschwitzten Füße liegen nach wie vor auf dem Tisch. Im Moment mache ich alles andere als einen professionellen Eindruck. So dürfte ich mich nicht einmal in einer Taxizentrale aufführen.
»Was die wohl hat?«, fragt Daniel flüsternd.
Ich zucke die Achseln.
Gleich darauf strömen die ersten Balletttänzer in das Foyer. Es muss jetzt zwanzig Uhr sein. Zeit für uns, Feierabend zu machen. Die letzten Abendkurse sind nun zu Ende. Der Fitnessbereich und das Schwimmbecken werden geschlossen. Die Kosmetikerinnen haben ihre letzte Massage/Wachsenthaarung/Gesichtsmaske hinter sich. Nach einem weiteren Tag, an dem ich der Londoner Highsociety geholfen habe, das optimale körperliche Erscheinungsbild zu erlangen – und nebenbei mit Daniel herumzualbern und mtv zu gucken –, bin ich nun ebenfalls bereit, nach Hause zu gehen.
»Hast du Lust auf einen kurzen Sprung ins Billy’s?«, fragt Daniel.
Billy’s Bar. Unser Stammlokal. Ein ziemlich angesagter Laden in der Nähe des Piccadilly Circus in Soho. Im Billy’s findet sich für jeden etwas. Jedenfalls für Daniel und mich. Knackige, nicht mit Verstand gesegnete Boygroup-Schönlinge für mich und … äh … knackige, nicht mit Verstand gesegnete Boygroup-Schönlinge für Daniel.
Aber nicht heute Abend.
»Ich kann nicht, Daniel. Die Ausrede mit Sasha zieht allmählich nicht mehr. Dad wird toben, wenn ich schon wieder so spät nach Hause komme.«
»Bist du sicher? Nach so einem Crash kann die Reha Monate dauern. Ist doch eine gute Ausrede.«
Bei dem Gedanken an meine Lüge werde ich rot. Natürlich war Sasha nicht in einen schrecklichen Massenunfall auf der Autobahn verwickelt und sitzt im Rollstuhl, und natürlich stehe ich ihr nicht bei ihren ersten, zaghaften Gehversuchen bei, aber die Vorstellung, ich würde dies tun, erfüllt meine Eltern mit großem Stolz, was beweist, dass eine Lüge auch etwas Gutes haben kann.
»Mensch, Mädchen, du bist vierundzwanzig«, sagt Daniel. »Ich verstehe einfach nicht, weshalb du noch zu Hause wohnst.«
Ich verstehe das durchaus. Weil es bequem ist und ich keine Miete zu zahlen brauche und weil … ähm … weil mein Vater mich eher umbringen würde, als mich gehen zu lassen – außer ich trage ein weißes Kleid mit einer sechs Meter langen Schleppe und werfe den Brautstrauß nach hinten, damit ihn meine jüngere Schwester fangen kann.
Das Telefon klingelt. Daniel, der sich gerade seine Jacke anzieht, meint: »Geh du dran.«
Ich hebe ab und sage: »Guten Abend, Sie sind mit The Zone verbunden. Sie sprechen mit Charlie. Was kann ich für Sie tun?« … Falls Sie nach diesem Sermon noch dran sind.
Wir sind angewiesen, uns am Telefon so zu melden – das vierte Gebot. Mich wundert nur, dass wir nicht auch noch Uhrzeit, Datum, Außentemperatur sowie das komplette Kinoprogramm herunterspulen müssen, bevor der Anrufer die Chance erhält, etwas zu sagen.
»Hier spricht Julie Furmansky von Mission Management«, erwidert die Anruferin mit näselnder Stimme, die klingt, als sei die Frau entweder schlimm erkältet oder schlimm blasiert. »Kann ich bitte den Studiomanager sprechen?«
Das wäre die Furcht erregende Lydia – die gerade erst mit einem Gesicht wie drei Tage Donnergrollen vorbeigerauscht ist. Soll ich sie wirklich belästigen?
»Unsere Managerin ist leider schon weg«, entgegne ich. »Können Sie vielleicht morgen noch einmal anrufen?«
Eigentlich hätte ich sagen müssen: Kann ich Ihnen weiterhelfen?, aber dann würde sie womöglich erwidern: Ja, können Sie und mich stundenlang aufhalten, wo ich doch endlich nach Hause möchte.
»Ich soll morgen wieder anrufen?«, sagt die Frau in einem Ton, als hätte ich sie gebeten, meine Toilette mit ihrer Zunge sauber zu lecken. »Wissen Sie eigentlich, wer ich bin?«
»Nicht wirklich«, entgegne ich wahrheitsgemäß und unterdrücke dabei einen genervten Stoßseufzer.
»Ich betreue Blaize«, informiert sie mich. Drei Worte, die mich sofort hellhörig werden lassen.
Blaize ist eine ganz heiße Nummer. Bei den diesjährigen Smash Hits Awards hat sie die Titel beste Newcomerin, beste Single, bestes Video, beste Küsserin abgeräumt … Den letzten Titel habe ich natürlich erfunden, aber gäbe es diese Kategorie tatsächlich, hätte sie darin ebenfalls gewonnen, jede Wette. Oh ja, Blaize ist momentan ganz groß im Kommen, und normalerweise wäre ich total aus dem Häuschen, dass ihre Managerin anruft …
Aber ich will jetzt einfach nach Hause.
Also sage ich: »Tut mir Leid, aber unsere Studiomanagerin ist morgen früh ab halb acht wieder zu erreichen. Okay? Also, tschüss dann.« Ich sage das mit meiner freundlichsten Stimme, damit mir keiner vorwerfen kann, ich sei nicht hilfsbereit. Dann lege ich auf.
Als ich durch den Flur gehe, höre ich erneut das Telefon klingeln. Scheiß drauf. Dieses Mal ignoriere ich es. Ich hole meine Jacke aus meinem Spind vor Lydias Büro heraus. Die Tür steht einen Spalt offen und ich höre, wie sie den Anruf entgegennimmt. Ich hoffe bloß, dass das nicht wieder die näselnde Managerin ist. Ich spitze die Ohren.
»Eine junge Frau, sagen Sie? Unhöflich und abweisend …?«
Scheiße. Sie ist es doch …
»… Nun, sie hat sich geirrt. Ich bin noch im Haus …«
… Und ich bin am Arsch.
»… aber es ist mir scheißegal. Wiederhören.«
Lydia knallt den Hörer auf, und ich kann nicht glauben, was ich soeben gehört habe.
Lydia ist es scheißegal?
Normalerweise ist Lydia überhaupt nichts scheißegal. Nicht einmal der kleinste Scheiß. Ich spähe durch den Türspalt. Auf Lydias Schreibtisch steht ein Karton, in den sie gerade lauter Sachen packt.
Wirft sie etwa das Handtuch?
Das würde sie nie und nimmer tun.
Oder doch?
Gut, egal, wie Furcht erregend Lydia auch sein mag, egal, wie sehr ihr Schielen mir Kopfschmerzen verursacht, ich muss Gewissheit haben. Ich klopfe an ihre Tür und drücke sie auf. Lydia richtet den Blick auf mich (und auf das Regal links von mir), ohne ein Wort zu sagen. Ihr Gesicht sieht verheult aus.
»Entschuldige, dass ich störe, Lydia«, sage ich nervös, »aber gerade eben hat die Managerin von Blaize angerufen. Ich dachte, du wärst schon nach Hause gegangen.«
Lydia bleibt nach wie vor stumm.
»Alles okay?«, frage ich.
»Nein … Nein, nichts ist okay«, entgegnet sie brüsk. »Ich räume gerade meinen Arbeitsplatz.«
Hurrraaaaaa!
»Mein Gott, das ist ja schrecklich«, entgegne ich mit geheucheltem Mitgefühl. »Warum denn?«
»Gute Frage. Warum fragst du nicht Jamie?«
Hat Jamie sie etwa gefeuert? Oh Jamie, ich liebe dich, Mann, wahrhaftig.
»Er hat aber nicht … du weißt schon …«
»Was, mich gefeuert? Doch, genau das hat dieses miese Schwein getan.«
Wieder kullern Tränen über ihre Wangen. Ich bin schockiert. Nicht weil Lydia weint, sondern weil ihre Tränen senkrecht herablaufen. Müssten sie nicht in zwei unterschiedliche Richtungen fließen? Scheiße, jetzt überkommt mich ein schlechtes Gewissen. Ich habe zwar Lydias Rausschmiss herbeigesehnt, aber nun, wo es so weit ist, fühle ich mich irgendwie schuldig.
»Und warum?« Dumme Frage, zumal die Antwort auf der Hand liegt. »Aber doch nicht wegen … äh … dem Zeug auf seinem Schreibtisch?«
»Das Alka-Seltzer? Sei nicht albern. Ich bin gefeuert, weil ich – ich glaube, die Antwort spare ich mir für meine Anwälte auf. Diesem miesen Schwein zahle ich es heim. Der kann sich auf was gefasst machen.«
»Kann ich etwas für dich tun?«, frage ich, da mir die Frage angemessen scheint.
»Das bezweifle ich stark«, erwidert sie und fährt fort, Sachen in den Karton zu packen.
»Es tut mir Leid … Ich werde dich wirklich vermissen … Das gilt für uns alle.«
Dies ist die dreisteste Lüge, die ich je in meinem Leben ausgesprochen habe – noch dreister als die mit der angeblich im Rollstuhl sitzenden Sasha –, aber im Moment scheint sie mir vertretbar.
»Blödsinn, Schätzchen«, entgegnet Lydia mit ihrem gewohnten Charme. »Morgen werdet ihr alle auf meinem Grab tanzen. Sag mal, willst du den ganzen Abend hier herumstehen?« Meint sie damit mich, oder hat noch jemand anderes den Raum betreten? Ein kurzer Blick nach hinten sagt mir, dass dort keiner steht. »Ich wäre jetzt gerne alleine«, fügt Lydia hinzu.
Ich trete den Rückzug an und murmle: »Sicher, Lydia. Tut mir Leid. Tja, tschüss dann und … äh … Es war …«
Es war was?
Die Hölle?
Ein Albtraum?
Wie eine OP am offenen Herzen ohne Narkose?
»… fantastisch.«
Was soll ich sonst sagen?
Als ich hinausgehe, fühle ich mich ganz seltsam. Ich schwanke zwischen dem Bedürfnis, einen Freudentanz aufzuführen, und dem, mir die Pulsadern aufzuschneiden. Besser, ich entscheide mich für den Freudentanz. Gott allein weiß, wie unser nächster Chef sein wird, aber er/sie/es kann unmöglich schlimmer sein als Lydia. Selbst wenn es der Schlächter von Piccadilly sein sollte. »Ich benötige deine Herzfrequenz für unsere aktuelle Umfrage. Das Beste wird sein, ich entferne dazu das Herz. Also, Mädchen, schön liegen bleiben und die Augen schließen. Du wirst überhaupt nichts spüren.« Zumindest kann ich mir dann sicher sein, dass tatsächlich ich gemeint bin.
Ich gehe zurück zum Empfang, wo Daniel gerade den Telefonhörer auflegt. Sein ernster Gesichtsausdruck macht mir Angst. Rebecca steht schüchtern hinter ihm. »Was ist?«, frage ich, obwohl ich beinahe platze, um ihm die Neuigkeit mit Lydia mitzuteilen, aber gleichzeitig möchte ich unbedingt wissen, warum er so erschrocken dreinsieht.
»Das war Jamie«, erwidert er. »Er will dich sehen.«
Oh, scheiße.
Oberscheiße.
Das bisschen, in dem Sie meinen Vater kennen lernen (viel Glück)
Als ich den Schlüssel in das Türschloss stecke, werfe ich einen Blick auf meine Armbanduhr. Zwanzig vor zehn. Gar nicht so schlecht. Mein Vater wird sich zwar bestimmt aufregen, aber wenn ich ihm die Neuigkeit verkünde, wird seine Begeisterung überwiegen.
Oder?
»Hi, ich bin’s!«, rufe ich laut, als ich die Tür öffne.
»Pschschsch!«, macht mein Vater. Er steht in der Diele und telefoniert. Er lauscht aufmerksam in den Hörer, mit leicht geneigtem Kopf und wütendem Gesicht.
»Das mir ist egal«, sagt er jetzt. »Wir haben einundswansigste Jahrhundert. Alle liefern in Haus. Sogar Babys kommen heute in Haus auf Welt. Bloß die griechische Esel nicht liefern in Haus!« Er sieht mich triumphierend an und sticht mit dem Finger durch die Luft, ein sicheres Zeichen, dass er das letzte Wort hatte. Aber mit wem auch immer er spricht, derjenige kann a) weder das Siegeszeichen sehen noch b) wissen, dass mein Vater grundsätzlich das letzte Wort hat. Offenbar lässt der Anrufer/die Anruferin nicht locker, ohne zu ahnen, dass mein Vater gerade purpurrot im Gesicht anläuft.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!