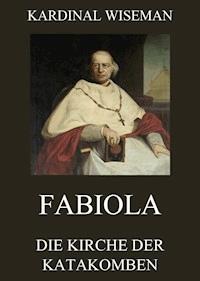
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Fabiola" ist kein Roman, keine erdichtete Erzählung, die etwa durch ihre schöne Darstellung und ihre spannenden Verwicklungen das Gemüt ergreift und die Phantasie anregt; nein - ein Roman hätte das nicht wirken können, was die "Fabiola" gewirkt hat; sondern es ist eine überaus geistreiche, fein angelegte und auf einen Leserkreis, der eigentlich nur Unterhaltung verlangt, mit großem psychologischen Verständnis berechnete Kontroversschrift - eine wahre und zwar eine glänzende Apologie der alten katholischen Kirche. Bald erzählend, bald wiederum belehrend, gibt er im interessanten und amüsanten Gewand einer derartigen Erzählung eine Verteidigung und Begründung fast aller von den Protestanten bestrittenen Lehren und Gebräuche, so daß seine "Fabiola" da, wohin seine Bücher, seine Vorträge über die Gebräuche der Kirche nicht eindringen können, die Vorurteile besiegt und die Herzen für den katholischen Glauben gewinnt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 706
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Fabiola
oder Die Kirche der Katakomben
Nicholas Kardinal Wiseman
Inhalt:
Nicholas Kardinal Wiseman – Biografie und Bibliografie
Fabiola
Erster Teil. Frieden.
Das christliche Haus
Der Sohn des Märtyrers
Die Weihe
Der heidnische Haushalt
Der Besuch
Das Gastmahl
Arm und reich
Das Ende des ersten Tages
Zusammenkünfte
Weitere Zusammenkünfte
Ein Gespräch mit dem Leser
Der Wolf und der Fuchs
Wohlthätigkeit
Die Extreme berühren sich
Werke der Wohltätigkeit
Der Monat Oktober
Die christliche Genossenschaft
Versuchung
Gefallen
Zweiter Teil. Kampf.
Diogenes
Die Cömeterien
Was Diogenes nicht von den Katakomben erzählen konnte
Was Diogenes von den Katakomben erzählte
Über der Erde
Beratungen
Düsterer Tod
Noch düsterer
Der falsche Bruder
Die Ordination im Dezember
Prie Ivn Pavsa
Die Villa in der Via Nomentana
Das Edikt
Die Entdeckung
Erklärungen
Der Wolf in der Herde
Die erste Blume
Vergeltung
Zwiefache Rache
Die öffentlichen Arbeiten
Das Gefängnis
Die Wegzehrung
Der Kampf
Der christliche Soldat
Die Rettung
Das Wiederaufleben
Die zweite Krone
Die erste Hälfte des entscheidenden Tages
Die zweite Hälfte desselben Tages
Das Ende desselben Tages
ΔΙΟΝΥCΙΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΠΡΕCΒΥΤΕΡΟΥ
Das Opfer wird angenommen
Mirjams Geschichte
Seliger Tod
Dritter Teil. Sieg.
Der Fremde aus dem Morgenlande
Der Fremde in Rom
Das Letzte
Fabiola, Kardinal Wiseman
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849640170
www.jazzybee-verlag.de
Nicholas Kardinal Wiseman – Biografie und Bibliografie
Kath. Geistlicher, geb. 2. Aug. 1802 von irischen Eltern in Sevilla, gest. 15. Febr. 1865 in London, kam sehr jung nach England, studierte später im englischen Kollegium zu Rom und gründete, nach England zurückgekehrt, 1835 die Zeitschriften: »Dublin Review«, »Catholic Magazine« und »Tablet«; auch stiftete er als Vorsteher des Marienkollegiums in Oscott mit andern die Metropolitan Tract Society zur Verbreitung religiöser Flugschriften und die Society of English Ladies zur Ausstattung unbegüterter katholischer Kirchen, Klöster, Schulen und Krankenhäuser. Auf seine Anregung stellte Pius IX. durch Bulle vom 24. Sept. 1850 die katholische Hierarchie in England wieder her und ernannte W. zum Kardinal und Erzbischof von Westminster. Das Verbot der Führung dieses Titels durch die Regierung (Kirchentitelbill) blieb praktisch ohne Bedeutung. W. wirkte ungestört fort durch zahlreiche Schriften, wie: »Erinnerungen an die letzten vier Päpste« (deutsch, 4. Aufl., Köln 1870); »Zwölf Vorlesungen über die Beziehungen zwischen den Wissenschaften und der geoffenbarten Religion« (deutsch von Haneberg, 3. Aufl., Regensb. 1866); »Lehren und Gebräuche der katholischen Kirche« (deutsch, 3. Aufl., das. 1867), auch Romane, von denen »Fabiola, oder die Kirche der Katakomben« (deutsch unter andern von Reusch. 38. Aufl., Köln 1904) am verbreitetsten ist. Vgl. Ward, The life and times of Cardinal W. (Lond. 1898, 2 Bde.); Thureau-Dangin, La renaissance catholique en Angleterre an XIX. siècle. Bd. 1 u. 2 (Par. 1899–1903).
Fabiola
Haec Sub Altari Sita Sempertino, Lapsibus Nostris Veniam Precatur, Turba, Quam Servat Procerum Creatrix Purporeorum.
Prudentius.
Erster Teil. Frieden.
Erstes Kapitel
Das christliche Haus
Wir bitten unseren Leser, uns an einem Nachmittage im September des Jahres 302 durch die Straßen von Rom zu begleiten. Die Sonne hat den Meridian längst überschritten, und es sind ungefähr noch zwei Stunden bis zu ihrem Untergange. Der Tag ist wolkenlos, die Hitze ist vorüber, die Menschen entströmen ihren Häusern und schlagen den Weg nach den Gärten Cäsars auf der einen Seite oder nach denen des Sallust auf der anderen Seite ein, um die Kühle des Abends auf einem Spaziergange zu genießen oder die Neuigkeiten des Tages zu hören.
Aber jener Teil der Stadt, nach welchem uns zu begleiten wir unseren freundlichen Leser bitten, ist der, welcher unter dem Namen Campus Martius bekannt ist. Er umfaßte die flache, angeschwemmte Ebene zwischen den sieben Hügeln des älteren Rom und dem Tiber. Vor dem Ende der republikanischen Periode hatte man begonnen, dieses flache Land, welches einst für die athletischen Übungen und kriegerischen Spiele des Volkes frei und offen gelassen worden, mit öffentlichen Gebäuden zu bebauen. Pompejus hatte dort sein Theater errichtet: bald darauf erbaute Agrippa das Pantheon und die daran grenzenden Bäder. Aber nach und nach entstanden dort auch Privatwohnungen, während die Hügel – in der ersten Zeit des Kaiserreichs der aristokratische Teil der Stadt – nur für größere Bauwerke benützt wurden. So wurde der Palatin nach Neros Feuersbrunst fast zu klein für die kaiserliche Residenz und den daran stoßenden Cirkus Maximus. Der Esquilin wurde von den Bädern des Titus usurpiert, welche auf den Ruinen des Goldenen Hauses erbaut wurden; der Aventin von denen des Caracalla; und zu der Zeit, von welcher wir schreiben, bedeckte der Kaiser Diocletian einen Raum, welcher für manches herrliche Wohngebäude hingereicht haben würde, durch die Errichtung seiner Thermen (heiße Bäder) auf dem Quirinal, nicht weit entfernt von den oben erwähnten Gärten des Sallust.
Die besondere Stelle auf dem Campus Martius, nach welcher wir unsere Schritte lenken wollen, ist eine, deren Lage so bestimmt ist, daß wir sie jedem, der mit der Topographie des alten oder neuen Rom bekannt ist, ganz genau beschreiben können. In den Zeiten der Republik lag inmitten des Campus Martius ein großer viereckiger Platz, der von einem Bretterverschlag umgeben und in Hürden abgeteilt war; hier wurden die Comitia oder Zusammenkünfte der verschiedenen Volksklassen abgehalten, um ihre Stimmen abzugeben. Dies wurde die Septa oder Ovile genannt wegen ihrer Ähnlichkeit mit einer Schafhürde. Augustus brachte einen Plan, welchen Cicero in einem Briefe an Atticusbeschreibt, zur Ausführung, indem er dieses häßliche Machwerk in ein prächtiges und festes Gebäude umwandelte. Die Septa Julia, wie sie fortan genannt wurde, war ein herrlicher Portikus von 1000 Fuß Höhe zu 500 Fuß Breite, von Säulen getragen und mit Gemälden geschmückt. Noch heute sind Spuren ihrer Ruinen vorhanden; sie stand auf dem Platze, wo sich in unseren Tagen die Paläste der Dorias und der Verospis (also an dem heutigen Corso entlang), das Collegio Romano, die Kirche des heiligen Ignatius und die Kapelle der Caravita erheben.
Das Haus, in welches wir den Leser bitten, uns zu folgen, liegt gerade gegenüber und auf der östlichen Seite des Gebäudes (auf seiner Grundfläche erhebt sich heute die Kirche des heiligen Marcellus), von wo es sich bis an den Fuß des Quirinals hinzog. Man sieht also, daß es eine sehr beträchtliche Fläche bedeckte, wie es damals der Fall war mit den Häusern der vornehmen Römer. Von außen bietet es nur einen leeren und toten Anblick. Die Mauern sind nackt und schlicht ohne architektonischen Schmuck, nicht hoch und fast ohne Fenster. In der Mitte der einen Wand dieses Vierecks befindet sich eine Thür, in antis, das heißt, nur hervorgehoben durch ein tympanum oder einen dreieckigen Fries, welcher auf zwei Säulen ruht. Indem wir von unserem Vorrecht der unsichtbaren Allgegenwart Gebrauch machen, wollen wir mit unserem Freund oder unserem "Schatten" wie man ihn in alten Zeiten genannt haben würde, eintreten. Jetzt treten wir durch den Porticus, auf dessen Pflaster wir mit Freuden den Gruß "Salve" oder Willkommen in Mosaikschrift lesen, und befinden uns im Atrium oder dem ersten Hofe des Hauses, welcher von Kolonnaden umgeben ist.
In der Mitte des marmorgepflasterten Hofes springt sanft murmelnd ein Strahl klaren Wassers, durch den Aquaduct des Claudius von den Hügeln Tusculums hierhergeleitet, in die Luft empor, bald höher, bald niedriger, und fällt dann in ein großes Bassin aus rotem Marmor, über dessen Rand es sich in weiß schäumenden Wellen ergießt und einen seinen Tropfenregen auf die herrlichen, seltenen Blumen, welche in kostbaren Vasen umherstehen, stiebt, bevor er in den größeren unteren Behälter fällt. Unter den Kolonnaden stehen reiche und eigenartige Möbelstücke umher; Ruhebetten, welche mit Silber und Elfenbein eingelegt sind; Tische aus orientalischem Holz, auf welchen Kandelaber, Lampen und andere Hausgeräte aus Bronze und Silber stehen; fein gemeißelte Büsten, Vasen, Dreifüße und herrliche Kunstgegenstände. An den Wänden sind Gemälde, augenscheinlich aus einer früheren Zeit, welche indessen noch ihre ganze Farbenpracht und die Feinheit der Ausführung bewahrt haben. Diese werden unterbrochen durch Nischen, in welchen sich Statuen befinden, die ebenso wie die Gemälde mythologische und historische Gestalten und Scenen darstellen. Aber wir können nicht umhin zu bemerken, daß sich dort nichts befindet, was das Auge ober das zarteste Gemüt verletzen könnte. Und daß dies nicht nur das Resultat des Zufalls, beweist hier und dort ein verhängtes Gemälde, eine leere Nische.
Da das gewölbte Dach außerhalb des Säulenganges ein großes Viereck läßt, welches sich nach dem Centrum hin öffnet, impluvium genannt, so ist ein Vorhang oder Schleier von dunklerem Stoff darüber gezogen, welcher sowohl Regen wie Sonne ausschließt. Daher setzt uns nur ein künstliches Zwielicht in den Stand, alles das zu sehen, was wir soeben beschrieben haben, aber es verleiht dem, was dahinter liegt, auch eine um so größere Wirkung. Durch einen Bogengang, gegenüber dem, durch welchen wir eingetreten sind, erhaschen wir einen Blick in den inneren und noch prächtigeren Hof, welcher mit buntfarbigem Marmor gepflastert und mit glänzenden Vergoldungen geschmückt ist. Da der Schleier, der die obere Öffnung bedeckt, welche hier jedoch mit dickem Glase oder Talkschiefer ( lapis specularis) geschlossen ist, halb zur Seite gezogen worden und einen hellen jedoch milden Strahl der Abendsonne einläßt, sehen wir zum erstenmal, daß wir uns nicht in einer verzauberten Halle, sondern in einem von Menschen bewohnten Hause befinden.
Neben einem Tische, welcher gerade außerhalb der Kolonnaden von phrygischem Marmor steht, sitzt eine Matrone, welche die Mitte des Lebens noch nicht überschritten hat; ihre edlen und doch so milden Züge zeigen Spuren von schwerem Leid und Kummer, welcher sie vielleicht in früherer Zeit betroffen hat. Aber ein mächtiger Einfluß hat die Erinnerung daran geschwächt oder sie durch süßere Gedanken gemildert. Und diese Gedanken und jener Einfluß herrschen schon lange vereint in ihrem Herzen. Die Einfachheit ihrer Erscheinung kontrastiert seltsam mit dem Reichtum, welcher sie umgiebt. Ihr Haar, das bereits mit Silberfäden durchzogen, ist unbedeckt und durch keine Kunst entstellt. Ihre Gewänder sind von einfachster Farbe und Stoff, ohne Stickerei, mit Ausnahme des purpurfarbigen aufgenähten Bandes, segmentum genannt, welches die Witwenschaft anzeigte; kein Juwel, kein kostbarerer Schmuck, mit dem die römischen Damen so verschwenderisch umzugehen pflegten, war an ihrer Gestalt zu entdecken. Nur um den Hals trug sie eine dünne goldene Kette oder Schnur, an welcher anscheinend ein Gegenstand hing, den sie sorgsam in dem oberen Saum ihres Gewandes verbarg.
In dem Augenblick, wo wir ihrer ansichtig werden, ist sie emsig mit einer Handarbeit beschäftigt, welche nicht für den persönlichen Gebrauch bestimmt ist. Auf einem langen, reichen Streifen von golddurchwirktem Tuch stickt sie mit noch kostbareren goldenen Fäden, und gelegentlich öffnet sie dies oder jenes prächtige Juwelenkästchen, von denen eine Menge auf dem Tische stehen, nimmt eine Perle heraus oder einen in Gold gefaßten Edelstein und fügt ihn dem Muster ein, welches sie stickt. Es scheint, als weihe sie den köstlichen Schmuck aus früheren Tagen irgend einem höheren Zwecke. Aber wie die Zeit vergeht, bemerken wir, daß eine leichte Unruhe sich ihrer Gedanken bemächtigt, welche allem Anschein nach bis jetzt vollständig in ihre Arbeit vertieft waren. Sie wendet den Blick dann und wann dem Eingange zu; nun horcht sie auf Fußtritte und scheint enttäuscht. Sie blickt zur Sonne empor; dann richtet sie das Auge auf eine clepsydra oder Wasseruhr, welche neben ihr auf einem Träger steht. Aber gerade in dem Augenblick, wo ein Gefühl ernsterer Beunruhigung sich auf ihren Zügen zu malen beginnt, ertönt ein fröhliches Klopfen von der Hausthür her, und sie beugt sich mit einem strahlenden Blick des Willkommens vorüber, um den Ankömmling zu begrüßen.
Zweites Kapitel
Der Sohn des Märtyrers
Dieser, ein Jüngling voll Grazie und Munterkeit und Offenherzigkeit, schreitet mit leichten, behenden Schritten durch das Atrium dem inneren Hofe zu. Wir werden kaum die Zeit haben, den Ankömmling flüchtig zu beschreiben, bevor er ihn erreicht. Er ist ungefähr vierzehn Jahre alt, aber groß für sein Alter, von vornehmer Gestalt und männlicher Haltung. Heilsame Leibesübungen haben seinen bloßen Nacken und seine Arme herrlich entwickelt; seine Gesichtszüge lassen auf ein warmes und offenes Herz schließen, während auf seiner hohen Stirn, um welche sich das braune Haar in natürlichen Locken legt, ein Heller, klarer Verstand thront. Er trägt das gebräuchliche Gewand der Jünglinge, die kurze praetexta, welche bis unter das Knie reicht, und eine goldene bulla oder hohle Sphäroide aus Gold, welche an seinem Halse hängt. Ein Bündel Papiere und Pergamentrollen, welche ein hinter ihm schreitender alter Diener trägt, zeigt uns, daß er gerade aus der Schule nach Hause kommt.
Während wir ihn so beschrieben haben, hat er die Umarmung seiner Mutter entgegengenommen und sich zu ihren Füßen gesetzt. Lange blickt sie ihn schweigend an, als wollte sie in seinen Zügen die Ursache der ungewöhnlichen Verspätung entdecken, denn er ist eine Stunde länger ausgeblieben als sonst. Er begegnet ihrem Auge indessen mit einem so offenen, ehrlichen Blicke, daß jede Wolke des Zweifels schon im nächsten Augenblick verscheucht ist. Dann spricht sie zu ihm wie folgt:
"Was hat dich heute so lange aufgehalten, mein teurer Knabe? Ich hoffe, daß dir auf dem Wege kein Unfall begegnet ist?"
"Keiner, oh, süßesteMutter; im Gegenteil, alles ist gar köstlich gewesen – so köstlich, daß ich kaum den Mut habe, es dir zu erzählen."
Ein Blick voll lächelnder Entschuldigung entlockte dem offenherzigen Knaben ein reizendes Lachen; dann fuhr er fort:
"Nun, ich glaube doch, daß ich es thun muß. Du weißt, daß ich niemals glücklich bin und nicht schlafen kann, wenn ich es unterlassen habe, dir all das Böse und das Gute des verflossenen Tages über mich zu erzählen."
Die Mutter lächelte wieder verwundert bei dem Gedanken an das "Böse".
"Vor wenigen Tagen las ich, daß die Scythen an jedem Abend einen weißen oder einen schwarzen Stein in eine Urne warfen, je nachdem der Tag glücklich oder unglücklich gewesen war; wenn auch ich das thun müßte, so würde es dazu dienen, in schwarz oder weiß die Tage zu bezeichnen, an welchen ich die Gelegenheit dir alles zu erzählen, was ich gethan, gehabt oder nicht gehabt habe. Aber heute habe ich zum erstenmal einen Zweifel, eine Gewissensangst, ob ich dir alles sagen darf."
Bebte das Herz der Mutter mehr als gewöhnlich vor Angst, oder war es noch eine tiefere Besorgnis, welche ihr Auge trübte, so daß der Sohn ihre Hand ergriff und sie zärtlich an die Lippen führte, während er entgegnete:
"Fürchte nichts, geliebteste Mutter, dein Sohn hat nichts gethan, das dir Kummer bereiten könnte. Sag mir nur, ob du alles hören willst, was mir heute geschehen ist, oder nur die Ursache meiner späten Heimkehr?"
"Sag mir alles, teurer Pancratius," entgegnete sie, "nichts, was dich angeht, kann gleichgültig für mich sein."
"Nun denn," begann er, "dieser letzte Tag, an dem ich die Schule besuche, scheint ein gesegneter für mich gewesen zu sein, und doch voll seltsamer Begebenheiten. Zuerst wurde ich als der siegreiche Mitbewerber bei einer feierlichen Rede gekrönt, welche unser guter Lehrer Cassianus uns als Aufgabe unserer Morgenlehrstunden gestellt hatte, und dies führte, wie du bald hören wirst, zu einigen seltsamen Entdeckungen. Der Gegenstand war: "daß der wahre Philosoph stets bereit sein soll für die Wahrheit zu sterben." Niemals habe ich etwas so kaltes und albernes gehört (ich hoffe, daß es kein Unrecht ist, wenn ich dies sage) wie die Vorträge, welche meine Gefährten hielten. Aber es war nicht ihre Schuld! Die Armen! Welche Wahrheit könnten sie denn auch die ihre nennen, und welchen Beweggrund könnten sie haben, für irgend eine ihrer eitlen, nichtigen Meinungen zu sterben. Aber welch eine Fülle von herrlichen Eingebungen empfängt ein Christ aus diesem Thema. Wenigstens erging es mir so. Mein Herz glühte und meine Gedanken schienen zu brennen, als ich meinen Aufsatz niederschrieb, in dem vollen Bewußtsein der Lehren, welche du mir gegeben und des häuslichen Beispiels, welches ich vor Augen habe. Der Sohn eines Märtyrers konnte nicht anders empfinden. Als die Reihe an mich kam, meinen Vortrag zu halten, hätten meine Gefühle mich beinahe in der verhängnisvollsten Weise verraten. In der Erregung des Sprechens entschlüpfte das Wort "Christ" anstatt "Philosoph" und "Glaube" anstatt "Wahrheit" meinen Lippen. Bei meinem ersten Versehen sah ich Cassianus zusammenschrecken; bei dem zweiten erglänzte eine Thräne in seinem Auge und indem er sich liebevoll zu mir neigte flüsterte er: "Hüte dich, mein Sohn, gar scharfe Ohren lauschen dir!"
"Wie," unterbrach ihn die Mutter, "ist denn Cassianus ein Christ? Ich wählte seine Schule für dich, weil sie in hohem Rufe steht wegen ihrer strengen Sittlichkeit und der außerordentlichen Gelehrsamkeit, welche junge Schüler dort sammeln können – und jetzt danke ich in der That Gott dafür. Aber in diesen Tagen der Furcht und der Gefahr sind wir gezwungen, wie Fremde in unserem eigenen Vaterlande zu leben. Wir kennen kaum die Gesichter unserer Mitbrüder. Gewiß, wenn Cassianus seinen Glauben bekannt hätte, so wäre seine Schule bald verödet gewesen. Aber fahr fort, mein teurer Sohn; waren seine Befürchtungen begründet?"
"Ich fürchte es; denn während die große Masse meiner Mitschüler, welche diese Sprachversehen überhört hatten, meinem aus dem Herzen kommenden Vortrage den reichlichsten Beifall zollten, sah ich, wie die Augen des Corvinus düster forschend auf mir ruhten und er in augenscheinlichem Mißmut sich die Lippen biß."
"Und wer war es, mein Kind, der so erzürnt, und weshalb war er es?
"Er ist der älteste und stärkste, aber unglücklicherweise auch der dümmste Knabe in der Schule. Aber dies, wie du ja weißt, ist nicht seine Schuld. Nur hegt er, ich weiß nicht weshalb, stets einen Unwillen und einen Groll gegen mich, deren Ursache ich nicht begreifen kann."
"That oder sagte er etwas gegen dich?"
"Ja, und das war die Ursache meiner Verspätung. Denn als wir aus der Schule auf die Wiese am Flusse hinaus gingen, redete er mich in Gegenwart unserer Gefährten in beleidigender Weise an und sagte: "Komm, Pankratius, wie ich höre, ist es das letzte Mal, daß wir uns hier treffen (er legte ein besonderes Gewicht auf das Wort "hier"); aber ich habe eine lange Rechnung mit dir abzuschließen. Du hast in der Schule stets danach gestrebt, deine Überlegenheit über mich und andere, die älter und besser sind als du, an den Tag zu legen; ich sah deinen hinterlistigen Blick auf mich, als du heute deinen hochtönenden Vortrag hieltest; ja, und ich fing Worte in demselben auf, welche du eines Tages – und zwar sehr bald – bereuen wirst; denn wie du wohl weißt, ist mein Vater Befehlshaber in dieser Stadt" – die Mutter schrak leicht zusammen – "und es bereitet sich etwas vor, das vielleicht auch dich nahe angeht. Ehe du uns verläßt, muß ich Rache an dir nehmen. Wenn du deines Namens würdig bist und wenn es nicht ein leeres Wortist, so laß uns ehrlich streiten in einem männlicheren Kampfe als in dein des Griffels und der Tafel.Ringe mit mir oder versuche den cestusgegen mich. Ich brenne vor Begierde, dich vor diesen Zeugen deiner frechen Triumphe zu züchtigen, wie du es verdienst!"
Die geängstigte Mutter beugte sich kaum atmend und angestrengt lauschend vorüber.
"Und was entgegnetest du, mein teurer Sohn?" rief sie endlich aus.
"Ich erklärte ihm sanft, daß er im Irrtum sei; denn niemals hätte ich mit Vorsatz irgend etwas gethan, das ihm oder einem meiner Mitschüler Ärger oder Kummer hätte verursachen können, und niemals hätte ich geträumt, eine Überlegenheit über sie geltend machen zu wollen. Und was deinen Vorschlag anbetrifft, Corvinus," fügte ich hinzu, "so weißt du, daß ich mich stets geweigert habe, mich in persönliche Kämpfe einzulassen, welche mit einem kühlen, besonnenen Erproben der Kraft und Geschicklichkeit beginnen und mit einem wütenden Streit, mit Haß und Rachedurst endigen. Und wieviel weniger könnte ich jetzt auf solche eingehen, wo du selbst eingestehst, daß du den Kampf schon mit den bösen Gefühlen beginnen willst, welche gewöhnlich erst sein trauriges Ende sind?" Jetzt hatten unsere Schulkameraden bereits einen Kreis um uns gebildet, und gar deutlich gewahrte ich, daß sie alle gegen mich waren, denn sie hatten schon auf die Freuden gehofft, welche ihre grausamen Spiele ihnen stets bereiten. Deshalb fügte ich fröhlich hinzu: "Und jetzt, meine Gefährten, lebet wohl. Möge alles Glück bei euch weilen. Wie ich mit euch gelebt habe, so scheide ich von euch – in Frieden!"
"Nicht so," entgegnete Corvinus, dessen Gesicht jetzt blaurot vor Wut war, "sondern – – "
Das Gesicht des Knaben wurde feuerrot, seine Stimme bebte, sein Körper zuckte, und mit von Schluchzen halb erstickten Tönen rief er aus: "Ich kann nicht fortfahren, ich kann das übrige nicht erzählen."
"Ich bitte dich um Gottes willen und um der Liebe willen, welche du für das Andenken deines Vaters hegst, verheimliche mir nichts," sagte die Mutter, indem sie ihre Hand auf das Haupt des Sohnes legte. "Ich werde niemals wieder Ruhe finden, wenn du mir nicht alles sagst. Was that oder sagte Corvinus sonst noch?"
Nach einem stillen Gebet und einer minutenlangen Pause erholte der Jüngling sich und fuhr dann fort: "Nicht so," schrie Corvinus, "nicht so wirst du mir entkommen, du feiger Anbeter eines Eselskopfes!Du hast deine Wohnung vor uns verheimlicht, aber wir werden dich ausfindig machen; bis dahin trage dieses Zeichen meines festen Vorsatzes, Rache an dir zu nehmen." Und mit diesen Worten versetzte er mir einen heftigen Schlag ins Gesicht, der mich zurücktaumeln machte, während ein Schrei wilden, tierischen Entzückens sich den Kehlen der Knaben entrang, die in weitem Kreise umherstanden."
Hier brach er in einen Thränenstrom aus, welcher ihm indessen Erleichterung schaffte und dann fuhr er fort:
"Oh, wie ich mein Blut in diesem Augenblick kochen fühlte! Wie mein Herz in mir zu zerspringen drohte! Eine Stimme schien mir verächtlich das Wort "Feigling" ins Ohr zu raunen! Es war gewiß ein böser Geist. Ich fühlte, daß ich stark genug war – die Wut, welche sich in mir aufbäumte, machte mich stark – meinen ungerechten Angreifer an der Kehle zu packen und ihn keuchend zu Boden zu werfen. Ich vernahm schon die Beifallsrufe, welche meinen Sieg begleiten und das Blatt gegen ihn wenden würden. Es war der härteste Kampf meines Lebens; niemals bäumten Fleisch und Blut sich so heftig in mir auf! O Gott, möchten sie niemals Macht über mich gewinnen!"
"Und was thatest du dann, mein geliebter Knabe?" keuchte die zitternde Matrone hervor.
Er entgegnete: "Mein guter Engel besiegte den Dämon, welcher mir zur Seite stand. Ich dachte an meinen gottgesegneten Herrn im Hause des Caiphas, wie er von tobenden Feinden umgeben war, einen Backenstreich empfing, und doch sanft und milde und vergebend war. Und konnte ich wünschen, anders zu sein? Ich streckte Corvinus meine Hand entgegen und sagte: "Möge Gott dir vergeben, wie ich es von ganzem Herzen und aus freiem Willen thue, und möge Er dir seinen Segen in reichem Maße zu teil werden lassen." In diesem Augenblick kam Cassianus heran, welcher alles aus der Ferne mit angesehen hatte, und die jugendliche Menge stob auseinander. Ich bat ihn bei unserem gemeinsamen Glauben, welchen wir einander jetzt bekannt hatten, Corvinus für das, was er gethan hatte, nicht zu verfolgen, und er gab mir sein Versprechen. Und jetzt, süße Mutter," murmelte der Knabe in leisem zärtlichem Ton am Halse der Matrone, "meinst du nicht, daß ich das Recht habe, dies einen glücklichen Tag zu nennen?"
Drittes Kapitel
Die Weihe
Während dieses Gesprächs hatte der Tag sich schnell seinem Ende zugeneigt. Jetzt trat eine ältliche Dienerin geräuschlos und unbemerkt ein und zündete die Lampen an, welche auf marmornen und bronzenen Kandelabern standen; dann zog sie sich eben so still wieder zurück. Ein helles Licht fiel auf die unbefangene Gruppe von Mutter und Sohn, die in langem Schweigen verharrten, nachdem die fromme Matrone Lucina auf Pancratius' letzte Frage nur mit einem liebevollen Kusse auf seine glühende Stirn geantwortet hatte. Es war nicht nur ein mütterliches Gefühl, das ihre Brust bewegte; – es war nicht allein die glückselige Empfindung einer Mutter, welche gewisse erhabene und schwer zu befolgende Grundsätze in ihrem Kinde groß gezogen hat und jetzt bei einer schweren Prüfung sieht, wie es mutig und unentwegt nach diesen Prinzipien handelt, – und ebensowenig war es die Freude einen Sohn zu haben, welcher nach ihrer Ansicht trotz seiner jungen Jahre sich so heldenmütig, tugendhaft gezeigt hatte; denn gewiß mit größerem Rechte, als die Mutter der Gracchen ihre Söhne den verwunderten römischen Matronen als ihre einzigen Juwelen zeigte, hätte diese christliche Mutter sich vor der Kirche des Sohnes rühmen können, welchen sie geboren und erzogen hatte.
Aber für sie war das noch eine Stunde tieferen, oder sollen wir sagen erhabeneren Empfindens. Es war ein Zeitpunkt, welchem sie schon seit Jahren sehnsüchtig entgegengesehen hatte; ein Augenblick, welchen sie mit all der glühenden Liebe einer Mutter herbeigefleht hatte. Manche frommen Eltern haben ihren Sohn schon in der Wiege für den heiligsten und edelsten Stand bestimmt, welchen die Erde trägt; sie haben gebetet und sich danach gesehnt, ihn zuerst als reinen Leviten und dann als heiligen Priester am Altar zu sehen; sie haben ängstlich und sorgsam jede keimende Neigung bewacht und mit Zartheit versucht, jeden liebenden Gedanken dem Herrn der Heerscharen zuzuwenden. Und wenn dieses nun noch ein einziges Kind, wie Samuel es der Anna war, so muß die Hingabe dessen, was sie mit ihrer zärtlichsten Liebe liebte, als eine That mütterlichen Heldenmutes betrachtet werden. Und was muß nun erst von jenen Matronen des Altertums – Felicitas, Symphorosa oder der ungenannten Mutter der Makkabäer – gesagt werden, denen es nicht genügte, daß ihre Kinder Priester wurden, sondern welche eins, oder viele, oder auch alle dem Feuertode weihten, um sie Gott zu geben?
Ein ähnlicher Gedanke war es, welcher in dieser Stunde das Herz der Lucina bewegte, während sie es mit geschlossenen Augen zu Gott emporhob und um Kraft flehte. Sie hatte die Empfindung als sei sie berufen, das, was ihr auf Erden am teuersten war, heldenmütig zum Opfer zu bringen, und obgleich sie es lange vorausgesehen und gewünscht hatte, so konnte sie dieses Verdienst doch nur mit den herbsten Schmerzen einer Mutter erkaufen. Und was mochte in der Seele dieses Knaben vorgehen, während auch er schweigsam und zerstreut dastand? Er hegte keinen Gedanken an eine große, erhabene Bestimmung, die seiner harrte. Keine Vision einer ehrwürdigen Basilika steigt vor ihm auf, welche sechzehnhundert Jahre später eifrig von frommen Pilgern und andächtigen Altertumsforschern besucht werden und seinen Namen, welchen sie tragen wird, auch dem benachbarten Thor von Rom geben wird!Er ahnt nichts von einer Kirche, die sich in gläubigen Jahrhunderten zu seiner Ehre an den Ufern der fernen Themse erheben wird, und die selbst noch nach ihrer Entweihung von Herzen, welche seinem teuren Rom treu geblieben sind, als letzte Ruhestätte gesucht werden.
Kein Gedanke an ein silbernes Tabernakel oder ciborium – 287 Pfund schwer – welches Papst Honorius I. über der Porphyrurne aufrichten lassen wird, die seine Asche enthält!Kein Vorgefühl, daß sein Name in jeder Geschichte der Märtyrer genannt werden, sein Bild mit einer Strahlenkrone, ihn als den Märtyrerjüngling der frühsten Christenheit darstellend, über vielen Altären hängen wird! Er war nur der einfache christliche Knabe, welcher es für eine selbstverständliche Sache hielt, daß er Gottes Gebote stets befolgen und seinem heiligen Evangelium gehorchen müsse. Er war nur glücklich, daß er an diesem Tage seine Pflicht gethan hatte, als ihre Erfüllung unter noch schwierigeren Umständen als gewöhnlich an ihn herantrat. In diesen Gedanken lag kein Stolz, keine Überhebung – sonst hätte er durch jene That ja keinen Heldenmut bewiesen.
Als er nach seiner stillen, friedlichen Träumerei die Augen wieder aufschlug, fiel sein Blick in dem hellen Lichtglanz, welcher die Halle jetzt erfüllte, auf das Antlitz seiner Mutter, die ihn wiederum anblickte, strahlend von Hoheit und Zärtlichkeit, so wie er sich nicht erinnern konnte, sie jemals zuvor gesehen zu haben. Es war ein Blick wie von einer Inspiration, ihr Angesicht war das einer Vision, ihre Augen waren solche, wie er glaubte, daß Engel sie haben müßten. Schweigend, fast unbewußt, hatte er seine Stellung verändert und kniete jetzt vor ihr. Und dazu hatte er Ursache. Denn war sie ihm Nichtsein Schutzengel, welcher ihn stets vor allein Unglück und Übel bewahrt hatte. Und mußte er nicht in ihr die lebende Heilige sehen, deren Tugenden ihm seit den Tagen seiner Kindheit als Vorbild gedient hatten? Lucina brach das Schweigen in einem Ton voll ernster Rührung.
"Die Zeit ist endlich gekommen, mein teures Kind," sagte sie, "welche schon längst der Gegenstand meines inbrünstigen Gebetes war, nach welcher ich mich in dem Übermaße meiner mütterlichen Liebe gesehnt habe. Eifrig habe ich in dir den emporsprießenden Keim jeder christlichen Tugend beobachtet und Gott dafür gedankt, wenn er ans Licht drang. Ich habe deine Milde, deine Sanftmut, deinen Fleiß, deine Frömmigkeit und deine Liebe zu Gott und Menschen beobachtet. Mit glückseliger Freude habe ich deinen lebendigen Glauben, deine Güte und Sorge für die Armen, deine Gleichgültigkeit weltlichen Dingen gegenüber beobachtet. Aber voll Angst und Sorge habe ich der Stunde geharrt, welche mir mit Bestimmtheit kund thun würde, ob es dir genügen würde, dies armselige Erbteil der schwachen Tugenden deiner Mutter, oder ob du der wahre Erbe der edleren, erhabeneren Eigenschaften deines teuren Märtyrervaters sein würdest! Und diese Stunde, Gott sei dafür gepriesen, ist heute gekommen!"
"Was habe ich denn vollbracht, das deine Meinung über mich so verändert oder gehoben hat?" fragte Pancratius.
"Hör mich an, mein Sohn. Mir ist, als hätte der barmherzige Heiland dir an diesem Tage, welcher der letzte deiner Schulzeit war, eine Lehre gegeben, welche alles gelernte aufwiegt. Er hat dir gezeigt, daß du das kindische Gebaren abgelegt hast und in Zukunft wie ein Mann behandelt werden mußt. Denn du kannst wie ein solcher denken, sprechen und handeln!"
"Wie meinst du das, teure Mutter?"
"Was du mir von deinem Vortrage an diesem Morgen erzählt hast, beweist mir, daß dein Herz voll sein muß von edlen und erhabenen Gedanken," entgegnete Lucina, "du bist zu ehrlich und zu aufrichtig, um zu schreiben und voll Feuer und Inbrunst vorzutragen, daß es eine glorreiche Pflicht sei, für den Glauben zu sterben, wenn du es nicht geglaubt und empfunden hättest."
"Und wahrlich, ich glaube und empfinde es," unterbrach sie der Knabe. "Welch größere Glückseligkeit auf Erden kann denn ein Christ sich wünschen?"
"Du sprichst sehr wahr, mein Kind," fuhr Lucina fort. "Aber Worte allein würden mich nicht beruhigt haben. Was darauf gefolgt ist, hat mir bewiesen, daß du nicht nur Schmerzen mutig und geduldig ertragen kannst, sondern aus etwas, von dem ich weiß, daß es deinem jungen Patrizierblut schwerer wurde über sich ergehen zu lassen, nämlich den qualvollen Schimpf eines schmachvollen Schlages und die verletzenden, verächtlichen Worte einer mitleidlosen Menge. Nein, noch mehr! Du hast dich stark genug erwiesen, deinem Feinde vergeben und für ihn beten zu können. An diesem Tage hast du dein Kreuz auf dich genommen und die höher gelegenen Pfade des Berges betreten; noch einen Schritt und du wirst das Kreuz auf seinem Gipfel aufpflanzen! Du hast dich als der wahre würdige Sohn des Märtyrers Quintinus erwiesen. Willst du ihm gleich werden?"
"Mutter, Mutter! teuerste, süßeste Mutter!" stieß der Jüngling keuchend hervor. "Könnte ich sein echter Sohn sein und nicht wünschen, ihm gleich zu werden? Obgleich ich niemals das Glück empfunden habe, ihn zu kennen, so hat sein Bild doch stets vor meiner Seele geschwebt! Ist er nicht der größte Stolz meiner Gedanken gewesen? Wie haben mein Fleisch und mein Blut über seinen Ruhm gejauchzt, wenn wir alljährlich zu seinem Gedächtnis das Fest begingen, an dem wir ihn als einen jener weißgekleideten Tapferen feierten, welche das Lamm umstehen und ihre Gewänder in seinem Blute waschen. Und wie habe ich zu ihm in der Glut meiner kindlichen Liebe gesteht, daß er mir schicken möge – nicht Ruhm, nicht Auszeichnung, nicht Reichtum, nicht irdische Freuden, sondern das, was er höher erachtete als alles dies: nämlich, daß das einzige, was er hier auf Erden zurückgelassen, so angewendet werden möge, wie er es für am edelsten und nützlichsten halten würde."
"Und was ist das, mein Sohn?"
"Es ist sein Blut," entgegnete der Sohn, "welches noch in meinen Adern fließt, und nur in ihnen. Ich weiß, daß er wünschen muß, daß auch ich es vergießen möge aus Liebe zu seinem Erlöser und um Zeugnis abzulegen von seinem Glauben." "Genug, genug, mein Kind!" rief die Mutter aus, vor heiliger Erregung zitternd, "nimm das Kennzeichen der Kindheit von deinem Halse, ich habe dir ein besseres Zeichen zu geben."
Er that wie ihm befohlen und legte die goldene bulla ab.
Die Mutter sprach mit noch größerer Feierlichkeit im Ton als bisher: "Du hast von deinem Vater einen edlen Namen, eine hohe Stellung, große Reichtümer und alle weltlichen Vorteile geerbt. Aber da ist noch ein Schatz aus seinem Erbe, den ich zurückbehalten habe, bis du dich desselben würdig erweisen würdest. Bis jetzt habe ich ihn vor dir verborgen, obgleich ich ihn höher schätzte als Gold und Edelsteine. Jetzt ist die Zeit gekommen, ihn dir zu übergeben."
Mit zitternden Händen nahm sie die eine goldene Kette ab, welche sie an ihrem Halse trug; und zum erstenmale sah der Sohn, daß ein kleiner Beutel daran hing, welcher reich gestickt und mit Edelsteinen besetzt war. Sie öffnete ihn und nahm einen trockenen aber mit dunklen Flecken besäeten Schwamm daraus hervor.
"Auch das ist das Blut deines Vaters, Pancratius," sagte sie mit bebender Stimme und überströmenden Augen. "Ich selbst trocknete es von seiner Todeswunde, als ich verkleidet an seiner Seite stand und ihn sterben sah an den Wunden, welche ihm um Christi willen geschlagen worden."
Voll Zärtlichkeit blickte sie auf diese Reliquie und küßte sie inbrünstig. Ihre heißen Thränen fielen darauf und feuchteten sie noch einmal wieder an. So wieder flüssig geworden, glänzte die rote Farbe warm und hell, als sei sie soeben erst der Todeswunde des Märtyrers entströmt.
Die heilige Matrone drückte den Schwamm an die bebenden Lippen ihres Sohnes und die heiligende Berührung färbte sie rot. Mit der tiefen Rührung des Sohnes und des Christen verehrte er die heilige Reliquie. Ihm war, als sei der Geist seines Vaters in ihn gefahren und hätte das übervolle Gefäß seines Herzens so gewaltsam aufgerührt, daß es zum Überfließen bereit war. So schien die ganze Familie noch einmal wieder vereinigt. Lucina that den Schatz in seine Hülle zurück, hing ihn an den Hals ihres Sohnes und sagte:
"Wenn er das nächste Mal feucht wird, so möge es durch ein edleres Naß sein, als das, welches den Augen eines schwachen Weibes entströmt!"
Aber der Himmel hatte es anders beschlossen. Und der künftige Vorkämpfer, der künftige Heilige wurde durch das Blut seines Vaters, welches sich mit den Thränen seiner Mutter vermischte, gesalbt und geweiht!
Viertes Kapitel
Der heidnische Haushalt
Während das, was wir in den letzten drei Kapiteln beschrieben haben, in dem christlichen Hause vor sich ging, spielten sich Scenen ganz anderer Art in einem Hause ab, welches in dem Thal zwischen dem Quirinal und den esquilinischen Hügeln lag. Dieses gehörte dem Fabius, einem Manne, dessen Familie dadurch Reichtümer angesammelt hatte, daß sie die Steuern der asiatischen Provinzen verwaltete. Sein Haus war größer und prächtiger, als dasjenige, welches wir bereits besucht haben. Es enthielt ein drittes großes Peristylium oder einen Hof, welcher von sehr großen Gemächern umgeben war; und außer vielen Schätzen europäischer Kunst waren auch noch die seltensten und kostbaren Erzeugnisse des Orients darin angehäuft. Teppiche aus Persien bedeckten den Boden, Seidenstoffe aus China, buntfarbige Gewebe aus Babylon und golddurchwirkte Stickereien aus Indien und Phrygien schmückten die Möbel, während seltsame Arbeiten aus Elfenbein und Metall von ungeheuerlichen Formen und fabelhafter Abstammung, welche überall umherstanden und lagen, den Einwohnern der Inseln jenseit des Indischen Oceans zugeschrieben wurden.
Fabius selbst, der Besitzer all dieser Schätze und großer Ländereien, war der echte Typus eines leichtlebigen Römers, entschlossen das irdische Leben gründlich zu genießen. In der That träumte er auch von keinem anderen. Er glaubte an nichts, aber als eine selbstverständliche Sache verehrte er bei jeder passenden Gelegenheit die Gottheit, welche gerade an der Reihe war, und so galt er als ein Mann, der nicht schlechter war als seine Nachbarn. Mehr von ihm zu verlangen hatte kein Mensch ein Recht. Den größten Teil des Tages brachte er in irgend einem der großen öffentlichen Bäder zu, welche außer dem Zweck, den ihr Name andeutet, in ihren vielen Abteilungen auch noch als Klubs, Lesezimmer, Spielräume, Fechthöfe und Ballspielhäuser dienten. Dort nahm er sein Bad, plauderte, las und vertändelte seine Zeit, oder er schlenderte auch ein wenig auf dem Forum umher, um einen Redner sprechen oder die Verteidigung eines Advokaten zu hören, oder er ging in einen der öffentlichen Gärten, wohin sich die vornehme Welt von Rom zu begeben pflegte. Dann kehrte er nach Hause zurück, um ein opulentes Nachtmahl einzunehmen, welches nicht später stattfand als heutzutage unser Mittagessen; an diesem nahmen täglich Gäste teil, welche entweder schon früher eingeladen oder von ihm selbst während des Tages zwischen den vielen Schmarotzern aufgelesen waren, welche stets Umschau nach guter Verpflegung hielten.
Zu Hause war er ein guter und nachsichtiger Gebieter. Eine Unzahl von Sklaven besorgten seinen Haushalt in der prächtigsten Weise, und da Mühe und Verdruß dasjenige war, was er am meisten fürchtete, so ließ er die Dinge unter der Leitung seiner Freigelassenen ruhig ihren Lauf nehmen, so lange alles um ihn her wohlgeordnet, vornehm und angenehm war.
Indessen ist er es nicht hauptsächlich, den wir unserem Leser vorzustellen wünschen, sondern eine andere Bewohnerin seines Hauses, die Teilnehmerin an all seiner Pracht und seinem großartigen Luxus, die einzige Erbin seines ungeheuren Reichtums. Es ist seine Tochter, welche nach römischer Sitte den Namen ihres Vaters trägt, der jedoch in das weibliche Fabiolaumgewandelt ist. Wie wir es zuvor gethan, wollen wir den Leser sofort auch in ihr Gemach führen. Eine Marmortreppe führt in dasselbe vom zweiten Hof aus, an dessen Seiten entlang sich eine Reihe von Zimmern zieht, die alle auf eine Terrasse hinausführen, welche durch einen prächtigen Springbrunnen geschmückt und von einer Menge erotischer Pflanzen und Blumen bedeckt ist. In diesen Gemächern ist alles zusammengetragen, was einheimische und fremde Kunst prächtiges und seltenes aufweisen kann. Ein raffinierter Geschmack, welcher über große Mittel und jede Gelegenheit verfügen kann, hat augenscheinlich die Erwerbung und Anordnung all der Gegenstände überwacht. In diesem Augenblick naht die Stunde der Abendmahlzeit, und wir entdecken die Herrin dieser prächtigen Behausung, wie sie sich vorbereitet, um mit der nötigen Pracht an derselben zu erscheinen.
Sie liegt in einem achteckigen Zimmer auf einem mit Silber eingelegten Ruhebett von atheniensischer Arbeit; die Fenster dieses Gemaches reichten bis auf den Fußboden und hatten somit einen Ausgang auf die blütenreiche Terrasse. Der jungen Gestalt gegenüber an der Wand hängt ein Spiegel von poliertem Silber, groß genug, um ihr ganzes Bild zurückzuwerfen; neben demselben auf einem Tische aus Porphyrstein befindet sich eine Sammlung all jener unzähligen seltenen Schönheitsmittel und Parfüms, welche den römischen Damen so lieb geworden waren und für welche sie ungeheure Summen ausgaben."Auf einem zweiten von indischem Sandelholz ist eine reiche Schaustellung von Juwelen und Schmuckgegenständen in ihren köstlichen Behältern, zwischen welchen die Auswahl für den Gebrauch des Abends getroffen werden soll.
Es ist weder unsere Absicht noch unser Talent, Personen oder Gesichtszüge zu beschreiben; wir haben es mehr mit dem Charakter und der Seele zu thun. Wir wollen uns deshalb darauf beschränken zu sagen, daß Fabiola, welche jetzt zwanzig Jahre alt war, nicht für weniger schön galt als andere Damen ihres Ranges, Alters und Vermögens, und daß sie viele Freier hatte. Aber in Laune und Charakter war sie der vollkommene Gegensatz ihres Vaters. Stolz, hochmütig, herrschsüchtig und heftig, herrschte sie mit einer oder zwei Ausnahmen wie eine Kaiserin über ihre Umgebung, und verlangte demütige Huldigung von allen, welche sich ihr näherten. Ein einziges Kind, dessen Mutter gestorben war, indem sie ihr das Leben gab, war sie von ihrem gutmütigen, sorglosen Vater mit der größten Nachsicht gepflegt und erzogen worden; er hatte ihr die besten Lehrer gegeben, jedes Talent war auf das sorgsamste kultiviert worden, und man hatte ihr stets jeden, selbst den extravagantesten Wunsch erfüllt. Sie hatte niemals erfahren, was die Nichterfüllung eines Wunsches bedeutet.
Da sie so viel sich selbst überlassen gewesen, hatte sie viel gelesen und ganz besonders ernste Bücher. Auf diese Weise war sie eine vollkommene Philosophin des Raffinements geworden, das heißt des ungläubigen und intellektuellen Epicurismus, welcher schon seit langer Zeit in Rom Mode war. Vom Christentum wußte sie nur, daß es etwas sehr niedriges, materielles und gemeines sei. Sie verachtete es in der That so sehr, daß sie gar nicht daran dachte, weiter in dasselbe einzudringen. Und was das Heidentum mit seinen Göttern, seinen Lastern, seinen Fabeln und seinem Götzendienst anging, so verspottete sie es einfach, obgleich sie ihm äußerlich anhing. In der That, sie glaubte an nichts, als an das gegenwärtige Leben und dachte an nichts, als an den raffinierten Genuß desselben. Jedoch gerade ihr Stolz war der Schild ihrer Tugend; sie verabscheute die Schlechtigkeit der heidnischen Gesellschaft, wie sie die frivolen Jünglinge verachtete, welche ihr die von ihr eifersüchtig geforderten Aufmerksamkeiten erwiesen, weil sie sich an ihren Thorheiten ergötzte. Sie galt für selbstsüchtig und kalt, aber ihre Moral war fleckenlos.
Wenn es scheint, daß wir uns im Anfang in zu langen Beschreibungen ergingen, so hoffen wir, daß unser Leser sie für unumgänglich notwendig halten wird, um ihn in Kenntnis zu setzen von den socialen Zuständen Roms, wie sie zur Zeit unserer Erzählung waren. Diese Auseinandersetzungen werden nur dazu dienen, um ihm alles zu verdeutlichen. Und wenn er versucht sein sollte zu glauben, daß wir Dinge zu prächtig und verfeinert schildern für das Zeitalter des Verfalls der schönen Künste und des guten Geschmacks, so bitten wir ihn, sich daran zu erinnern, daß jenes Jahr, in welchem wir Rom unsern Besuch abstatten, nicht so entfernt war von der besseren Periode der römischen Kunst, z. B. von jener des Antonius, als unser Zeitalter es von dem des Cellini, Rafael oder Donatello ist. Und doch, in wie vielen italienischen Palästen werden noch Gemälde dieser großen Künstler aufbewahrt, hoch geschätzt, wenn sie auch längst keine Nachahmer mehr finden! Und so war es ohne Zweifel auch mit den Häusern, welche den alten reichen Familien Roms gehörten.
Wir finden also Fabiola auf ihrem Ruhebette lehnend, in ihrer linken Hand einen silbernen Spiegel mit einem Griffe und in der rechten ein Instrument, welches sich in einer so zarten Hand gar seltsam ausnimmt. Es ist ein scharf gespitztes Stilett, mit einem fein geschnitzten Elfenbeingriff und einem goldenen Ringe, um es daran aufzuhängen. Dies war die beliebte Waffe, mit welcher römische Damen ihre Sklavinnen zu bestrafen pflegten, oder ihren Zorn, wenn sie den geringsten Ärger empfanden oder sich von ihnen gereizt glaubten, an ihnen vergalten. Drei Sklavinnen sind jetzt um ihre Herrin beschäftigt. Sie gehören verschiedenen Rassen an und sind zu hohen Preisen gekauft worden, nicht nur um ihrer äußeren Erscheinung willen, sondern wegen irgend einer seltenen Fertigkeit, welche sie besitzen sollen. Eine ist eine Schwarze; nicht von jener verachteten Negerrasse, sondern von einem jener Stämme, wie die Abyssinier und Nubier, deren Gesichtszüge eben so regelmäßig sind wie die der asiatischen Völker. Sie soll große Kenntnisse der Kräuter und ihrer kosmetischen und heilenden Eigenschaften besitzen, vielleicht auch ihrer gefährlicheren Wirkungen – möglicherweise versteht sie etwas von Zaubertränken, giftigen Tropfen und – Hexerei. Man kennt sie nur unter ihrer nationalen Bezeichnung als Afra. Eine Griechin ist die nächste; sie wurde gekauft um ihrer Erfahrung willen, welche sie in Bezug auf Eleganz der Kleidung hatte und wegen ihrer schönen, reinen Sprache. Man nennt sie daher Graca. Der Name, welchen die dritte trägt, Syra, sagt uns, daß sie aus Asien kommt; sie zeichnet sich durch ihre prächtigen Stickereien und ihren unermüdlichen Fleiß aus. Sie ist ruhig, schweigsam, aber vollständig von den Pflichten in Anspruch genommen, welche ihr jetzt obliegen. Die andern beiden sind geschwätzig, leichtlebig und machen viel Worte bei allem, was sie thun. Jeden Augenblick sagen sie ihrer jungen Herrin die extravagantesten Schmeicheleien oder versuchen es, der Werbung des einen oder andern Bewerbers ihrer Hand das Wort zu reden, je nachdem sie zuletzt oder am höchsten bestochen worden sind.
"Wie glücklich würde ich mich schätzen, edelste Herrin," sagte die schwarze Sklavin, "könnte ich nur im tricliniumsein, wenn du heute Abend eintrittst, um den prächtigen Eindruck zu gewahren, welchen dieses neue Antimonauf deine Gäste machen wird! Es hat mich manchen Versuch gekostet, bevor ich es so vollkommen herstellen konnte. Ich bin überzeugt, daß man in Rom nichts ähnliches gesehen hat."
"Was mich anbetrifft," unterbrach sie die fröhliche Griechin, "so würde es mir nicht einfallen, nur eine so hohe Ehre zu erwünschen. Ich wäre zufrieden, wenn ich durch die Thür blicken dürfte, um den Eindruck dieser wundervollen seidenen Tunika zu beobachten, welche zusammen mit der letzten Goldsendung aus Asien kam. Nichts kommt ihrer Schönheit gleich, Und ich darf auch wohl hinzufügen, daß die Art der Verwendung – das Resultat meines mühevollen Studiums – des Stoffes nicht unwert ist."
"Und du, Syra," fiel hier die Herrin mit verächtlichem Lächeln ein, "was würdest du wünschen? Und was hast du von deinem Machwerk zu rühmen?"
"Ich wünsche nichts, edle Herrin, als daß du immer glücklich sein mögest; von meinem eignen Machwerk habe ich nichts zu rühmen, denn ich bin mir nicht bewußt, mehr als meine Pflicht gethan zu haben," lautete die bescheidene und aufrichtige Entgegnung.
Diese gefiel jedoch der hochmütigen Gebieterin nicht und sie sagte: "Mir scheint, Sklavin, daß es nicht allzu sehr deine Gewohnheit ist zu loben. Man hört nur selten ein zartes Wort von deinen Lippen."
"Und welchen Wert würde es auch haben, wenn es von mir käme," entgegnete Syra, "von einer armen Dienerin einer edlen Dame gegenüber, welche daran gewöhnt ist, den ganzen Tag hindurch zarte Worte von beredten und vornehmen Lippen zu hören? Glaubst du an sie, wenn du sie von ihnen hörst? Verachtest du sie nicht, o Herrin, wenn sie dir von uns kommen?"
Ihre beiden Gefährtinnen, warfen ihr zornige Blicke zu. Auch Fabiola war erzürnt über das, was sie für einen Tadel hielt. Eine erhabene Empfindung in einer Sklavin!
"Hast du denn noch immer nicht gelernt," entgegnete sie hochmütig, "daß du mein Eigentum bist und daß ich dich zu hohem Preise erstanden habe, damit du mir nach meinem Gefallen dienst? Und ich habe ein ebenso gutes Anrecht auf den Dienst deiner Zunge als auf den deiner Arme; und wenn es mir gefallt, mich von dir loben und preisen und anbeten zu lassen, so sollst du es thun, ob du nun willst oder nicht. Eine neue Idee in der That, daß eine Sklavin einen anderen Willen kennt als den ihrer Gebieterin, wenn diese sogar über das Leben der Niedriggeborenen zu verfügen hat!"
"Es ist wahr," erwiderte die Magd ruhig, aber mit Würde, "mein Leben gehört dir, Herrin, und ebenso gehört dir alles andere, das mit dem Leben endet – Zeit, Gesundheit, Kraft, Leib und Atem. Alles dies hast du mit deinem Golde erkauft und es ist dein Eigentum geworden. Aber mein eigen bleibt noch, was nicht der Reichtum eines Königs erkaufen kann – keine Sklavenketten fesseln können – was auch nicht die Grenze des Lebens beenden kann!" "Und was ist das?"
"Eine Seele!"
"Eine Seele!" wiederholte Fabiola erstaunt, denn sie hatte noch niemals gehört, daß eine Sklavin sich die Eigentümerin eines solchen Besitztums genannt hätte. "Und darf ich dich fragen, was du eigentlich mit dem Worte sagen willst?"
"Ich verstehe mich nicht auf philosophische Sentenzen," antwortete die Dienerin, "aber ich meine jenes in mir lebende Bewußtsein, welches mich empfinden läßt, daß ich ein Dasein mit und zwischen besseren Dingen führen werde als jene sind, welche mich umgeben, welches bewußt vor der Zerstörung und instinktiv vor allem znrückschreckt, was damit verbunden ist, wie die Krankheit es mit dem Tode ist. Und deshalb verabscheut es jede Schmeichelei und es verabscheut die Lüge! So lange ich jene unsichtbare Gabe besitze, die nicht sterben kann, so lange ist es mir unmöglich zu lügen und zu schmeicheln."
Von all diesem verstanden die andern beiden nur wenig. Sie standen in stummem Erstaunen da über die Dreistigkeit ihrer Gefährtin. Auch Fabiola war erschrocken, aber bald bäumte ihr Stolz sich wieder empor und sie sprach mit sichtbarer Ungeduld.
"Wo hast du all diese Thorheiten gelernt? Wer hat dich gelehrt, auf diese Weise zu schwatzen? Ich meinerseits habe seit vielen Jahren studiert und bin zu dem Schlusse gekommen, daß alle Ideen eines geistigen Weiterlebens nur Träume der Poeten oder Sophisten sind. Und als solche verachte ich sie. Und willst du, eine arme, unwissende, unerzogene Sklavin dies besser wissen als deine Gebieterin? Oder glaubst du wirklich, daß wenn nach dem Tode dein Körper auf den Haufen von Sklaven geworfen wird, welche sich ertränkt haben oder zu Tode gepeitscht sind, um mit dieser elenden Masse auf einen: Holzstoß verbrannt zu werden, und wenn diese Asche in eine Grube geworfen worden, du sie als ein selbstbewußtes Wesen überleben und ein anderes Leben voll Freude und Freiheit durchleben wirst?"
" Non omnis moriar,wie einer eurer Dichter sagt," erwiderte die fremde Sklavin bescheiden aber mit einem inbrünstigen Blick, welcher ihre Herrin in Erstaunen setzte, "ja, ich hoffe, nein, ich will dies alles überleben. Und noch mehr; ich glaube, ich weiß, daß es eine Hand giebt, welche auch das kleinste verkohlte Überbleibsel meines Körpers aus jener Leichengrube, welche du so lebhaft beschrieben hast, hervorziehen wird. Und es giebt eine Macht, welche alle Himmelswinde zur Rechenschaft ziehen und sie zwingen jedes Atom meines Staubes, welchen sie zerstieben gemacht haben, zurück zu geben. Dann werde ich noch einmal wieder sein wie ich jetzt bin, nicht als deine oder irgend eines Menschen Sklavin, sondern frei und freudig und glückselig, liebend und geliebt für immer. Diese bestimmte Hoffnung trage ich in meiner Brust!"
"Was für wilde Ausgeburten einer orientalischen Phantaste, die dich unfähig machen, deine Pflichten zu erfüllen? Davon mußt du geheilt werden. In welcher Schule hast du all diesen Unsinn gelernt? In griechischen oder lateinischen Büchern habe ich niemals davon gelesen."
"In einer, welche meinem Heimatlande angehört; eine Schule, in welcher man keinen Unterschied zwischen Griechen und Barbaren, Freien oder Sklaven kennt oder erlaubt."
"Was!" rief die stolze Dame in heftiger Erregung aus, "ohne einmal auf das künftige, ideale Dasein nach dem Tode zu warten! Schon jetzt nimmst du dir heraus, dich für meinesgleichen zu erachten? Nein, vielleicht sogar als etwas besseres als ich bin! Komm, sag mir doch ohne Umschweif und ohne Rückhalt und Verstellung, ob du das thust oder nicht? Und sie richtete sich auf in einer Stellung gespannter Erwartung. Mit jedem Worte der ruhigen Entgegnung wuchs ihre Erregung; und heftige Leidenschaften schienen in ihr zu kämpfen, als Syra sagte:
"O edle Herrin, weit überlegen bist du mir an Stellung und Macht und Gelehrsamkeit und Klugheit und an allem, was das Leben verschönert und bereichert; und an jeder Anmut der Form und der Züge, an jedem Reiz des Handelns und der Sprache; hoch erhaben stehst du über jedem neidischen Gedanken, jeder Rivalität. Wie könnte eine, die so niedrig ist wie ich, an dich heranreichen! Wenn ich aber die reine Wahrheit auf deine befehlende Frage sprechen soll" – hier versagte ihr die Sprache und sie hielt inne, bis eine herrische Bewegung ihrer Gebieterin sie wieder sprechen machte, "so überlasse ich es deinem eigenen Urteil, ob eine arme Sklavin, welche das unumstößliche Bewußtsein hegt, in sich ein geistiges Wesen zu tragen, dessen Daseinsmaß die Unsterblichkeit ist, deren einzige wahre Wohnung im Himmel ist, deren einziges gerechtes Vorbild die Gottheit ist – ob diese arme Sklavin sich an moralischer Würde, an Erhabenheit des Denkens für geringer halten kann als eine Dame, welche, wie begabt sie auch sein mag, kein köstlicheres Schicksal verlangt, kein höheres Ziel und Ende anerkennt als jenes, welche jene schön gefiederten, unvernünftigen Sänger anerkennen, welche ohne Hoffnung auf Freiheit, mit den Flügeln gegen die vergoldeten Stäbe ihres Käfigs schlagen."
Fabiolas Augen funkelten vor Wut; zum erstenmal in ihrem Leben fühlte sie sich getadelt, gedemütigt – von einer Sklavin. Sie griff mit ihrer rechten Hand nach ihrem Stilett und machte einen fast blinden Stoß nach der unerschütterlichen Dienerin. Syra, um ihren Körper zu schützen, hielt instinktiv den Arm empor und empfing den Stich, welcher von dem Ruhebett nach aufwärts geführt, eine tiefere Verwundung verursachte, als sie jemals zuvor erlitten hatte. Der Schmerz der Wunde, aus welcher das Blut in Strömen floß, trieb ihr die Thränen in die Augen. Fabiola schämte sich augenblicklich ihrer grausamen, obgleich unbeabsichtigten That und fühlte sich vor ihren Dienerinnen noch mehr gedemütigt.
"Geh, geh," sagte sie zu Syra, welche mit ihrem Tuche das hervorquellende Blut zu stillen suchte, "geh zu Euphrosyne und laß sie die Wunde verbinden. Ich hatte nicht die Absicht, dich so ernstlich zu verletzen. Aber wart einen Augenblick, ich muß dir eine Entschädigung geben."
Nachdem sie zwischen den Schmuckgegenständen auf dem Tische umhergesucht hatte, fuhr sie fort:
"Nimm diesen Ring, und heute Abend werde ich dich nicht mehr brauchen."
Hiermit war Fabiolas Gewissen vollständig beruhigt; für die Verletzung, welche sie der Dienerin zugefügt, hatte sie ihrer eigenen Ansicht nach vollständige Genugthuung geleistet, indem sie einer niederen Sklavin ein kostbares Geschenk machte.
Am folgenden Sonntage wurde in der Kirche oder dem Titel Sankt Pastor, nicht weit von ihrem Hause, unter den Almosen, welche für die Armen gesammelt wurden, ein kostbarer Smaragdring gefunden, von dem der fromme Priester Polycarp glaubte, daß er von einer sehr reichen, wohlthätigen Römerin gespendet sein müsse. Aber Er allein, der mit strahlendem Auge auf den Opferstock Jerusalems herabblickt und auch das Scherflein der Witwe bemerkt, sah, wie der verwundete Arm einer fremden Sklavin den Ring in die Opferlade fallen ließ.
Fünftes Kapitel
Der Besuch
Während des letzten Teils des soeben wiederholten Dialogs und der Katastrophe, welche ihm ein Ende machte, trat eine Erscheinung in Fabiolas Zimmer, welche, wenn diese sie erblickt hätte, dem ersteren wahrscheinlich ein Ende gemacht und letztere verhütet haben würde. Die inneren Gemächer des römischen Hauses waren häufiger durch Vorhänge an den Thüröffnungen abgeschlossen als durch Thüren, und daher war es leicht, besonders während einer so erregten Scene wie die oben geschilderte, unbemerkt einzutreten. Dies war auch jetzt der Fall, und als Syra sich umwandte, um das Zimmer zu verlassen, erschrak sie fast, als sie von dem purpurroten Hintergrunde des Thürvorhangs sich eine lichte Gestalt abheben sah, welche sie augenblicklich erkannte, die wir aber kurz beschreiben müssen.
Es war die einer Jungfrau oder eigentlich eines Kindes, das nicht mehr als zwölf oder dreizehn Jahre zählte, in reines, fleckenloses Weiß gekleidet, ohne einen einzigen Schmuckgegenstand.
In ihrem Antlitz vereinigte sie die Unbefangenheit und Reinheit der Kindheit mit dem Verstande des reiferen Alters. In ihren Augen lag nicht nur die taubengleiche Unschuld, welche der heilige Dichter beschreibt,sondern oft strahlten sie auch in so reiner Liebe, als blickten sie über alles, was sie umgab, fort, und ruhten auf Einem, der von allen anderen ungesehen, nur ihr gegenwärtig und ihrem Herzen unendlich teuer war. Auf ihrer Stirn thronte die Wahrheit und Aufrichtigkeit; ein gütiges Lächeln umspielte ihre Lippen, und auf den frischen jugendlichen Zügen wechselte der Ausdruck tiefer Empfindung mit arglosem Ernst; jedes Gefühl spiegelte sich eben so schnell auf ihrem Antlitz ab, wie ihr warmes und zärtliches Herz es empfand. Diejenigen, welche sie kannten, hegten die Überzeugung, daß sie niemals an sich selbst dachte, sondern sich vollständig zwischen der Güte und Fürsorge für ihre Umgebung und der Hingebung für ihre unsichtbare Liebe teilte.
Als Syra diese wunderliebliche Erscheinung erblickte, welche einem Engel gleich vor ihr stand, hielt sie einen Augenblick inne. Aber das Kind ergriff ihre Hand und sagte, indem sie sie ehrerbietig küßte: "Ich habe alles gesehen; warte auf mich in dem kleinen Zimmer am Eingange, wenn ich fort gehe, komme ich zu dir."
Dann trat sie näher. Als Fabiola ihrer ansichtig wurde, bedeckte ein tiefes Rot ihre Wangen, denn sie fürchtete, daß das Kind Zeuge des unwürdigen Ausbruches ihrer Leidenschaften gewesen sein könne. Mit einer hochmütigen Handbewegung entließ sie ihre Dienerinnen und begrüßte dann ihre Verwandte – denn das war sie – mit herzlicher Freundlichkeit. Wir haben schon gesagt, daß Fabiola in ihrer hochfahrenden Laune dennoch einige Ausnahmen machte. Eine derselben war ihre alte Amme und Freigelassene Euphrosyne, welche ihren ganzen Privathaushalt führte und deren ganzes Glaubensbekenntnis dahin lautete, daß Fabiola das vollkommenste Wesen der Schöpfung, die klügste, die schönste, die bewunderungswürdigste Dame in Rom sei.
Die zweite Ausnahme bildete ihre junge Besucherin, welche sie liebte und stets mit der zartesten Hingebung behandelte, deren Gesellschaft sie unaufhörlich begehrte.
"Es ist wirklich gütig von dir, Agnes," sagte die schnell besänftigte Fabiola, "meiner plötzlichen Einladung, uns bei der heutigen Abendtafel Gesellschaft zu leisten, so schnell Folge zu leisten. Die Sache ist aber die, daß mein Vater einen oder zwei Fremde eingeladen hat, und ich dringend wünschte, eine Person hier zu haben, mit der ich unter dem Vorwande, daß es meine Pflicht sei, sie zu unterhalten, ungestört sprechen könnte. Ich gestehe indessen, daß ich in Bezug auf den einen unserer Gäste ein wenig Neugierde hege. Es ist Fulvius, von dessen Liebenswürdigkeit, Anmut, Reichtum und Klugheit ich so viel höre, obgleich niemand zu wissen scheint, wer und was er ist, oder woher er so plötzlich gekommen ist."
"Meine teure Fabiola," antwortete Agnes, "du weißt, daß ich stets glücklich bin, dich zu besuchen, und daß meine gütigen Eltern mir es auch gern gestatten; deshalb mach keine Entschuldigungen über diesen Punkt."
"Und so bist du denn wieder wie gewöhnlich zu mir gekommen," sagte die andere scherzhaft, "in deinem eigentümlichen schneeweißen Gewande, ohne Edelsteine, ohne Schmuck, grade als wenn du täglich eine Braut wärst. Du scheinst eine ewige Hochzeit zu feiern. Aber gütiger Himmel! Was ist das? Hast du dich verletzt? Oder weißt du nicht, daß mitten auf deiner Tunika, grade an der Stelle des Herzens sich ein großer roter Fleck befindet? – Es sieht aus wie Blut. Wenn dem so ist, so laß mich dir sofort einen anderen Überwurf geben."
"Nicht um alle Schätze der Welt; es ist der Edelstein, der einzige Schmuck den ich heute Abend zu tragen gedenke. Es ist Blut, und zwar das einer Sklavin; in meinen Augen aber edler und hochherziger als das, welches in deinen und meinen Adern fließt!"
Fabiola erfaßte sofort die ganze Wahrheit. Agnes hatte alles gesehen; und über alle Begriffe gedemütigt, sagte sie schnippisch: "Du willst also vor aller Welt einen Beweis meiner Laune und Heftigkeit zur Schau tragen, nur weil ich mich hinreißen ließ, eine übermütige Sklavin etwas zu strenge zu strafen?"
"Nein, teure Cousine, weit entfernt davon. Ich will nur mir selbst eine Lehre der Charakterfestigkeit und Hochherzigkeit bewahren, welche eine Sklavin mir gegeben hat. Sie ist erhabener als manche, die ein patrizischer Philosoph uns geben kann."
"Welch seltsamer Gedanke, Agnes! In der That, es hat mich oft bedünkt, daß du zu viel aus dieser Klasse von Leuten machst. Schließlich – was sind sie denn eigentlich?"
"Menschliche Geschöpfe so gut wie wir selbst, mit derselben Vernunft, denselben Gefühlen, dem gleichen Organismus begabt. Das wirst du mir doch zugeben müssen. Dann bilden sie einen Teil derselben Familie, und wenn Gott, von dem wir unser Leben haben, dadurch unser Vater ist, so ist Er der ihre ebensogut, und folglich sind sie unsere Brüder."
"Ein Sklave mein Bruder oder eine Sklavin meine Schwester! Agnes! Die Götter mögen mich davor bewahren! Sie sind unser Gut und unser Eigentum, und ich kenne nichts anderes, als daß es ihnen gestattet ist, sich zu bewegen, zu handeln, zu denken und zu fühlen, wie ihre Herren es befehlen, oder wie es deren Vorteil ist."
"Komm, komm, Fabiola," sagte Agnes in ihrer süßesten Weise, "laß uns nicht in einen Wortkampf geraten. Du bist zu wahr und zu hochherzig, um nicht zu fühlen und anzuerkennen, daß du heute in allem, was du am meisten bewundern mußt, von einer Sklavin übertroffen worden bist – in Gemüt, in Vernunft, in Wahrhaftigkeit und in heldenmütiger Stärke! Antworte mir nicht; in jener Thräne sehe ich deine Antwort. Aber, teure Cousine, ich will dir eine Wiederholung deines Kummers ersparen. Willst du mir meine Bitte gewähren?"
"Jede, welche zu gewähren in meiner Macht liegt."
"So gestatte mir denn, Syra zu kaufen – nicht, wahr, Syra ist ihr Name. Es wird dir nicht lieb sein, sie um dich zu sehen."
"Du irrst, Agnes. Ich will dies eine Mal meinen Stolz besiegen, und ich gestehe dir, daß ich sie jetzt achten, vielleicht sie sogar bewundern werde. Es ist dies ein neues Gefühl, welches ich für ein Wesen in ihrer Stellung hege."
"Aber ich glaube, Fabiola, daß ich sie glücklicher machen könnte, als sie es jetzt ist."





























