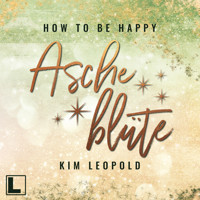1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carlsen
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
**Der Sommer deines Lebens** Lorraine kann an einer Hand abzählen, wie oft sie ihre Heimatstadt Straßburg bisher verlassen hat. Sie umgibt sich lieber mit ihren Büchern und sammelt besondere Worte, anstatt in der echten Welt Abenteuer zu erleben. Daher hätte sie sich niemals träumen lassen, im Sommer nach ihrem Abschluss mit einem ihr nahezu Fremden in ihrem fliederfarbenen Citroën Richtung Côte d'Azur zu fahren. Doch als sie dem leidenschaftlichen Tänzer Faisal begegnet, dessen durchdringender, meerblauer Blick ihre Knie weich werden lässt, scheint Lorraine plötzlich alles möglich zu sein… //Textauszug: »Basorexia schreibe ich auf den Zettel und schiebe ihn zu Alita, die mit zusammengekniffenen Augenbrauen versucht, die Buchstaben zu entziffern. Schließlich schaut sie mich fragend an. Ich ziehe das Stück Papier zurück und schreibe daneben: das überwältigende Verlangen, jemanden zu küssen. Sie liest meine Erklärung und nickt anerkennend. Das ist ein gutes Wort und die Definition dafür ist noch besser.«// //»Faith in you. Das Lächeln unserer Herzen« ist ein in sich abgeschlossener Einzelband.//
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Kim Leopold
Faith in you. Das Lächeln unserer Herzen
**Der Sommer deines Lebens** Lorraine kann an einer Hand abzählen, wie oft sie ihre Heimatstadt Straßburg bisher verlassen hat. Sie umgibt sich lieber mit ihren Büchern und sammelt besondere Worte, anstatt in der echten Welt Abenteuer zu erleben. Daher hätte sie sich niemals träumen lassen, im Sommer nach ihrem Abschluss mit einem ihr nahezu Fremden in ihrem fliederfarbenen Citroën Richtung Côte d’Azur zu fahren. Doch als sie dem leidenschaftlichen Tänzer Faisal begegnet, dessen durchdringender, meerblauer Blick ihre Knie weich werden lässt, scheint Lorraine plötzlich alles möglich zu sein …
Wohin soll es gehen?
Buch lesen
Vita
Playlist
Das könnte dir auch gefallen
© Maik Bruns
Kim Leopold wurde 1992 geboren und lebt derzeit mit ihrem Mann im schönen Münsterland. Schreiben und Reisen gehören zu ihren Hobbies, die sie gerne verbindet, indem sie ihre Handlung an Orten spielen lässt, die sie schon besucht hat. Wenn sie nicht gerade an ihren eigenen Geschichten schreibt, gestaltet sie Buchcover oder liest die Bücher ihrer Kollegen – immer mit dabei: ein heißer Tee und ihr Kater Filou.
Träume, als würdest du ewig leben.
Lebe, als würdest du morgen sterben.
James Dean
Playlist
Drive – Oh Wonder
Written in the Water – Gin Wigmore
Lonely with me – Parachute
La vie en rose – Édith Piaf
After Rain – Dermot Kennedy
Hard Love (feat. Andra Day) – NEEDTOBREATHE
Kill the Beast – Go Radio
Wonderland (intro) – Jasmine Thompson
Pas besoin de permis – Vanessa Paradis
Living Louder – The Cab
Swim Good – Dermot Kennedy
La La – The Cab
Close the Distance – Go Radio
Live, Learn, Let Go – Go Radio
La même – Maître Gims, Vianney
Fire – Pvris
Fight, Fight (Reach for the Sky) – Go Radio
I Could Never – Ed Prosek
Replaced – American Authors
Too Late for Lullabies – James Morrison
Young & Free – Dermot Kennedy
Prolog
Genau drei Mal habe ich Straßburg in den letzten achtzehn Jahren verlassen.
An das erste Mal kann ich mich nicht erinnern. Das war kurz nach meiner Geburt, als meine Mutter das Fernweh packte und mein Papa kurzerhand unseren alten, gelben Citroën belud, um uns damit nach Paris zu bringen. Maman hat Paris geliebt. Auf den verstaubten Fotos trägt sie einen lila Regenmantel und ein breites Grinsen im Gesicht, das längst erloschen ist.
Beim zweiten Mal war ich fünf Jahre alt, hatte eine Zahnlücke, weil mir gerade ein Milchzahn ausgefallen war, und liebte meine roten Gummistiefel so sehr, dass ich sie sogar in unserem Sommer an der Côte d’Azur getragen habe. Auch dieses Mal hat uns das gelbe Auto begleitet, nur um auf der Rückfahrt ein für alle Mal den Geist aufzugeben.
Erst als ich sieben wurde, hatte Papa genug Arbeit, damit wir uns einen weiteren Sommer an der Küste leisten konnten. Wir fuhren glücklich hin, doch als wir am Ende des Sommers zurückkehrten, war nichts mehr so, wie es einmal gewesen war.
Ein Raum ohne Bücher ist wie ein Körper ohne Seele
Lorraine
Basorexia schreibe ich auf den Zettel und schiebe ihn zu Alita, die mit zusammengekniffenen Augenbrauen versucht, die Buchstaben zu entziffern. Schließlich schaut sie mich fragend an. Ich ziehe das Stück Papier zurück und schreibe daneben: das überwältigende Verlangen, jemanden zu küssen.
Sie liest meine Erklärung und nickt anerkennend. Ihre Kringellocken wippen dabei in alle Richtungen. Das ist ein gutes Wort und die Definition dafür ist noch besser.
»Hast du das jemals gespürt?«, wispert sie in mein Ohr und schon ist unser kleiner Wettbewerb vergessen. Ich blicke zu Matthieu.
Matthieu war der erste Junge, der mich geküsst hat. Das war, bevor unsere Klasse gemerkt hat, dass Alita und ich die Freaks sind. Aber Basorexia habe ich bei ihm nicht gefühlt, eher Ekel, weil seine Lippen so schlabbrig waren.
Eine Antwort bleibt mir vorerst erspart, weil Madame Albret sich mehrfach laut räuspert, um die Aufmerksamkeit ihrer Schüler auf sich zu ziehen. Alita und ich sind die einzigen, die sofort reagieren – der Rest der Klasse ist immer noch damit beschäftigt, sich lauthals über das Abschlussfrühstück herzumachen.
Manchmal verstehe ich nicht, wie zwanzig Schüler so viel Lärm machen können. Das muss daran liegen, dass sie sonst immer lautstark mit Kopfhörern Musik hören und ihre Trommelfelle schon so sehr beschädigt sind, dass sie einander kaum noch ohne Hörgeräte verstehen.
Der Gedanke an Matthieu oder Bernadette mit einem Hörgerät bringt mich zum Grinsen. Für all die Schikanen in den letzten Monaten hätten sie es fast verdient.
Madame Albret ist endlich zufrieden mit dem Lärmpegel in ihrem Klassenraum und streicht sich die wilden Haare hinter die Ohren. Sie trägt eine graue Bluse mit Schweißflecken unter den Achseln und Tinte auf dem Bauch.
»Wollt ihr eure vorläufigen Zeugnisse?« Ihre Stimme ist selbst nach einem Jahr in unserer Klasse unsicher und leise. Ihr ist wohl immer noch nicht aufgegangen, dass die Leute freundlicher zu ihr wären, wenn sie mehr Selbstsicherheit an den Tag legen würde.
Aber was weiß ich schon? Immerhin sind sie zu mir genauso gemein.
Madame Albret nimmt die Zeugnisse aus dem vergilbten Umschlag und beginnt sie zu verteilen. Dass ihr dabei keiner ein Bein stellt, ist ungewöhnlich. Aber heute sind wohl schon alle mit ihren Gedanken bei der Abschlussfeier in zwei Wochen oder in den Sommerferien – wer weiß das schon.
Mein eigenes Zeugnis ist in Ordnung. Meine Noten sind nicht zu gut, nicht zu schlecht – sie bewegen sich in diesem Bereich in der Mitte, der niemandem Anlass geben kann, sich darüber lustig zu machen. Ich weiß, ich hätte besser sein können, wenn ich mich häufiger gemeldet hätte. Aber selbst mit diesen Noten sollte ein Platz an einer Universität nicht unmöglich sein.
»Zeig mal her.« Alita zieht mein Zeugnis zu sich und hält mir ihr eigenes hin. Neugierig schlage ich es auf. Fast überall Bestnoten. Meine einzige und somit wohl beste Schulfreundin war offenbar unterfordert mit dem Unterrichtsstoff. Das Jura-Studium wird ihr jedenfalls keine Probleme bereiten.
»Wahnsinn«, murmle ich und lege das Blatt Papier vor uns auf den Tisch. »Ich werde dich vermissen, wenn du an der Elite-Uni bist und keine Zeit mehr für mich hast.«
Alita grinst und entblößt eine große Zahnlücke zwischen ihren strahlend weißen Frontzähnen, die im starken Kontrast zu ihrer Kaffeehaut stehen. Sie beugt sich zu mir. »Zwischen all den intelligenten Leuten gibt es hoffentlich nicht so viele Idioten.«
Ich lache leise auf, stecke mein Zeugnis in den Umschlag und den Umschlag in meinen Lieblingsbeutel. Bücher machen aus Muggeln Zauberer steht auf einer Seite und erinnert mich daran, dass zu Hause der dritte Harry-Potter-Band auf ein Reread wartet.
Madame Albret verabschiedet uns bis zur Abschlussfeier, doch kurz bevor wir gehen wollen, erhebt sich Bernadette, um eine kurze Ansprache zu halten. »Wir wollen mit der ganzen Klasse noch ein Eis essen gehen«, erklärt sie. Ihr Blick eine unausgesprochene Drohung. »Wir würden uns freuen, wenn alle mitkommen.«
Zustimmendes Gemurmel erfüllt den Raum. Alita wirft mir eine stille Frage zu. Sollen wir?
Ich schüttle den Kopf, kurz und ruckartig, in der Hoffnung, dass Bernadette es nicht sieht.
»Alita? Lorraine?«, fragt sie übertrieben freundlich. »Seid ihr auch dabei?«
Alita stopft ihre Sachen in ihre Tasche, um sich nicht mit der Reaktion der anderen auseinanderzusetzen. Das überlässt sie lieber mir.
»Lorraine?« Bernadette hebt eine Braue und stützt ihre Hände auf die Hüftknochen. Meine Gedanken überschlagen sich, während sich sämtliche Blicke erwartungsvoll auf mich richten. Nervös schiebe ich meine Brille mit der Fingerspitze hoch. Alita rempelt mich an, weil ich nicht reagiere.
»Nein«, stottere ich schließlich. »Ich kann nicht … Meine Eltern warten.«
Selbst in meinen Ohren klingt das verdammt nach Loser.
»Alita?«, fragt Bernadette ungeduldig.
»Ne, lass mal«, erwidert Alita schnippisch und wendet sich ab. Ohne mich würde sie nie im Leben mitgehen.
Bernadette schnaubt auf und greift nach ihrer Tasche. Damit ist die Stunde beendet und alle packen ihre Sachen zusammen, um ihr und Matthieu zur Eisdiele zu folgen. Auch wenn ich versuche nicht hinzuhören, nehme ich trotzdem Worte wie Langweiler und Versager wahr.
Alita wirft sich ihren grünen Rucksack über eine Schulter und macht sich auf den Weg zur Tür. Wir gehören zu den Letzten.
»Warte auf mich.« Ich beeile mich meine restlichen Sachen einzupacken und folge ihr. Auf dem Gang hole ich sie wieder ein. »Was ist denn los?«
Sie bleibt stehen und schaut mich wütend an. Sie ist fast zwei Köpfe kleiner als ich, deswegen fällt es mir manchmal schwer, ihre Wut ernst zu nehmen. Aber heute sorgt das zornige Funkeln in ihren Augen dafür, dass mir das Lachen vergeht.
»Wir hätten echt mitgehen können. Es ist doch der letzte Schultag. Außerdem: deine Eltern warten? Was Uncooleres konnte dir nicht einfallen?«
»Du weißt doch, wie sie sind«, werfe ich gequält ein. »Außerdem hättest du ja auch allein mitgehen können.«
»Darum geht’s doch gar nicht. Dass du nicht zur Abschlussfeier kommen kannst, okay – aber nicht mal Eis essen?« Sie schüttelt den Kopf und geht weiter. »Du bist doch keine Gefangene.«
»Meine Eltern machen sich eben Sorgen, wenn ich nicht direkt nach Hause komme.«
»Gott, Lorraine, heute ist dein achtzehnter Geburtstag«, stößt sie hervor. »Du bist erwachsen! Benimm dich gefälligst mal so.«
Ich bleibe stehen, weil mich die Wucht ihrer Worte so unvorbereitet trifft. Sie war bisher immer diejenige, die Verständnis für mich hatte. Die mich tröstete, wenn die anderen gemein zu mir waren, und die mich in Schutz nahm, wenn mir mal wieder die Worte fehlten.
Doch jetzt schaut sie nicht einmal zurück, bevor sie aus dem Gebäude stürmt und mich allein zurücklässt.
***
Ich hasse Geburtstage. Ich hasse es, gute Laune vortäuschen zu müssen, wenn man eigentlich nichts lieber tun würde, als sich mit Harry Potter oder Clary und Jace in seinem Bett zu verkriechen. Ich hasse es, so zu tun, als würde ich das Essen genießen, wenn ich insgeheim Bauchschmerzen habe, weil in der Schule wieder etwas Unangenehmes vorgefallen ist.
Und ich hasse es, wenn Maman meine schlechte Stimmung bemerkt und mich darauf anspricht. Dann muss ich sie nämlich immer anlügen, weil ich nicht will, dass sie weiß, wie wenige Freunde ich habe.
»Ist dein Zeugnis so schlecht?«, fragt sie, als ich mich nach der Schule an den Esstisch in unserer Küche fallen lasse, den sie für meinen Geburtstag dekoriert hat.
Ich hole das Zeugnis aus dem Baumwollbeutel, knülle diesen zusammen und werfe ihn mit Schwung auf den antiken Geschirrschrank, bevor ich ihr das bedeutungsvolle Blatt Papier reiche. »Hier. So schlecht ist es nicht.«
Mein Großvater betritt die Küche, lehnt seinen Spazierstock gegen die Wand und rutscht auf seinen Stammplatz.
»Warum ziehst du dann so ein Gesicht?«, fragt Maman und wirft einen Blick auf die Uhr.
Ich seufze, doch bevor ich antworten kann, kommt Papa in die Küche. Auf den Armen balanciert er einen schweren, verpackten Karton. »Wo ist mein Geburtstagskind?«
Er stellt den Karton auf dem Stuhl neben mir ab, bevor er sich zu mir hinunterbeugt, um mir links und rechts ein Küsschen auf die Wangen zu geben. »Alles Gute zum Geburtstag, mein Schatz.«
»Danke, Papa.« Ich lächle ihm zu, aber selbst ich spüre, dass das Lächeln meine Augen nicht erreicht. Alitas Worte spuken mir noch immer im Kopf herum.
Maman holt den Flammkuchen aus dem Ofen und serviert das Essen. Es riecht himmlisch, wie jedes Mal, wenn sie mein Lieblingsessen zubereitet, doch der Anblick des knusprigen Teiges lässt mir heute nicht das Wasser im Mund zusammenlaufen.
Stattdessen lehne ich mich zurück und spiele mit dem dreieckigen Kettenanhänger, der die Heiligtümer des Todes symbolisieren soll, während Maman das Essen verteilt. Manchmal wünschte ich mir, ich hätte auch einen Tarnumhang. Dann könnte ich mich einfach darunter verstecken, wenn meine Mitschüler schon wieder auf mir herumhacken.
»Kopf hoch, Lorraine.« Mein Großvater, den wir alle Papi nennen, stupst mir mit seinem Zeigefinger in die Seite. »Heute war der letzte Schultag. Du bist sie ein für alle Mal los.«
Ich schenke ihm ein müdes Lächeln, bevor wir uns ans Essen machen. Papi ist der Einzige, der weiß, wie sehr ich die Schule hasse. Papa ist meistens zu sehr mit seiner Arbeit beschäftigt und Maman – ja, Maman ist eben Maman.
»Das ist es nicht«, murmle ich mit halb vollem Mund. »Kann ich nicht doch zur Abschlussfeier gehen? Ich hab das Gefühl, ich bin nie dabei. Alita kommt auch.«
»Die schicken dir dein Zeugnis doch«, wirft Papa ein. Seine Haare sind zerzaust und auf seiner schmalen Brille befinden sich Farbspritzer. Offenbar hat er bis gerade eben noch gearbeitet.
»Schon, aber«, setze ich an. Ich weiß gar nicht, was ich sagen will. Alle anderen sind auch da? Das hat mich noch nie interessiert. Vielleicht früher mal, als ich noch neu auf der Schule war und der Illusion erlag, ich könnte Freunde finden, wenn ich nur genug Zeit mit ihnen verbringe.
»Ich finde, du solltest hingehen«, mischt sich Papi ein. »Du siehst die Leute vielleicht nie wieder. Dann kannst du ihnen sagen, was du von ihnen hältst.«
»Alain, das ist nicht hilfreich.« Maman legt ihr Besteck ab und wendet sich mir zu. »Süße, wenn du unbedingt hingehen möchtest, dann kannst du das natürlich machen. Aber willst du das wirklich? Abschlussfeiern sind laut und alle trinken Alkohol. Wir könnten doch stattdessen einen Serienmarathon machen. Oder ist dir das so wichtig?«
»So wichtig nun auch wieder nicht. Ich dachte nur … Ach, egal. Du hast recht.« Ich verziehe den Mund und zucke mit den Schultern, als würde es mich nicht kümmern, aber in Wahrheit bin ich den Tränen nahe. »Wahrscheinlich würde es mir sowieso nicht gefallen.«
»Du könntest stattdessen ja ein paar Freundinnen einladen«, schlägt Papa vor. »Einmal im Jahr kannst du doch auch mal ein bisschen feiern.«
Ich lasse die Gabel auf den Teller fallen, weil mir der Appetit vergangen ist.
»Davide, lass sie doch.« Maman schaut meinen Vater ermahnend an. »Wenn sie nicht feiern will, will sie nicht feiern.«
»Und wenn ich es mir anders überlegt habe?« Ich lehne mich mit verschränkten Armen zurück und blicke trotzig in die Runde. »Ich bin doch jetzt achtzehn. Ich könnte heute Abend mit Alita in einen Club gehen.«
»Nein.« Maman schaut mich scharf an. »Clubs sind nichts für dich.«
»Abschlussfeiern sind nichts für mich, Clubs auch nicht. Geburtstagspartys auch nicht – gibt es überhaupt irgendwas, das mir gefallen würde?«, fahre ich sie frustriert an und springe auf. »Immer verbietest du mir alles. Wie soll ich so jemals herausfinden, wer ich wirklich bin?«
Maman sieht aus, als hätte ich sie ins Gesicht geschlagen. Es dauert keine halbe Minute, da bilden sich die ersten Tränen in ihren blauen Augen. Sie presst sich eine Hand auf den Mund, in dem verzweifelten Versuch, nicht zu weinen, aber dann tut sie es doch.
Ich schnaube und verlasse die Küche, poltere die enge Treppe hinauf, vorbei am Schlafzimmer meiner Eltern, am Büro und den anderen beiden Räumen, bis ich an der Leiter zum Dachboden angekommen bin. Die schmalen Stufen fühlen sich unter meinen wütenden Schritten ungewohnt an. Erst als ich die Tür hinter mir schließe und mich auf mein Bett fallen lasse, atme ich wieder durch.
Ich weiß nicht, was ich erwartet habe. Wie konnte ich glauben, heute wäre alles anders? Weil ich achtzehn bin und meinen Abschluss in der Tasche habe?
Das ist verrückt. Es hat sich nichts geändert. Das habe ich doch schon gespürt, als ich nach Hause gekommen bin. Die Fenster sehen vom anderen Ende der Straße immer noch aus wie gähnende Münder, vor die man staubige Vorhänge gezogen hat, um die Trauer dahinter zu verstecken. Habe ich wirklich gedacht, dass Maman mit ihrem Bademantel auch ihre Depressionen an den Nagel hängt? Nur, weil sie sich heute ausnahmsweise zurechtgemacht hat, heißt das nicht, dass auch ihr Innenleben von einem Tag auf den anderen wieder aufgeräumt ist.
Ich knülle das Kissen unter meinem Kopf zusammen, presse meine Wange in den weichen Stoff und schließe die Augen. Heute ist mein achtzehnter Geburtstag und ich liege heulend auf meinem Bett.
Ich bin so ein Versager.
***
Es gibt zwei Dinge, die ich gern mag. So richtig gern, mein ich. Das sind Bücher – vor allem Jugendbücher – und Klamotten. Für diese beiden Dinge würde ich jeden Monat mein gesamtes Taschengeld ausgeben, wenn ich nicht vor einiger Zeit beschlossen hätte, zwei Drittel meines Geldes in dem großen grünen Schwein in meinem Bücherregal für die Zeit nach der Schule zu sparen.
Auch jetzt, als ich mich wieder beruhigt habe, greife ich in die Taschen meiner Latzhose, um mein übriges Geld rauszuholen und es ins Sparschwein zu stecken. Dann ziehe ich die Latzhose und das geringelte T-Shirt aus und tausche die Sachen gegen Sweatshorts und ein T-Shirt mit der Aufschrift Sorry, I only date fictional characters.
Die Sonne heizt das Dachgeschoss in den Sommermonaten so sehr auf, dass es in meinem Zimmer wärmer ist als draußen. Da hilft es nicht mal mehr, die beiden Fenster zu öffnen, um für Durchzug zu sorgen.
In der Mitte unseres Daches ist eine Wand gezogen, die den Platz in zwei Zimmer unterteilt. Der Raum nebenan steht leer. Nur die blaue Tür erinnert daran, dass er mal eine Bestimmung hatte.
Meine Tür ist weiß und auf der Innenseite geschmückt mit Fotos und Postkarten aus fernen Ländern. Dieser Platz ist mein Zugeständnis an das Fernweh, das manchmal in meinem Inneren schlummert. Gegen das Fernweh – gegen alles eigentlich – hilft mir aber meistens meine große Bücherwand. Über tausend Bücher stapeln sich mittlerweile in den fünf ausladenden Regalen und jedes einzelne davon eignet sich für eine bestimmte Stimmung.
Eigentlich hatte ich für den Sommer einen Reread von Harry Potter geplant, aber heute ist mir mehr nach einer neuen Welt. Vom Altbekannten hatte ich heute schon genug. Ich bin bereit für ein richtiges Abenteuer.
Bevor ich mir allerdings ein Buch aussuchen kann, mit dem ich mich auf eine Decke in den Garten pflanzen will, klopft es an meine Tür.
»Ja?«
Maman kommt rein, auf den Armen den Karton mit meinen Geschenken, den ich schon fast vergessen hatte. »Darf ich?«
»Klar.« Ich deute nickend aufs Bett und sie lässt den Karton mit einem Ächzen fallen. Ihre Augen sind verquollen und ihre Nasenspitze gerötet. Sofort habe ich ein schlechtes Gewissen, weil ich sie so angefahren habe. »Tut mir leid … das eben.«
»Mir tut es leid«, druckst sie herum. »Du sollst nicht das Gefühl haben, wir würden dich zurückhalten. Wenn du zur Abschlussfeier gehen möchtest, kannst du gerne gehen.«
»Ich will gar nicht.« Ich ziehe meine Kette aus, lege sie zu den anderen Merchandise-Artikeln in meinem Regal und binde meine Haare zu einem Knoten. »War eine blöde Idee. Ich bin froh, dass sie mir das Zeugnis schicken.«
Maman lächelt mich an. »Willst du nicht deine Geschenke auspacken? Alain hat auch noch etwas für dich. Aber dazu musst du nach unten kommen.«
»Ich wollte sowieso gleich in den Garten«, erkläre ich, setze mich neben den Karton und greife nach einem eckigen Päckchen. Mit ein paar Handgriffen habe ich es vom Papier befreit und klappe den Karton auf.
Das Erste, was ich sehe, ist ein Funko Pop. »Dobby!«
Ich hole die Schachtel raus und betrachte die kleine Figur, die mir noch in meiner Sammlung fehlt. Mit den großen Augen und den spitzen Ohren sieht er fast so niedlich aus wie in den Harry-Potter-Filmen.
Nach Dobby folgen ein Gutschein von meinem Lieblings-Online-Shop, meine Lieblingsschokolade und ein paar Bücher von meiner Wunschliste – Zorn und Morgenröte, der zweite Teil von Tom und Malou, Strike oder die Unwahrscheinlichkeit vom Blitz getroffen zu werden und die große Liebe zu finden und Was bleibt, sind Schatten –, auf die ich mich schon eine halbe Ewigkeit freue.
Ich umarme Maman zum Dank, räume die Bücher in den Teil meines Regals, in dem sich die ungelesenen Bücher stapeln, und verlasse dann mein Zimmer. Auf dem Weg nach unten halte ich kurz am Büro an, klopfe, warte, bis Papa mich hineinbittet, und umarme auch ihn für meine Geschenke.
Sein großer Schreibtisch ist das reinste Durcheinander. Hier eine Projektskizze, da ein Modell, und überall Farben, Rot, Grün, Blau und Gelb, Bleistifte in unterschiedlichen Stärken, leeres Papier und vollgekritzeltes. Über all dem hängt sein Parfum wie eine schwere Wolke und verbindet sich mit dem Geruch von Druckerschwärze und frischen Ideen. Das Chaos beherrscht sein Büro – genauso wie ihn – und deshalb liebe ich es hier.
»Woran arbeitest du?« Neugierig betrachte ich die Projektmappe auf dem Tisch. Ein Kaffeerand zieht sich über mehrere hastig übereinandergelegte Blätter, darauf steht seine Superdad-Tasse, die ich ihm vor ein paar Jahren zum Geburtstag geschenkt habe. Wenn er in seiner Arbeit aufgeht, verschüttet er oft Sachen. Manchmal nur Wasser oder Kaffee, oft aber auch Farbe. Dementsprechend bunt sind die Holzdielen in einem bestimmten Radius zum Tisch.
»Die Stadt möchte ein Bild fürs Rathaus.« Er deutet mit einem Rucken seines Kinns auf die Entwürfe, die aussehen, als wären sie für ein Treppenhaus gedacht. »Ich sitze schon am fünfzehnten Entwurf, weil ihnen ständig etwas missfällt.«
»Deine Kunst soll in unser Rathaus?« Überrascht betrachte ich die Blätter. Unten rechts steht sein Name, darunter Rathaus Straßburg und eine Zahl, die den Entwurf markiert. Ich liebe jedes seiner Bilder, aber ich kann verstehen, dass ein Rathaus sich mit der Entscheidung Zeit lässt. »Hoffentlich bezahlen sie dich wenigstens für jeden Entwurf.«
Er verzieht das Gesicht.
»Papa! Du musst ihnen sagen, wie viel Arbeit das ist. Du kannst doch nicht ständig deine Arbeit verschenken.«
»Ich bin froh, wenn ich überhaupt Arbeit habe, Lori«, murmelt er und schiebt seine Brille mit der Fingerspitze hoch. Das habe ich wohl von ihm. »Das verstehst du erst, wenn du selbst arbeiten gehst.«
»Hmpf«, mache ich und weil wir einander nicht viel mehr zu sagen haben, druckse ich noch einen Moment herum und verlasse schließlich mit einer fadenscheinigen Ausrede das Büro, um in den Garten zu gehen. Auf dem Weg in die Küche treffe ich Papi, der gerade aus seinem Zimmer im Erdgeschoss kommt.
»Da bist du ja.« Tock, tock, tock. Sein Spazierstock schlägt auf den Dielenboden, als er zu mir kommt. Es überrascht mich immer wieder, wie sehr sein Schmunzeln meine Laune heben kann. Wenn sich die gebräunte Haut in Falten wirft und die blauen Augen amüsiert leuchten, fühle ich mich, als könnte nichts und niemand auf der Welt unsere Familie zerstören. »Adeline hat dich wohl überzeugt, dass es sich lohnt, für dein Geburtstagsgeschenk runterzukommen.«
Ich umarme ihn halb, drücke ihm einen Kuss auf die Wange, die nach Pfefferminz riecht, bevor ich ihm durchs Wohnzimmer hinaus in den Garten folge. Die Neugierde steigt, als er um die Ecke humpelt, vor mir weg, mit einem gut gelaunten Pfeifen auf den Lippen, und schließlich hinter der Ecke verschwindet. Ich folge ihm in den Innenhof, in dem unser Citroën steht und –
»Zwei Pferde!«, rufe ich aus, als ich den Oldtimer entdecke. Der Citroën 2CV glänzt in der Sonne, sein fliederfarbener Lack so perfekt, als wäre er gerade aus dem Werk gerollt. Bloß das schwarze Vinyldach wirft die Sonne nicht zurück.
»In Deutschland nennt man sie auch Ente«, erklärt Papi und gräbt in seiner Hosentasche, bevor er mir einen glänzenden Gegenstand zuwirft. Der Schlüssel.
»Aber –«
»Für dich, mein Schatz.« Papi zwinkert mir zu. Ungläubig schaue ich zwischen ihm und dem Auto hin und her, während meine Finger sanft über den Schlüssel streicheln. Erst als sich mein Großvater in Bewegung setzt und zum Auto humpelt, schüttle ich mich aus meiner Erstarrung und folge ihm. Meine Handflächen werden feucht, als ich den Schlüssel vorsichtig ins dafür vorgesehene Loch schiebe und umdrehe. Die Tür öffnet sich mit einem lauten Klacken.
»Du musst beide Türen per Hand aufschließen«, schiebt Papi ein, bevor ich mich hinsetzen kann. Also eile ich um das Schmuckstück herum, öffne auch seine Tür und halte sie ihm auf wie ein englischer Chauffeur. Er schmunzelt und setzt sich ächzend ins Auto. Seinen Spazierstock lehnt er gegen die geöffnete Tür. Ein Zeichen dafür, dass ich sie nicht zu schließen brauche.
Ich laufe zurück auf die Fahrerseite, entdecke dabei den L-Aufkleber auf der Heckscheibe, der mich als Fahranfänger ausweist, und folge Papis Beispiel, rutsche auf den Fahrersitz, kühles Leder unter meinen nackten Beinen, den Geruch eines frisch restaurierten Autos in der Nase. Ich war noch nie ein großer Fan von Autos, aber dieser 2CV lässt selbst mein Herz schneller schlagen.
»Wahnsinn«, flüstere ich und lasse meine Hände ehrfürchtig über das schlichte, mit braunem Leder bezogene Lenkrad gleiten. An diesem Auto ist nicht viel dran, nicht so viel zumindest wie an dem, das meine Eltern fahren, aber es fühlt sich an, als hätte es alles, was ich brauche. Ein paar Anzeigen, die im Vergleich zu neueren Autos beinahe mechanisch wirken, einen verrückt aussehenden Steuerknüppel am Lenkrad, der in einer Billardkugel endet, ein Handschuhfach und sogar ein Radio, was vermutlich eingebaut wurde, als man den Wagen restauriert hat.
Papi erklärt mir, wie der 2CV funktioniert, was ich beachten muss, wenn ich ihn anlassen möchte, wie ich schalte und tanke. Es ist alles anders als in einem neueren Wagen, aber ich lausche seinen Worten aufmerksam und bemerke, wie sehr mich die Funktionsweise dieses Fahrzeugs begeistert.
Schließlich lasse ich meine Hand über das glatte Sitzleder gleiten, bevor ich den Choke einen Finger breit rausziehe, den Schlüssel in die Zündung stecke und den Wagen starte. Ich brauche ein paar Versuche, um ihn anzutreten, aber dann erwacht er mit einem leisen Röhren zum Leben. »Es ist perfekt. Mehr als perfekt.«
»Sie braucht einen Namen«, erklärt Papi mit einem verschmitzten Grinsen.
»Sie?«
»Ein Auto mit so schönen Kurven muss eine Sie sein, findest du nicht?«
»Hm«, mache ich nachdenklich. Recht hat er. Ein männlicher Name für dieses schöne Auto fühlt sich nicht richtig an. Ich lege meine Hände ans Lenkrad, schließe die Augen und konzentriere mich ganz auf den Wagen, auf sein leises Schnurren, auf den Geruch und das Gefühl unter meinen Nervenenden. Ich stelle mir vor, wie ich mit meinem Auto über die Autobahn fahre. Mit offenem Fenster und wehenden Haaren, meine Lieblingsmusik im Ohr und weit und breit nur Sonnenschein und gute Laune.
»Hedwig«, sage ich schließlich und öffne meine Augen. »Sie soll Hedwig heißen.«
Die einen lesen Geschichten, die anderen leben sie
Lorraine
Hedwig röhrt wie ein Hirsch, als wir später am Abend über den warmen Asphalt gleiten. Papi neben mir, Maman und Papa auf der Rückbank und Edith Piaf im Radio, die Fenster aufgeklappt, die Oberschenkel angespannt, als würde ich zum ersten Mal hinterm Steuer sitzen. Die Angst davor, mein Auto gleich kaputt zu fahren, ist groß und das Entspannen gelingt mir erst nach ein paar Minuten im Stadtverkehr von Straßburg.
Wir halten etwas außerhalb, recht nah bei meiner Stammbuchhandlung, und klappen die Fenster mit viel Schwung wieder zu, bevor wir schließlich aussteigen. Ich renne um den Wagen herum, um alle Türen abzuschließen, und folge meiner Familie zu der Eisdiele mit dem besten Eis in Straßburg. Manchmal, wenn wie heute nur so wenig los ist, fühlt es sich an, als wäre die Eisdiele ein absoluter Geheimtipp. Aber ich weiß, dass die Menschen an anderen Tagen sogar auf dem Bürgersteig anstehen, um ein formvollendetes Eis zu essen.
Wir haben einfach nur Glück.
»Essen wir hier?« Maman schiebt sich die Sonnenbrille in die braunen Haare. »Nicht, dass wir noch die Sitze mit Eis vollschmieren.«
Wir stimmen ihr zu, suchen uns einen Platz auf der Terrasse und dort dann ein Eis in der Karte. Ich lese mir fast die gesamte Speisekarte durch, bevor ich mich für den Klassiker entscheide, den ich immer nehme: einen Erdbeerbecher.
Nachdem der Kellner unsere Bestellung aufgenommen hat, lehne ich mich zurück. Mir ist warm, meine dicken Haare kleben mir nass im Nacken, ob von der Sommerhitze oder der Aufregung, weiß ich nicht.
Ein paar Tische weiter sitzt eine südländische Familie mit vier Kindern. Drei Mädchen, zwei davon viel jünger als ich, die Dritte in meinem Alter oder älter. Der Sohn mit der hellen Jeans, dem blassblauen Hemd über dem weißen T-Shirt und der blauen Cap sieht aus, als gehöre ihm die Terrasse. Als hätte er meinen Blick gespürt, hebt er den Kopf und schaut zu uns. Meerblaue Augen, Bartschatten, verzücktes Lächeln auf den Lippen.
Unser Blickkontakt währt nur ein paar Sekunden, aber es ist lang genug, um mein Herz schneller schlagen zu lassen. Doch dann bringt seine Schwester ihn mit etwas zum Lachen und sein Lachen endet in einem Husten, das sich anhört wie ein sterbendes Pferd. Nichts mit Musik in meinen Ohren, nein, sein Lachen stellt die Haare in meinem Nacken auf, weil es so schmerzhaft klingt. Sogar der Rest meiner Familie hört mitten im Gespräch auf, um sich nach der Ursache des Hustens umzusehen.
Ich unterdrücke ein Schaudern und wende mich wieder unserem Tisch zu. Der Korbstuhl drückt sich in meine Oberschenkel. Wahrscheinlich werde ich wieder ein wildes Muster auf den Hinterseiten haben, wenn ich später aufstehe.
»Der arme Junge«, meint Maman. »Hört sich an, als wäre er krank. Mitten im Sommer.«
Papi legt den Kopf schief. »Das muss ja nicht unbedingt schlecht sein. Ich kann mich noch genau an den Sommer 1951 erinnern. Ich wurde nach Avignon versetzt. Schöne Stadt, wirklich traumhaft, aber die Rhône war wohl nicht zum Schwimmen geeignet. Wir machten uns einen Spaß draus, baden zu gehen, wenn wir keinen Dienst hatten. Aber ein paar Tage später hat mich eine Lungenentzündung eingeholt.« Er hebt seine buschigen Brauen und macht eine vielsagende Pause. »Im örtlichen Krankenhaus traf ich sie dann.«
Maman lehnt sich zurück und verschränkt skeptisch die Arme vor dem Bauch. Sie scheint die Geschichte noch nicht zu kennen, was vermutlich bedeutet, dass Papi sich die Erzählung gerade ausdenkt.
Bevor er jedoch weitersprechen kann, kommen unsere Eisbecher. Der Kellner stellt sie mit ein paar freundlichen Worten vor uns ab und geht zum anderen Tisch. Es scheint, als wäre er eng mit der Familie befreundet, wenn nicht sogar verwandt. Er drückt die Cap des Jungen hinunter und albert mit ihm herum.
Ich lehne mich vor und genieße meinen eigenen Eisbecher, während ich Papi lausche, der sich offenbar gerade dazu entschieden hat, das Geheimnis seiner großen Liebe zu lüften.
»Ihr Name war Odette«, erzählt er. »Odette Béliers. Sie hat dort als Krankenschwester gearbeitet. Ich sag euch, sie sah aus wie Schneewittchen, so dunkle Haare und blasse Haut hatte sie. Sie war wunderschön.«
Maman schnaubt.
»Glaubst du mir nicht, Adeline?« Papi lacht. Sein Lachen ist leise und charmant, das komplette Gegenteil vom Lachen des Jungen. Der sanfte Ausdruck in seinem Blick weicht einer Erinnerung. Wann immer das passiert, fühlt es sich so an, als würden seine Augen zu einem Fenster in die Vergangenheit. Wenn er aus seinem Leben erzählt, werden Farben lebendig und Gesprächsfetzen real – ganz egal, ob die Geschichte sich tatsächlich so zugetragen hat.
Auch wenn Maman ihm nicht glaubt, sie nimmt trotzdem ihren Eisbecher in die eine Hand, den Löffel in die andere und lehnt sich zurück, ihre Gesichtszüge entspannt, der Ausdruck in ihren Augen nicht ganz so müde wie sonst. Wir essen unser Eis schweigend, lauschend, während Papi vom Sommer 1951 erzählt. Von Lungenentzündungen, Soldatenleben und Krankenhausbesuchen. Von einer Frau, schöner als eine Prinzessin und freundlicher als ein Sommertag an der Küste.
Wir unterdrücken ein Kichern, als er uns von ihrem ersten Kuss erzählt, von Versteckspielen in Lavendelfeldern und von einer roten Ente, mit der sie die ganze Welt erkunden wollten.
»Wir hatten viele Träume«, beendet er seine Erzählung, lange nachdem der Kellner unsere leeren Eisbecher abgeräumt hat. Selbst die andere Familie spricht leiser, als würden auch sie meinem Großvater zuhören. »Aber in Wahrheit haben wir es nie aus Avignon hinausgeschafft. Als ich wieder gesund war, wurde ich nach Nancy versetzt.«
»Und Odette?«, frage ich atemlos.
Papi lächelt geheimnisvoll. »Sie ist immer die Frau meiner Träume geblieben.«
***
Mit der Dunkelheit kommt der Regen, mit dem Regen das Gewitter und mit dem Gewitter die Angst. Ich liege auf meinem Bett, meine bestickte Tagesdecke über den Kopf gezogen, die Hände auf die Ohren gepresst, und male mir aus, wie es wäre, wenn ich mich vor nichts fürchten würde. Dann hätte ich mein Fenster aufgerissen, in der Hoffnung, dass der Wind die Sommerhitze aus dem Raum treibt. Vielleicht würde ich sogar im Regen tanzen, das Gewitter einfach fortlachen.
Ich wünschte, es wäre so einfach. Stattdessen kommt das Gewitter näher, wird lauter, gräbt sich durch meine Ohren in meinen Kopf und nistet sich dort ein. Ich versuche meine Angst zu vertreiben, indem ich an Odette denke. An Odette und Lavendel und Sommerregen. Ob Papi und sie im Regen getanzt haben?
Ich frage mich, ob sie noch lebt. In Avignon oder Marseille vielleicht oder in einem kleinen Haus am Meer, die helle Haut mittlerweile sonnenverbrannt, das dunkle Haar ergraut, ein Lächeln im Gesicht, das dem von Papi in nichts nachsteht.
Mir liegen plötzlich tausend Fragen auf der Zunge. Automatisch streife ich die Decke zurück, klettere aus dem Bett und dann die Treppe hinunter ins erste Geschoss. Unter der Erinnerung an Papis Geschichte verblasst das Gewitter zu einem fernen Grollen und als ich an seine Tür klopfe, meinen Schlafanzug zurechtzupfe und auf sein raues »Herein« warte, ist meine Angst fürs Erste vergessen.
Es dauert nicht lange, da bittet er mich herein. Ich öffne die Tür und werde empfangen von warmem Licht und Pfefferminzgeruch. Papi sitzt auf seinem Sessel, ein weißes Feinripphemd zur Schlafanzughose, auf der Nase eine dünne Brille und in der Hand ein dickes Buch.
»Kannst du auch nicht schlafen?«, fragt er mich und deutet auf den zweiten Sessel neben dem runden Tisch. Ich setze mich hin und lasse meinen Blick durch den Raum gleiten. Seine Tagesdecke liegt zusammengefaltet am Fußende, die Bettdecke ist aufgeschlagen. Er war wohl schon im Bett und ist wieder aufgestanden, als das Gewitter begann. Die meisten Leute werden im Alter schwerhöriger, er hingegen scheint immer mehr und immer lauter zu hören. Kein Wunder also, dass er nicht schlafen kann.
»Was liest du da?« Neugierig beuge ich mich vor, um den Titel im schummrigen Licht zu erkennen. Als hätte er erst durch meine Frage gemerkt, dass er das Buch noch in der Hand hält, hebt er es erstaunt hoch, klappt es zu und schaut auf den Titel. Dann lächelt er still in sich hinein und reicht mir das gebundene Buch.
Harry Potter und der Stein der Weisen.
»Ich habe mit deiner Liste angefangen«, erklärt er, bevor er sich räuspernd erhebt, zu seinem prall gefüllten Bücherregal schlurft und ein dünnes Büchlein hervorzieht. Er klappt es auf, holt ein Blatt Papier hervor, steckt das Buch zurück ins Regal und kommt zu mir, um mir den Zettel zu reichen. Ein Blick genügt, um festzustellen, dass auch er meiner Bitte nachgekommen ist, mir eine Leseliste zu erstellen.
»Du hast dran gedacht.«
»Natürlich.« Er hebt seine Braue, als wenn er sagen wollte Denkst du, ich werde vergesslich? »Und bisher gefällt mir Harry Potter ausgesprochen gut. Ich hoffe, so ergeht es dir mit den Büchern auf dieser Liste auch.«
»Ganz bestimmt.« Ich lege das Blatt auf den Tisch, lächle ihn an, zögere, und frage dann doch. »Papi, war die Geschichte über Odette erfunden?«
»Was denkst du denn?«
Ich zucke mit den Schultern. Bei ihm verschwimmen die Grenzen zwischen Realität und Fiktion, zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Odette fühlt sich real an. Das sage ich ihm.
Er muss lachen. »Sie ist real.«
Wir schweigen einen Moment, gefangen in unseren Gedanken. Ich in meiner Erinnerung an die Geschichte, er vielleicht in der Erinnerung an die Liebe seines Lebens. Da kommt mir eine Idee.
»Wir könnten an die Küste fahren. Mit Hedwig. Du und ich.«
Er denkt lange darüber nach. Zurückgelehnt in seinen Sessel, die Hände im Schoß, die Gedanken in der Ferne, bis er schließlich seufzt, den Kopf neigt, mich mit feuchten Augen ansieht. »Das schaffe ich nicht mehr, Lori. Ich bin zu alt, um eine so lange Strecke im Auto zu verbringen.«
»Hm«, mache ich und überlege stumm, wie ich eine Reise für ihn erträglicher machen könnte. Aber es stimmt schon. Papi ist nicht mehr gut zu Fuß und die lange Fahrt in Hedwig würde seinen Rücken vermutlich umbringen, ganz abgesehen davon, dass wir ja nicht einmal wissen, ob Odette noch lebt. Was, wenn sie längst gestorben ist und es ihn so hart trifft, dass er daran zugrunde geht?
»Du könntest ja allein nach ihr suchen«, schlägt er schließlich vor und schmunzelt. »Du hast zwei Monate Zeit, bevor das Leben weitergeht. Und du hast jetzt ein Auto.«
Niemand hat gesagt, es wäre einfach
Lorraine
Nach dem Frühstück krieche ich zurück ins Bett, um zu lesen. Die Nacht war lang, nicht nur, weil das Gewitter zurückgekehrt ist, sondern vor allem, weil mich die Gedanken an Odette nicht mehr losgelassen haben. Ich habe versucht mir vorzustellen, wie es wäre, wenn ich allein an die Küste fahren würde. Wehendes Haar, offene Fenster, das blau glitzernde Meer in der Ferne. So schön anzusehen und doch so gefährlich.
Ich wüsste nicht einmal den Weg, geschweige denn, wie ich die Nächte verbringen soll. Meine Ersparnisse sind zwar groß, aber nicht so riesig, dass ich davon zwei Monate im Hotel bezahlen könnte. Ich bräuchte ein Zelt, eine Luftmatratze und Ersatzbenzin und mein Handy müsste immer aufgeladen sein, sodass ich jederzeit bei meinen Eltern anrufen könnte, damit sie mich abholen kommen, wenn es mir zu viel wird.
Mein Blick gleitet zu meiner Regalwand. Zwischen all den Büchern befinden sich zahlreiche, in denen die Protagonisten verreisen. Mal um die Welt, mal ins Nachbarland, mal auch nur zur Familie in einer anderen Stadt. Es ist nicht so, als wäre ich nicht rumgekommen. Nein, ich würde fast behaupten, ich habe schon mehr als meine Eltern gesehen und vielleicht auch schon mehr als Alita, aber eben nicht durch meine eigenen Augen, sondern durch die Brille eines Protagonisten.
Ich wünschte, ich wäre so mutig wie Frodo und seine Freunde oder so schlau wie Hermine. Dann würde ich mich sofort ins Auto setzen und losfahren. Aber so?
Seufzend schlage ich Zorn und Morgenröte auf, in der Hoffnung, dass die Geschichte um Shahrzad und Chalid mich von meinen Gedanken ablenkt, aber selbst das funktioniert heute nicht. Nach den ersten zehn Seiten habe ich das Gefühl, die Worte nur überflogen zu haben, ohne irgendetwas von deren Inhalt aufzunehmen.
Ich lege das Buch beiseite, werfe einen Blick auf mein Handy und sehe, dass Alita mir geschrieben hat.
Hey, Lori, das mit gestern tut mir leid. Das war total daneben von mir.
Ich antworte ihr, dass ich nicht sauer bin. Immerhin hat sie ja irgendwie recht. Ich bin erwachsen und benehme mich nicht so – das nervt mich selbst.
Weil ich mich sowieso nicht länger auf mein Buch konzentrieren kann, ziehe ich mich an und gehe in den Garten. Dort frage ich Papi, ob ich ihm im Gemüsebeet helfen könne, aber auch er will mich heute nicht von meinen Gedanken ablenken. Ich setze mich einen Moment in die Sonne, spiele mit der Lehne des Gartenstuhls, fahre sie vor und zurück, und finde doch keine bequeme Position.
»Lorraine«, schimpft Papi schließlich. Er richtet sich auf, funkelt mich genervt an, bis ich den Stuhl beschämt in eine aufrechte Position bringe und aufstehe.
»Mir ist langweilig«, verkünde ich.
»Dann lies ein Buch.«
Seufzend erkläre ich ihm, dass nicht mal ein Buch mich heute von meinen Gedanken ablenken kann.
»Dann fahr in die Buchhandlung und kauf ein Buch.« Er reibt sich den Schweiß von der Stirn.
Ein Besuch bei Marilou könnte tatsächlich die Lösung für meine Probleme sein. Mit ihr könnte ich über Odette reden und sie würde mir erklären, wie unwahrscheinlich es ist, dass diese noch lebt, und dass mein Auto für eine Reise an die Côte d’Azur sowieso zu alt ist.
Mit frischer Motivation springe ich auf und eile ins Haus, um meinen Autoschlüssel zu holen. Ich schreibe einen Zettel für meine Eltern, lege ihn auf den Küchentisch und trinke noch einen Schluck Wasser, bevor ich mich auf den Weg zum Auto mache.
Hinterm Steuer fällt mir auf, dass es das erste Mal ist. Zum ersten Mal sitze ich alleine in meinem Auto, zum ersten Mal habe ich meine Eltern nicht um Erlaubnis gebeten, bevor ich das Haus verlassen habe.
In meiner Magengrube beginnt ein Kribbeln, das sich in meinem gesamten Körper ausbreitet, als ich vom Hof fahre. Ich klammere mich ans Lenkrad, die Finger verkrampft, der Blick aufmerksam, und fühle mich ein kleines bisschen verwegen. Wie eine der Heldinnen aus meinen Büchern.
***
»Das ist so romantisch!« Marilou beugt sich vor, ihre dunklen Haare wehen sanft in der Sommerbrise. Die grünen Augen blitzen begeistert auf. »Du musst fahren.«
Nachdem ich ihr Hedwig vorgestellt habe, haben wir uns auf die Terrasse des winzigen Buchladens gesetzt, um Tee zu trinken. Also ich trinke Tee, sie trinkt Kaffee. Schwarz, wie immer. Durch die Schiebetüren haben wir den gemütlichen Laden im Blick. Heute ist wenig los, die Sommerhitze verlockt wohl nicht gerade zum Bücherkaufen, deshalb konnte ich ihr in Ruhe von Papi und Odette erzählen.
»Ich wollte, dass du mir sagst, wie bescheuert dieser Einfall ist«, seufze ich schließlich. »Ermunterung kann ich nicht gebrauchen.«
Marilou lacht auf. »Lori, Lori, du musst dich auch mal etwas trauen. Dein eigenes Abenteuer erleben. Man lebt nur einmal und so.«
»Aber an die Küste?« Ich zweifle immer noch an meiner fixen Idee. Wenn ich doch bloß mutiger wäre. Dann würde ich jetzt wahrscheinlich in der Abteilung mit den Reiseführern stehen und meine Route planen.
»Für die Liebe?« Sie blinzelt und nimmt einen Schluck von ihrem Kaffee, bevor sie die Tasse mit so viel Elan abstellt, dass der Inhalt beinahe über den Rand geschwappt wäre. »Stell dir nur vor, Odette lebt noch. Meinst du nicht, sie würde sich freuen, von Alain zu hören?«
»Aber an die Küste?«, wiederhole ich mein Argument, obwohl selbst ich merke, dass es keinen guten Grund gibt, nicht zu fahren. Mein Auto ist generalüberholt, ich habe zwei Monate Zeit und noch nie ein Abenteuer erlebt. Das wäre die perfekte Gelegenheit.
»Du könntest schwimmen gehen.« Marilou wackelt mit den Augenbrauen. »In Saint-Tropez oder Cannes einen reichen Mann kennenlernen und heiraten. Hach, ich beneide dich jetzt schon. Ich wünschte, ich könnte mitkommen.«
»Kannst du doch.« Ich zucke mit den Schultern und hoffe inständig, dass sie sofort ihre Sachen packt, um mich zu begleiten. »Warum nicht? Im Auto ist genug Platz für uns beide.«