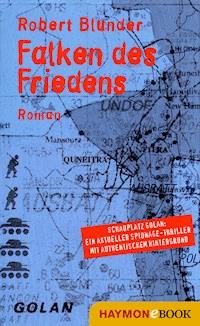
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
"Möchten Sie mühelos 5000 Dollar verdienen?" Mit dieser Frage eines Mitreisenden im Flugzeug nach Damaskus beginnt für den österreichischen UNO-Soldaten Robert Bergner, der sich mitten in einer privaten und beruflichen Krise zu einem mehrmonatigen Einsatz auf den Golanhöhen gemeldet hat, ein Abenteuer, das ihm nicht nur physisch und psychisch alles abverlangt, sondern das ihn auch in akute Lebensgefahr bringt. Geheime Überwachung, Erpressungsversuche, Bestechung und Drohungen sind nur einige der Mittel, die von den Armeen und Geheimdiensten beiderseits des neutralisierten und von der UNO überwachten Streifens am Golan angewandt werden, um die "Falken des Friedens" für ihre Zwecke einzuspannen, sprich: sie zur Spionage zu missbrauchen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 491
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Robert Blunder: Falken des Friedens
Robert Blunder
FALKEN DES FRIEDENS
Roman
© 2000HAYMON verlagInnsbruck-Wienwww.haymonverlag.at
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder in einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
ISBN 978-3-7099-7108-6
Umschlag: Benno Peter unter Verwendung einer militärischen Karte der Golanhöhen
Dieses Buch erhalten Sie auch in gedruckter Form mit hochwertiger Ausstattung in Ihrer Buchhandlung oder direkt unter www.haymonverlag.at.
Dieses Buch ist allen UN-Soldaten gewidmet,die im Dienste des Friedens ihr Leben einsetzen,insbesonders jenen 20 Österreichern,die bisher während ihres Einsatzes am Golangestorben sind.
Unter ihm kam die Insel Zypern in Sicht, ein riesiger Flugzeugträger auf endlos glitzerndem Wasser...
Bergner stand auf, um auf die Toilette zu gehen. Als er die Schiebetüre wieder öffnete, stand plötzlich der Fremde vor ihm: ein gut gekleideter, jüngerer Mann, der, obwohl er eher südländisch wirkte, ein einwandfreies Deutsch sprach. Er hatte etwas von einem Wiesel an sich.
„Guten Tag, Colonel ...“, grinste er, „oder soll ich lieber Dr. Bergner sagen?“ Der Mann war klein, sehr klein. Er mußte den Kopf in den Nacken legen, um zu ihm hinaufzusehen.
„Entschuldigung...“ Bergner wollte sich an ihm vorbeidrängen, aber die Schiebetür klemmte fest.
„Erlauben Sie, daß ich mich vorstelle?“ Der Mann verneigte sich leicht. „Mein Name ist Winter, Aron de Winter. Bitte nennen Sie mich einfach Aron.“ Er zeigte nach vorne. „Wollen wir uns nicht setzen?“ Winter winkte nach einer Stewardeß und bestellte für jeden eine Tasse Kaffee, wobei Bergner ein leichter holländischer Akzent auffiel. „Bitte, hier sind wir ungestört!“ Sie nahmen in einer der hinteren Sitzreihen Platz.
Bergner wußte nicht, was er sagen sollte. Sein Gegenüber stierte ihn nur schweigend an. „Womit kann ich Ihnen behilflich sein?“ begann Bergner schließlich das Gespräch.
„Sie werden sich jetzt fragen, wer ich wirklich bin. Glauben Sie mir, es tut nichts zur Sache. Stellen Sie sich einfach vor, ich sei Kaufmann. Tatsächlich will ich etwas von Ihnen kaufen.“
„Von mir?“ Bergner schüttelte ungläubig den Kopf.
„Ja. Sie haben etwas, was ich nicht besitze.“
„Und das wäre?“ Bergner war sichtlich verstört.
„Sie haben die kleine, blaue Wunderkarte“, dabei zeichnete Winter mit beiden Zeigefingern ein Rechteck in die Luft.
„Was meinen Sie denn damit?“ Bergner ärgerte sich schön langsam über den Geheimniskrämer.
„Ihre ID-card!“ Der Unbekannte begann zu flüstern, als würden sie beide beobachtet.
Bergner fiel ein, daß er seinen UN-Ausweis noch gar nicht besaß. Aber gleich nach der Ankunft, noch vor der Zoll- und Polizeiabfertigung, würde er das Dokument von jemandem erhalten, der ihn damit aus dem Flughafen schleuste.
„Wozu wollen Sie denn meinen Ausweis?“
„Ich möchte Ihnen gerne ein kleines Geschäft vorschlagen, natürlich nur, wenn Sie daran interessiert sind.“ Wieder setzte er sein nachhaltiges Grinsen auf. „Es springt auch ganz schön was dabei raus für Sie!“ Winter hatte seinen Köder ausgelegt.
„Ich verstehe nicht, was Sie mit einem Ausweis wollen, auf dem mein Foto klebt. Sie sehen mir überhaupt nicht ähnlich.“ Bergner grinste jetzt ebenfalls, schließlich war er froh, nicht so auszusehen wie dieser Kerl da. Er hatte die Fleischnarbe am Hals bemerkt, die als grobes Zickzackmuster vom Hemdkragen bis zum Ohr hochlief, als hätte man einen Sack notdürftig zusammengenäht.
„Ich will Ihren Ausweis überhaupt nicht.“ Winter grinste immer noch und setzte mit übertriebener Betonung nach: „Colonel!“ Dann ergänzte er: „Ich will nur einen der Vorteile nützen, die er Ihnen verschafft.“
Bergner wäre am liebsten einfach aufgestanden. Ihm war plötzlich ziemlich warm geworden. Instinktiv krempelte er seine Hemdsärmel nach oben. „Könnten Sie bitte etwas präziser werden, Herr Winter?“ Er wollte diesen Kerl nicht mit dem Vornamen ansprechen.
„Fünftausend Dollar, Colonel, für einen kleinen Gefallen ...“
Bergner wäre seine Tasse beinahe aus der Hand gefallen, als er einen Schluck Kaffee nahm. „Und wer soll dafür umgebracht werden?“ meinte er mehr im Spaß.
„Ich bitte Sie. Für dieses Trinkgeld würde doch niemand einen Mord begehen?“ Der fiese Typ lachte laut auf. Sein Lachen klang wenig herzlich, es war mehr ein Bellen.
Bergner wußte, daß seine Reaktion nicht besonders klug gewesen war. Bevor er nachhaken konnte, zog Winter ein Päckchen aus einer Reisetasche unter dem Sitz hervor. Es hatte die Größe einer Zigarettenschachtel. „Sehen Sie diesen Karton? In ihm steckt ein nettes kleines Spielzeug. Einige Syrer würden liebend gern Bekanntschaft damit schließen.“ Bedächtig hielt er es Bergner hin. „Hier, stecken Sie das Päckchen ein, es hat leicht in der Seitentasche Ihrer Uniform Platz. Als UN-Offizier werden Sie weder vom Zoll noch von der Paßkontrolle angehalten. In der Abflughalle wird Ihnen ein drusischer Wasserverkäufer ein Glas Wasser anbieten, diesem Mann geben sie die Schachtel. Sie schaden niemandem damit. Das Geld erhalten Sie jetzt gleich.“ Er zog ein Bündel glatter Dollarnoten etwas umständlich aus seiner Sakkotasche. „Da, lauter nagelneue Scheine, frisch von der Bank.“
Aber anstatt auf die Scheine zu schauen, starrte Bergner in Winters Gesicht. Irgend etwas irritierte ihn. Das rechte Auge des Holländers schien sich zu verkrampfen, und plötzlich wendete er den Blick ab. Hatte er gelogen?
Gleichzeitig zündete in Bergners Gehirn ein Feuerwerk an Fragen. Woher kannte ihn dieser Mensch – warum 5000 Dollar für eine Kleinigkeit, die angeblich niemandem weh tat – was war wirklich in dieser Schachtel – wer war bloß dieser Kerl – warum gerade ich? – Andererseits... Er überlegte. Die 5000 Dollar würden ihm aus seinen Schwierigkeiten helfen.
„Woher wissen Sie eigentlich, daß ich dieses Ding da wieder hergeben werde?“ versuchte er den vifen Geschäftsmann abzulenken.
„Lieber Colonel“, Winter schüttelte mehrmals langsam den Kopf, „wenn Sie auf dieses Geschäft eingehen ...“, er blickte aus dem Kabinenfenster und deutete auf den Küstenstreifen hinunter, „sollten Sie sich über eines im klaren sein. Wir fliegen gleich über Latakia in syrisches Hoheitsgebiet ein. Unser Geschäft wird also nach islamischem Recht abgeschlossen. Ich glaube, Sie wissen, welche Strafe der Koran für Diebe vorsieht?“ Dabei rieb er genußvoll beide Hände ineinander. „Vielleicht kann ich Ihnen die eine oder andere Frage beantworten, die in Ihrem Kopf herumschwirrt? Daß Sie Oberstleutnant Dr. Ronald Bergner sind, sehe ich an Ihrem Dienstgrad und Namensschild“, grinste er hämisch, und sein rechtes Auge zuckte wieder, „aber daß Sie Ihr Bankkonto mit mehr als hunderttausend Schilling überzogen haben, steht nicht in Ihrem Personalakt, stimmt’s?“ Sein Mund verzerrte sich zu einem schrägen Loch, und mehrere Goldplomben blinkten darin, als hätte er einen Juwelier zum Zahnarzt.
Plötzlich schrillte es in Bergners Kopf. Winter hatte recht, er hätte in Wien seine Verschuldung im Personaldatenblatt angeben müssen, doch er hatte sich einfach geschämt dafür. Aber woher wußte dieser verdammte Kerl nur davon?
Winter kam ihm mit seiner Antwort zuvor. „Ich sagte Ihnen doch, daß ich Kaufmann bin. Ich handle mit Informationen, wichtigen Informationen. Und in dieser Schachtel“, er tippte auf den harten Gegenstand, den er zwischen seinen Beinen eingeklemmt hatte, „befindet sich wie gesagt ein nettes kleines Spielzeug. Wenn Sie so wollen, ein Geschenk. Mehr kann und darf ich Ihnen im Moment dazu nicht sagen.“ Er schüttelte energisch seinen Wieselkopf und herrschte Bergner an. „Sind Sie nun interessiert, oder?“ Er tippte mit den Knöcheln seiner Faust auf das Geldbündel.
„Wissen Sie was, ich glaube Ihnen kein Wort. Kein einziges verdammtes Wort glaube ich Ihnen.“ Bergner wollte aufstehen und wieder seinen Platz einnehmen, als ihn der Fremde mit einem brutalen Griff am Handgelenk zurückhielt. Seine Augen funkelten plötzlich wie irr.
„Sie Dummkopf, Sie. Glauben Sie etwa, ich bin auf Sie angewiesen?“ Sein Gesicht war grau geworden, und er schnaubte. „Seien Sie ja vorsichtig“, drohte er, „und vertrauen Sie niemals einem Araber. Keinem!“ Er ließ ihn los, gerade als sich Bergner mit der anderen Hand befreien wollte. „Das nächste Mal werden Sie mich um einen Gefallen bitten!“ bellte er ihm hinterher.
An den Rest des Fluges konnte sich Bergner später nicht mehr genau erinnern. Zu sehr war er mit dem beschäftigt, was sich gerade abgespielt hatte. In was war er da nur hineingeraten? Und warum war er überhaupt hier? Immer und immer wieder gingen ihm die Gründe für seine Entscheidung durch den Kopf, sich erneut für diesen Einsatz zu melden. Beruf, Familie, Glaube, sogar sein Mut, alles schien verloren, sein Leben eine einzige Farce. Nein, Flucht war gewiß keine Lösung. Er brauchte eine Aufgabe. Vielleicht konnte er sie am Golan finden.
VORBEREITUNG
Vor über zehn Jahren hatte sich Ronald Bergner als junger Reserveoffizier schon einmal für einen UN-Einsatz auf den Golanhöhen gemeldet. Damals, gerade mit seinem Studium fertig, bildete er sich unbedingt den Doktortitel ein. Die Idee war, in Ruhe seine Dissertation zu schreiben und zugleich Geld für seine Familie zu verdienen. Nach acht Monaten am Golan war seine Doktorarbeit fertig, und vier Monate später feierte er bereits seine Promotion.
Diesmal gab es nichts zum Feiern. Vor einem halben Jahr hatte er seinen Job verloren, über Nacht wegrationalisiert, und vor kurzem vermutlich auch seine Frau. Nachdem er ihr einen Seitensprung gebeichtet und zugleich von seinen Auslandsabsichten erzählt hatte, schrie sie ihn an: Zuerst von ihm betrogen und dann auch noch verlassen zu werden, sei zuviel.
Trotzdem. Er brauchte diesen Einsatz. Vermutlich war es seine letzte Chance. Seine Arbeitslosenunterstützung lief aus, sämtliche Ersparnisse waren aufgebraucht, und sein Konto war nichts als ein gähnendes Loch. Er mußte wieder auf den Golan, ob er wollte oder nicht. Dabei war es nicht einmal sicher, ob er überhaupt zum Zug kommen würde. Alles hing von der Untersuchung ab, die jedem Einsatz voranging. Erfahrungsgemäß lag die Ausfallsquote ziemlich hoch, und die Ergänzungsabteilung berief für jeden Posten zwei, drei Ersatzleute zur Vorauswahl nach Wien-Stammersdorf ein.
Einen Monat lang rückten tagtäglich etwa vierzig Mann beim Kommando Auslandseinsätze in der Van-Swieten-Kaserne ein. Drei Tage lang mußten sie sich einer umfangreichen Prozedur unterziehen: strenge medizinische Untersuchungen, psychologische Tests, Überprüfung des militärischen Wissens, und eine körperliche Leistungsfeststellung. Parallel dazu wurde der ganze administrative Kram erledigt.
Lediglich ein Viertel von ihnen, etwa zweihundert Mann, überstanden und erhielten den Einberufungsbefehl. Einen Monat später stiegen sie mit einem hellblauen Barett in die Chartermaschine nach Damaskus. Dort wartete bereits das halbe österreichische UN-Bataillon, von den Neuen abgelöst zu werden. Diese Rotation fand zweimal im Jahr statt, einmal im Juni, das andere Mal im Dezember.
Vor einigen Wochen hatte Bergner im „Soldat“, einer Bundesheerzeitung, die er vierzehntägig zugeschickt bekam, die Ausschreibung für den Posten des Chief Liaison Officer beim UN-Hauptquartier in Syrien entdeckt. Da Bergner sämtliche Anforderungen wie Dienstgrad, Kurse, Englischkenntnisse, und Golanerfahrung erfüllte, bewarb er sich schriftlich bei der Ergänzungsabteilung im Verteidigungsministerium. Da dies ein Traumjob für jeden Offizier war, rechnete er sich keine großen Chancen aus, bis ihn der zuständige Abteilungsleiter, Regierungsrat Sieberer, zu Hause anrief und ihm mitteilte, daß es nur drei Bewerber gäbe. Seine Chancen stünden gar nicht so schlecht, meinte er, wenn Bergner seine Auswahluntersuchung in Wien bestünde.
Sein Flug sollte erst nach der Rotation, genau am 1. Juli erfolgen. Hauptquartiersposten wurden unabhängig von der Kontingentsablöse besetzt. Zu diesem Zeitpunkt liebäugelte er zum ersten Mal mit dem Spitzenverdienst, der im Auslandseinsatz gezahlt wurde: 57.500 Schilling monatlich, steuerfrei! Manche behaupteten, damit würde auch gleich die Lebensversicherung für den Fall der Fälle ausbezahlt. Aber wer rechnete schon damit, wenn er sich für diesen Einsatz verpflichtete. Zypern und der Golan hatten einen unzweifelhaften Ruf bei den UN-Soldaten: holiday-mission. Bergner gefiel dieser Gedanke. Wenn er es damals als Hauptmann geschafft hatte, neben dem Dienst seine Dissertation zu schreiben, dann würde er diesmal als Oberstleutnant garantiert Zeit dafür finden, wozu er noch nie Zeit gehabt hatte: zum Leben. Damaskus schien wie geschaffen dafür. Inshallaah!
Nachdem er das kleine, längliche Päckchen aus der Hand des Dienstführenden entgegengenommen hatte, griff er nach seiner silbernen Füllfeder und schrieb mit blauschwarzer Tinte zügig seinen Namen, Dienstgrad und Geburtsdatum auf die weiße Umschlaglasche: Ronald Bergner...
Er brauchte den schmalen Karton erst gar nicht zu öffnen, um zu wissen, was darin enthalten war: ein Wattestäbchen, dessen Ende er bis spätestens morgen früh in seinen Stuhlgang eintauchen und danach wieder zurück in die Lasche stecken mußte. Nichts hatte sich seit dem letzten Mal geändert, dachte er: die trostlose Kaserne, der miefige Lehrsaal mit den zerkratzten Schulbänken, der alte, griesgrämige Unteroffizier, die leidige Untersuchung, und vermutlich auch sein Stuhlgang nicht.
Sie saßen im Lehrsaal I des häßlichen Mehrzweckgebäudes und füllten eine Unmenge von Zetteln und Formularen für die Untersuchung aus. Da er längst damit fertig war, blickte Bergner kurz durch die Reihen, ob er irgend jemanden kannte. Zugleich wartete er darauf, daß der alte Spieß mit seinem Plastikwäschekorb, aus dem er die Stuhlprobepäckchen verteilte, von der letzten Reihe wieder nach vorne an sein Pult schlenderte. Bevor er sie entließ, würde der Vizeleutnant sicher seinen saublöden Satz von sich geben: „Geht’s scheißn, oder wollts an Anschiß von mir?“ Er hieß übrigens Kotsdorfer.
Da er niemand Bekannten entdecken konnte, wanderte Bergners Blick aus dem Fenster hinaus auf den Sportplatz, wo sie später die 2400 Meter laufen mußten, unter zwölf Minuten, eine einfache Übung, an der viele Untrainierte bereits scheiterten. Meist waren es Reservisten. Über Fünfunddreißig durfte man 12:45 brauchen. Ein Kinderspiel für ihn, da er noch immer regelmäßig trainierte, fast täglich, obwohl er schon längst keine Orientierungsläufe mehr bestritt. Wahrscheinlich würde er unter zehn Minuten bleiben, vielleicht 9:30, wenn er sich etwas anstrengte.
Neben ihm hatte ein kindlich wirkender Leutnant mit bunter Brille sein Stuhlpäckchen geöffnet und das Wattestäbchen herausgezogen. Mit kreisenden Bewegungen seiner Hand und dämlicher Grimasse stocherte er damit in seinem Ohr herum, gerade als der Dienstführende an ihm vorbeiging und sein Gesicht kopfschüttelnd verzog. In breitem Wiener Dialekt wies er den jungen Offizier zurecht, wie es sich nur ein Spieß erlauben darf: „Herr Leitnant, Sie glab’n woi, daß eana Scheiße im Hirn steckt“, worauf dieser purpurrot anlief und sofort das Stäbchen zurück in die Lasche steckte. Der Unteroffizier verließ grinsend den Lehrsaal.
Während Bergner aufstand und das nächste Fenster öffnete, um seinen vernebelten Kopf zu lüften, hämmerte immer wieder die eine Frage gegen seine Schläfen: Wieso muß ich ausgerechnet dort wieder von vorne beginnen, wo ich vor mehr als zehn Jahren aufgehört habe?
Er wußte selbst nur zu gut, daß er keine Antwort darauf finden würde. Was lernt ein Betriebswirt schon über das Leben. Außer Zahlen nichts. Aber das Schicksal ist kein Rechenbeispiel, und seine Lösungen sind nicht beweisbar. Sein Blick richtete sich auf einen Vogel am Horizont, der mit langsamen, fast zeitlupenartigen Flügelschlägen durch ein lichtblaues Himmelsmeer segelte. In diesem Augenblick glaubte er zu wissen, daß seine Entscheidung richtig gewesen war und er derjenige sein würde, den das Schicksal auswählte.
Als er das Fenster wieder schloß, merkte er, daß sich auf dem Sportplatz bereits die ersten Läufer aufwärmten, mit zum Teil seltsam ungelenken, hüpfenden oder dehnenden Bewegungen, an denen er erkannte, daß die meisten von ihnen nicht im Lauftraining standen, denn ein Läufer wärmt sich zuerst immer mit langsamem Laufen auf und nicht sofort durch Gymnastik. Ein Blick auf die Uhr verriet ihm, daß er noch knapp zehn Minuten Zeit hatte, sich umzuziehen und warmzulaufen. Mit ein paar zügigen Schritten war er im ersten Stock des Gebäudes, sperrte sein Zimmer und den Spind auf, den er vorsichtshalber verschlossen hielt. Während des Umziehens lief er langsam auf der Stelle und trieb seinen Puls auf Arbeitsfrequenz. Zuletzt schlüpfte er in seine hellblauen Karhu-Schuhe. Obwohl sie bereits einige tausend Kilometer auf den Noppen hatten, sahen sie immer noch fast neuwertig aus. Man mußte sie nur ab und zu in einem Stoffsack in die Waschmaschine stecken und bei dreißig Grad durch das Schonprogramm laufen lassen.
Er war verliebt in seine Laufschuhe, den einzigen Ausrüstungsgegenstand, den er für seine Sportart brauchte, und er war verliebt in das Laufen selbst, weil es für ihn absolute Freiheit bedeutete. Er konnte laufen, wann immer er wollte, überall, wo er wollte, und vor allem, er brauchte niemanden dazu. Heute war eine Ausnahme. Zusammen mit anderen mußte er sechs öde Runden auf einer Laufbahn drehen, und das in einem vorgegebenen Zeitlimit. Er hielt diesen Test für überflüssig. Würde man Kasparov gegen einen Schachcomputer mit der Kapazität eines Taschenrechners antreten lassen?
Nachdem er seine Rundenzeiten von 1:35 heruntergespult hatte, lief er nach einem kurzen Schlußsprint und einer Zeit von 9:22 ins Ziel ein. Gleich danach tauchte er vor der Aufsicht die geforderten achtzehn Liegestütze herunter. Obwohl er kaum geschwitzt hatte, ging er dann in den Keller duschen, um für den Abend und die möglichen folgenden Ereignisse frisch zu sein.
Die heiße Dusche wirkte angenehm ermüdend. Obwohl es draußen warm war, würde er nach dem Laufen niemals kalt oder gar heiß-kalt duschen. Kälte wirkte für die warmen und extrem durchbluteten Muskeln wie ein Schock und führte langfristig zur Gefahr von Muskeleinrissen oder Sehnenabrissen. Im Zimmer stieg er aus seinen Badeschlapfen, trocknete sich die Füße gut ab und massierte mit einem Kräuterbalsam Fersen und Zehen.
Danach legte er sich nackt auf das Heeresbett, eine Stahlrohrpritsche mit Brettereinlage und einer dünnen Schaumgummiauflage. Es war Mitte Mai, und es gab keinen Grund sich zuzudecken. Seinen Kopf auf dem sogenannten Polster, oder dem, was davon übriggeblieben war, zurechtrückend, schloß er die Augen. Durch nichts abgelenkt, kam er sofort ins Grübeln. Da waren sie wieder, die Selbstvorwürfe, mit denen er sich seit Monaten quälte. In ihrem Mittelpunkt stand eine Person mit lauter Fehlern und Widersprüchen, mit der er am liebsten nichts mehr zu tun gehabt hätte. Und mit jedem Tag, an dem er tiefer in seiner Misere versank, zog sich die Schlinge des Selbstmitleids enger um seinen Hals.
Die einzige Chance war ein Neuanfang. Aber konnte ein Mensch denn ein neues Leben beginnen, solange er selbst der gleiche blieb, mit denselben Gefühlen, denselben Instinkten, denselben Taten, derselben Sprache. Mußten nicht Lebensumstände, Ort, Beruf oder der Partner gewechselt werden? Oder waren das Ausreden, Wunschträume? Man konnte vor seinem Leben doch nicht einfach davonlaufen. Selbst wenn man bis ans Ende der Welt lief, holte es einen irgendwann wieder ein. Wie schnell würde ihn die Vergangenheit einholen, wenn er ab Juli wieder von vorne beginnen würde, sein ganzes gescheitertes Leben, seine Unfähigkeit im Beruf, sein Versagen in der Ehe, seine Kapitulation als Mensch?
Bergners Gedanken verschwammen unter den Pinselstrichen des Traummalers, der ihn porträtierte. Er sah sich selbst laufen. Mit weit ausholenden Schritten, die zu einer einzigen Bewegung verschmolzen, glitt er durch einen feuerfarbenen Laubwald, sein Puls war gleichförmig, und er lächelte. Das Rascheln unter seinen Füßen hörte sich an wie das Knattern von Flügeln, und er hatte das Gefühl, abzuheben und knapp über dem Boden dahinzuschweben. Sein Gesicht strahlte, und wenn es so etwas wie Erleuchtung gab, dann spürte er sie in diesem Augenblick. Der Weg, auf dem er lief, hörte nie auf, und er würde nicht müde werden, ihn weiterzulaufen, bis ans Ende der Welt.
Als er aufwachte, war es bereits dunkel. Seine Verabredung fiel ihm ein, und ein Blick auf seine blaue Swatch sagte ihm, daß er spät dran war. Aber eine Hausfrau hatte Zeit zum Warten, dachte er sich, schließlich wartete sie das ganze Leben lang auf ihren Mann oder die Kinder. Er zog sich an, eine verwaschene Boss-Jeans, dazu ein weißes Kurzarmhemd, eine rotgetupfte Krawatte und ein anthrazitfarbenes Sakko. Er steckte sich das grüne Wehrdienstbuch in die linke Innentasche, überprüfte den Inhalt seiner Geldtasche und schloß den Spind und die Zimmertür ab.
Auf dem Weg zum Haupttor der Kaserne überlegte er, ob er sie von der Telefonzelle aus anrufen sollte, ließ es aber bleiben, weil er fürchtete, daß sie eine Entschuldigung von ihm verlangen würde, und es vielleicht zu einem Streit käme. Daß er doch noch gekommen wäre, würde mehr wiegen als seine Verspätung. Das Kasernentor stand offen, und der Wachposten ließ ihn passieren. Direkt gegenüber der Van-Swieten-Kaserne wartete er, nachdem er die Brünner Straße überquert hatte, auf die nächste Straßenbahn, die ihn zum Bahnhof Floridsdorf brachte. Er stieg in die U6 um und in Meidling in die Südbahn. Von dort waren es noch gut zwanzig Minuten bis nach Bad Vöslau, wo er ein Taxi zu ihrem Haus nahm. Etwa hundert Meter davor stieg er aus und ging zu Fuß weiter.
Als er an der Gartentür stehenblieb, bemerkte er Licht im Haus und fühlte sich beobachtet. Er wußte, daß sie allein daheim war. Ihr Mann, ein UNO-Beamter, mit dem sie Englisch sprach, war mit ihren beiden Töchtern über die Pfingstferien zu Hause in Irland. Das kleine bunte Türschild neben der Klingel war aus Fimo zu einem Vierklee geformt, mit den Namen Hanna, Ian, Lisa und Denise in den Kleeblättern und dem Familiennamen im Stengel. Sie hieß jetzt Hougnon und nicht mehr Hager wie damals, als sie noch zusammen zur Schule gegangen waren.
Sie öffnete in dem Augenblick, als sein Finger gegen den Klingelknopf drückte. „Du kommst spät“, stellte sie fest, aber in einem versöhnlichen Ton.
„Ich war noch laufen“, versuchte er sich zu entschuldigen, so gut es ging.
Sie sah ihn fragend an, zugleich zog sie ihn bei der Tür herein. Ein herber Duft entfaltete sich im Zimmer, ihr langes, kastanienbraun gefärbtes Haar glänzte einladend. Am liebsten hätte er sie auf der Stelle geküßt.
„Willst du etwas trinken? Ich habe Sekt kalt gestellt“, ihre Einladung klang bittend.
Er nickte und setzte sein spitzbübisches Lächeln auf, das sie so an ihm liebte, weil es sie an ihren Lieblingsschauspieler Mel Gibson erinnerte. Sie holte Gläser, echte Riedel, und bat ihn, die Flasche zu öffnen. Sichtlich nervös nahm sie hastig einen kräftigen Schluck, nachdem sie sich beide auf die Ledercouch gesetzt hatten.
„Ich werde für ein Jahr weggehen ...“, fing er plötzlich völlig überraschend an, er hatte ihr bis dahin nichts davon erzählt. Ihr Blick suchte irgendwo Halt in seinen Augen, während er ihr nachschenkte, „... ich habe mich für den Golan gemeldet.“
„Du spinnst! – Warum?“
„Weil es für mich eine Chance ist, Abstand zu gewinnen.“ Er sagte es leise, um sie nicht noch mehr zu verletzen.
„Aber was ist mit uns?“ Sie starrte ihn entgeistert an.
„Wir können uns schreiben, telefonieren.“ Er wollte der Situation das Dramatische nehmen und setzte zu einem Lachen an, verschluckte sich aber und mußte husten.
Sie trank ihr Glas mit einem Schluck leer und lachte mit einem abfälligen Zug um ihre Mundwinkel zurück. „Das soll wohl ein Witz sein?“
„Wenn es dich beruhigt, meine Frau hat dasselbe gesagt.“ Er öffnete seine verschränkten Hände und deutete eine versöhnliche Geste an.
„Ich kann sie gut verstehen“, schüttelte sie den Kopf, „mit dir verheiratet zu sein ...“
„Erinnere mich bloß nicht ... Siebzehn Jahre Krieg und Frieden.“
„Du kannst das ja ändern“, gab sie zurück, betont schnippisch, obwohl sie es genau so meinte.
Er blickte sie mit einem Anflug von Zorn an und fragte mit bitterem Unterton: „Und du, willst du dich etwa auch scheiden lassen?“
„Wegen dir bestimmt nicht.“
Er spürte, daß ihre Stimmung in Enttäuschung umschlug. Sie hatte ihre Füße zum Oberkörper hin angezogen und den Kopf auf ein Knie gelegt. Ihre Haltung hatte etwas von einem Vogel, dessen Käfig offenstand, der aber Angst vor der Freiheit hatte. Jetzt bemerkte er auch, daß sie ihre Zehennägel in demselben Braunrosé lackiert hatte wie ihre kurzgeschnittenen Fingernägel.
„Ich würde nie wieder heiraten!“ Während er das sagte, bereute er es bereits, aber ihre Antwort überraschte ihn noch mehr. „Ich würde auch nie mehr heiraten ...“ Sie trank noch einen Schluck und fügte hinzu: „... meinen Mann.“
„Warum sagst du das?“
„Weil ich lieber dich geheiratet hätte.“ Sie blickte ihn lange an. Es kam ihm vor, als spiegelten sich die Wellen des Pfrillsees in ihren hellgrünen Augen, und als er es ihr sagte, mochte sie das Kompliment. Es erinnerte sie an ihre gemeinsame Jugendzeit, an den kleinen versteckten Bergsee in der Nähe ihrer Heimatstadt, die sie beide nach der Schule verlassen hatten.
Plötzlich streckte sie ihre Hand aus und fuhr ihm zärtlich durch das kurzgeschnittene Haar. Mit dem Zeigefinger zeichnete sie Spiralen in seinen hohen Stirnansatz. „Ich würde gern mit dir schmusen“, sagte sie beinahe flüsternd, den ungeschminkten Mund ließ sie dabei leicht geöffnet, wie erschrokken. Er bemerkte, daß ihre Lippen ein wenig spröde waren, beugte sich langsam zu ihr und küßte sie, so zärtlich er konnte. Dabei streichelte er vorsichtig ihre Brustwarzen, die unter dem zimtfarbenen Body schon ganz hart geworden waren. Nach einer Ewigkeit, in der sich ihre ausgehungerten Körper gegenseitig mit Zärtlichkeiten erkundeten, spürte er, daß ihre Hände immer verlangender wurden, und er wußte, daß er sie nicht mehr zu fragen brauchte, ob sie mit ihm schlafen wollte.
Gegen vier Uhr morgens fuhr sie ihn mit ihrem Mercedes zurück in die Kaserne, weil sie nicht wollte, daß er bis zum Morgen bei ihr blieb. Sie schwiegen beide während der Fahrt, nur einmal fragte sie ihn kurz, ob er sie anrufen oder ihr schreiben würde. Bergner nickte abwesend.
Vor dem Kasernentor griff er ihr ins Lenkrad und hupte der Wache, während sie den Motor laufen ließ. Sie küßten sich lange, bis der Posten mit dem Finger gegen das Fenster klopfte. Wahrscheinlich hatte er ihnen eine Weile lang zugesehen und wollte zurück ins Wachlokal. Ohne ein Wort zu sagen, schlüpfte Bergner aus dem Wagen und zeigte unaufgefordert seinen Ausweis. Der Wachposten blätterte im Wehrdienstbuch und schlug zuerst die Seite mit seinem Foto auf, dann die, auf der seine Beförderungen eingetragen waren. Etwas verschlafen nahm der Soldat die Grundstellung ein. Anstatt zu salutieren, griff er mit der linken Hand an den Lauf der umgehängten Waffe, mit der rechten an den Gewehrkolben, etwas lasch, aber vorschriftsmäßig. Dazu murmelte er: „Weg frei!“ Währenddessen hatte sie ihren Wagen gewendet und bog nun bereits in die Brünner Straße ein. Bergner hatte sich die ganze Zeit lang nicht nach ihr umgedreht.
Auf dem Weg zu seinem Zimmer bemerkte Bergner, daß er seine Krawatte bei ihr vergessen hatte. Es war fünf Uhr früh, und bis zum Aufstehen blieben ihm noch anderthalb Stunden Schlaf. Er stellte seinen Wecker auf halb sieben und legte das Stuhlpäckchen daneben hin. Irgendwie gelang es ihm einzuschlafen ...
Es war Zeit zum Mittagessen, als der letzte Mann mit den medizinischen Untersuchungen fertig war. Zuerst war es zum Lungenröntgen gegangen, danach ins Labor, wo ihnen mehrere Röhrchen Blut abgezapft worden waren. Unterbrochen von langen Pausen, folgten die Fachärzte für Innere Medizin, HNO, Augen- und Zahnmedizin, den Abschluß bildete die peinlichste Untersuchung, die für Haut- und Geschlechtskrankheiten. Bei der Schlußuntersuchung mit dem Oberstarzt wurden die Befunde besprochen. Die Laborwerte würden erst in zwei Tagen vorliegen, ansonsten hatte er alles bestanden.
Am Nachmittag standen dann die verschiedenen Tests der Heerespsychologen am Programm, mit denen herausgefiltert werden sollte, ob jemand psychopathisch oder suizid veranlagt war, ob man mit dem psychischen Streß eines Auslandseinsatzes fertig würde. Bei Bergner ging das alles sehr rasch. Es war ja nicht sein erster Einsatz, und niemand zweifelte an der psychischen Verfassung eines Oberstleutnants – außer er selbst vielleicht.
Danach hatte er frei. Er zog sich um und ging laufen. Bergner rannte aus der Kaserne hinaus und trabte etwa zwanzig Minuten auf einem Schotterweg an einem kleinen Kanal entlang, bis er die Müdigkeit spürte, die durch seine Füße über den Rücken in den Kopf hinaufkroch. Er überquerte eine Holzbrücke, um auf der anderen Uferseite zurückzulaufen. Seine Laufschuhe wurden schwer wie Blei, und er quälte sich Schritt für Schritt vorwärts. Schon wieder brannten ihm quälende Fragen Löcher ins Gehirn. Da waren Schuldgefühle wegen der vergangenen Nacht, Bedenken, Angst vor der Zukunft, Zweifel. Er redete sich ein, nichts Falsches getan zu haben, und konnte sich nicht erklären, womit er seine aussichtslose Lage verdient hatte. Gewiß, der Golan war eine Flucht vor seinen Problemen. Mußte er zugeben. Aber was blieb ihm anderes übrig, versuchte er sich selbst von der Richtigkeit seiner Entscheidung zu überzeugen. Und wenn dieser Schritt falsch sein sollte, war er dann nicht immer noch besser, als weiter auf der Stelle zu treten? Die Hoffnung blieb, daß er durch diesen Einsatz auf eine neue Sache stoßen würde. Vielleicht nahm sein Leben eine Wendung.
Den Bunkertest hatte Bergner als Stabsoffizier nicht mitmachen müssen, so erschien er am nächsten Morgen gut ausgeschlafen beim schriftlichen Test über sein militärisches Wissen. Dann wurden mündlich Kartenkunde und Orientieren im Gelände geprüft. Der Ausbildner stellte ihm eine scheinbar schwierige Aufgabe, bei der er auf einer Militärkarte mittels Bussole und einer vorgegebenen Marschzahl den genauen Standort durch Rückwärtseinschneiden bestimmen mußte. Außerdem mußte er die Koordinaten eines markanten Punktes mit Rechts- und Hochwert beschreiben.
Funkgerätelehre samt Funksprechverkehr war für Bergner als gelernten Fernmeldeoffizier ein Klacks. Anschließend mußte er eine „gebrochene“ Hand schienen, bevor er zu den Fragen über die im Einsatzraum verwendeten Waffen Sturmgewehr, Maschinengewehr und Pistole kam. Bergner haßte diesen Teil, weil er Waffen seit dem Einrücken nicht ausstehen konnte. Zu seinem Glück war der Prüfer ein Unteroffizier, den er vom letzten Einsatz her kannte. Er hakte ihn auf seiner Liste einfach ab, ohne ihm eine Frage zu stellen. Dafür interessierte er sich umso mehr für sein Privatleben, letztendlich noch unangenehmer. Zum Glück drängte hinter ihm ein Waffennarr, der darauf brannte, ein Gewehr zu zerlegen. Er kannte diesen Typ UN-Söldner: bereit, für den Frieden in den Krieg zu ziehen.
Gegen Mittag war das ganze Theater zu Ende, und es stellte sich heraus, daß von den ursprünglich vierzig Mann vorläufig nur zwölf übriggeblieben waren, die für einen Auslandseinsatz in Frage kamen, wobei die gefürchteten Laborwerte noch fehlten, vor allem die Leberwerte. Für Bergner sicher kein Problem. Er zog sich um und stürmte so schnell es ging aus der Kaserne zum Westbahnhof, um den nächsten Zug nach Hause zu erreichen.
ANKUNFT
Punkt zehn Uhr dreißig stieg die Maschine in den Himmel. Es war Montag, der 1. Juli, und Linienflug OS 707, ein Airbus der Austrian Airlines, nahm Kurs auf Damaskus. Der Flieger war kaum zur Hälfte ausgebucht. Mehrere UN-Soldaten befanden sich auf dem Rückflug von ihrem Heimaturlaub in Österreich. Obwohl Bergner auch in Uniform flog, hatte er absichtlich nicht bei ihnen Platz genommen. Er wollte nicht viereinhalb Stunden lang ihre Neugier füttern.
Beim Start hielt er die Augen geschlossen. Er dachte an die schmerzhafte Trennung von seiner Familie. Seine Frau hatte sich mit den Kindern zu Hause von ihm verabschiedet. Sie wollte sich bis zuletzt nicht festlegen, ob sie sich nun scheiden ließ oder ihm verzieh. Die Zeit würde für sie arbeiten, meinte sie. Auf keinen Fall sollte er sich die ganze Sache noch einmal überlegen und im letzten Moment vielleicht doch zu Hause bleiben. Irgendwie war sie froh, endlich allein zu sein und mit sich ins reine zu kommen. Ablenkung gab es ja genug mit den Kindern und ihrem Geschäft, dem sie sich jetzt vielleicht mehr widmen konnte.
Vielleicht war nach dem Jahr ein Neubeginn möglich, redete er sich ein. Aber er hatte Angst und wünschte sich, er hätte sich nie darauf eingelassen. Doch das Schicksal mischt seine Karten selbst, hatte er kürzlich irgendwo gelesen, und wer nicht damit einverstanden ist, sollte sich erst gar nicht an den Spieltisch setzen. Das Leben ist ein schlechter Verlierer, wenn man versucht, die Karten zu zinken. Er liebte solche Vergleiche.
Erst als jemand seinen Namen nannte, öffnete Bergner die Augen wieder. Neben ihm saß jetzt ein junger Unteroffizier. „Entschuldigen Sie, Herr Oberstleutnant ...“
„Ja, bitte?“
„... sind Sie der neue Offizier im Hauptquartier?“ fragte der Heimaturlauber, obwohl er die Antwort schon kennen mußte.
„Wer möchte das wissen?“ forschte Bergner nach und bemerkte das fehlende Namensschild.
„Wachtmeister Finke, Schreiber in der Kanzlei des Hauptquartiers“, gab der Unteroffizier bereitwillig Auskunft, „ich habe Ihren Personalakt bearbeitet.“
„Und was habe ich verbrochen?“ Er wollte den jungen Soldaten ein wenig provozieren.
„Natürlich nichts, Herr Oberstleutnant, aber mir ist in diesem Zusammenhang etwas Merkwürdiges aufgefallen.“ Seine Stirnfalten wellten sich. „Ein paar Tage nachdem wir Ihre Daten dem syrischen Verbindungsbüro gemeldet hatten, kam die Anfrage, ob wir nicht auch die Daten Ihrer Familie nachreichen könnten.“
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!





























