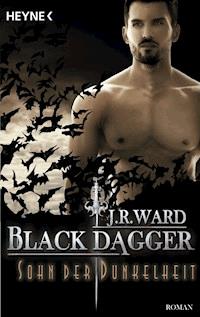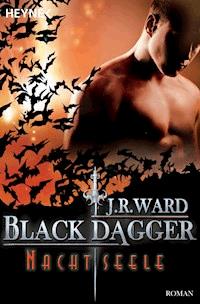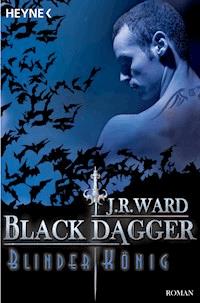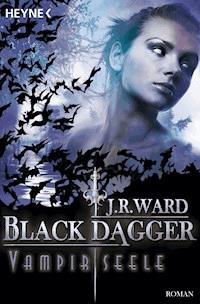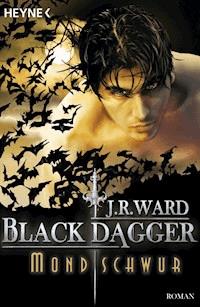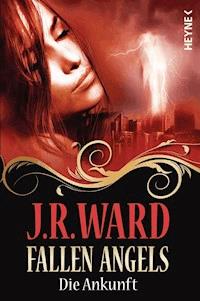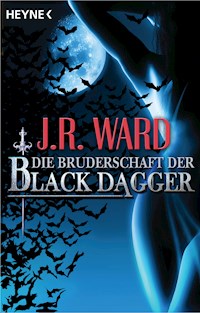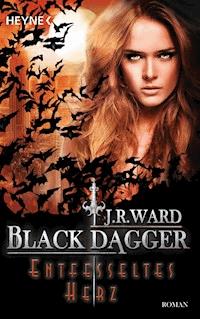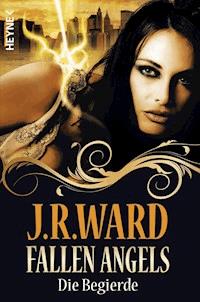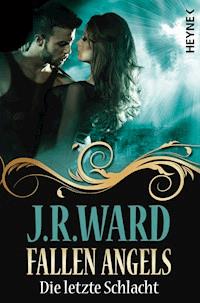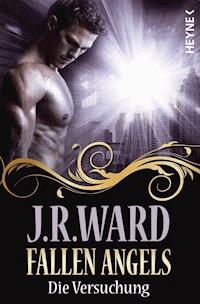11,99 €
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: FALLEN ANGELS
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Die atemberaubende Fortsetzung der großen SPIEGEL-Bestsellerserie
Seit Anbeginn der Zeit herrscht Krieg zwischen den Mächten des Lichts und der Finsternis. Nun wurde ein Gefallener Engel dazu auserwählt, den Kampf ein für alle Mal zu entscheiden. Sein Auftrag: Er soll die Seelen von sieben Menschen erlösen. Sein Problem: Ein weiblicher Dämon macht ihm dabei die Hölle heiß ...
Nach dem Bestsellererfolg BLACK DAGGER kommen J. R. Wards FALLEN ANGELS – atemberaubend düster und erotisch!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 653
Ähnliche
J. R. WARD
FALLEN ANGELS
Der Rebell
Roman
Aus dem Amerikanischen
von Astrid Finke
Für Dr. David B. Fox,
der in vielerlei Hinsicht das schönste Lächeln macht.
Eins
Es war Frühling, an einem dunklen Aprilabend, als Detective Thomas DelVecchio jr. erlebte, dass Albträume tatsächlich den Sprung aus dem Kopf in die reale Welt schaffen konnten.
Leider war das für ihn keine neue Erkenntnis.
Überall war Blut. Glänzend und im Mondlicht schimmernd, als hätte jemand einen Farbeimer geöffnet und nicht nur wild über den Waldboden verspritzt … sondern auch über den Mann, der zerfetzt und reglos auf einem Bett aus verrottendem Laub lag.
Genau vor Vecks Füßen.
Das Zeug war allerdings keine Premium-Wandfarbe. Kein wasserlöslicher Lack und auch kein robuster Fassadenanstrich. Man konnte es weder im Baumarkt kaufen noch mit Terpentin entfernen und auch nicht in einem B-Movie verwenden.
Das hier war das echte Leben. Floss in alle Richtungen davon.
Was hatte er getan? Großer Gott …
Er riss sich die Lederjacke vom Leib, knüllte sie zusammen, kniete sich hin und drückte sie auf den freiliegenden Brustkorb des Mannes. Gurgelgeräusche vermischten sich mit den harten Stößen von Vecks eigenem Atem, während er in Augen blickte, die rapide trüb wurden.
»Hab ich dich umgebracht? Habe ich das getan?«
Keine Antwort. Wahrscheinlich hing der Kehlkopf des Burschen da irgendwo an einem Ast.
Scheiße … oh Scheiße … es war wie in der Nacht, als seine Mutter getötet wurde.
Nur dass er dieses Mal gekommen war, um tatsächlich jemanden aufzuschlitzen.
Veck erinnerte sich noch genau: Er hatte sich auf sein Motorrad gesetzt, war hierhergefahren und hatte im Wald gewartet, bis dieses psychotische Dreckschwein aufgetaucht war – wobei er sich die ganze Zeit die Lüge eingeredet hatte, er wolle den »Verdächtigen« nur in Gewahrsam nehmen.
Seine Handfläche hatte die Wahrheit verraten. Als seine Beute endlich erschienen war, hatte das Messer plötzlich in seiner Hand gelegen, und er hatte sich in seinen absichtlich komplett schwarzen Klamotten wie ein Schatten genähert …
Das Monroe Motel & Suites lag nur fünfzehn Meter entfernt, jenseits des dichten Kieferngebüschs. Es war ein zwielichtiges, von pissgelben Laternen beleuchtetes Stundenhotel und der Grund, warum er selbst wie auch der geschredderte Mörder dort auf dem Waldboden heute Nacht hergekommen waren.
Serienkiller bewahrten oft Trophäen von ihren Opfern auf. Wegen ihrer Unfähigkeit zu normalen emotionalen Bindungen und ihrem Bedürfnis nach greifbaren Symbolen der flüchtigen Macht, die sie über ihre Beute genossen hatten, übertrugen sie Gefühle auf Gegenstände oder Überreste der Menschen, die sie abgeschlachtet hatten.
David Kroner war seine Andenkensammlung vor zwei Tagen abhandengekommen. Als seine Arbeit hier gestört worden und die Polizei angerückt war.
Deshalb würde er selbstverständlich an den Ort zurückkehren, an dem er zuletzt Macht empfunden hatte. Hier wäre er all dem, was er einst besessen hatte, am nächsten.
»Ich habe einen Krankenwagen gerufen«, hörte Veck sich sagen, ohne genau zu wissen, mit wem er sprach.
Sein Blick wanderte zum hintersten Zimmer des Motels, dem von der Rezeption am weitesten entfernten. Ein amtliches Polizeisiegel des Caldwell Police Departments klebte über Tür und Rahmen. Vor Vecks geistigem Auge blitzte auf, was er und seine Kollegen dort vorgestern gefunden hatten: Eine weitere junge Frau, die eben erst getötet und von ihrem Mörder nach fleischlichen Souvenirs untersucht worden war.
Wieder Gegurgel.
Veck senkte den Kopf. Der Mann, der da vor ihm verblutete, war drahtig und dünn, aber David Kroners Opfer waren ja auch junge Frauen zwischen sechzehn und vierundzwanzig gewesen, daher brauchte der Kerl auch kein Türsteherformat zu haben. Er hatte rötlich blondes Haar, das sich auf dem Kopf bereits lichtete. Die einst blassweiße Haut wurde allmählich grau – zumindest an den Stellen, die nicht mit Blut beschmiert waren.
Veck wühlte in seiner internen Datenbank und versuchte, sich zu erinnern, was zum Henker eigentlich gerade passiert war. Nach gefühlt tagelanger Warterei hatte ihn das Knacken von Zweigen aufgeschreckt, und er hatte Kroner entdeckt, der auf Zehenspitzen durch die Bäume schlich.
Sobald er den Mann sah, hatte er nach dem Messer gegriffen, sich geduckt, und dann hatte er …
»Verfluchte …«
Der Kopfschmerz setzte abrupt und heftig ein, als hätte ihm jemand einen Zimmermannsnagel in den Stirnlappen getrieben. Er hob die Hand, lauschte nach links zum Parkplatz hin und dachte: Na super! Wenn der Krankenwagen käme, könnte er ihn gleich wegen eines Aneurysmas behandeln.
Dann hätten sie wenigstens etwas zu tun – denn Kroner wäre hinüber, bis sie einträfen.
Als der brüllende Schmerz etwas nachließ, unternahm Veck einen erneuten Anlauf, sich zu erinnern … nur um mit der Schläfe voran gleich noch mal gegen die Mauer von Migräne und Ohnmacht zu prallen. In seinem Kopf wurde alles leuchtend rot, er schloss die Augen und spielte mit dem Gedanken, sich zu übergeben – und während die Reihern-oder-nicht-Reihern-Debatte in seinen Eingeweiden tobte, kam er zu dem Schluss, dass es Zeit wurde, ehrlich zu sich selbst zu sein. Denn auch wenn in seinem Kurzzeitgedächtnis ein gähnendes Loch klaffte, gab es an einem nichts zu deuteln: Er war hierhergekommen, um diesen perversen Wichser zu töten, der – nach derzeitiger Zählung – im vergangenen Jahr mindestens elf junge Frauen zwischen Chicago und Caldwell umgebracht hatte.
Grauenhaft, natürlich. Allerdings amateurhaft im Vergleich zu Vecks eigenem Vater, der das im Zeitraum von drei Monaten vollbracht hatte: Thomas DelVecchio sr. war das große Vorbild von Kerlen wie Kroner.
Und genau diese Abstammung hatte ihn in eine Zwickmühle nicht nur in Bezug auf den Krankenwagen, sondern auch auf seinen Partner bei der Mordkommission gebracht.
Sosehr es ihm widerstrebte, es sich einzugestehen – er war seines Vaters Sohn. Er war gekommen, um zu töten. Punkt. Und dass sein Opfer ein so brutales Arschloch war, stellte letztendlich nur einen gesellschaftlich akzeptablen Filter über dem realen Bild dar.
Im Kern war es nicht darum gegangen, die toten Frauen zu rächen.
Und er hatte verflucht noch mal gewusst, dass diese Nacht unausweichlich kommen würde. Sein ganzes Leben lang hatte der Schatten hinter ihm gelauert, ihn geleitet, verführt, hin zu diesem Schauplatz der Zerstörung gezogen. Deshalb leuchtete auch ein, dass er sich an nichts erinnerte; seine andere Hälfte hatte die Kontrolle übernommen und sie erst wieder abgetreten, als die Gewalt begangen war. Der Beweis dafür? Irgendwo in seinem Hinterkopf hallte Gelächter, wahnsinnig und befriedigt.
Ja, ja, freu dich nur, solange du kannst, dachte er. Denn er würde sich selbst nicht weiter in die Fußstapfen seines Vaters treten lassen.
Das Heulen von Sirenen drang von Osten her zu ihm vor und wurde rasch lauter.
Offenbar war er nicht der Einzige, der es hörte. Ein Mann stürzte aus einem der Motelzimmer und rannte um die Motorhaube einer zehn Jahre alten Schrottkarre herum, die statt Seitenfenstern Gitter besaß. Er kämpfte damit, den Schlüssel aus der Tasche zu fummeln, da er gleichzeitig noch seine Hose hochziehen musste.
Die Nächste in der Fluchtparade war eine grobschlächtig wirkende Frau, die in einen alten Honda Civic kletterte, während sie noch hektisch ihren Minirock herunterzog.
Ihre Abreise mit quietschenden Reifen sorgte dafür, dass der Parkplatz leer war, als der Krankenwagen von der Straße einbog und vor der Rezeption anhielt.
Der Sanitäter stieg aus, und ein Motelmitarbeiter öffnete die Glastür, woraufhin Veck laut vernehmlich pfiff. »Hier drüben!«
Offenbar hatte der Motelangestellte nicht die Absicht, sich einzumischen, und verdrückte sich gleich wieder ins Gebäude. Der Sanitäter hingegen setzte sich in Trab, und der Krankenwagen rollte quer über den Parkplatz. Während sie ihn einkreisten, wurde Veck vollkommen ruhig. So unantastbar wie der kalte, weit entfernte Mond, der über die pechschwarze Nacht wachte.
Scheiß auf seine dunkle Seite. Er hatte das hier getan. Und er würde persönlich dafür sorgen, dass er dafür auch zur Rechenschaft gezogen wurde.
Sophia Reilly, Mitarbeiterin des Dezernats für Interne Ermittlungen, raste in einem Affenzahn mit ihrem zivilen Dienstwagen durch das Hinterland von Caldwells verwahrlosten Randbezirken. Allerdings hatte ihr mörderisches Tempo nur wenig damit zu tun, dass sie auf dem Weg zu einem Tatort war: Sie fuhr stets schnell. Aß hastig. Hasste es, in Schlangen zu stehen, auf Leute zu warten, auf Information zu warten.
Solange ihr kein Reh vors Auto lief, bevor sie das Monroe Motel & Suites erreicht hatte …
Als ihr Handy klingelte, hielt sie es noch vor dem zweiten Klingeln ans Ohr. »Reilly.«
»De la Cruz.«
»Hallo. Raten Sie mal, wohin ich gerade fahre.«
»Wer hat Sie angerufen?«
»Die Zentrale. Ihr Partner steht auf meiner To-do-Liste – wenn er also mitten in der Nacht einen Krankenwagen sowie Verstärkung ruft und sagt, er wisse nicht, was mit dem Opfer passiert sei, erhalte ich einen Anruf.«
Leider gewöhnte sie sich langsam schon daran. Thomas DelVecchio jr. arbeitete erst seit zwei Wochen bei der Mordkommission und war bereits knapp an einer Suspendierung vorbeigeschrammt, weil er einen Paparazzo, der heimlich ein Bild von einem Opfer schießen wollte, k. o. geschlagen hatte.
Im Gegensatz zu dieser Nummer jetzt war das allerdings ein Klacks.
»Woher wissen Sie es?«, fragte sie.
»Er hat mich aufgeweckt.«
»Wie klang er?«
»Ich will ehrlich zu Ihnen sein.«
»Das sind Sie immer, de la Cruz.«
»Er klang völlig in Ordnung. Klagte über Kopfschmerzen und Gedächtnisverlust. Er sagte, da sei viel Blut und er sei hundertprozentig sicher, dass das Opfer David Kroner sei.«
Alias der kranke Bastard, der junge Frauen zerstückelt und Körperteile seiner Opfer aufgehoben hatte. Die letzte »Session« hatte vorletzte Nacht in diesem Motel stattgefunden, war aber von Unbekannten gestört worden. Daraufhin war Kroner durch das Klofenster geflüchtet und hatte eine furchtbar zugerichtete Leiche sowie einen Lastwagen voller Gläser mit präparierten Leichenteilen und anderer Gegenstände zurückgelassen – die jetzt samt und sonders im Polizeipräsidium katalogisiert und landesweit Vermisstenfällen zugeordnet wurden.
»Haben Sie ihn gefragt, ob er es getan hat?« Als Mitarbeiterin des Internen Ermittlungsdezernats untersuchte Reilly die Verfehlungen ihrer eigenen Kollegen, und obwohl sie stolz auf ihre Arbeit war, machte es ihr keine Freude, dass Angehörige ihres Berufsstandes überhaupt etwas zu tun bekamen. Viel besser wäre es, wenn alle – einschließlich der Polizei – gesetzestreu wären und sich an die Regeln hielten.
»Er meinte, er wisse es nicht.«
Blackout beim Begehen eines Mordes? Nicht ungewöhnlich. Besonders, wenn eine Affekthandlung vorlag – wie beispielsweise im Falle eines Ermittlers der Mordkommission, der einen abartigen Serienmörder ausknipste. Und Veck hatte sich bereits als Hitzkopf beim Beschützen oder Verteidigen von Opfern erwiesen. Na ja, als Hitzkopf, Punkt. Wobei der Mann ein sehr kluger, sexy Hitzkopf …
Nicht, dass die Sache mit dem sexy irgendwie relevant wäre.
Nicht im Geringsten.
»Wann sind Sie voraussichtlich am Tatort, de la Cruz?«, fragte sie.
»In circa fünfzehn Minuten.«
»Ich bin nur noch einen guten Kilometer weg. Wir sehen uns dort.«
»Alles klar.«
Reilly steckte das Handy in die Innentasche ihrer Jacke und rutschte auf ihrem Sitz herum. Ein Angehöriger der Polizei als möglicher Verdächtiger in einer Mordermittlung – Vecks Notruf zufolge war die Wahrscheinlichkeit, dass Kroner überlebte, gering – schuf diverse Interessenskonflikte. Meistens kümmerten sich die Kollegen vom Internen Ermittlungsdezernat um Korruptionsfälle, Verfahrensverletzungen und Fragen der beruflichen Kompetenz. Aber eine Situation wie die vorliegende versetzte die Kollegen aus Vecks eigener Abteilung in die unangenehme Lage, beurteilen zu müssen, ob einer von ihnen ein Verbrechen begangen hatte.
Mannomann, je nachdem, wie die Ermittlungen liefen, müsste sie vielleicht sogar einen externen Ausschuss anrufen, um eine Entscheidung zu fällen. Aber dafür war es noch zu früh.
Nicht zu früh war es allerdings, über Vecks Vater nachzudenken.
Jeder wusste, wer der Mann war, und Reilly musste zugeben, dass sie ohne diese Blutsbande möglicherweise nicht ganz so in Alarmbereitschaft gewesen wäre … und in Sorge, dass gewissermaßen Rache in Gestalt eines DelVecchios stattgefunden hatte.
Thomas sr. war einer der berüchtigtsten Serienmörder des späten zwanzigsten Jahrhunderts. Offiziell war er in »nur« achtundzwanzig Fällen des Mordes angeklagt und verurteilt worden. Aber sein Name wurde mit noch etwa dreißig weiteren in Verbindung gebracht, und das waren nur die, von denen die Behörden in vier Staaten wussten. Vieles sprach dafür, dass es noch Dutzende vermisster Frauen gab, die ihm zum Opfer gefallen waren, aber nicht zweifelsfrei mit ihm in Verbindung gebracht werden konnten.
Also ja, wäre Vecks Vater Anwalt oder Buchhalter oder Lehrer gewesen, dann wäre sie nicht ganz so beunruhigt gewesen. Aber die Sache mit dem Apfel, der nicht weit vom Stamm fällt, war nicht ganz belanglos, wenn es um Serienkiller und ihre Söhne ging.
Hinter einer niedrigen Brücke lag das Monroe Motel & Suites auf der rechten Seite. Sie bog ab und fuhr an der Rezeption vorbei auf den hinteren Teil des Parkplatzes am Waldrand. Dort stieg sie mit ihrem Rucksack aus. Der süßliche Geruch des Diesels vom Krankenwagen brachte sie zum Niesen, gleich danach schnappte sie den Duft von Kiefernzweigen auf … neben dem unverkennbaren Kupfergeruch von frischem Blut.
Die Sanitäter hatten ihr Fahrzeug so abgestellt, dass die Front zum Wald zeigte, und im Scheinwerferlicht mühten sich beide an dem blutigen Körper des Verletzten ab. Die Kleider des Opfers waren heruntergeschnitten – oder heruntergerissen – worden, was ein Wirrwarr von mehr Wunden, als man zählen konnte, entblößte.
Auf keinen Fall würde er überleben, dachte Reilly.
Und dann entdeckte sie Veck. Er stand etwas seitlich, breitbeinig, mit verschränkten Armen und einer Miene, die … absolut nichts erkennen ließ. Genau wie de la Cruz gesagt hatte.
Großer Gott, der Kerl hätte genauso gut an der Supermarktkasse anstehen können.
Sie wappnete sich innerlich, als sie über das federnde Bett aus Laub und weicher Erde lief. Obwohl das, wenn sie ehrlich war, nicht nur an dem Tatort lag, sondern auch an dem Mann, dessentwegen sie hier war.
Sie bemerkte das schwarze Motorrad, das am Waldrand geparkt war. Es gehörte ihm; sie hatte es schon vor dem Präsidium gesehen. Um genau zu sein, hatte sie ihn von ihrem Fenster aus beobachtet, wenn er aufstieg, die Maschine startete und losraste. Er trug seinen Helm – meistens.
Sie wusste, dass viele Frauen auf der Wache ihn ebenfalls heimlich anstarrten, aber es gab ja auch einiges zu sehen: DelVecchio hatte breite Schultern und schmale Hüften und war gebaut wie ein Boxer, doch sein Gesicht war eher hübscher Junge als Faustkämpfer; zumindest, wenn man seinen Blick außen vor ließ. Diese kalten, intelligenten, dunkelblauen Augen machten aus dem smarten Modeltypen einen echten Mann.
Als Reilly vor ihm stehen blieb, fiel ihr als Erstes das Blut auf seinem Rolli auf. Hier und da ein paar Spritzer, keine großen Flecken oder aufgeweichten Stellen.
Keine Kratzer auf dem Gesicht. Oder dem Hals.
Kleidung und Mütze waren in gutem Zustand – nichts hing schief, nichts war zerrissen oder abgescheuert. Auf den Knien seiner schwarzen Hose sah sie zwei Matschkreise. Die Pistole steckte im Holster. Ob er noch andere Waffen bei sich trug, war nicht zu erkennen.
Er sagte nichts. Kein »Ich war’s nicht« oder »Ich kann das erklären«.
Stattdessen richtete er die Augen auf sie und … das war alles.
Ohne überflüssige Höflichkeiten kam sie gleich zur Sache. »Die Zentrale hat mich informiert.«
»Dachte ich mir schon.«
»Sind Sie verletzt?«
»Nein.«
»Was dagegen, wenn ich Ihnen ein paar Fragen stelle?«
»Nur zu.«
Gott, er war so beherrscht. »Was hat Sie heute Nacht hergeführt?«
»Ich wusste, Kroner würde zurückkommen. Er musste. Nachdem seine Sammlung beschlagnahmt worden war, besaß er keine greifbaren Beweise seiner Arbeit mehr, also ist das hier eine heilige Stätte für ihn.«
»Und was geschah, als Sie hier eintrafen?«
»Ich habe gewartet. Er kam … und dann …« Veck zögerte, zog die Augenbrauen fest zusammen, dann rieb er sich mit einer Hand die Schläfe. »Mist …«
»Detective?«
»Ich kann mich nicht erinnern.« Er blickte ihr wieder direkt in die Augen. »Ich kann mich an nichts erinnern, seit er aufgetaucht ist, und das ist die reine Wahrheit. Im einen Moment läuft er durch den Wald, im nächsten ist überall Blut.«
»Darf ich Ihre Hände sehen, Mr DelVecchio?« Er streckte sie aus, sie zitterten nicht … und wiesen keine Kratzer oder Abschürfungen auf. Kein Blut auf den Innenflächen, den Fingerspitzen oder unter den Nägeln. »Haben Sie das Opfer untersucht oder es sonst in irgendeiner Weise berührt, bevor oder nachdem Sie den Notruf abgesetzt haben?«
»Ich habe meine Lederjacke ausgezogen und sie ihm auf den Hals gedrückt. Ich wusste, es würde nicht helfen, aber trotzdem.«
»Haben Sie noch andere Waffen als Ihre Pistole bei sich?«
»Mein Messer. Das steckt im …«
Sie legte ihm die Hand auf den Arm, als er nach hinten greifen wollte. »Lassen Sie mich mal sehen.«
Er nickte und drehte sich auf dem Absatz seines Stiefels um. Im Licht des Krankenwagens blitzte eine gefährlich aussehende Klinge auf, die er sich auf den unteren Rücken geschnallt hatte.
»Darf ich diese Waffe entfernen, Detective?«
»Nur zu.«
Sie holte ein Paar Gummihandschuhe aus ihrem Rucksack, zog sie über und löste die Schnalle der Messerscheide. Er regte sich überhaupt nicht. Sie hätte genauso gut eine Statue entwaffnen können.
Das Messer war sauber und staubtrocken.
Sie hob es an die Nase und schnüffelte. Kein Geruch von einem Reinigungsmittel, mit dem er es eilig abgewischt hatte.
Als er sich über die Schulter blickte, ließ die Drehung seines Körpers seine Schultern massig aussehen, und Reilly stellte unwillkürlich fest, dass sie auf Augenhöhe mit seiner Brust war. Mit ihren knapp eins siebzig war sie durchschnittlich groß, aber neben ihm kam sie sich vor wie ein Zwerg.
»Ich konfisziere diese Waffe, wenn Sie nichts dagegen haben?« Sie würde ihm auch die Pistole abnehmen, aber angesichts der Verletzungen des Opfers … brauchte sie eigentlich nur das Messer.
»Überhaupt nichts.«
Als sie eine Plastiktüte aus ihrem Rucksack zog, fragte sie: »Was glauben Sie denn, was hier passiert ist?«
»Jemand hat ihn kräftig aufgemischt, und ich vermute, dass ich das war.«
Sie stockte. Nicht weil sie es für ein irgendwie geartetes Eingeständnis hielt – sie hatte nur nicht erwartet, dass jemand unter solchen Umständen so ehrlich wäre.
In diesem Augenblick fuhr ein weiteres ziviles Fahrzeug in Begleitung von zwei Streifenwagen auf den Parkplatz.
»Das ist Ihr Partner. Aber der Sergeant möchte, dass ich die Ermittlungen führe, um mögliche Interessenskonflikte zu vermeiden.«
»Kein Problem.«
»Sind Sie einverstanden, wenn ich Proben unter Ihren Fingernägeln entnehme?«
»Ja.«
Erneut griff sie in ihren Rucksack und holte ein Schweizer Armeemesser sowie einige kleinere Plastiktüten heraus.
»Sie sind ja sehr gut organisiert«, sagte Veck.
»Ich bin ungern unvorbereitet. Bitte strecken Sie Ihre rechte Hand aus.«
Sie arbeitete rasch, beim kleinen Finger angefangen. Seine Nägel waren kurz geschnitten, aber nicht manikürt, und unter keinem war viel zu finden.
»Haben Sie Erfahrung mit kriminalistischer Arbeit?«
»Ja.«
»Merkt man.«
Als sie fertig war, hob sie den Kopf … und musste ihn sofort wieder von seinen mitternachtsblauen Augen auf die Kinngegend senken. »Möchten Sie vielleicht eine Jacke? Es ist kalt hier draußen.«
»Nein, danke.«
Wenn du aus einer Brustwunde bluten würdest, würdest du ein verdammtes Pflaster annehmen?, fragte sie sich. Oder würdest du den harten Kerl mimen, bis kein Plasma mehr in deinen Adern ist?
Er würde den harten Kerl mimen, dachte sie. Eindeutig.
»Ich möchte, dass die Sanitäter Sie kurz untersuchen –«
»Nicht nötig …«
»Das ist eine Anweisung, DelVecchio. Sie sehen aus, als hätten Sie Kopfschmerzen.«
In diesem Moment stieg de la Cruz aus seinem Wagen und kam mit finsterem und müdem Gesicht auf sie zu. Es hieß, er habe schon vor ein paar Jahren einen Partner verloren; offenbar war er nicht begeistert über die Wiederholung, auch wenn der Grund dieses Mal ein anderer war.
»Entschuldigen Sie mich«, sagte sie zu beiden. »Ich gehe mir schnell mal einen Sanitäter schnappen.«
Doch als sie bei den zwei Weißgekleideten ankam, legten sie Kroner gerade auf die Bahre, und man sah, dass sie keine Minute zu verschenken hatten. »Wie stehen seine Chancen?«
»Schlecht. Aber wir geben unser Bestes.«
»Das weiß ich.«
Die Beine wurden ausgeklappt, sodass die Bahre auf Hüfthöhe stand, und unmittelbar, bevor sie losgerollt wurde, prägte Reilly sich das Bild ein. Kroner sah aus, als hätte man ihn aus dem qualmenden Wrack eines Autos gezogen, sein Gesicht war so übel zugerichtet wie nach einem Flug durch die Windschutzscheibe.
Reilly schielte zu Veck hinüber.
Es gab viel Uneindeutiges an diesem Tatort. Vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass DelVecchio sich selbst für den Angreifer hielt. Aber es war unmöglich, sich mitten im Wald nach solch einem Gemetzel so schnell zu säubern. Außerdem sah er überhaupt nicht aus, als wäre er in eine Auseinandersetzung geraten – Kratzer und Prellungen konnte man nicht abwaschen.
Die Frage war … wer hatte es dann getan?
Anscheinend spürte er ihren Blick auf sich, denn Veck drehte den Kopf herum, und in dem Moment verschwand alles andere: Sie hätte ebenso gut mit ihm allein sein können … und nicht fünfzehn Meter von ihm entfernt, sondern fünfzehn Zentimeter.
Aus heiterem Himmel wallte eine lodernde Hitze in ihr auf, und wäre sie nicht im Freien gewesen, hätte sie sich eingeredet, sie stünde unter einem Heizlüfter. So allerdings rechtfertigte sie die Empfindung als Adrenalinausschüttung infolge von Stress.
Stress, verdammt. Nicht sexuelle Anziehung.
Reilly kappte die Verbindung, indem sie den neu eingetroffenen Uniformierten zurief: »Sperren Sie bitte den Tatort ab.«
»Wird gemacht.«
Alles klar, zurück an die Arbeit. Der kurze Moment völlig unangebrachter Anziehung würde sie nicht an der Ausübung ihrer Arbeit hindern. Erstens war sie ein viel zu nüchterner Mensch, und zweitens erforderte das ihre berufliche Integrität. Außerdem beabsichtigte sie nicht, sich in die lange Liste der Veck anhimmelnden Fans einzureihen; sie würde ihre Aufgabe erledigen und die schmachtenden Blicke den anderen überlassen.
Davon abgesehen standen Männer wie Veck nicht auf Frauen wie sie, und das war völlig in Ordnung. Sie interessierte sich weit mehr für ihre Arbeit als dafür, ihre Beine zu präsentieren, die Haare aufzutürmen und sich an der Flirtolympiade zu beteiligen. Brittany – gesprochen Britnae alias das Bürohäschen – konnte ihn gerne haben und behalten, wenn sie wollte.
In der Zwischenzeit würde Reilly herausfinden, ob der Sohn an die Horrortaten des Vaters angeknüpft hatte.
Zwei
Bereits unter normalen Umständen betrachtete Jim Heron sich als schlechten Verlierer.
Das galt für den üblichen Alltagsquatsch wie World of Warcraft oder Tennis oder Poker.
Nicht, dass er seine Zeit mit solchen Spielen vergeudete, aber wenn, dann wäre er der Typ, der die Tastatur, den Sandplatz oder den Tisch nicht verließe, bis er ganz oben wäre.
Und wie gesagt, das bezog sich nur auf unwichtigen Zeitvertreib.
Wenn es um den Krieg gegen die Dämonin Devina ging, stand ihm der Schaum vor dem Mund, so wütend war er, wenn er verlor. Und er hatte die letzte Runde verloren.
Verloren im Sinne von: kein Sieg. Im Sinne von: Bei den sieben Seelen, um die er und diese miese Schlampe kämpften, stand es jetzt eins zu eins unentschieden. Okay, es standen noch fünf Runden aus, aber diese Einstellung führte weder ihn noch sonst jemanden in die richtige Richtung.
Wenn er unterlag, dann hätte diese Dämonin die Herrschaft nicht nur über die Erde, sondern auch den Himmel gewonnen … was bedeutete, dass sowohl seiner Mutter und all den guten Seelen dort oben wie auch ihm und seinen gefallenen Engelsoldaten ewige Verdammnis bevorstünde.
Und das war, wie er erst kürzlich entdeckt hatte, kein rein hypothetisches Versprechen zur Motivierung der Gottesfürchtigen. Die Hölle war ein greifbarer Ort, und das Leiden dort sehr real. Um genau zu sein, hatte sich vieles von dem, was er früher als alberne Phrasen bigotter Spießer abgetan hätte, als absolut zutreffend herausgestellt.
Also ja, es stand einiges auf dem Spiel, und er hasste es, zu verlieren. Besonders, wenn es eigentlich unnötig war.
Er war stinksauer auf das Spiel. Auf seinen Boss Nigel. Auf die »Regeln«.
Wenn man jemanden losschickte, um irgendeinen Blödmann an einem Scheideweg seines Lebens zu beeinflussen, dann wäre es durchaus hilfreich, ihm auch mitzuteilen, von wem überhaupt die Rede war – das gebot doch wohl der beschissene gesunde Menschenverstand. Und immerhin war es ja kein so großes Geheimnis gewesen: Nigel hatte es gewusst. Der Feind, Devina, hatte es gewusst. Jim? Fehlanzeige. Und dank dieses schwarzen Informationslochs hatte er sich in der letzten Runde auf den Falschen konzentriert und es versaut.
Und jetzt stand es unentschieden mit der miesen Schlampe, und er hockte wutschnaubend in einem Hotelzimmer in Caldwell, New York.
Und er war nicht der Einzige, der sich mit grottenschlechter Laune herumschlug.
Nebenan, hinter der Verbindungstür, brummten zwei tiefe männliche Stimme in der Tonlage »total frustriert«.
Was nichts Neues war. Seine Kollegen Adrian Vogel und Eddie Blackhawk waren nicht zufrieden mit ihm, und jetzt bekam er in Abwesenheit sein Fett weg.
Dabei war die Rückkehr nach Caldwell gar nicht so sehr das Thema. Sondern der Grund, aus dem Jim sie alle hierhergeschleift hatte.
Sein Blick wanderte über die Bettdecke. Hund lag zu einer Kugel zusammengerollt neben ihm, sein zottiges Fell machte den Eindruck, als wäre es mit Schaumfestiger bearbeitet und der Hund dann in eine steife Brise gestellt worden. Was aber nicht der Fall war. Neben dem kleinen Kerl lag ein drei Wochen alter Zeitungsartikel aus dem Caldwell Courier Journal. Die Überschrift lautete »Mädchen vermisst«, und neben dem Text war ein Foto einer Gruppe lächelnder Freunde abgedruckt, die Köpfe dicht zusammengesteckt, die Arme einander um die Schultern gelegt. Die Bildunterschrift benannte die junge Frau in der Mitte als Cecilia Barten.
Seine Sissy.
Na ja, eigentlich nicht »seine«, aber inzwischen betrachtete Jim sich als für sie verantwortlich.
Im Gegensatz zu ihren Eltern, Angehörigen und Freunden wusste er nämlich, wo sie war und was mit ihr geschehen war. Sie gehörte nicht zu der Heerschar der jungen Ausreißer; sie war auch nicht von ihrem eifersüchtigen Lover oder einem Fremden ermordet worden; und sie war auch nicht diesem Serienkiller zum Opfer gefallen, der laut der Website des Caldwell Courier Journals die Gegend unsicher machte.
Allerdings war ihr durchaus Gewalt angetan worden. Von Devina.
Sissy war eine Jungfrau, die geopfert worden war, um den Spiegel der Dämonin, ihren heiligsten Besitz, zu schützen. Jim hatte ihre Leiche im Badezimmer des vorübergehenden Unterschlupfs von Devina kopfüber hängend gefunden und sie dort zurücklassen müssen. Es war schon schlimm genug gewesen, zu erfahren, dass sie ihr Leben an seine Feindin verloren hatte, aber später hatte er Sissy auch noch in Devinas Seelenbrunnen entdeckt … eingesperrt, leidend, auf ewig gefangen inmitten der Verdammten, die dieses Schicksal verdienten.
Cecilia hingegen gehörte nicht in die Hölle. Sie war eine Unschuldige, die vom Bösen entführt und missbraucht worden war – und Jim würde sie befreien, auch wenn es das Letzte war, was er tat.
Genau deswegen waren sie nach Caldwell zurückgekehrt. Und genau deswegen waren Adrian und Eddie total genervt.
Sorgsam hob Jim den Artikel auf und strich mit dem schwieligen Daumen über die körnige Abbildung von Sissys langem, blondem Haar. Als er blinzelte, sah er es in blutverschmierten Strähnen tief über dem Abfluss der Porzellanwanne hängen. Er blinzelte erneut und hatte sie so vor Augen, wie er sie neulich Nacht in Devinas klebrigem Gefängnis gesehen hatte, verängstigt, verwirrt und besorgt um ihre Eltern.
Er würde die Sache in Ordnung bringen, für die Bartens. Adrians und Eddies Genörgel war ohnehin nur Aerobic für die Lippen. Jim würde den Krieg auf keinen Fall aus dem Blick verlieren, denn er konnte es sich nicht leisten, gegen Devina zu verlieren, ehe er Sissy aus dem Seelenbrunnen befreit hatte. Schlaumeier.
Die Verbindungstür wurde weit geöffnet, und Adrian – alias das Wunder an Unmusikalität – marschierte ohne Klopfen herein. Was genau sein Stil war.
Der Engel war ganz in Schwarz gekleidet, wie üblich, und die diversen Piercings in seinem Gesicht machten nur einen kleinen Teil dessen aus, was er vermutlich am ganzen Körper trug.
»Habt ihr genug über mich gelästert?« Jim drehte den Zeitungsartikel um und verschränkte die Arme vor der Brust. »Oder macht ihr nur eine kleine Pause?«
»Wie wäre es, wenn du das Ganze mal ernst nehmen würdest.«
Jim stand auf und stellte sich Nase an Nase vor seinen Mitstreiter. »Mache ich irgendwie den Eindruck, ich würde rumalbern?«
»Du hast uns nicht wegen des Kriegs hergeschleppt.«
»Ach nee.«
Adrian ließ sich nicht einschüchtern, obwohl Jim als ehemaliger Auftragskiller des amerikanischen Militärs mindestens zwölf unterschiedliche Techniken kannte, um selbst ein Schwergewicht wie den Engel zusammenzufalten. »Das Mädchen ist nicht deine Zielperson«, sagte Ad. »Und falls es dir noch nicht aufgefallen ist: Wir haben eine Runde verloren. Ablenkungen sind unerwünscht.«
Jim überging die Bemerkung bezüglich Sissy; er sprach aus Prinzip nie über sie. Seine Jungs waren Zeugen gewesen, als er ihre Leiche fand, und hatten miterlebt, wie stark ihn das mitgenommen hatte – also wussten sie Bescheid. Und es gab keinen Grund, laut auszusprechen, wie es gewesen war, sie dort in Devinas Brunnenwand zu sehen. Oder zu erwähnen, dass er befürchtete, die junge Frau könnte alles mit angesehen haben, was Devina und ihre Helfershelfer mit ihm angestellt hatten.
Was da auf diesem »Arbeitstisch« passiert war, wünschte man nicht einmal einem abgebrühten Soldaten. Aber einer Unschuldigen? Die sowieso schon Todesangst ausstand?
Zwar hatte ihn die Gewalt so oder so nicht sonderlich gekümmert. Folter, egal in welcher Form, war nichts als ein Übermaß an körperlicher Empfindung – aber andererseits brauchte niemand das mit anzusehen, erst recht nicht sein Mädchen.
Was sie eigentlich nicht war.
»Ich bin auf dem Weg zu Nigel«, blaffte Jim. »Wenn du dann also fertig wärst mit deinem Gemecker? Oder willst du noch ein bisschen mehr von meiner Zeit vergeuden?«
»Warum bist du dann immer noch hier?«
Tja, weil er auf dem Bett gesessen, ins Leere gestarrt und gegrübelt hatte, wohin zum Teufel Devina wohl Sissys Leiche gebracht hatte.
Bloß dass Jim eben die Sorte Blödmann war, die das nicht zugeben würde.
»Jim, ich weiß, dass das Mädchen dir ein Anliegen ist. Aber komm schon, Mann, wir haben etwas zu erledigen.«
Während Ad sprach, sah Jim ihm über die Schulter. Eddie stand in der Verbindungstür zwischen den beiden Zimmern, sein riesiger Körper war angespannt, die roten Augen ernst, sein langer, geflochtener schwarzer Zopf hing nach vorne und reichte ihm fast bis auf den Bund der Lederhose.
Scheiße.
Gegen Adrians Gebrüll konnte man anstreiten. Oder ihm eine verpassen, was auch schon vorgekommen war. Aber Eddies bedächtige, unaggressive Art bot keine Angriffsfläche. Sie war ein Spiegel, der einfach nur das eigene bescheuerte Verhalten zurückwarf.
»Ich habe das unter Kontrolle«, sagte Jim. »Und ich gehe jetzt sofort zu Nigel.«
Der Erzengel Nigel befand sich in seinen Privatgemächern im Himmel, als das Gesuch durchgestellt wurde.
Es war ohnehin Zeit, aus der Wanne zu steigen.
»Wir bekommen Besuch«, sagte er zu Colin, während er sich aus dem duftenden Wasser erhob.
»Ich bleibe noch – das Bad hat die perfekte Temperatur.« Damit reckte er sich wohlig. Sein dunkles Haar war feucht vom Dampf und kringelte sich an den Spitzen, sein hoheitsvolles, intelligentes Gesicht war so entspannt, wie es nur sein konnte. Was nicht besonders viel hieß. »Dir ist aber doch bewusst, warum er kommt?«
»Selbstverständlich.«
Nigel lief über den weißen Marmor zu dem korallenrot-saphirblauen Vorhang, zog ihn beiseite und trat aus der Badestube. Sorgfältig schob er danach den schweren Stoff aus Samt und Damast wieder zurück. Niemand brauchte zu wissen, wer sich manchmal zu ihm in die Wanne gesellte – obwohl er vermutete, dass Bertie und Byron so eine Ahnung hatten. Sie waren allerdings viel zu diskret, um etwas zu sagen.
Statt sich um etwas formellere Kleidung zu bemühen, zog Nigel nur einen seidenen Morgenmantel über. Jim Heron würde nichts auf sein Erscheinungsbild geben, und in Anbetracht des zu erwartenden Verlaufs des Gesprächs würde es eh erforderlich sein, hinterher wieder in die Wanne zurückzukehren.
Mit einer knappen Handbewegung rief Nigel den Engel von der Erde herauf, sammelte seinen fleischlichen Leib auf und fügte ihn hier in seinen Privatgemächern zusammen.
Genauer gesagt auf der mit Seide bezogenen Chaiselongue.
Der Erlöser wirkte auf dem himbeerfarbenen Stoff höchst lächerlich, die schweren Arme und Beine hingen schlaff herunter, das schwarze T-Shirt und die stark ausgewaschene Jeans waren eine Beleidigung für ein solch zartes Gewebe.
Herons Geist kam den Bruchteil einer Sekunde später im Himmel an als sein Körper; sofort sprang er auf, wachsam, bereit … und nicht sonderlich erfreut.
»Eiswein?«, erkundigte sich Nigel, während er zu einer französischen Kommode schlenderte, deren Marmorplatte als Bar diente. »Oder vielleicht einen Schluck Whiskey?«
»Ich will wissen, wer als Nächstes dran ist, Nigel.«
»Also nichts zu trinken?« Der Erzengel nahm sich reichlich Zeit, unter den Kristallkaraffen auszuwählen, und als er sich schließlich etwas eingoss, tat er es langsam und bedächtig.
Er war kein Tölpel, dem man einfach so Forderungen stellen konnte, Heron musste mal ein paar Manieren lernen.
Nigel drehte sich herum und nahm einen Schluck. »Schmeckt leicht und erfrischend.«
»Scheiß auf den Wein.«
Nigel überging den Kommentar stillschweigend und blickte den Erlöser wortlos an.
Als der Schöpfer Nigel und Devina erschienen war und erklärt hatte, dass es einen letzten Wettbewerb gäbe, hatten beide Seiten sich auf Heron geeinigt, um ihn zusammen mit den sieben auserwählten Seelen aufs Spielfeld zu schicken. Natürlich wollten beide Gegner ihre Werte repräsentiert wissen, mit dem Ergebnis, dass dieser wuchtige, rauflustige Engel da vor ihm zu gleichen Teilen Gutes und Böses in sich vereinte.
Nigel hatte allerdings geglaubt, dass Jims ermordete Mutter, die sich hinter den Mauern der Seelenherberge hier oben befand, den Ausschlag dafür geben würde, dass Herons gute Seite die Oberhand gewinnen würde, und davon war er immer noch überzeugt. Wobei Augenblicke wie dieser ihn an den Grundfesten dieses finalen Spiels, an dem sie alle teilnahmen, zweifeln ließen.
Der Engel sah aus, als wollte er jemanden umbringen.
»Du musst mir sagen, wer es ist.«
»Wie ich bereits sagte, darf ich das nicht.«
»Ich habe die letzte Runde verloren, Arschloch. Und zwar, weil sie geschummelt hat.«
»Ich bin mir der Grenzen, die sie überschritten hat, sehr wohl bewusst, und mein Rat lautete, falls du dich erinnerst, sie tun zu lassen, was sie will – es wird Vergeltungsmaßnahmen geben.«
»Wann?«
»Wenn es so weit ist.«
Heron gefiel die Antwort nicht, und er fing an, in dem prunkvollen Zelt mit seinen Satinvorhängen, Orientteppichen und dem niedrigen Bettpodest auf und ab zu laufen – wobei um letzteres, wie Nigel zu spät bemerkte, deutlich sichtbar die sehr unterschiedlichen Kleidungsstücke von zwei Besitzern verstreut lagen.
Nigel räusperte sich. »Ich kann nichts riskieren, was später auf uns zurückfallen könnte. Ich habe mich bereits zu weit auf Devinas Niveau herabgelassen, als ich dir Adrian und Edward an die Seite gestellt habe. Würde ich dir noch weitere Hilfestellung geben, verwirke ich möglicherweise nicht nur eine Runde, sondern den gesamten Wettstreit. Und das ist nicht hinnehmbar.«
»Aber du weißt, wer die Seele ist? Und Devina auch?«
»Ja.«
»Und das kommt dir nicht total unfair vor? Sie wird sich denjenigen doch höchstpersönlich vorknöpfen – hat sie wahrscheinlich schon.«
»Nach den vereinbarten und noch bestehenden Regeln ist ihr nicht gestattet, in Berührung mit den Seelen zu treten. Genau wie ich selbst soll sie dich dahingehend beeinflussen, die Seele zu beeinflussen. Direkter Kontakt ist untersagt.«
»Warum bist du dann nicht eingeschritten?«
»Das liegt nicht in meinem Aufgabenbereich.«
»Ach, Kinderkacke, Nigel, du hast doch keine …«
»Ich kann dir versichern, seine Eier sind vollkommen intakt.«
Bei diesem trockenen Einwurf wandten sich sowohl Nigel als auch der Erlöser zu dem Vorhang um, der das Bad abtrennte. Colin hatte auf einen Morgenmantel verzichtet und stand ganz ungeniert nackt da.
Und nun, da er die allgemeine Aufmerksamkeit besaß, legte der Erzengel noch nach: »Außerdem möchte ich dich doch bitten, deinen Ton zu mäßigen, mein Freund.«
Herons Augenbrauen schnellten nach oben, und er spielte kurz Wimbledon, drehte den Kopf vom einen zum anderen und wieder zurück.
Nigel fluchte gedämpft. So viel zur Etikette. Und zur Privatsphäre. »Eiswein, Colin?«, fragte er barsch. »Und vielleicht etwas zum Anziehen?«
»Nein, danke, kein Bedarf.«
»Da hast du natürlich nicht unrecht. Aber dein Mangel an Schamgefühl hüllt dich in nichts als die wohltemperierte Luft in diesem Zelt. Und ich habe einen Gast.«
Ein Grunzen war die einzige Erwiderung. Was Colins Art war, zum Ausdruck zu bringen, dass es keinen Grund gab, sich wie ein spießiges altes Weib zu benehmen.
Zauberhaft.
Zurück an den Erlöser gerichtet, sagte Nigel: »Es tut mir leid, dass ich dir nicht gewähren kann, was du erbittest. Glaub mir.«
»Beim Ersten hast du mir geholfen.«
»In dem Fall besaß ich die Erlaubnis.«
»Und sieh dir an, wie Kampf Nummer zwei ausgegangen ist.«
Nigel verbarg seine besorgte Zustimmung, indem er einen Schluck aus dem Glas nahm. »Dein Einsatz ist löblich. Und ich will dir mitteilen, dass deine Rückkehr nach Caldwell sehr dienlich ist.«
»Danke für den Tipp. Es gibt zwei Millionen Menschen in der blöden Stadt. Das grenzt die Auswahl ja wahnsinnig ein.«
»Nichts ist willkürlich, und es gibt keine Zufälle, Jim. Mehr noch, es gibt einen Weiteren, der danach sucht, was du ersehnst, und wenn euer getrenntes Streben sich vereint, wirst du die nächste Seele finden.«
»Nichts für ungut, aber das heißt doch einen Scheiß.« Heron schielte zu Colin hinüber. »Und dafür werde ich mich nicht bei der Sprach-Polizei entschuldigen. Sorry.«
Colin verschränkte die Arme vor der nackten Brust. »Ganz wie du willst, Bürschlein. Und ich halte es genauso.«
Sprich: Vielleicht verpass ich dir jetzt gleich eine. Vielleicht auch später.
Das Letzte, was Nigel brauchen konnte, war ein Faustkampf in seinen Räumlichkeiten, denn das würde zweifellos die anderen Erzengel einschließlich Tarquins im gestreckten Galopp auf den Plan rufen. Nicht unbedingt die Unterbrechung, die man sich wünschte.
»Colin«, sagte er deshalb, »geh spielen.«
»Ich habe keine Lust, allein zu spielen.«
Grummelnd wandte Nigel sich wieder an Jim. »Gehe hin und vertraue darauf, dass du sein wirst, wo du sein sollst, und tun wirst, was du tun musst.«
»Ich glaube nicht an Schicksal, Nigel. Das ist, als würde man eine ungeladene Waffe nehmen und sich darauf verlassen, dass sie schon schießen wird. Man muss die Kugeln schon selbst ins Magazin stecken.«
»Und ich sage dir, dass hier größere Kräfte am Werk sind als deine Bemühungen.«
»Von mir aus, super, schreib das auf eine Weihnachtskarte. Aber verschon mich mit dem Blödsinn.«
Als er in das harte Gesicht des Erlösers blickte, spürte Nigel ein Aufflackern von Furcht. Mit dieser Einstellung standen die Chancen auf einen Sieg der Engel noch etwas geringer. Doch was konnte er schon tun? Heron besaß weder Geduld noch Gottvertrauen, aber das änderte nichts an den Spielregeln oder der Wahrscheinlichkeit, dass der Schöpfer Devinas Freiheiten beschneiden würde.
Zumindest Letzteres wirkte sich zu ihren Gunsten aus.
»Ich glaube, es ist alles gesagt«, sagte Nigel. »Unser Gespräch ist beendet.«
Es folgte ein dunkler, ziemlich böser Augenblick, während dessen Heron ihn wütend musterte.
»Schön«, sagte der Erlöser schließlich. »Aber ich gebe nicht so leicht auf.«
»Und ich bin der Berg, der nicht wankt.«
»Alles klar.«
Innerhalb eines Wimpernschlags war der Engel verschwunden. Und erst, als die Stille laut im Zelt hallte, bemerkte Nigel, dass nicht er Heron fortgeschickt hatte. Sondern er war aus eigener Kraft gegangen.
Er wurde allmählich stärker, wie es schien.
»Soll ich nach unten gehen und über ihn wachen?«, fragte Colin.
»Als ich einwilligte, ihn zum Auserwählten zu machen, dachte ich, es gäbe genug Zügel, um ihn zu halten. Das dachte ich wirklich.«
»Und deshalb frage ich: Soll ich über ihn wachen?«
Nigel drehte sich zu seinem besten Freund um, der viel mehr als ein Kollege und Vertrauter war. »Das ist Adrians und Edwards Aufgabe.«
»So ist es vereinbart. Aber ich mache mir Sorgen, wohin seine wachsenden Fähigkeiten ihn noch führen werden. Wir befinden uns auf keinem guten Weg.«
Nigel nahm noch einen Schluck von seinem Wein und starrte auf die Stelle, an der Heron eben noch gestanden hatte. Zwar blieb er still, doch er musste insgeheim zustimmen. Die Frage war, was tun, was tun …
Drei
Unten, im kalten Wald um das Monroe Motel & Suites stand Veck genau im grellen Scheinwerferlicht des Krankenwagens, seinen Partner de la Cruz zur Rechten, seinen Kumpel Bails zur Linken. So hell angestrahlt, fühlte er sich wie auf einer Bühne, während Kroner auf einer Bahre durchs Unterholz gerollt wurde.
Nur dass ihn lediglich ein einziger Mensch ansah.
Sophia Reilly vom Dezernat für Interne Ermittlungen.
Sie stand etwas abseits, und als ihre Blicke sich trafen, wünschte er sich, sie würden sich unter anderen Umständen begegnen – wieder einmal. Zum ersten Mal über den Weg gelaufen waren sie sich, als er diesem blöden Paparazzo eine gezimmert hatte.
Gegen diese Scheiße hier wirkte ein Faustschlag allerdings wie ein Picknick.
Er hatte sie sofort gemocht, als er ihr zum ersten Mal die Hand schüttelte, und dieser erste Eindruck hatte sich heute Abend noch verstärkt: Der Polizist in ihm war mehr als angetan von ihren Fragen und ihrem Vorgehen. Selbst wenn er sie belogen hätte – was er nicht hatte –, hätte sie es gemerkt.
Aber sie mussten aufhören, sich auf diese Weise zu treffen. Buchstäblich.
Drüben auf dem Parkplatz hörte man ein Knallen, als die Sanitäter die Türen des Transporters zuschlugen, dann setzte der Wagen zurück, und mit ihm verschwand das Licht seiner Scheinwerfer. Als Reilly sich umdrehte, um ihm nachzublicken, wurde sie von Dunkelheit umhüllt – bis sie eine Taschenlampe anknipste.
Ehe sie zu ihnen zurückkam, beugte sich de la Cruz rasch zu ihm vor und fragte leise: »Wollen Sie einen Anwalt?«
»Wozu sollte er einen Anwalt brauchen?«, blaffte Bails.
Veck schüttelte den Kopf. So gut er die Loyalität seines Kollegen nachvollziehen konnte, aber Bails hatte offenbar momentan um einiges mehr Vertrauen in ihn als er selbst. »Das ist eine vernünftige Frage.«
»Also, wollen Sie?«, flüsterte de la Cruz.
Reilly umrundete die Blutpfütze und schlängelte sich durch die Baumstämme und Äste, ein paar Zweige knackten unter ihren Füßen. Es dröhnte in seinen Ohren.
Sie blieb vor ihm stehen. »Ich werde morgen noch ein paar Fragen haben, aber fürs Erste können Sie nach Hause.«
Veck verengte die Augen. »Sie lassen mich gehen?«
»Ich hatte Sie gar nicht in Gewahrsam.«
»Und das war’s?«
»Nein, ganz und gar nicht. Aber für heute sind Sie hier fertig.«
»Hören Sie, das kann doch nicht …«
»Die Spurensicherung ist unterwegs. Ich möchte Sie nicht dabeihaben, wenn die Kollegen den Tatort untersuchen, weil es ihre Arbeit beeinträchtigen könnte. Verstanden?«
Ach so. Das hätte er sich denken können. Es war dunkel hier im Wald. Er könnte leicht Beweise aufheben oder manipulieren, ohne dass es jemand merkte, und Reilly hatte versucht, ihm einen eleganten Abgang zu ermöglichen.
Sie war klug, dachte er.
Außerdem war sie schön. Im Schein der Taschenlampe sah sie toll aus, wie es nur eine natürliche, gesunde Frau konnte – ohne dickes Make-up, das ihre Poren verklebte oder ihre Lider niederdrückte, ohne fettigen, schmierigen Glanz auf den Lippen. Sie war absolut ungekünstelt.
Und diese vollen, roten Haare und ihr intensiver grüner Blick waren auch nicht gerade eine Beleidigung fürs Auge.
Dazu noch ihre souveräne Art …
»Na schön.«
»Bitte melden Sie sich morgen um halb neun im Büro des Sergeants.«
»Wird gemacht.«
Als Bails vor sich hinmurmelte, betete Veck insgeheim, der Kerl würde seine Ansichten für sich behalten. Reilly machte nur ihre Arbeit – und zwar verdammt professionell. Das Mindeste, was sie tun konnten, war, ihr ebenfalls mit Respekt zu begegnen.
Ehe also sein Kumpel noch irgendetwas von sich geben konnte, verabschiedete er sich mit einem Handschlag von Bails und nickte de la Cruz zu. Doch als er sich zum Gehen wandte, klang Reillys tiefe, ernste Stimme noch einmal durch die Nacht.
»Detective DelVecchio.«
Er sah über die Schulter. »Ja?«
»Ich muss Ihnen die Waffe abnehmen. Und die Dienstmarke. Und das Messerholster.«
Klar. Natürlich. »Die Marke ist in der Lederjacke da drüben auf dem Boden. Wollen Sie sich selbst die Ehre mit der Neunmillimeter und dem Holster geben?«
»Bitte, ja. Und Ihr Handy nehme ich auch an mich, wenn Sie nichts dagegen haben.«
Als sie näher trat, nahm er ihren Duft wahr. Nichts Fruchtiges oder Blumiges oder, Gott bewahre, diesen Vanillescheiß. Auch keins der üblichen Parfüms aus dem Handel. Shampoo vielleicht? Hatte sie den Anruf bekommen, als sie gerade aus der Dusche kam?
Na, das war mal ein Bild …
Moment mal. Träumte er jetzt tatsächlich von seiner Kollegin … drei Meter neben dem Schauplatz eines Mordes? Bei dem er der Verdächtige war?
Wow.
Mehr fiel ihm dazu im Moment nicht ein.
Reilly klemmte sich die Taschenlampe zwischen die Zähne und streckte die in knallblauen Handschuhen steckenden Hände aus. Als er die Arme hob, damit sie leichter an seine Taille kam, bemerkte er ein leises Ziehen in den Hüften, so wie er es gespürt hätte, wenn sie ihm die Hose ausgezogen hätte …
Der Stromstoß, der ihm in den Schwanz schoss, kam überraschend – und er war heilfroh, dass der Lichtkegel genau auf seine Brust zeigte und nicht weiter südlich.
Mann, das war so was von falsch – und gar nicht typisch für ihn. Normalerweise baggerte er keine Kolleginnen an, egal ob sie in der Verwaltung, bei ihm in der Mordkommission … oder im Internen Ermittlungsdezernat arbeiteten. Viel zu nervig, wenn das unausweichliche Ende der Affäre kam.
Lieber Gott, wo hatte er seinen Kopf?
Nicht in der Realität offensichtlich.
Es war fast, als wäre das, was vorhin auf diesem rot durchtränkten Laub passiert war, so riesig und unfassbar, dass sein Gehirn sich in jedes andere Thema flüchtete.
Oder er hatte eben einfach den Verstand verloren. Punkt.
»Danke«, sagte Reilly, als sie mit seiner Waffe und dem Lederholster in der Hand zurücktrat. »Ihr Handy?«
Er reichte es ihr. »Wollen Sie auch meine Brieftasche?«
»Ja, aber Ihren Führerschein können Sie behalten.«
Als die Übergabe abgeschlossen war, ergänzte sie noch: »Und ich muss Sie bitten, zu Hause Ihre Kleidung auszuziehen, in eine Tüte zu packen und morgen bei mir abzugeben.«
»Kein Problem. Und Sie wissen ja, wo Sie mich finden«, sagte er schroff.
»Ja, weiß ich.«
Als sie sich endgültig trennten, legte sie nicht kokett den Kopf schief oder ließ die Augen aufblitzen. Sie warf nicht die Haare zurück. Streifte nicht seine Hüfte. Was – zugegeben – unter diesen Umständen auch albern gewesen wäre, aber er hatte so ein Gefühl, dass sie auch in einer Bar an der Theke keine derartige Show abgezogen hätte. Nicht ihr Stil.
Mist, sie wurde wirklich von Minute zu Minute attraktiver. Wenn das so weiterging, würde er ihr nächste Woche einen Heiratsantrag machen.
Ha, ha. Rasend komisch.
Damit wandte Veck sich zum zweiten Mal von ihr ab. Und hörte sie zu seiner Überraschung sagen: »Sind Sie sicher, dass Sie keine Jacke wollen? Ich habe noch eine Schutzjacke im Kofferraum, es wird ganz schön kalt auf Ihrem Motorrad werden.«
»Ich komm schon klar.«
Aus unerfindlichem Grund wollte er sich nicht umsehen. Wahrscheinlich wegen der beiden Zuschauer auf den billigen Plätzen, de la Cruz und Bails.
Genau. Daran lag es.
Er ging zu seiner BMW, schwang das Bein über den Sattel und griff nach seinem Helm. Auf dem Weg hierher hatte er das blöde Ding nicht getragen, aber er musste Körperwärme sparen. Halb rechnete er damit, dass de la Cruz zu ihm käme, um noch einmal über den Anwalt zu sprechen. Doch der ehrwürdige Kommissar blieb, wo er war, und unterhielt sich mit Reilly.
Bails war derjenige, der zu ihm hinüberschlenderte. Er trug Sportklamotten, die kurzen Haare standen ihm vom Kopf ab, die dunklen Augen waren leicht aggressiv – sicher, weil es ihm nicht passte, dass Reilly den Fall übernahm. »Kommst du wirklich klar?«
»Ja.«
»Soll ich dir nachfahren?«
»Nicht nötig.« Wahrscheinlich würde er es trotzdem tun. So war er einfach.
»Ich weiß, dass du es nicht getan hast.«
Als Veck seinen Kumpel musterte, war er versucht, sich alles von der Seele zu reden – seine beiden Seiten, den inneren Riss, den er seit Jahren kommen spürte, die Angst, dass schließlich passiert war, wovor er sich gefürchtet hatte. Verdammt, er wusste, dass er dem Mann vertrauen konnte. Er und Bails waren vor Jahren zusammen auf der Polizeischule gewesen, und obwohl sie danach getrennte Wege gegangen waren, hatten sie immer engen Kontakt gehalten – bis Bails ihn angeworben hatte, von Manhattan nach Caldwell zu wechseln.
Zwei Wochen. Er war erst seit beschissenen zwei Wochen hier.
Gerade, als er den Mund aufklappte, hielt ein Transporter hinter den anderen Polizeiwagen. Ankunft des Erbsenzählerteams.
Veck schüttelte den Kopf. »Danke, Mann. Wir sehen uns morgen.«
Mit einem schnellen Tritt startete er den Motor, und als er am Gashebel drehte, warf er einen Blick hinter sich. Reilly kniete neben seiner Jacke und durchsuchte seine Taschen. So, wie sie es auch mit seiner Brieftasche machen würde.
Ach du Schande. Sie würde darin …
»Ruf mich an, wenn ich vorbeikommen soll, okay?«
»Ja, mach ich.«
Veck nickte Bails noch einmal zu und lenkte dann seine Maschine vom Seitenstreifen. Es war absolut nicht nötig, dass sie die beiden Kondome sah, die er immer in dem Fach hinter seinen Kreditkarten aufbewahrte.
Komisch, sein lasterhaftes Leben hatte ihn vorher noch nie gestört. Jetzt wünschte er, er hätte schon vor Jahren einen Schlussstrich darunter gezogen.
Als er die befestigte Straße erreichte, drehte er voll auf. Er jagte durch die vielen Kehren und Biegungen der Route 149, legte sich in die Kurven, kauerte sich tief über den Lenker, wurde zu einem aerodynamischen Teil der BMW. Bei seinem rasenden Tempo waren enge Serpentinen nur mehr ein schneller Ruck nach rechts oder links, er und das Motorrad wetteten auf die Gesetze der Physik.
Und da er bei dieser Geschwindigkeit alles setzte, was er besaß, konnte er bei einer Niederlage froh sein, wenn seine Überreste groß genug zum Begraben waren.
Schneller. Schneller. Schnell…
Leider – oder zum Glück, er war sich selbst nicht sicher – ereilte ihn sein Ende nicht in Form eines kreischenden Schlenkers in den Wald, um einem Buick oder Bambi auszuweichen.
Es war ein Factory-Outlet von Polo Ralph Lauren.
Genauer gesagt die Ampel genau vor dem Laden.
Aus dem genussvollen Tunnelblick gerissen zu werden machte ihn seltsam orientierungslos, und der einzige Grund, warum er bei Rot anhielt, waren die Autos vor ihm; er musste die Verkehrsregeln beachten oder über ihre Dächer fahren. Die blöde Ampelschaltung dauerte ewig, und als es endlich Grün wurde, bewegte sich die Schlange vor ihm im Schneckentempo vorwärts.
Andererseits hätte er auch mit hundert Sachen auf dem Highway unterwegs sein können, und es hätte sich angefühlt wie Däumchen drehen.
Aber er versuchte ja nicht, vor etwas zu fliehen oder so. Nicht doch.
Während er an den Geschäften von Nike, Van Heusen und Brooks Brothers vorbeisteuerte, fühlte er sich so leer wie die riesigen Parkplätze, und am liebsten wäre er immer weitergefahren … vorbei an diesem Industriegebiet, durch Caldies Vorstadtlabyrinth, um die Wolkenkratzer herum und über die Brücke nach Gott weiß wohin.
Das Problem war, dass egal, wohin er auch ginge … er wäre immer noch da: Ein Ortswechsel würde das Gesicht im Spiegel nicht verändern. Oder den Teil von ihm, den er noch nie verstanden, aber auch nie hinterfragt hatte. Oder was zum Henker heute Abend passiert war.
Er musste dieses kranke Schwein umgebracht haben. Eine andere Erklärung gab es nicht. Und er hatte keine Ahnung, was Reilly sich dabei dachte, ihn laufen zu lassen. Vielleicht sollte er einfach gestehen … Gut und schön, aber was? Dass er mit der Absicht, zu töten, losgefahren war? Und dann …
Der Kopfschmerz, der durch seinen Stirnlappen pflügte, war von der Sorte, um die man nicht herumdenken konnte. Man stöhnte nur und schloss die Augen, was nicht so ideal war, wenn man gerade auf einer Maschine saß, die im Prinzip nur ein Motor mit aufgeschraubtem Sitz war.
Also zwang Veck sich, sich ausschließlich auf die Straße zu konzentrieren, und war erleichtert, als das Pochen in seinem Schädel nachließ und er in seine Wohnsiedlung einbog.
Das Haus, in dem er lebte, lag in einem Viertel voller Lehrer, Krankenschwestern und Vertreter. Es gab eine Unmenge kleiner Kinder, und die Gärten wurden nicht professionell gepflegt – was bedeutete, dass es im Sommer wahrscheinlich jede Menge Unkraut gäbe, aber wenigstens würde es regelmäßig gemäht werden.
Veck war der Sonderfall. Er hatte keine Frau, keine Kinder, und er würde nie am Rasenmäher glänzen. Zum Glück kam es ihm so vor, als wären die Nachbarn auf beiden Seiten seines handtuchgroßen Gartens von der Sorte, die fröhlich mit ihren Klingen übergreifen würde.
Brave Leute, die ihm erzählt hatten, sie fühlten sich sicherer, seit ein Polizist nebenan wohne.
Was zeigte, dass sie keine Ahnung hatten.
Sein zweistöckiges Haus war ungefähr so schick und einzigartig wie ein Centstück aus den Siebzigern. Ungefähr damals waren auch die Wände zum letzten Mal tapeziert worden.
Er hielt vor der Garage, stieg ab und ließ den Helm am Lenker hängen. In dieser Gegend gab es keine hohe Kriminalitätsrate – insofern waren seine Nachbarn doppelt angeschmiert.
Durch den Seiteneingang ging er in die Küche. Essenstechnisch passierte hier nicht viel: Außer ein paar leeren Pizzaschachteln und einigen Starbucks-Bechern in der Spüle besaß er nichts. Halb geöffnete Post und Berichte stapelten sich unordentlich auf dem Tisch. Der Laptop war zugeklappt, daneben lagen ein Lebensmittelcoupon-Heft, das er nie benutzen würde, und eine Rechnung fürs Kabelfernsehen, die noch nicht überfällig war, es aber wahrscheinlich werden würde, weil er miserabel darin war, Sachen rechtzeitig zu bezahlen.
Stets zu beschäftigt, um eine Online-Überweisung zu erledigen.
Der einzige Unterschied zwischen diesem Haus und dem Büro in der Stadt war, dass oben ein Doppelbett stand.
Apropos, diese Reilly wollte doch, dass er sich auszog.
Er schnappte sich eine Mülltüte aus dem Schrank unter der Spüle, ging nach oben und dachte sich unterwegs, dass er eine Putzfrau engagieren musste, wenn er nicht wollte, dass in jeder Ecke Spinnweben hingen und die Wollmäuse sich hemmungslos unter dem Sofa vermehrten. Aber das hier war kein Heim und würde auch nie eines werden. Einmal die Woche eine Behandlung mit Staubsauger und Meister Proper machten es noch nicht gemütlich.
Obwohl dann wenigstens die Mädels, die er ab und zu mitbrachte, einen einigermaßen annehmbaren Ort vorfänden, um sich wieder anzuziehen.
Sein Schlafzimmer lag zur Straßenseite raus, und es war nur mit dem großen Bett und einer Kommode möbliert. Rasch zog er Stiefel, Socken und Hose aus. Den Rolli ebenfalls. Als er die schwarzen Boxershorts abstreifte, weigerte er sich, sich auszumalen, wie Sophia Reilly das täte. Er blendete es einfach aus.
Dann ging er ins Bad und stellte die Dusche an, und während er darauf wartete, dass das Wasser warm wurde, stellte er sich vor den Spiegel über dem Waschbecken. Nichts zu sehen darin – er hatte das Glas sofort am Tag seines Einzugs mit einem Badehandtuch verhängt.
Er war kein Freund von Spiegeln.
Er hob die Hände, mit den Handrücken nach oben. Dann drehte er sie um. Sah unter den Nägeln nach.
Sein Körper wies offenbar, ebenso wie sein Kopf, nicht den geringsten Anhaltspunkt auf. Obwohl man natürlich sagen könnte, dass keinerlei Kratzer, kein Blut, keine Hautpartikel an ihm durchaus ein Hinweis waren – was zweifellos auch die kluge Kollegin Reilly bemerkt und berücksichtigt hatte.
Mann, das war das zweite Mal in seinem Leben, dass er sich in dieser Situation befand. Und das erste …
Kein Grund, über den Mord an seiner Mutter nachzudenken. Nicht an einem Abend wie heute.
Er stieg in die Dusche, schloss die Augen und ließ den Wasserstrahl über Kopf, Schultern und Gesicht strömen. Seife. Abwaschen. Shampoo. Ausspülen.
Er stand noch immer in der dampfenden, feuchten Hitze, als er den Luftzug spürte: So deutlich, als hätte jemand das Fenster neben dem Klo geöffnet, schoss der Luftstrom über den Plastikvorhang und strich über seine Haut. Die Gänsehaut kam auf Kommando, zog sich quer über seine Brust, die Beine hinunter und wieder hoch.
Das Fenster war aber immer noch zu.
Und genau wegen dieser Momente hatte er die Glaswand der Duschkabine entfernt und den eingebauten Spiegel abgedeckt. Das waren die einzigen Veränderungen, die er an dem Haus vorgenommen hatte, und sie dienten seiner geistigen Gesundheit. Seit Jahren rasierte er sich ohne Spiegel.
»Hau ab, verflucht«, sagte er mit fest geschlossenen Augen.
Der Luftzug wirbelte um seine Füße, betastete seinen Körper wie mit Händen, wanderte höher, streichelte sein Geschlecht, ehe er sich dem Bauch, der Brust, dem Hals widmete … seinem Gesicht …
Kalte Finger fuhren durch seine Haare.
»Lass mich in Ruhe!« Ruckartig schob er den Duschvorhang zur Seite. Warme Luft wehte herein, er bückte sich, versuchte, den Eindringling wegzutreten, die Verbindung zu zerstören.
Schwer atmend taumelte er zum Waschbecken, stützte die Arme ab und beugte sich nach vorn. Er hasste sich, hasste diesen Abend, hasste sein Leben.
Bei jemandem mit multipler Persönlichkeitsstörung war es möglich, das wusste er verdammt gut, dass sich ein Teil des Ichs abspaltete und unabhängig agierte. Betroffene hatten dann keine Ahnung von dem, was ihr Körper getan hatte, selbst wenn Gewalt im Spiel war …
Als der Kopfschmerz erneut wie ein Bulldozer durch seine Schläfen donnerte, fluchte er und trocknete sich ab; dann zog er das Flanellhemd und die NYPD-Jogginghose an, in denen er die vorangegangene Nacht geschlafen hatte. Gerade wollte er wieder nach unten gehen, als ein flüchtiger Blick aus dem Fenster ihn zurückhielt.
Etwa zwei Häuser weiter auf der gegenüberliegenden Straßenseite parkte ein Wagen.
Er kannte alle Autos aus der Nachbarschaft, alle SUVs, Kombis, Vans und Pick-ups, und dieses schlammfarbene, neuere, nichtssagende amerikanische Modell da stand nicht auf der Liste.
Allerdings war es genau der Typ, den die Polizei von Caldwell als Zivilfahrzeug benutzte.
Reilly ließ ihn überwachen. Gute Taktik – genau dasselbe hätte er an ihrer Stelle auch getan.
Es könnte sogar sie persönlich sein.
Unten am Treppenabsatz zögerte er kurz; er war versucht, barfuß nach draußen zu gehen, denn vielleicht hatte sie, oder wer auch immer es war, Neuigkeiten vom Tatort …
Mit einem neuerlichen Kraftausdruck schlug er sich diese schlaue Idee aus dem Kopf und ging in die Küche. In einem der Schränke musste doch etwas Essbares sein.
Nachdem er alle geöffnet und nichts als leere Regale vorgefunden hatte, fragte er sich, welche Supermarkt-Fee denn wohl seiner Ansicht nach herbeigeflogen sein und Essen gebracht haben sollte.
Andererseits könnte er auch einfach eine Ladung Ketchup auf einen Pizzakarton spritzen und den knabbern. Wahrscheinlich gut für seinen Ballaststoffhaushalt.
Lecker.
Schräg gegenüber von DelVecchios Haus saß Sophia Reilly hinterm Steuer und war halb geblendet.
»Bei allem, was heilig ist …« Sie rieb sich die Augen. »Von Gardinen hältst du wohl nichts?«
Während sie betete, das Bild des splitterfasernackten Kollegen würde sich schleunigst von ihrer Netzhaut zurückziehen, überdachte sie noch einmal ernsthaft ihre Entscheidung, die Observierung selbst zu übernehmen. Erstens war sie erschöpft – zumindest war sie das gewesen, bevor sie so ungefähr alles gesehen hatte, was Veck zu bieten hatte.
Streich das so ungefähr.
Wenigstens war sie jetzt hellwach, besten Dank – genauso gut hätte sie zwei Finger ablecken und in eine Steckdose halten können: Ein solcher Anblick verpasste einem die Dauerwelle, die sie sich mit dreizehn gewünscht hatte.
Vor sich hin murmelnd ließ sie die Hände wieder in den Schoß sinken – sah aber, obwohl sie das Armaturenbrett anstarrte, nur … was sie gerade gesehen hatte.
Ja, wow, bei manchen Männern bedeuteten keine Klamotten so viel mehr als nur nackt.
Und dabei hätte sie die Show fast verpasst. Sie hatte gerade ihr Zivilfahrzeug geparkt und ihre Position durchgegeben, als oben das Licht anging und sie freien Blick auf ein Schlafzimmer bekam. Daraufhin hatte sie sich zurückgelehnt, da ihr noch nicht so ganz klar gewesen war, wohin die unverstellte Aussicht sie beide führen würde – eigentlich hatte sie nur interessiert festgestellt, dass lediglich eine nackte Glühbirne von der Decke des Raums hing.
Andererseits waren Junggesellenbuden eben normalerweise entweder vollgestopft wie ein Möbellager oder öde wie das Death Valley.
Veck war offenbar der Death-Valley-Typ.
Sehr plötzlich hatte sie dann allerdings nicht mehr über Inneneinrichtung philosophiert, als ihr Verdächtiger ins Bad gegangen war und auch dort das Licht angeschaltet hatte.
Hallooo, großer Junge.
In so ungefähr jeder Hinsicht.
»Hör auf damit … hör auf damit!«
Auch die Augen zu schließen half nicht: Hatte sie bisher nur widerstrebend bemerkt, wie gut er seine Kleidung ausfüllte, wusste sie jetzt genau, warum. Er war sehr durchtrainiert, und da sein Oberkörper nicht behaart war, verdeckte nichts die harten Brustmuskeln, den Waschbrettbauch und die kräftigen Stränge, die sich über die Hüften zogen.
Was Haarwuchs betraf, hatte er lediglich einen dunklen Streifen, der zwischen seinem Nabel und seinem …