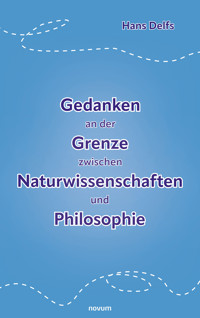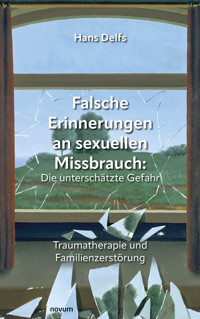
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: novum Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Erinnerungen verändern sich im Lauf der Zeit, weil sie immer wieder neu rekonstruiert werden. Dabei können auch Erinnerungen an Erlebnisse entstehen, die es niemals gab. Die Arbeitsweise des Gehirns unterscheidet nicht zwischen realen und nur vorgestellten Inhalten. Pseudoerinnerungen entstehen besonders leicht in Psychotherapien durch suggestive Spekulationen über erlittene Traumata wie sexuellen Missbrauch. Die Therapierten sind von der Realität dieser falschen Erinnerungen fest überzeugt. Sie leiden genauso wie wirklich Missbrauchte. Sie machen Unschuldige dafür verantwortlich. Familien werden zerstört, Existenzen werden bedroht, und es gibt nur Verlierer. Besonders schlimm wird es, wenn Verschwörungstheorien von rituellem Missbrauch und Opferprogrammierung dabei Pate stehen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 187
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie.
Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Funk und Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger, elektronische Datenträger und auszugsweisen Nachdruck, sind vorbehalten.
© 2024 novum publishing
ISBN Printausgabe: 978-3-99146-613-0
ISBN e-book: 978-3-99146-614-7
Lektorat: Ute Leber
Umschlagabbildung: René Magritte, La clef des champs, 1936, genehmigt durch VG Bild-Kunst, Bonn 2024
Umschlaggestaltung, Layout & Satz: novum publishing gmbh
www.novumverlag.com
Erläuterung
In dem Bild von Magritte auf dem Umschlag ist das Fenster mit seinem Blick auf eine friedliche Realität mutwillig zerschlagen worden. Im Vordergrund des Erlebens liegen jetzt die Scherben und zeugen noch von dem, was unwiederbringlich verloren gegangen ist – ein Symbol für das, worum es in diesem Buch geht.
H. D.
Vorbemerkung
Der Autor dieses kleinen Buches ist Naturwissenschaftler, kein Psychologe. Mit den hier behandelten psychologischen Fragestellungen befasst er sich aber bereits seit über 25 Jahren, insbesondere anhand wissenschaftlicher Literatur. Außerdem kennt er in allen Einzelheiten einige Hundert Fälle von Personen, die entweder als Therapierte oder als Beschuldigte von falschen Erinnerungen an sexuellen Missbrauch betroffen sind.
Eine erste Ausgabe dieses Buches erschien im Jahre 2013 im Verlag Dietmar KIotz unter dem TitelFalsche Erinnerungen an sexuellen Missbrauch: Eine therapeutische Mode, die Familien zerstört. Sie stand in engem Zusammenhang mit der Gründung des Vereins False Memory Deutschland e. V. (FMD). Es war notwendig geworden, den von diesem Verein beratenen Personen eine erste Information über das Phänomen der falschen Erinnerungen an sexuellen Missbrauch zu geben.
Eine zweite, wesentlich erweiterte und ergänzte Ausgabe erschien 2017 im Verlag Pabst Science Publishers unter dem TitelFalse Memory: „Erinnerungen“ an sexuellen Missbrauch, der nie stattfand.
Seit 2017 haben sich sowohl die gesellschaftlichen als auch die wissenschaftlichen Schwerpunkte der False Memory-Problematik verschoben. Dieser Tatsache trägt die hiermit vorgestellte dritte Ausgabe Rechnung. Es wurden weitere Fallberichte hinzugefügt und an den Anfang des Buches gestellt. Der gesamte Aufbau des Buches wurde neu gestaltet.
Einführung
Es geht in diesem Buch um Missbrauch und falsche Erinnerungen, keine erfreulichen Themen. Aber es sind wichtige Themen, die allein in Deutschland das Leben von Millionen Menschen betreffen.
Sexueller Missbrauch an Kindern ist etwas Furchtbares und leider weit verbreitet. Jahrelang wurde nicht erkannt, wie häufig sexueller Missbrauch ist. Man dachte dabei vor allem an den pädophilen Onkel mit der Bonbontüte an der Straßenecke. Dass aber sexueller Missbrauch am häufigsten innerhalb der Familie und im Freundeskreis geschieht, wurde verschwiegen und blieb meist gut getarnt. Es ist gut, dass die Öffentlichkeit in dieser Hinsicht sensibler geworden ist und dass die Missbrauchsopfer mehr und mehr wagen, sich zu wehren und die Täter zu nennen. Da die überwiegende Zahl der Missbrauchsopfer weiblich ist, ist diese Entwicklung vor allem der feministischen Bewegung zu verdanken.
Nach der besten derzeit in Deutschland vorliegenden Studie zur Häufigkeit sexuellen Missbrauchs1gibt es in Deutschland die gigantische Zahl von ca. 5 Millionen Missbrauchsopfern, eine Zahl, die größte Anstrengungen im Kampf dagegen rechtfertigt. Dieser Kampf wird zunehmend hitzig geführt, und das verengt die Perspektive. Einige Opferhilfsorganisationen und selbsternannte Missbrauchs-Jäger haben sich ideologische Scheuklappen angelegt. Meldet sich jemand als Missbrauchsopfer, so wird meist nicht gefragt, ob die Beschuldigung zu Recht besteht. Vielmehr gilt weithin, dass man dem Missbrauchsopfer aufs Wort glauben müsse. Den Opfern nicht zu glauben, wird als schwerer Fehler und erneute Traumatisierung des Opfers angesehen.
1 Stadler L, Bieneck S, Pfeiffer C: Repräsentativbefragung Sexueller Missbrauch 2011. Hannover: Kriminologisches Forschungsinstitut Niedersachsen 2012. www.kfn.de/versions/kfn/assets/fob118.pdf
Im öffentlichen Bewusstsein ist der Beschuldigte bereits verurteilt, bevor überhaupt eine Anklage erfolgt. Das juristische Grundprinzip der Unschuldsvermutung wird praktisch ausgehebelt, und oft können sich auch Gerichte dieser Dynamik nicht entziehen. Vielfach wird ohne Prüfung davon ausgegangen, dass der Beschuldigung reale Tatsachen zugrunde liegen. Das ist keineswegs immer der Fall, wie eine Reihe spektakulärer Fälle der letzten Jahre gezeigt hat. Es wurden Unschuldige verurteilt und Gerichte fügten den Beschuldigten nicht wieder gut zu machendes Unrecht zu.2
2 Rückert, Sabine, Unrecht im Namen des Volkes, ISBN: 9783455500158.
Es sind hauptsächlich vier Ursachen, die zu Falschbeschuldigungen führen.
Eine bewusste Falschbeschuldigung wird aus persönlichen Gründen vorgebracht, zum Beispiel aus Rache, oder um in einer gescheiterten Beziehung einen Sorgerechtsstreit im gewünschten Sinne zu beeinflussen.Verhalten und Aussagen von Kindern werden fehlinterpretiert. Man vermutet, dass sie Opfer von sexuellem Missbrauch seien. Bei wiederholten Vernehmungen sagen Kinder häufig einfach das, was von ihnen erwartet wird.Personen mit psychischen Störungen, insbesondere der Borderline-Störung, beschuldigen Bezugspersonen, wobei nicht immer klar ist, ob es sich um falsche Erinnerungen oder absichtliche Beschuldigung handelt.Erwachsene Personen entwickelnfalsche Erinnerungen, meist im Rahmen von Psychotherapien.Die erste Ursache wird in diesem Büchlein nicht behandelt, der Schwerpunkt unserer Betrachtungen liegt auf dem letzten Fall.
Die Bezeichnungfalsche Erinnerungenist ein Fachausdruck aus der Gedächtnispsychologie. Wer die genaue Bedeutung des Wortes nicht kennt, wird den Begriff vielleicht irrtümlich in Zusammenhang mit Lügen und absichtlichen Täuschungen bringen. Damit hat er aber nichts zu tun.Falsche Erinnerungen sind persönliche Erinnerungen an Ereignisse, die der Erinnernde glaubt, erlebt zu haben. Falsch daran ist, dass es diese Erlebnisse nicht gegeben hat.
Fälle falscher Erinnerungen an sexuellen Missbrauch kennen wir seit den 70-er Jahren. Mitte der 80-er Jahre nahm die Häufigkeit sprunghaft zu, anfangs ausschließlich in den USA. Dort häuften sich die Fälle in dramatischer Weise, bei denen erwachsene Personen, die wegen irgendwelcher Lebensprobleme einen Psychotherapeuten aufgesucht hatten, sich im Verlauf der Therapie an etwas erinnerten, was sie vor Beginn der Therapie nicht wussten: Dass sie als Kinder angeblich sexuell missbraucht worden waren. Es waren falsche Erinnerungen.
Um diese Art falscher Erinnerungen geht es in diesem Buch. Wenn im weiteren Verlauf des Buches der Begrifffalsche Erinnerungenbenutzt wird, so meist im Sinne von induzierten Erinnerungen an sexuellen Missbrauch, die nach abgeschlossener Pubertät im Rahmen einer Psychotherapie oder anderen Lebensberatungen entstanden sind, und die vorher nicht vorhanden waren.
Die massenhafte Entstehung derartiger Fälle in den USA erreichte Anfang der 90-er Jahre einen vorläufigen Höhepunkt und hatte zur Folge, dass die zu Unrecht des Missbrauchs Beschuldigten sich wehrten. Sie hatten die psychologische Forschung auf ihrer Seite. Es entstand eine erbitterte öffentliche Kontroverse zwischen den Beschuldigten und jenen Therapeuten, bei denen falsche Erinnerungen an sexuellen Missbrauch entstanden waren, diememory wars (Gedächtniskriege). Eine Konsequenz war, dass die psychologische Forschung sämtliche damit zusammenhängenden Fragen mit besonderer Intensität zu klären suchte. Dabei haben sich insbesondere zwei Ergebnisse herausgestellt:
Sexueller Missbrauch wird selten vergessen, vor allem dann nicht, wenn es ein traumatisches Ereignis war.Wird eine nicht vorhandene Erinnerung bei Erwachsenen durch gezielte Suche „wiedergewonnen“, so ist es mit größter Wahrscheinlichkeit eine falsche Erinnerung.Der Psychiater Paul McHugh schrieb 2006, diememory warsseien entschieden: Die Wissenschaft habe gesiegt.3Dennoch sehen wir heute, dass nach wie vor in Psychotherapien falsche Erinnerungen an sexuellen Missbrauch entstehen, vielleicht sogar mehr als früher. Was ist da schief gegangen?
3 McHugh, Paul R., The Mind Has Mountains: Reflections on Society and Psychiatry, Johns Hopkins University Press, 2006.
In Bezug auf die naturwissenschaftliche Psychologie hatte McHugh Recht. Eindeutige Ergebnisse zu Gedächtnis, Verdrängung oder dissoziativer Amnesie lagen schon vor dem Jahre 2000 vor. Seitdem nimmt die Zahl der wissenschaftlichen Veröffentlichungen, die falsche Erinnerungen betreffen, ständig ab.4Das Thema ist weitgehend geklärt und erschöpft.
4 Pope, Harrison G. et al., Current Scientific Interest in Dissociative Amnesia: A Bibliometric Analysis, Applied Cognitive Psychology 37/1 2023, S. 42-51.
Viele Kliniker und Therapeuten aber interessieren sich wenig für diese Ergebnisse. Deshalb haben die wichtigsten psychologischen Forschungsergebnisse aus den letzten Jahren eher soziologischen Charakter. Ein Meilenstein ist dabei eine Studie von Patihis & Pendergrast5, die in dem AbschnittRepräsentativstudien zu sexuellem Missbrauchgenauer besprochen wird und die gezeigt hat, dass falsche Erinnerungen an sexuellen Missbrauch weit häufiger sind als bisher allgemein angenommen.
5 Patihis, Lawrence und Pendergrast, Mark H., Reports of Recovered Memories of Abuse in Therapy in a Large Age-Representative U.S. National Sample. Clinical Psychological Science 2019, S. 3-21.
Die wissenschaftliche Kontroverse der Gedächtniskriege in den USA ist einer nicht minder heftigen Debatte gewichen, in der um die mediale Meinungshoheit zur Traumatherapie des sexuellen Missbrauchs oder um die Existenz rituellen Missbrauchs gestritten wird. Diese Debatte wird in allen Medien ausgetragen, wobei die sozialen Netzwerke eine Rolle spielen, die man im letzten Jahrtausend noch nicht ahnen konnte.
Es ist aber seit dem Beginn dieses Jahrtausends noch etwas hinzugekommen oder weitaus stärker geworden: Es kann kein Zweifel daran bestehen, dass für Kliniken und für die Gesamtheit der in bestimmten Berufsorganisationen repräsentierten Psychotherapeuten Traumatherapie ein Multimillionen-Business ist. Entsprechend stark ist der Lobbyismus zugunsten von Therapieformen, die lukrative und langdauernde Behandlungen garantieren.
Der Verein False Memory Deutschland stellt sich dieser Entwicklung entgegen, doch die Hauptaufgabe dieses Vereins ist die Beratung Betroffener, nicht Lobbyismus oder Forschung. Deshalb spielen Veröffentlichungen eines seriösen und sorgfältig recherchierten Journalismus eine sehr wichtige Rolle. Sie erreichen ein weit größeres Publikum als die Wissenschaft und gelangen den wichtigsten Institutionen wie Opferverbänden, Kirchen, Strafverfolgungsbehörden, Fachverbänden, Ausbildungsstellen usw., und nicht zuletzt auch den Organen der Bundesregierung, zur Kenntnis. Ansätze dazu sind vorhanden und haben zu ersten Konsequenzen geführt.
In der öffentlichen Diskussion zu falschen Erinnerungen an sexuellen Missbrauch stößt man immer wieder auf die Behauptung, es handele sich um einen Trick von Kinderschändern, ihrer Verfolgung zu entkommen.6Nichts könnte von der Wahrheit weiter entfernt sein. Nur weil es so viel wirklichen Kindesmissbrauch gibt, konnte sich eine psychotherapeutische Arbeitsrichtung entwickeln, die im Missbrauch den Universalgrund für psychische Schwierigkeiten aller Art sieht. Der Aussagepsychologe Max Steller7bezeichnet induzierte Missbrauchserinnerungen als den „Kollateralschaden“ des Kampfes gegen Kindesmissbrauch. Davon Betroffene sind demnach indirekte Opfer des tatsächlichen Kindesmissbrauchs.
6 zum Beispiel in Foren und Veröffentlichungen von Wildwasser e. V.
7 Steller, Max, Nichts als die Wahrheit, München 2015.
An dieser Stelle soll ausdrücklich betont werden:Dieses Buch dient nicht dazu, Kindesmissbrauch zu verharmlosen oder den wirklichen Tätern eine Brücke zum Entkommen zu bieten. Aber es geht darum, zwischen berechtigten Beschuldigungen und Falschbeschuldigungen zu unterscheiden.
Ein paar Worte zum Aufbau des Buches: Es beginnt mit vier Fallgeschichten, die dem Leser zeigen, mit welchen Problemen wir es hier zu tun haben. In allen vier Fällen geht es um die therapeutische Entstehung bzw. Erzeugung falscher Erinnerungen an sexuellen Missbrauch. Das ist das eigentliche Thema dieses Buches. Es ist ein komplexes Thema. Um es zu verstehen, müssen die wichtigsten Tatsachen zu sexuellem Missbrauch, zu Gedächtnis und Erinnerungen, zur Verfälschung von Erinnerungen, zu Psychotherapeuten und -therapien, zu Suggestionen etc. bekannt sein. Deshalb werden diese Wissensgebiete systematisch in dem für das Verständnis notwendigen Umfang behandelt, bevor im AbschnittTrauma-Erinnerungstherapiendas Hauptthema des Buchs angegangen wird. Es folgt ein kurzer Abschnitt über die Institutionen, die in dem Zusammenhang dieses Buches von Bedeutung sind. Ein letzter Abschnitt ist der Wissenschaft gewidmet, ihren Arbeitsmethoden und einzelnen besonders wichtigen oder interessanten Ergebnissen.
Kurz noch ein Wort zur Zielgruppe dieses Buches: Das Buch richtet sich vor allem an diejenigen, die sich erste Informationen über das Problem falscher Erinnerungen an sexuellen Missbrauch verschaffen wollen. Wer Genaueres wissen will, kann den in diesem Buch zitierten Literaturangaben folgen. Mit Rücksicht auf die Zielgruppe werden hier wissenschaftliche Untersuchungen ohne die typischen Vorsichtsklauseln zitiert, die in der wissenschaftlichen Arbeit notwendig und wichtig sind, hier aber nur verwirren würden.
Jetzt noch zwei Klarstellungen, die für das gesamte Buch gelten:
Wenn von Therapeuten, Beschuldigten, Beschuldigern, Patienten, Rechtsanwälten, Gutachtern etc. geschrieben wird, dann sind damit immer beide Geschlechter in gleicher Weise gemeint. Das vereinfacht das Schreiben und den Text. Gelegentlich wird noch eine weitere Vereinfachung vorgenommen: Da bei der überwiegenden Mehrheit der vorliegenden Fälle falscher Erinnerungen an sexuellen Missbrauch die Väter von ihren Töchtern beschuldigt werden, werde ich manchmal einfach von Vätern und Töchtern schreiben, obwohl jede andere Geschlechtskombination ebenso vorkommt, wie auch die Beschuldigung durch Enkel, Neffen, Nichten oder Freunde der Familie.Dieses Buch richtet sich nicht gegen die Psychotherapie als solche. Im Gegenteil: Viele, die von falschen Erinnerungen an sexuellen Missbrauch betroffen sind, sei es nun als zu Unrecht Beschuldigte oder als Therapierte, sind auf verständige Therapeuten angewiesen, um wieder eine Balance in ihrem Leben zu finden. Das Buch richtet sich ausschließlich gegen die therapeutische Arbeitsweise, die im vorliegenden Text alsTrauma-Erinnerungstherapiebezeichnet wird.Erster Fall: Eine Familie wird zerstört
Die Meiers, eine ganz normale Familie
Herr Meier lebt in einer Kleinstadt. Er ist seit vielen Jahren verheiratet und hat eine erwachsene Tochter. Er arbeitet freiberuflich und besitzt eine erfolgreiche Versicherungsagentur mit mehreren Angestellten. Mit großen Versicherungen hat er vertragliche Regelungen. In seiner Stadt ist Herr Meier eine bekannte Vertrauensperson.
Frau Meier ist nicht berufstätig. Sie arbeitet aktiv in verschiedenen Vereinen. Vor allem engagiert sie sich in einem Verein, der sich um Bürger kümmert, die Hilfe brauchen.
Ihre Tochter Sabine ist das einzige Kind. Sie wird sehr geliebt, früh gefördert und erhält die beste Erziehung, die ihre Heimatstadt zu bieten hat. Sabine ist ein fröhliches Kind, sie bringt gute Schulzensuren nach Hause, ohne viel zu arbeiten. Sie treibt viel Sport, vor allem Mannschaftssportarten. In der Pubertätszeit fällt eine Bulimie-Phase auf, die aber überwunden wird. Ihre ersten sexuellen Erfahrungen macht sie mit 16, ohne dass das ihre Welt umstürzt. Sie macht ein glänzendes Abitur. Alle Studienfächer stehen ihr offen. Sie schreibt sich in der nahegelegenen Universitätsstadt für ein Jurastudium ein. Parallel zum Studium trainiert Sabine eine Jugendmannschaft im örtlichen Sportverein.
Anfangs studiert sie mit großem Engagement und viel Fleiß. Nach einigen Semestern lässt ihre Begeisterung für die trockene Materie nach. Schließlich überrascht sie ihre Eltern mit der Mitteilung, sie werde das Jurastudium aufgeben und umsatteln. Ihre Arbeit mit der Sportjugend hat sie darauf gebracht, Lehrerin zu werden, Fächer Sport und Erdkunde. Das Sportstudium macht ihr Freude, das Fachstudium betreibt sie mit mehr Fleiß als Begeisterung. Mit einem wichtigen Dozenten hat sie Probleme. Sie glaubt, er kann sie nicht leiden. In einem Seminar hat er ihre Leistung als schwach bezeichnet und sie fühlt sich falsch beurteilt. Trotzdem legt sie mit 25 ein gutes Staatsexamen ab. Sie hat in ihrer Studienzeit einige Freunde. Etwas wirklich Dauerhaftes wird nicht daraus, offenbar ist der Richtige nicht dabei.
Sabines Zeit als Studienreferendarin bringt für Familie Meier eine einschneidende Umstellung. Sabine kommt in eine Stadt, die von ihrer Heimatstadt zu weit entfernt ist, um ständig nach Hause zu fahren. Die Eltern vermissen ihre Anwesenheit, insbesondere Herr Meier, der immer einen sehr direkten Draht zu seiner Tochter gehabt hat. Zwar ruft Sabine regelmäßig mehrmals in der Woche zu Hause an, aber das ist kein Ersatz für ihre Anwesenheit. Meiers wissen nicht mehr so genau, wie es ihrer Tochter geht, ob sie Schwierigkeiten oder Erfolge hat. Sabine dagegen hat das Gefühl, dieser größere Abstand vom Elternhaus sei überfällig und sie müsse sich einmal abnabeln.
Anfangs fühlt sich Sabine als Lehrerin wohl, kommt gut mit den Klassen zurecht, hat Ideen und Freude am Zusammensein mit der Jugend. Es dauert eine Weile, bis sie auch die Belastungen spürt. Wenn sie jetzt zu ihren Eltern nach Hause kommt, ist sie müde, angestrengt, erholungsbedürftig. Dabei hat sie sich Fächer ausgesucht, in denen die Korrekturarbeit in Grenzen bleibt. Allerdings ist Sabine fest davon überzeugt, dass ihre Schuldirektorin sie nicht mag. Sie bezieht deren ironische Bemerkungen in der Lehrerkonferenz auf sich. Auch die Kritik ihres Betreuungslehrers an ihrer Arbeit erscheint ihr unangebracht und übertrieben. Vor dem zweiten Staatsexamen hat Sabine wirklich Angst, doch es geht ohne Probleme über die Bühne.
Im Kollegium hat sie sich mit einer älteren Kollegin angefreundet, die ihr völlig neue Lebensbereiche eröffnet. Sie gehört einer esoterisch-spirituellen Gruppierung an und regt Sabine dazu an, verschiedene Selbsterfahrungsgruppen aufzusuchen. Sabine ist von den neuen Erfahrungen hellauf begeistert und am Telefon schwärmt sie ihren Eltern davon vor. Denen sind diese Dinge ganz fremd.
Doch die Arbeit in der Schule wird schwieriger. Ihre Eltern sind alarmiert, als Sabine ihnen berichtet, dass sie oft Angst hat, vor die Klassen zu treten. Dabei macht Disziplin ihr keine Schwierigkeiten, auch Mittelstufenklassen gehorchen ihr.
Sehr überrascht sind die Meiers, als Sabine ihnen sagt, dass sie sich für eine Heilpraktiker-Ausbildung eingeschrieben hat, welche an Wochenenden stattfindet. Sie sei sich nicht sicher, ob sie die Belastung des Lehrerdaseins ein Berufsleben lang aushalten könne. Sie sei sich aber sicher, ein gutes Gefühl für Menschen und deren Probleme zu haben.
Durch die zusätzliche Belastung an den Wochenenden kommt Sabine immer seltener nach Hause, doch ruft sie weiterhin regelmäßig ihre Eltern an. Wenn sie dann aber Zeit hat, ihre Eltern zu besuchen, ist die Atmosphäre wie früher, liebevoll und voller gegenseitigem Verständnis. Bei einem dieser Besuche berichtet sie, dass sie an einer Familienaufstellung nach Bert Hellinger teilnehmen will, die ein in ihrer Stadt ansässiger Heilpraktiker zusammen mit einem bekannten Experten durchführt. Sabine weiß zwar nicht genau, was da auf sie zukommt, deshalb kann sie es auch ihren Eltern nicht genau erläutern.
Am Tag nach der Familienaufstellung warten die Eltern gespannt auf einen Bericht ihrer Tochter am Telefon. Es kommt kein Anruf. Auch in den nächsten zwei Tagen nicht. Nun entschließt sich Herr Meier, von sich aus anzurufen. Sabine ist am Apparat. Er fragt nach ihren Erfahrungen in der Familienaufstellung. Darüber könne sie überhaupt noch nicht reden, sagt Sabine. Sie habe es noch gar nicht verarbeitet.
Auch in der nächsten Woche kein Anruf von Sabine. Als sich dieses Mal Frau Meier zu einem Anruf entschließt, meldet sich nur die Mailbox. Frau Meier bittet um einen Rückruf. Der aber kommt nicht. Es kommt überhaupt kein Anruf mehr.
Herr Meier entschließt sich zu etwas Ungewöhnlichem: Er fährt in die Stadt, in der Sabine arbeitet, und wartet am Mittag vor ihrer Schule auf sie. Er muss sie treffen, er muss wissen, was los ist. Und er trifft sie. Er kann nur die Frage loswerden: „Sabine, was ist denn los?“ Weiter kommt er nicht. Er traut seinen Ohren nicht, als sie sagt: „Du bist hier unerwünscht! Und bitte ruf mich nicht an!“ Sie dreht sich auf der Stelle um und lässt ihn entsetzt stehen.
Das ist für einige Zeit das Letzte, was er von seiner Tochter sieht und hört. Fassungslos setzt er sich ins Auto und weint wie ein Kind.
Ein Vierteljahr später klingelt es bei Meiers morgens sehr früh und sehr energisch. Herr Meier öffnet, noch im Morgenrock. Drei Polizisten stehen vor der Tür.
Er kennt zwei davon, auch den ältesten, der ihn anspricht: „Wohnt hier Herr Meier?“
„Nanu, Sie kennen mich doch?“
„Ich muss Sie bitten, mitzukommen.“
„Wieso das? Das muss doch ein Irrtum sein!“
„Ich fürchte, es ist kein Irrtum.“
Und er weist ihm einen Haftbefehl vor. Erst auf der Polizeiwache erfährt Herr Meier, was ihm vorgeworfen wird: Dringender Verdacht, seine Tochter, Sabine Meier, jahrelang und wiederholt sexuell missbraucht zu haben. Herr Meier wird verhört. Er kann nichts tun, als seine Unschuld zu beteuern. Auf viel Glauben stößt er bei den vernehmenden Polizisten nicht. Die kennen ihre Pappenheimer. Kinderschänder leugnen immer. Nach dem Verhör möchte Herr Meier nach Hause. Nein, er bleibe vorerst in Untersuchungshaft. Er lässt seinen Rechtsanwalt verständigen. Der erscheint umgehend, klärt ihn über den Ernst seiner Lage auf und gibt ihm die nötigen Verhaltensmaßregeln. Wenige Tage später wird er dem Haftrichter vorgeführt. Der sieht keine Notwendigkeit weiterer Untersuchungshaft, Herr Meier kann nach Hause gehen.
Doch in diesen wenigen Tagen hat sich die Welt für die Meiers vollkommen verändert. Die Nachbarn haben gesehen, wie Herr Meier von den Polizisten abgeführt wurde. Deren Neugier und ein indiskreter Polizeibeamter genügen, und jetzt weiß Hinz und Kunz in der Kleinstadt, dass Herr Meier ein Kinderschänder ist. Es kommen keine Kunden mehr ins Büro. Frau Meier wird im Bürgerverein unmissverständlich erklärt, dass man an ihrer Mitarbeit nicht mehr interessiert sei. Sie wird auf der Straße von alten Bekannten geschnitten. Nach einigen Wochen muss sich Herr Meier entschließen, seinen Angestellten zu kündigen. Es gibt keine Arbeit mehr. Die Versicherungen teilen Herrn Meier mit, die Zusammenarbeit mit ihm sei beendet.
Herr Meier hat Glück mit seinem Anwalt. Der hat sich Akteneinsicht verschafft und ein psychologisches Gutachten zur Aussage von Sabine beantragt. Das wird vom Staatsanwalt angefordert. Es kommt zum Ergebnis, dass Sabines Aussagen als nur eingeschränkt glaubwürdig einzustufen sind, weil Sabine vor ihrer Therapie sich nicht an einen Missbrauch erinnern konnte, weil die Erinnerungen erst durch systematische und wiederholte Bemühungen wiedergewonnen wurden und weil sich unter den Erinnerungen ein Ereignis aus ihrem dritten Lebensjahr befindet, das in den Bereich der kindlichen Amnesie fällt. In einem der von Sabine angeführten Fälle kann Herr Meier außerdem die berichteten Nebenumstände widerlegen. Das Ereignis konnte jedenfalls nicht so stattgefunden haben, wie sich Sabine erinnert.
Trotz des Gutachtens ist der Staatsanwalt sich nicht sicher, er stellt das Verfahren nicht ein, sondern erhebt Anklage. Es kommt zur Verhandlung. Meiers sehen ihre Tochter zum ersten Mal seit längerer Zeit und sind entsetzt, wie schlecht sie aussieht. Sie können nicht mit ihr sprechen, weil ihre Therapeutin sie sorgfältig von den Eltern abschirmt. Obwohl die Therapeutin im Zeugenstand Sabines Erinnerungen als zweifelsfrei erwiesene Fakten darstellt, sieht das Gericht das anders, weist den Vorwurf sexuellen Missbrauchs als nicht erwiesen zurück und spricht Herrn Meier frei.
Alles wieder gut? Keineswegs! In der öffentlichen Meinung der Kleinstadt ist der Freispruch zwar zur Kenntnis genommen worden, aber vorherrschend ist nach wie vor die Meinung, irgendetwas müsse an den Vorwürfen ja dran gewesen sein, denn sonst würde doch die eigene Tochter ihren Vater nicht verklagen.
Herr Meier hat fast kein Einkommen mehr. Seine Rücklagen reichen nur für wenige Monate. Er muss sein Büro auflösen. Der Dienstwagen wird verkauft und durch einen gebrauchten Kleinwagen ersetzt. Meiers können die Miete des von ihnen bewohnten schönen Hauses nicht mehr aufbringen. Die Suche nach einer kleineren Wohnung erweist sich als unmöglich. Bei den wenigen Angeboten in der Kleinstadt ziehen Meiers regelmäßig den Kürzeren. Einmal sagt ein Vermieter unumwunden, er vermiete nicht an Kinderschänder. Herr Meier sieht sich gezwungen, in die Kreisstadt umzuziehen, die eine halbe Autostunde entfernt ist. Dort kennt man ihn kaum, er findet zuerst eine Bürotätigkeit und dann auch eine geeignete kleine Wohnung. Er hat nicht den Mut, sich erneut freiberuflich niederzulassen. Freilich sind seine Einkünfte jetzt mit den früheren kaum vergleichbar. Um Miete, Lebensunterhalt, Auto und seine Lebensversicherungen finanzieren zu können, muss auch seine Frau mitarbeiten, die einen Minijob in einem Supermarkt annimmt.