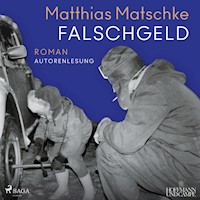10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Es ist nicht verwerflich, sich an etwas zu erinnern, das es nicht gegeben hat. Wer soll uns dafür richten?« Eine Kindheit und Jugend in der westdeutschen Provinz in den achtziger Jahren: ein zutiefst wahrhaftiger, unvergesslicher Roman über das Leben auf dem Land, über eine versunkene Zeit, über die erste Liebe und den ersten Tod und über das, was bleibt. Eine Neubausiedlung in einem kleinen hessischen Dorf in den achtziger Jahren: Der Vater ist Pfarrer, die Mutter arbeitet bei der Post – und der Sohn erzählt seine Geschichte zwischen Schule und Zivildienst: von Johanna, seiner ersten Liebe, von seinem Großvater, von seinem Religionslehrer Herr Zitelmann und den Ereignissen im Café Chaos ; vom Glück, an einem Commodore 64 die Olympischen Spiele zu gewinnen und von der Angst vorm Sterben nach einem Sturz vom Apfelbaum. Mit schwebender Leichtigkeit erzählt Matthias Matschke von einer Zeit im Leben, in der alles möglich scheint, das Glück ebenso wie der Tod. Mit Falschgeld ist Matthias Matschke ein besonderes Stück Literatur geglückt, das ohne große Worte auskommt, um auf umso intensivere Weise existenzielle Fragen zu verhandeln. Ein Roman, der lange nachhallt und der liebevoll davon erzählt, dass im Leben die vermeintlich kleinen Dinge manchmal die alles entscheidenden sind.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 296
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Matthias Matschke
Falschgeld
Roman
Hoffmann und Campe
Für meinen Vater
Man muss an die Erinnerung glauben. Sie ist formbar wie die Zukunft. Es ist nicht verwerflich, sich an etwas zu erinnern, das es nicht gegeben hat. Wer soll uns dafür richten?
Christian Matschke
Apfelbaum
Wie bin ich hierhergekommen?
Ich liege auf dem Rücken, durch den ein immer stärker werdendes Pochen hämmert. Eigentlich kenne ich Oliver Miller nicht so gut. Er wohnt drei Häuser weiter. Gegenüber, in dem alten Neubaugebiet unseres Dorfes, neben dem nie fertiggestellten Rohbau. Oliver sitzt noch immer da, wo ich vor Sekunden auch gesessen habe. Auf einem dicken Ast in der Krone des Apfelbaumes. Er schaut durch seine Nickelbrille in die Ferne.
In den Sommerferien spielt man mit Kindern, mit denen man sonst nicht spielt, denn alle Kinder, egal ob sie die Realschule oder das Gymnasium besuchen, teilen die Tatsache, dass sie zu Hause sind und Zeit im Überfluss haben. In den Sommerferien 1984 spiele ich mit Oliver Miller.
»Öde!« So hat mich Oliver vorhin auf der Straße begrüßt. »Es ist so öde!«
Ich habe dieses Wort noch nicht so oft gehört, dass ich genau wüsste, wann und wie man es gekonnt einsetzt. Ein Cousin aus Nordhessen hat es einmal benutzt, bei einer Familienfeier, aber das Wort ist fremd geblieben und der Cousin auch. Oliver ist ein Jahr jünger als ich, hat aber heute die Führung übernommen. Ich habe mich an ihn drangehängt, und er hat entschieden, dass wir heute nicht schon wieder kicken, dass der Spielplatz abgespielt ist und jetzt um zwei Uhr mittags noch nichts Gescheites im Fernsehen kommt. Er hat entschieden, dass alles öde ist. Er hat einen feuchten angefaulten Apfel genommen, der am Rand der abschüssigen Wiese mit den Apfelbäumen gelegen hat, und hat damit groß die kleinen Buchstaben ö und d und e auf den Asphalt des schmalen Weges neben der Wiese geschrieben. Ich sehe das erste Mal, dass einer mit einem Apfel schreibt. Aber die Buchstaben sind schön. Sie sehen aus wie die Druckschrift im Lesebuch. Das d hat einen langen geraden Hals, und die Rundungen des ö und des e sind auf gleicher Höhe, und die drei Buchstaben sitzen genau im richtigen Abstand zueinander auf dem schmalen abschüssigen Weg. Wie ein auf die Straße gemalter Ermutigungsspruch bei einer Bergetappe der Tour de France, die ich im Fernsehen verfolge, weil sonst nichts Gescheites kommt.
»Öde«, sagt Oliver. Er schaut auf sein Straßengraffiti, schaut auf den Rest des abgeschabten faulen Apfels in der Hand und feuert ihn in die Apfelwiese und sagt: »Man muss dem Kind einen Namen geben.« Und dann betritt er die Apfelbaumwiese und steigt auf den Baum, unter dem der faule Apfel gelandet ist.
Ich bin Matthias Matschke. Ich bin gerade vom Baum gefallen, und aus dem Pochen in meinem Rücken ist Atemnot geworden. Ich merke, dass in mir eine ungekannte Angst aufsteigt. Ich bekomme keine Luft mehr. Ich liege unter dem Baum auf dem Rücken. Unter mir liegen Äpfel. Einige weich und zermatscht. Andere noch hart, weil unreif vom Baum gefallen. Alles zieht sich zusammen, mein Körper ist wie eingeschnürt. Es fühlt sich an, als könnte ich fortan an nichts anderes mehr denken als an diesen Schmerz. Und doch denke ich: Man muss dem Kind einen Namen geben. So hat es Oliver vorhin formuliert. Und ich denke weiter: So sprechen nur Erwachsene. Oliver Miller muss sich den Satz bei den Erwachsenen gestohlen haben. Ich denke: gestohlen. Wir dürfen gar nicht hier sein. Die Wiese gehört einem Bauern aus dem Dorf, und er wird sagen, dass wir Äpfel stehlen wollten, und er wird es meinen Eltern sagen, und mein Vater wird sagen, dass ich keine Äpfel stehle, weil ich es nicht nötig habe, und sich mit dem Bauern streiten, und meiner Mutter wird es peinlich sein, und ich werde nichts sagen können, weil ich gelähmt bin. Ich bekomme keine Luft, und mein Körper gehorcht mir nicht mehr, und ich möchte schreien und kann es nicht und will es auch nicht, weil es mir peinlich ist vor Oliver. Es ist der erste Moment in meinem dreizehnjährigen Leben, in dem ich so etwas erlebe. Meine Luftröhre fühlt sich an wie ein verknickter Strohhalm. Da ist der Gedanke, dass mir soeben etwas passiert sein könnte, was mein mir bislang bekanntes Leben beendet oder nicht mehr so sein lässt, wie es bis jetzt war.
Da ist die Frage, warum man dem Kind einen Namen geben muss. Und der Schmerz. Und die Peinlichkeit vor Oliver Miller. Der sitzt noch oben im Baum und hat nicht bemerkt, dass ich abgestürzt bin. Warum alles gleichzeitig?
Kurz bevor ich abgestürzt bin, hat Oliver gesagt, dass er, wenn er groß ist, sich einen Ferrari 308 GTS kaufen will. So wie Magnum im Fernsehen. Oliver sitzt ein paar Äste weiter und schaut auf die Hügel in der Ferne. Ich denke darüber nach, ob ich das auch will. Eigentlich bin ich willenlos gegenüber der Zukunft, und Autos sind mir, im Gegensatz zu meinem Vater, sehr egal.
Aber ich liebe Flugzeuge, und Pilot könnte ich mir vorstellen. Aber meine Mutter sagt: »Da müsstest du besser sein in Mathe.« Sie traut es mir nicht zu, und so traue ich es mir auch nicht zu, und so bleibe ich am Boden. Wo ich jetzt gelähmt liege. Kurz davor habe ich oben im Apfelbaum gesessen und mir seine Äste angeschaut. Andere Kinder müssen schon vor uns versucht haben, den Baum zu erobern. Da sind zwei kinderhandbreite Latten, die durch krumme rostige Nägel an dem Apfelbaum haften. Die Latten sehen aus wie ein Teil des Baumes, sie haben den gleichen Moosbelag wie die Rinde angenommen. Das ist wohl die Bauruine eines Baumhauses.
Vorhin, bevor ich abgestürzt bin, habe ich mich vorsichtig auf die Latten gesetzt, und sie tragen mich. Oliver schaut noch immer in die Ferne, dahin, wo sich die Parabolantenne des Radarturms auf der Neunkircher Höhe dreht. Sein Vater fährt jeden Tag die zehn Kilometer dorthin. »Er sichert als Fluglotse den süddeutschen Luftraum«, sagt Oliver, als ich ihn einmal frage, was sein Vater da macht. Und jetzt sagt Oliver: »Ey, ich will das wirklich! Ich will den Ferrari!« Ich fühle mich unter Zugzwang und sage: »Jaja, ich auch!« Und als ob ich dem Nachdruck verleihen könnte, indem ich mich abstoße, springe ich die zwei Meter vom Baum. Aber einer der Nägel des Baumhausversuchs hält meine Hose fest. Und anstatt sich elegant zu bewegen, streckt sich mein Körper und stürzt steif wie ein gefällter Baum vorwärts. Mein Kopf bewegt sich am schnellsten, mein Hintern ist der Dreh- und Angelpunkt. Mein Gesicht nimmt Fahrt auf Richtung Boden. Es ist klar, dass ich dem Unglück nur noch zuschauen kann. Dennoch rudere ich mit den Armen. Alles ist schnell und langsam zugleich. Meine Haare flattern wie beim Fahrradfahren. Ich schaue mir zu, wie ich auf den Aufprall warte, doch der bleibt erst mal aus. Der Nagel, an dem mein Körper hängt, dreht mich komplett um. Kopfüber und weiter. Der Stoff der Hose reißt, und ich knalle platt mit dem Rücken auf den Apfelwiesenboden, so wie ein Pizzabäcker den ungebackenen Teig auf die mehlige Platte knallt.
Ich bin Matthias Matschke, denke ich. Als sei es das Einzige, was ich denken kann. Ich bin gerade vom Baum gefallen, und ich bin ein Zufall des Raum-Zeit-Kontinuums. So jedenfalls hat Herr Zitelmann uns Menschen genannt. »Aber es macht uns zu Lebewesen, dass wir der Zeit und ihrem Fortschreiten ausgesetzt sind.« Herr Zitelmann ist unser Religionslehrer, und ich habe schon viel zu lange nicht mehr geatmet. Wie bekomme ich wieder Luft in meinen gestauchten Schockstarreleib? Und viel wichtiger: Wie kann ich verhindern, dass Oliver rausfindet, was mir gerade passiert ist? Noch blickt er in die Ferne und träumt von der Zukunft.
Und dann, mit einem Mal, saugt der Unterdruck meiner Lunge einen kräftigen Schluck Luft in den Körper zurück. Meine Stimmbänder sind noch willenlos, und so entsteht durch den scharfen Luftstrom ein schnarrendes Geräusch, das sich wie ein »Ja« anhören muss. Jedenfalls hört es sich so an, wenn meine Handarbeitslehrerin Frau Petry beim Einatmen »Ja« sagt. Ich hasse das. Aber jetzt rettet es mich vor dem Ersticken. Und dann springe ich auf. Der Schmerz hat sich von lähmend in rasend gewandelt, und ich gehe mit staksigen Schritten um den Baum, um ihn abzuschütteln. Oliver hat sich umgedreht und sieht mich um den Baum laufen. Es scheint ihn nicht zu verwundern, dass ich nicht mehr neben ihm sitze.
Er fragt: »Was hast du gesagt?«
Ich sage: »Ich habe nur Ja gesagt«, und stakse weiter wie ein Huhn.
Der Schmerz ist immer noch da, jeder Atemzug ist eine Bestrafung, und weil Oliver weiter schaut und sich fragt, was ich da mache, sage ich: »Ey, guck mal, da ist der Apfel, mit dem du vorhin geschrieben hast!« Ich bücke mich steif und hebe den platt geschabten Apfel aus der Vielzahl der braunen Äpfel hoch, um ihn Oliver zu zeigen. Mein erhobener Arm zittert, und geschäumtes Blut pulst durch meinen Körper. Ich hoffe, dass Oliver nichts merkt. Oliver guckt mich lange an, dann grinst er und schaut wieder in die Ferne.
Ich muss mich bewegen. Der Schmerz ist zu groß, und ich gehe zurück Richtung Weg und rufe, ohne mich noch mal umzublicken: »Ich geh heim. Gleich kommt Captain Future!«
Commodore 64
Ich bin Matthias Matschke, und meine Mutter heißt Irmhild Matschke. Ich bin dreizehn Jahre alt, und sie ist irgendwie unbestimmt alt. Sie hat sich dafür entschieden, gegen Computer zu sein. Natürlich dränge ich. Ich will einen Computer zum Spielen und für alles. Aber dass man sich auskennen muss, dass es mehr als drei amerikanische Firmen gibt, die Personal Computer anbieten, über die man sich vor dem Kauf informieren muss, das überfordert sie, und deshalb ist sie zu dem Schluss gekommen, dass wir erst einmal abwarten sollen, ob sich das mit den Computern durchsetzt.
Meine Mutter könnte es wissen. Sie arbeitet, wenn sie nicht als Pfarrersfrau Gemeindedinge tut, als Beamtin bei der Post im Fernmeldewesen in Dieburg, vierzehn Kilometer entfernt von unserem Dorf. Mit acht Jahren fragte ich meine Mutter einmal, was das Fernmeldewesen überhaupt sei, und sie sagte: »Ach, alles Mögliche. Das erkläre ich dir später mal im rechten Moment.« Der Moment bleibt aus, und so bleibt das Fernmeldewesen alles Mögliche. In Dieburg gibt es riesige Antennen, und dort gibt es auch Computer, mit Bildschirmen, mit grüner oder bernsteinerner Schrift und mit blinkendem Cursor. Wie in Cape Canaveral, denke ich, als ich bei einer Betriebsfeier gemeinsam mit anderen Kindern einmal den Raum mit den vielen Rechnern betreten darf. Meine Mutter kann aber nicht glauben, dass sich diese Geräte jemals in einem privaten Haushalt werden finden können. Dabei haben immer mehr Menschen um uns herum einen Computer zu Hause.
»Deine Eltern leben in einer Zeitschleife, sagt mein Vater«, sagt Robi Brandt. Robi ist mein bester Freund, aber ich hasse seinen Vater. Ich weiß nicht, was ich gegen ihn tun soll. Er hat Gefallen daran gefunden, mich zu provozieren, mir unbequeme Fragen zu stellen, immer wenn ich bei ihnen, beispielsweise nach einem langen Spielnachmittag, zum Abendbrot bleibe und wir zu viert mit seiner Frau am Tisch sitzen. Frau Brandt ist nett und schön, und ihr Wesen prägt meine Vorstellung davon, welche Frauen ich später einmal begehrenswert finde.
»Ein Einzelkind besucht das andere einzelne Kind, haha!«, sagt der Vater. Und dann stellt er wieder Fragen. »Wie alt sind deine Eltern?« Ich sage: »Ich weiß es nicht.« Und er fragt: »Wie haben sie sich kennengelernt?« Ich sage: »Ich weiß es nicht«, auch wenn ich es eigentlich ungefähr weiß.
Warum mag Robis Mutter diesen Mann? Herr Brandt hat im Neubaugebiet eine Straße unter uns das Haus für seine Familie gebaut. Er ist Architekt. Er und seine Frau haben viele Freunde, auch unter den Nachbarn.
Meine Eltern haben keine Freunde, nur Geschwister. Ich habe keine Geschwister, aber Freunde.
Mein Vater ist der Dorfpfarrer dreier dicht beieinanderliegender Dörfer am Rand des Odenwalds. Meine Mutter unterscheidet strikt zwischen dem »Außen« und dem »Innen«. So nennt sie die Welt einerseits und unsere dreiköpfige Familie andererseits. Alles, was meine Eltern mit dem Außen zu tun haben, sind soziale Verpflichtungen. So nennen sie es jedenfalls, wenn sie darüber reden: Bibelkreis. Kerberöffnung. Gottesdienst. Seelsorge. Konfirmanden. Seniorencafé. Begräbnis.
Wir, das Innen, sind das, was nicht offiziell ist. Dann ist meine Mutter auch entspannter als sonst. Immer wenn meine Eltern nach Hause kommen, ziehen sie sich um. Als wäre das, was sie draußen tragen, ein Kostüm, und als wären sie Schauspieler und unser Haus die Garderobe, wo man sich zum ungeschminkten Ich zurückverwandelt. Wenige sehen sie so. Wir haben selten Besuch. Die Eltern meiner Eltern besuchen wir dort, wo sie wohnen. Robi darf mit uns zu Abend essen und bei uns sein. Auch meine anderen Freunde aus der Schule, wenn sie mal zu uns kommen. Das geht schon. Aber bei den wenigen Malen, die uns Bekannte oder Kollegen besuchen, wirken meine Eltern ungelenk und eckig. Es ist dann, als wären sie bei sich selbst zu Gast. Auch Gemeindemitglieder werden nur im Büro meines Vaters, im Gemeinderaum Gethsemane oder in der Kirche empfangen.
Aber auch das ist meinen Eltern noch zu nahe. Als ich in die Schule komme, ziehen sie mit mir ein Dorf weiter in ein Fertighaus mit Doppelgarage. Es hat sich im Außen etwas verändert. Im Dorf weiter ist ein Neubaugebiet entstanden. Bauern haben ihre Felder verkauft. Sie sind keine Bauern mehr, aber haben jetzt Geld und gehen in Betriebe. Meine Eltern bestellen das Haus aus einem Katalog und stellen es auf ein Grundstück in der obersten Straße am Hang des Neubaugebietes. Das Fertighaus wird zu unserem neuen Innen.
Und im Innen sucht meine Mutter gerne die Konfrontation. Mit meinem Vater. Das passt ihm gar nicht. Er will seine Ruhe und keine Sticheleien. Ich kann also davon ausgehen, dass der eine das will, was der andere gerade als unpassend empfindet. Ich kann das nicht verstehen, kann es nur beobachten und denken, dass diese Ungleichheit wohl das ist, was die beiden zusammenhält.
Und als ich dreizehn bin, träume ich davon, dass meine zukünftige Frau und ich das nicht so machen werden. Ich will nicht wie meine Eltern sein. Wir wollen Frieden. Sie lächelt liebevoll, wenn es was bei mir zu belächeln gibt, und ich weiß souverän mit ihren gelegentlichen Ungehaltenheiten umzugehen. Das will ich.
Und ich will einen Computer. Meine Mutter schreibt im Büro des Fernmeldewesens selbst an einem. Sie kontrolliert die Daten des Personals, denn auf einer Schulung in Limburg an der Lahn hat man ihr die elektronische Datenverarbeitung nähergebracht: Ja. Aber. Computer sind im Außen.
Ich bin Matthias Matschke, ich bin Fahrschüler. Die Schule, die ich seit drei Jahren besuche, ist in Darmstadt, siebzehn Kilometer entfernt. Dort gibt es Kinder mit Computern. Viele Kinder. Fast alle Kinder haben einen. Aber hier, in dem Dorf, in dem wir wohnen, dem Dorf mit dreihundert Einwohnern, da ist das etwas anderes.
Die Sommerferien sind seit einem Monat vorbei, und Oliver Miller habe ich seitdem nicht mehr gesehen.
Aber er hat einen Commodore 64.
Und das macht ihn sehr beliebt. Als sie mir die Haustür öffnet, sagt Olivers Mutter, Frau Miller, auch gleich: »Aber der Robi ist schon da!«
Das ist ein Satz, der sämtliche Einzelteile dieses Nachmittags nach der Schule zusammenfasst: Man will Computerspiele spielen, aber man hat keinen Computer. Daher streicht man bei Oliver vorbei, der eigentlich kein Freund ist. Der Robi schon. Er ist mein bester Freund. Er hat aber vorhin, als ich bei ihm geklingelt habe, gesagt, er könne heute nicht, er habe zu viele Hausaufgaben. Er geht auf ein anderes Gymnasium als ich.
Der beste Freund hat gelogen. Um frei zu sein.
Olivers Mutter straft einen sofort mit stillem Blick. Sie weiß, dass man nur vor der Tür steht, weil Oliver einen Computer hat. Und dann gewährt sie einem doch Eintritt, was eigentlich noch schlimmer ist, denn ab jetzt ist man der Kaiser, das Fertighaus der Millers ist Canossa, und Oliver Miller ist der Papst. Das alles hat die Geschwindigkeit und Unaufhaltsamkeit von Blitzeis.
Mein Vater hat dieses Jahr im Januar seinen Volvo Kombi über die Landstraße schießen lassen, mit mir drin. Ich soll immer noch hinten sitzen. Ich finde das erniedrigend, ich bin seit drei Monaten dreizehn. »Ich muss erst nachschauen, ob das erlaubt ist. So was steht in der Straßenverkehrsordnung«, hat er gegen Ende der Herbstferien gesagt. Seitdem ist nichts passiert. Ich sitze immer noch hinten, und der Wagen schießt über die Landstraße. Mein Vater liebt seinen Volvo und sagt immer wieder, dass es Europas sicherstes Auto ist und dass sein technischer Aufbau dem eines Panzers entspricht. Meine Mutter und ich wissen zu dieser Information nichts zu sagen, immer wenn er das sagt, und daher versiegt auch immer das Gespräch nach den Ausführungen über den Panzer. Mein Vater macht mit sechzehn eine Lehre als Werkzeugmacher bei Opel in Rüsselsheim. Er liebt Autos so sehr. Aber dann will er mehr. Er besucht das Abendgymnasium und studiert evangelische Theologie, obwohl er aus einer katholischen Familie kommt. Die Liebe zu den Autos bleibt. »Ich schätze den Volvo wegen seiner Sicherheit«, sagt er.
Und dann dieses Jahr im Januar schießt der Volvo über die Landstraße, und mein Vater ruft plötzlich: »Ein Reh!« Und dann: »Blitzeis!«, und der Wagen dreht sich mitten auf der B 426 mit meinem Vater und mir um sich selbst, bis er durch einen Betonpfeiler am Straßenrand gestoppt wird. Der Pfeiler bohrt sich in die Beifahrertür, da, wo ich so gerne gesessen hätte.
Nur der kalte Wind aus dem Wald neben der Straße ist auf einmal durch die geborstene Scheibe zu hören.
Wir schweigen.
Das Reh steht starr eine Wagenlänge weit weg und blickt uns regungslos und stumm an. Das Reh sieht uns, wir sehen das Reh. Wir hören das Reh atmen. Dann zieht es sich ins Gebüsch zurück.
Das Rauschen des Gestrüpps.
Wir sitzen im Volvo, und mein Vater spürt etwas zwischen Ärger und Scham.
So wie ich jetzt, da ich die Stufen zu Olivers Zimmer hinaufsteige. Drinnen sitzen Oliver und Robi. Aber der ignoriert mich komplett, und auch Oliver grüßt nur knapp, und dann hört man nur noch, wie sie am Joystick rütteln. Sie spielen Summer Games. Beim Sprint über hundert Meter muss man wie besessen am Joystick rütteln, damit man als Läufer in staksigen Pixelbewegungen die Strecke schneller bewältigt als der computergemachte Spieler aus Japan, Jamaika oder der Sowjetunion. Da Oliver nur einen Joystick besitzt, kann man auch nur im Ein-Spieler-Modus gegen den Computer spielen. Oliver und Robi wechseln sich ab. Ihr Blick haftet am Bildschirm. Ich bin ausgeblendet und schon wieder vergessen. Dass ich mitspielen könnte, war nie angedacht. Die beiden sitzen vor dem Fernseher, der auf dem Schreibtisch steht und leise fiept, wenn keine Musik oder kein anderes Geräusch vom Spiel kommt. Ich sitze auf der Bettkante hinter ihnen.
Die Nackenverspannung, die ich gerade zum ersten Mal verspüre, wird sich ab jetzt lebenslänglich mit dem Gefühl von Eifersucht verbinden. Meine Wirbelsäule, von der ich dachte, dass sie zerbrochen sei, als ich unter dem Apfelbaum lag, wird steif und reißt die Muskeln drumherum an sich. Die Eifersucht hat etwas Kaltes und Heißes zugleich. Mit eisiger Wange schmiegt sie sich an mich und umarmt mich dabei hitzig, sitzt mit mir auf der Bettkante und macht sich über mein Zusehen lächerlich.
Die Nationalhymne der Vereinigten Staaten erklingt. Oliver ist immer Amerika und hat seinen eigenen und den Weltrekord für die USA eingestellt.
Er zieht den Joystick nach oben, und mit einem schmatzenden Geräusch lösen sich die kleinen Saugnäpfe an der Unterseite des Joysticks. Dann rammt er den Joystick mit den vier Saugnäpfen auf die glatte Schreibtischplatte. Nun soll Robi zeigen, was er kann. Er ist immer Sowjetunion. Und immer etwas langsamer als Oliver.
Robi beginnt nach dem nächsten Startschuss den Joystick wie verrückt nach rechts und links zu reißen.
»Wer wichsen kann, ist im Vorteil«, sage ich. Ich will mich nicht fühlen wie der Computerspieler, der unter albanischer Flagge startet und regelmäßig als Letzter auf Platz acht einläuft. »Und bei solchen Sprintdisziplinen werden unheimlich viel Hormone ausgestoßen, wusstet ihr das?«, sage ich. Ich will auch nicht, dass dieses Gefühl der Niederlage bleibt, wenn ich gleich aus dem Zimmer gehe. »Hormone sind das A und O in der Leichtathletik.«
Die beiden schauen stur auf den Fernseher, während Robi den Hebel hin und her reißt. Robi läuft als Erster ein, ist aber langsamer als Oliver. Der ist jetzt dran.
Saugnapfgeräusch – Ablösen, Saugnapfgeräusch – Festkleben.
»Jedes Rennen ist Stress. Die Hormone Adrenalin und Noradrenalin werden ausgeschüttet, und die Läufer erleben bei jedem Wettkampf, was andere Menschen in geistigen Belastungssituationen erleben.«
Jetzt rüttelt Oliver am Hebel, wieder für die USA.
»Wie zum Beispiel Todesangst, Angst vor Versagen oder Gesichtsverlust.«
Oliver wird Erster, macht aber keinen Rekord.
»Bei Tieren ist das auch so. Mein Vater hat dieses Jahr im Januar ein Reh angefahren. Es ist voll in die Beifahrertür gerannt. Aber unser Volvo ist wie ein Panzer. Das war mein Glück, weil ich auf dem Beifahrersitz gesessen habe. Ich habe genau gesehen, wie das Reh seine Augen aufgerissen hat. Die Scheibe ist zerbrochen, und ich konnte ihm aus dreißig Zentimetern Entfernung in die Augen schauen.«
Die italienische Nationalhymne erklingt. Robis Sowjetunion ist nur Zweiter geworden.
»Und dann hat sich das Reh aufgebäumt und ist gerannt. So schnell habe ich noch nie ein Tier laufen sehen. Rehe sind übrigens nicht Hirsche, sondern gehören zur Familie der Trughirsche. Mein Vater ist dem Tier hinterhergefahren, aber er konnte es nicht einholen, so schnell war es. Wir sind einfach der Blutspur gefolgt. Das Reh ist dann in seiner Panik bis ins Dorf gelaufen und vor der Metzgerei von Gerd Weidner zusammengebrochen.«
Die beiden starren immer noch auf den Bildschirm. Aber das Rütteln hat aufgehört.
»Wir haben das Auto geparkt und den Metzger gefragt, was man jetzt machen soll. Der hat gesagt: ›Na, was wohl?‹, und hat den Rehbock gleich durch das Tor neben seinem Geschäft in den Hof gezogen. Und dann hat er sein Bolzenschussgerät genommen und das Ding auf den Kopf von dem Bock angesetzt. Aber in dem Moment ist der Bock noch mal in Panik geraten und aufgesprungen und, ohne zu bremsen, gegen die Stalltür gerannt, dass ein Loch drin war. Und er war immer noch nicht tot. Die Beine haben gezuckt wie bei einem Hund, wenn er träumt. Und als er endlich tot war, hat Gerd Weidner ein Messer genommen und den Bock aufgeschnitten, und was an Blut noch da war, ist rausgeflossen, und aus allem, was drin war, wurde Fleisch und Wurst gemacht. Nur das Herz hat Herr Weidner in den Mülleimer geschmissen. Das hat immer noch geschlagen.
›Kann man das Herz denn nicht gebrauchen?‹, habe ich meinen Vater gefragt, und der hat geflüstert: ›Matthi, das Herz gehört nur dem Bock, es ist für immer frei.‹ Und wir und der Weidner Gerd haben für einen kleinen Moment um den Eimer mit dem zuckenden Herz gestanden, als wäre er ein offenes Grab. Ja, und zu Ostern haben wir von ihm ein großes Stück von dem Rehrücken bekommen.«
Die beiden schauen sich die Siegerehrung des letzten Laufes an. Keiner hat es auf das Treppchen geschafft.
»Hast du eigentlich auch schon Winter Games? Das ist zwar ein gutes Spiel, aber nicht so gut wie Olympic Games. In Amerika spielt das jeder«, sage ich.
Als ich die Tür zu Olivers Zimmer geschlossen habe und die ersten Stufen der Treppe nach unten gehe, fühle ich mich überlegen. Und als ich unten ankomme und Olivers Eltern vor dem Fernseher sitzen sehe, fühle ich mich schlecht.
»Du gehst ja schon wieder«, sagt die Mutter sehr nett und fast traurig und lächelt mich an.
Jetzt fühle ich mich noch schlechter.
»Ich habe was vergessen«, sage ich.
Parotitis
Als ich sechs bin, leben wir noch im Pfarrhaus. Neben dem Haus ist ein kleiner Parkplatz für drei Autos. Und an dieser Bucht liegen unser Haus, gegenüber der evangelische Kindergarten und dazwischen, etwas zurückgesetzt, die kleine Kirche.
In der Kirche hängt ein großes Bild, das einen langen Kerzenständer mit einer brennenden Kerze zeigt. Der Kerzenständer steht auf einer Bibel, die schwebt. Das Bild ist dunkel, und nur die Kerze und ihr Schein bringen Licht in das schwarze Viereck. Ganz unten steht in goldenen Buchstaben Lux lucet in tenebris, der Wahlspruch der Waldenser.
Mein Vater steht einmal mit mir in der Kirche. Er sagt, dass die Menschen, die diese Kirche gebaut haben, aus Frankreich geflüchtet sind, weil sie nicht katholisch sein wollten. »So wie du«, sage ich ihm. »Ja«, sagt er, »ich war katholisch, wollte es aber nicht mehr sein.« Es entsteht eine bedeutungsvolle Gesprächspause, die ich aber so noch nicht empfinde, weil ich zu klein bin. Es ist nur Zeit, in der nicht geredet wird. Aber ich bin groß genug, um auf eine Antwort zu warten, warum er nicht mehr katholisch sein wollte. Nach der Pause sagt mein Vater bedeutungsvoll: »Es ist nicht alles Gold, was glänzt.« Auch da wieder eine Pause. Dann sagt er: »Was aber ewig glänzt und scheint, ist dieses Licht.« Er deutet auf die Kerze. »Da steht: Das Licht leuchtet in der Finsternis. Latein. Lernst du später. Und das Licht leuchtet gegen alles, was wir nicht wollen und was uns ergreifen will!«, sagt er, und seine Stimme wird kräftig schneidend.
Auch das verstehe ich nicht. Aber es wird still um uns, obwohl es das vorher auch schon war.
Ab jetzt spüre ich die Stille öfter.
Und nach der Stille sagt mein Vater, jetzt wieder weniger laut: »Unser Leben ist sehr kurz und nicht ausreichend. Daher brauchen wir ein ewiges Leben. Die Kerze zeigt uns den Weg. Mehr kann ich dir auch nicht sagen.« Und mir wird seltsam warm, wahrscheinlich weil mein Vater diesmal so leise und vorsichtig gesprochen hat.
Mein Vater ist selten so. Er ist nicht der liebevolle christliche Mann, der mit Frau und fünf Kindern im glücklichen Chaos lebt und die Gemeinde aufopferungsvoll betreut und das Leid und die Freuden der Menschen teilt. Ich kenne ein Porträt von Diego Velázquez aus einem Kunstbuch, das mich an meinen Vater erinnert. Er ist oft grimmig und streitbar. So gerät er regelmäßig mit Schwester Ruth in Konflikt. Auch mit anderen. Dem Gemeinderat, dem Postboten. Aber immer wieder mit Schwester Ruth. Sie leitet den evangelischen Kindergarten, der von unserem Pfarrhaus nur durch den Parkplatz für drei Autos getrennt wird.
Dort gehe ich hin, in die große Gruppe. Das ist die Gruppe, die schon ein wenig Vorschule ist, mit Buchstabenmalen und Musikmachen und Purzelstunde, so etwas wie einfacher Sportunterricht. Ich gehe jeden Morgen vorbei an der Kirche über den Parkplatz für drei Autos ins Gartentor des Kindergartens. Ich kann bis zehn zählen, und genauso lange dauert der Weg vom Pfarrhaus bis zu Schwester Ruth. Ich darf allein gehen. Das erfüllt mich mit Stolz. Ich ziehe mir meinen Mantel aus dunkelgrünem Lodenstoff an. Der Mantel ist mehr ein Cape mit blau-weiß-gelb kariertem Innenfutter. Mein Cousin ist da rausgewachsen, und ich trage es auf. Meine Mutter nennt das Cape den Ein-Männlein-steht-im-Walde-Mantel, obwohl es gar nicht purpurn, sondern grün ist. Mich ärgert das, ich will kein Männlein im Walde sein. Da ich aber keinen anderen Namen für den Mantel kenne, muss ich ihn auch so nennen. Das amüsiert meine Mutter, und mich ärgert das. Seitlich am Mantel kann man die Hände durch zwei Öffnungen stecken, die wie Taschen aussehen. Aber man kann die Hände auch einfach unter dem Cape lassen. Und über dem Cape hängt meine Trinkflasche, die aus einem fahlen Weiß ist und einen roten einen Zentimeter breiten und steifen Plastikstreifen als Riemen hat. Wenn man daraus trinkt, dann schmeckt der Tee oder Saft vor allem nach dem Plastik der Flasche. Manchmal rieche ich an der Flasche, wenn ich mich unsicher fühle. Das passiert im Kindergarten, auch wenn ich schon in der großen Gruppe bin.
»Matthias Matschke, hör auf, dadran zu riechen!«, sagt Schwester Ruth. Sie ist eine Diakonissin und trägt einen grauen Habit mit weißer Schürze und einer weißen Haube. Was ein Habit ist, hat mein Vater mir erklärt. Sie sieht aus wie eine englische Weltkriegskrankenschwester aus alten Filmen. Das weiß ich aber erst später, wenn man so was weiß. Jetzt weiß ich nur, dass sie streng ist und auch gütig, aber beides sprunghaft wahlweise. Ich höre auf, an der Flasche zu riechen, und grinse, als wäre ich überlegen. Aber niemand ist Schwester Ruth überlegen. Auch nicht mein Vater. Theoretisch ist sie ihm gegenüber weisungsgebunden. Er denkt das so. Sie denkt das Gegenteil.
Ich blicke vom Arbeitszimmer meines Vaters auf den Außenbereich des Kindergartens und in die Sonne, und es ist die Karwoche. Das offene Fenster vor dem Schreibtisch meines Vaters lässt noch kalte, aber irgendwie schon frühlingshafte Luft herein. Die Kindergartenkinder toben durch den Kindergartengarten. Ich gehöre eigentlich dazu, zur Vorschulgruppe, bin aber krank. Ich habe eine Parotitis, eine eitrige Entzündung der linken Ohrspeicheldrüse. Die Drüse produziert Speichel. Ziemlich genau zweimal im Jahr habe ich diese schmerzhafte Schwellung der Drüse vor dem linken Ohr. Zu Beginn und zum Ende des Winters. Wie jetzt, im April. Es tut weh, und ich kann nicht richtig sprechen und essen. Kiefersperre.
Ich stehe da und schaue auf die Gruppe, aber ich darf nicht raus. »Weil du doch wieder dein Ohr hast«, sagt meine Mutter. Heute Morgen, ganz früh, als der Tag noch grau war, hat es noch einmal geschneit. Der Boden ist weiß, aber die Sonne, die sich jetzt zeigt, wird den Schnee schnell auflösen.
Ich langweile mich und suche nach Beschäftigung. Kiefersperre. Ich stehe stumm im Arbeitszimmer meines Vaters, der sich dunkel über das Gesangbuch beugt und summt. Er trifft die Liederauswahl für die Osternacht. Die Lieder für die anderen Gottesdienste des Osterfestes sind immer gleich und daher schon ausgewählt, aber die Osternacht soll etwas Besonderes werden.
Ganz dunkel wird die Kirche sein, und dann trägt der Kirchenälteste eine kleine Kerze in die Kirche, und so kommt das Licht in die Welt zurück.
Ohne aufzusehen und aus seinem Summen heraus, sagt mein Vater: »Zur Auferstehung musst du aber wieder fit sein.«
Er erwartet keine Antwort, er kennt meinen Zustand der Kiefersperre. Sehen und schweigen. Kurz sieht er auf, blickt flüchtig aus dem Fenster, zurück zum Gesangbuch. Dann aber mit raschem Ruck wieder aus dem Fenster. Jetzt ist er wie erstarrt. Dann schaut er mich an, als erwarte er diesmal eine Antwort. Mir treten Tränen in die Augen, und ich weiß nicht, warum. Meine Eiterdrüse pocht. Mein Vater steht auf und lehnt sich weit über den wuchtigen Schreibtisch, um besser sehen zu können. Auch ich schaue auf Zehenspitzen aus dem Fenster, um dort draußen nach dem Grund seiner Gefühlsveränderung zu suchen.
Die alte Heizung, die zwischen Fenster und großem Schreibtisch wie eingeklemmt wirkt, heizt auf vollen Touren. Mein Vater ist immer verfroren. Die erhitzte Luft erzeugt wabernde Schlieren.
Dahinter sehe ich meine Kindergartengruppen im gleißenden Sonnenlicht. Der Schnee ist weg, als wäre er nie da gewesen. Schwester Ruth achtet mit überlegener Langeweile auf die Kinder. Die Jungs der Gruppe rutschen auf den Hosenböden ihrer Matschhosen herum. Wäre ich nicht mit Parotitis hier oben, sondern mit meiner Matschhose da unten, würden sie bestimmt wieder rufen: »Matthias Matsche mit der Matschkehose!« Es stört mich fast nicht, wenn die Jungs das sagen, denn so zeigen sie, dass es ihnen egal ist, ob mein Vater der Dorfpfarrer ist oder nicht. Das macht mich ihnen gleich.
Der Dorfpfarrer macht mir mehr Angst. Eingefroren wie ein Vorstehhund steht er da. Ich weiß, was ein Vorstehhund ist. Ich will einen Hund, einen English Pointer, zu Deutsch Vorstehhund. Das hat mir meine Mutter vorgelesen, in dem Hundebuch, das in der Bibliothek meines Vaters steht, ganz unten, wo ich hinkomme. Ich kann auch schon etwas Zahlen lesen, vor allem Zahlen mit Komma. Darauf bin ich stolz. Ein Pointer wiegt durchschnittlich zweiundzwanzig Komma fünf Kilogramm. So viel wie ich. Ich will einen Vorstehhund, und der soll Beppe heißen.
Selten ist so viel Spannung im Körper meines Vaters. Normalerweise hat er die Haltung eines Menschen, der zu viel am Schreibtisch sitzt. Die Schultern nach vorne eingerollt wie ein welkes Blatt, eine schlaffe Körpermitte und eine steife Hüfte. Selbst der Segen zum Abschluss des Gottesdienstes, bei dem die anderen Pfarrer beide Hände ausbreiten und die Gemeinde mit behütenden Sätzen überströmen, als kämen sie direkt aus ihnen heraus, lassen den Körper meines Vaters rund aussehen wie ein Insekt mit Buckelpanzer. Doch jetzt ist er straff wie ein Pointer und hat Witterung aufgenommen. Erst passiert nichts.
Dann geht er los, ohne den Blick nach draußen zu verlieren. Hinaus. Die Tür bleibt offen. Ich stehe im Schlafanzug da, und wieder passiert nichts. Mein Vater ist weg. Die Sekunden fließen wie das Aprilsonnenlicht um mich herum. Auf einmal fröstle ich. Das offene Fenster. Keine Bewegung nirgendwo.
Die Kinder stehen in einem Kreis. Gerd Weidner heißt wie sein Vater, der Metzger, und sitzt in der Mitte wie ein Hase. Auch Schwester Ruth bewegt sich nicht. Alles wirkt wie bei Pieter Brueghel. In der Bibliothek meines Vaters gibt es ein großes Buch, es heißt Von Bosch bis Brueghel, nicht weit vom Hundebuch entfernt. Bibliothek bedeutet in diesem Fall eine hohe Schrankwand mit Büchern im Arbeitszimmer. Die Bildbände sind wegen ihrer Größe ganz unten eingeordnet, und ich kann da gut ran. Der Einband von Von Bosch bis Brueghel fasziniert mich. Da sind Vögel mit Menschenkörpern, und in den Menschenkörpern stecken Pfeile. Immer wenn ich mich dem Bildband nähere, höre ich aus dem Hintergrund die Stimme meines Vaters. »Nicht, Matthi, mach das nicht kaputt!« Ich verstehe nicht, wie ich etwas durch Angucken kaputt machen kann. Ich frage zurück: »Und wenn ich ganz vorsichtig bin?« Mein Vater ist trotz seinem Grimm auch gütig. »Aber sei vorsichtig, das ist wertvoll.« Das Wimmelbild auf Seite neunundzwanzig ist mein Lieblingsbild und heißt Kinderspiele. Alle spielen. Und dabei sind sie traurig oder lustig, rennen rum oder verharren.
Schwester Ruth, Gerd Weidner und die anderen Kinder würden gut in das Bild passen. So, wie sie jetzt da unten stehen. Eingefroren. Nur die Zeit bleibt flüssig.
Dann regt sich etwas, denn mein Vater regt sich auf. Ich sehe ihn noch nicht. Ich stehe nicht nahe genug am Fenster, aber ich sehe das Gesicht von Schwester Ruth. Es verdunkelt sich. Offenbar nähert sich mein Vater ihr mit staksigen schnellen Schritten.
Gerd Weidner rennt ungeahnt spontan los, und alle Kinder folgen in den hinteren Teil des Gartens. Die Vorschulkinder zuerst. Die Kleinen laufen hinterher. Nun ist mein Vater zu sehen. Er schimpft. Ich kann ihn von hinten sehen. Sein Kopf wirkt wie der eines zuckenden Vogels, der sich mit einem Artgenossen um ein Weibchen streitet. Nervös, ungelenk und übertrieben. Schwester Ruth ist ungerührt. Wäre sie ein Mann, würde sie meinen Vater mit einem ruhigen Schlag niederstrecken, denke ich. Wünsche ich.
Ich höre nicht, worum es geht. Das Spielgetöse meiner Vorschulkindergruppe und der Kleinen überdeckt alles. Mein Vater gockelt weiter. Der Kopf zuckt. Schwester Ruth verschränkt die Arme, ihr Körper bleibt ungerührt. Ein seltsames Gefühl streicht an mir herauf, ähnlich wie die Heizungsluft. Mein Nacken kribbelt, und meine kleine Penisspitze zwickt zweimal. Das macht sie, wenn mir etwas peinlich ist. Ich bin Matthias Matschke, sage ich mir dann.