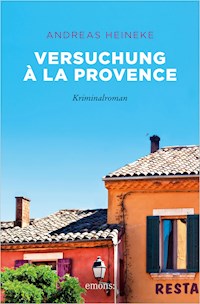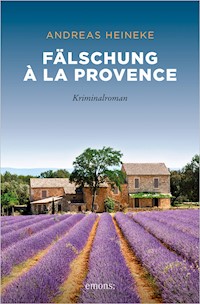
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: emons: Sehnsuchts Orte
- Sprache: Deutsch
Die südfranzösische Kunstszene unter Mordverdacht. Eigentlich lebt Dorfgendarm Pascal Chevrier in der Provence, weil er die regionale Küche und das ruhige, pittoreske Leben schätzt. Doch die Idylle findet ein jähes Ende, als im Picasso-Schloss eine junge Kunsthistorikerin ermordet aufgefunden wird. In exklusiven Kreisen sucht Chevrier nach Hinweisen und trifft auf exzentrische Kunstsammler und Galeristen, die alle mehr oder weniger verdächtig wirken. Aber nicht nur der verzwickte Fall in der spätsommerlichen Hitze des Luberon treibt ihm den Schweiß auf die Stirn. Audrey von der Police nationale, für die er mehr als kollegiale Gefühle hegt, macht alles noch viel komplizierter ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 357
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Sammlungen
Ähnliche
Andreas Heineke war Radiomoderator, Musikmanager und Dot-Com-Firmengründer. Heute arbeitet er vor allem als Autor, Filmemacher, Drehbuchautor und Regisseur u. a. für das ZDF und den NDR. Er schreibt außerdem Sachbücher und Kriminalromane, die in der Provence spielen, wo er seit Jahren so viel Zeit wie möglich verbringt. Andreas Heineke ist fast dauerhaft auf Lesetour und hat 2020 den Bücher-Podcast »2MannBuch« ins Leben gerufen. »Fälschung à la Provence« ist sein dritter Kriminalroman rund um den Gendarm Pascal Chevrier.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© 2021 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: mauritius images/Matjaz Corel/Alamy
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer
Lektorat: Susann Säuberlich, Neubiberg
E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-96041-718-7
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Dieser Roman wurde vermittelt durch die Verlagsagentur Lianne Kolf, München.
Für meinen Lieblingsmaler und Freund Ralf-Rainer Odenwald
Die meiste Zeit wird damit vergeudet, festzuhalten, was man längst verloren hat.
Pablo Picasso
Prolog
Schon als Teenager hatte sich Donia die eine Frage gestellt: Was würde in ihrem Leben ihre letzte Tat sein? Nie hätte sie daran gedacht, dass es so eine profane Handlung sein könnte wie ein Bild aufzuhängen. Sie hatte immer geglaubt, am Lebensende werde irgendetwas Bedeutendes stehen. Ein wichtiger letzter Satz, ein kluger Gedanke, ein »Ach so, dafür war das alles«.
Doch so war es nicht, als sie den Schrei hinter sich hörte. Wut, Entsetzen, Verzweiflung. Und dann war da schon der Schmerz mit all seiner erbarmungslosen, auslöschenden Gewalt. So intensiv, so allumfassend, dass es ihr nicht mehr vergönnt war, den eigenen Mörder zu sehen, sein Gesicht, den Hass in seinen Augen, die Waffe.
Die Lanze – sicher gut fünfzig Jahre alt – bereitete ihr ein recht schnelles, vor allem aber unerwartetes Ende. Nur ein letzter Atemzug war ihr erlaubt, ein finales Einatmen. Sie spürte, wie die Luft sich in ihrer verletzten Lunge mit dem Blut vermischte und diese schließlich in sich zusammenfiel. Ihre Seele durfte sie nicht mehr ausatmen, würde später in einem der Zeitungsartikel stehen.
Gerade eben hatte sie noch die schwere rote Tür des Château de Vauvenargues aufgedrückt, sich mit ihrem ganzen Körper gegen das massive Holz gestemmt, bis es schließlich nachgegeben und den Blick auf einen Ort freigegeben hatte, der seit über vierzig Jahren der Öffentlichkeit verwehrt worden war. Das war ihr Arbeitsplatz, für die Kunstwelt waren diese Räume der Heilige Gral.
Sie hatte wie jeden Morgen den Souvenirshop aufgeschlossen, die Lampe eingeschaltet und das Wechselgeld in die Kasse gefüllt. Dann war sie den Picasso-Flur hinuntergegangen, noch einmal, vorbei an den Bildern, den Skulpturen und den spanischen Reliquien. Jeder Zentimeter war zu Kunst geworden. Wo das Auge suchte.
Die Sonne zeigte sich erst in einem schmalen Streifen hinter den Hügeln der Provence, in einem rötlichen Licht zum Niederknien. Donias Todestag sollte die letzte Hitzewelle des Jahres in der Provence einläuten.
Der schmale Weg zum Schloss, den sie in den vergangenen Wochen in einer Mischung aus Ehrfurcht und Euphorie gegangen war, gehörte in den frühen Morgenstunden noch ihr allein. Erst um zehn Uhr würden sie kommen, die Kunstkenner aus aller Welt, die Amerikaner, die Engländer, die Deutschen und die Chinesen mit ihren Fotoapparaten und Handys, die sie ohnehin am Eingang abgeben mussten – bei Jean, dem kräftig gebauten Museumswärter.
Der schweigsame Mann mit den tiefen dunklen Augen war für die Einhaltung der Regeln verantwortlich. Er klebte immer die kleinen Zettel mit den Namen auf die Handys und Fotoapparate und gab der aufgeregten Menschengruppe seine Anweisungen. Die Linien nicht zu übertreten, nichts anzufassen, sich nicht von der Gruppe zu entfernen.
Er war der letzte Mensch gewesen, mit dem Donia am Abend zuvor gesprochen hatte. Sie hatten zusammen einen Wein getrunken, und die Art, wie er sie dabei angesehen hatte, hatte verraten, dass der Moment für ihn noch lange hätte andauern können. Er hatte sich verliebt, schon seit dem ersten Tag, seit der großen Eröffnung der Ausstellung, als die Kunstwelt auf dieses Schloss in der Provence geschaut hatte. Unter ihnen die schöne Frau: Donia, die um ihre Wirkung auf Männer wusste.
Die Kuratoren hatten in den Medien auf ihre Erscheinung gesetzt, auf ihre Wortgewandtheit. Sie waren stolz darauf gewesen, eine der größten Picasso-Kennerinnen des Landes als Kunstführerin für sich gewonnen zu haben.
Das Schloss Vauvenargues mit seiner bewegten Geschichte, dieser besondere Ort, an dem so viele Werke erschaffen, so kluge Texte erdacht worden waren, war Donias Sehnsuchtsort gewesen. Die Erfüllung all ihrer Träume, schon seitdem sie denken konnte. Ihr Leben lang hatte sie auf diese Wochen hingearbeitet. Das schmale Zeitfenster, jene wertvollen Tage, an denen die Öffentlichkeit die letzten von Picasso gemalten Bilder sehen durfte, ging in die Geschichte der Kunstausstellungen ein. Es war nicht weniger als eine Weltsensation.
Tag für Tag hatte Donia die Besucher durch das Atelier, das Herzstück des Hauses, geleitet. Sie konnte zuhören, wie die Picasso-Liebhaber schluckten, sich etwas zuflüsterten. Schon für das Raunen der Menschen lohnte sich ihre Arbeit. Dort stand die Staffelei mit dem unvollendeten Gemälde. Ein kleiner Tisch, darauf die aufgeschlagene Zeitung vom 8. April 1973. Morgens noch hatte Picasso darin gelesen, einen Tag später war er selbst auf der Titelseite gewesen, schwarz-weiß mit einem Trauerrand. Morgen würde dort das Foto von Donia zu sehen sein. »Eine Kunstkennerin im Picasso-Schloss ermordet«.
War es nicht am Ende sogar eine Belohnung, als letzten Eindruck vor dem Nichts ein Bild mit einer solchen Gewalt gesehen zu haben? War nicht die Handlung, das Werk eines Genies aufzuhängen, am Ende doch etwas Lohnendes gewesen? Hätte sie es nicht in ihrer letzten Sekunde so sehen können?
Als die Lanze in Donias Rücken eindrang, waren weder Jean noch ein Besucher oder die Kuratorin vor Ort. Niemand konnte ihren kurzen Schrei hören, das Gurgeln aus der Lunge, ihren Fall. Donia sah das viele Blau des Bildes, ein wenig Grün, Weiß, die Augen der Frau darauf und dazu eine schwarze Katze. Provozierend kindlich gemalt. »Am Ende kehrt der Mensch in seine Kindheit zurück«, hatte ihre Oma auf dem Sterbebett gesagt. Dann übernahm Rot die Macht, ein waberndes, sich langsam ausbreitendes Rot. Es lief ihr über den Rücken, den Po, die Beine und auf den Boden. Es war zu wenig Leben in ihr, um sich noch abstützen zu können, und so war nur noch der dumpfe Aufschlag zu hören. Schön war sie gewesen, würde es heißen.
Dann tauchte sie ab in eine Welt ohne Farben. Eine farblose Welt hatte immer jenseits ihrer Vorstellungskraft gelegen.
1
Die letzten Septembertage im Luberon hatten es in sich. Das Thermometer an Pascals Hauswand hatte heute Mittag einunddreißig Grad angezeigt. Es war unmöglich gewesen, die Renovierungsarbeiten seines kleinen Hauses, seines Mas, abzuschließen.
Schon vor ein paar Tagen hatte er den Boden abgeschliffen und neu geölt. Im hinteren Bereich des Wohnzimmers wollte er seine Möbel wieder an ihren Platz stellen, sie waren überall im Haus verteilt. In der Küche, im Schlafzimmer, eine Kommode hatte er sogar in den Garten unter die Markise gestellt.
Regen war nicht in Sicht, die geringe Luftfeuchtigkeit konnte dem alten deutschen Biedermeierschrank also nichts anhaben. Auf eine weitere Nacht kam es deshalb nicht an.
Erschöpft saß Pascal Chevrier an dem runden Bistrotisch vor seinem Haus, ein Glas Rosé vor sich, daneben ein paar getrüffelte Salamischeiben als Snack. Bordeaux, sein gerade mal sechs Monate alter Labrador, hatte es sich unter dem Tisch bequem gemacht. Zum ersten Mal an diesem Tag. Die Hitze schien er zuvor nicht wahrgenommen zu haben, fast hatte Pascal das Gefühl, Bordeaux hätte ihn bei jedem Stöhnen – und er stöhnte oft an diesem Nachmittag – mit einer Mischung aus Spott und gespieltem Mitleid angeschaut. Dann hatte er sein Herrchen zu einem Ballspiel herausgefordert. Gut gelaunt warf er ihm seinen durchnässten Tennisball vor die Füße. Eine Runde Werfen zur Aufmunterung. Sogar Pascal konnte der Idee etwas Praktisches abgewinnen, immerhin war sein Hund dann mit dem Ball und nicht mit dem Gemüsebeet beschäftigt, in dem er bereits die Karottenernte eingeleitet hatte.
»Allez, mon ami, lass uns unsere Abendrunde durchs Dorf machen«, sagte er, während er aufstand.
Der Hund verstand. Seine Zunge hing links zum Entlüften aus dem Maul, die Augen hatte er wie zur Hypnose starr auf Pascal gerichtet. Die Vorfreude auf die schönste Stunde des Tages machte es ihm unmöglich, die Entscheidung zu treffen, ob er lieber sitzen oder stehen sollte.
Pascal zog die Uniformjacke über das hellblaue Hemd und hing sich die Hundelederleine um den Hals. Letzte Woche hatte er versucht, Bordeaux in Lucasson frei laufen zu lassen, doch das ständige Entschuldigen, »Er ist noch jung, er will nur spielen« oder »Nein, das ist kein Betteln, essen Sie ruhig Ihr Eis allein weiter«, hatte er als zu anstrengend empfunden. Seitdem übte er mit ihm, an der Leine zu gehen. Wer an wessen Leine ging, darüber herrschte allerdings noch eine gewisse Uneinigkeit.
Pascal fühlte sich fitter, seitdem er den Hund hatte. Noch im Winter und Frühjahr war er mit dem Auto zur Mairie gefahren, um von dort aus die Abendrunde zu gehen, doch seitdem seine Tochter Lillie und ihr Verlobter Claude ihm Bordeaux geschenkt hatten, ging er das Stück zu Fuß.
So auch heute, durch das kleine Wäldchen hinter seinem Haus, ein Stück die Landstraße entlang, die Lucasson und Lourmarin verband, einen Blick auf das Schloss im Nachbarort werfend, dann am Weingut von Michelle und Hector vorbei – und schon war er im Dorf.
Hier begann bereits seine Dienstrunde. Es roch nach Essen, die Restaurants und Bars hatten ihre Tische auf die Kopfsteinpflasterstraße gestellt, die um diese Uhrzeit nicht mehr von Autos befahren werden durfte, und so freuten sich die Gastronomen auf einen lukrativen Abend.
Der Ort Lucasson sowie die umliegenden Dörfer, sogar auf der anderen Seite des Bergmassivs, auf der Nordseite, waren wie die Bilderbuchorte Bonnieux, Lacoste und Ménerbes seit Monaten ausgebucht. Australier, Russen, Amerikaner, Belgier und Deutsche fluteten die Provence.
»Bonsoir, René, alle Tische reserviert?«
»Bonsoir, Pascal, ja, wie jeden Abend.«
»Das ist gut«, sagte Pascal und zog an der Leine, weil Bordeaux bereits so unauffällig wie möglich versucht hatte, den Weg in die Küche einzuschlagen, die Nase senkrecht in die Luft gereckt.
»Wir sind kaputt«, entgegnete René. »Seit Mai haben wir täglich geöffnet, keinen freien Tag, die Touristen sind erbarmungslos.«
»Aber sie bezahlen.« Pascal lächelte und versuchte, Bordeaux zu sich zu ziehen, um weiterzugehen. Es herrschte mal wieder Uneinigkeit zwischen Herrchen und Tier.
»Du musst ihn erziehen«, rief René ihm hinterher, während er die Kerzen auf die Tische stellte und sie anzündete. »Erziehen!«
An der Ecke der Place de la Fontaine, auf der die Dorfältesten schon am Nachmittag den Bouleabend eingeläutet hatten, setzte sich Fabrice gerade auf seinen Klappstuhl. Er hatte bereits seinen Verstärker eingeschaltet, den Koffer mit seinen selbst gebrannten CDs vor sich gestellt, bereit, die nächste Stunde bekannte und weniger bekannte Bluesstücke zu spielen. Er galt als einer der besten Straßenmusiker in der Gegend. Im Grunde spielte er den ganzen Tag. Zwei Schichten an den Vormittagen auf mindestens zwei Märkten in der Nähe, auf der Place de la Fontaine zum Déjeuner und am Abend zum Dîner.
Er strahlte, als er Pascal und Bordeaux auf sich zukommen sah. Als Straßenmusiker brauchte man ein gutes Verhältnis zum Dorfgendarm, doch das fiel ihm nicht schwer. Auch Pascal mochte Fabrice und sein Spiel, den Blues, den Jazz, die Melancholie in seiner Stimme und die Molltöne, die Blue Notes. Oft hörte er selbst zu.
»Gibt es heute etwas von Robert Johnson?«
Fabrice streckte den Daumen in die Höhe und begann mit »When a man loves a woman«, Mainstream gegenüber dem, was später kommen würde. Aber zunächst galt es, ein paar Euros, gern in Scheinform, in seinem Gitarrenkoffer zu sammeln.
Inzwischen war die Dämmerung vorangeschritten, die Straßenlaternen erhellten die engen Gassen des alten Ortskerns. Einheimische und Touristen nahmen an den Tischen Platz, der Geräuschpegel schwoll an wie üblich in den ersten Herbstnächten auf den Straßen des Luberon.
In der Mairie brannte noch Licht. Der Bürgermeister Jean-Paul Betrix, der auch Pascals offizieller Vorgesetzter war, feierte schon seit Tagen seinen Wahlsieg aus der letzten Woche. Pascal hatte ihn nicht gewählt, nur allzu gern hätte er einen Chef gehabt, mit dem normale Gespräche auf Augenhöhe möglich gewesen wären, doch Betrix war ein selbstherrlicher, cholerisch veranlagter Machtmensch, eine Art Donald Trump in Kleinformat, der ihm das Leben immer wieder schwer gemacht hatte. Vielleicht lag es an Pascals Vergangenheit bei der Police nationale in Paris. Sowohl die freundschaftlich verfeindeten Polizeiorganisationen, die Gendarmerie und die Police nationale, als auch die Pariser Hochnäsigkeit waren dem ersten Mann im Rathaus zuwider. Dass Pascal Pariser war, durfte im täglichen Umgang eigentlich nur eine Nebenrolle spielen. Ein Politiker wie Betrix, der vor allem Karriere machen wollte, und das um jeden Preis, hatte jedoch kein Verständnis für einen Polizisten, der freiwillig zu der weniger angesehenen Gendarmerie gewechselt und sich damit selbst zu einem Dorfpolizisten degradiert hatte. »Ein Abstieg par excellence«, hatte er damals zu ihm gesagt.
Doch Pascal war glücklich, zum ersten Mal seit vielen Jahren. Nach der Scheidung von seiner Frau Catherine und dem Auszug seiner Tochter Lillie war er durch die emotionale Hölle gereist. Plötzlich wohnte er allein und hatte außer seinem einzigen Freund von der Police nationale, Alexandre, niemanden mehr, mit dem er sein Leben teilen konnte. Seine Entscheidung, Paris zu verlassen und an seinen persönlichen Sehnsuchtsort zu ziehen, hatte er nie bereut. Wäre Jean-Paul Betrix mit seinen ständigen Sticheleien nicht gewesen, hätte er sich wie im Paradies gefühlt – und tat es auch, solange er nicht das Rathaus betrat. Zu dumm, dass er das täglich musste, denn es war nun mal sein Arbeitsplatz.
Der durchschnittliche Gendarm verbringt achtzig Prozent seiner Dienstzeit im Büro mit dem Ausfüllen von Formularen und dem Erstellen der Berichte. Meist geht es um Diebstahl. Aufgeknackte Autos, Einbrüche in leer stehende Ferienhäuser oder Verkehrsdelikte. Die Überzeugung, dass ein guter Dorfgendarm auf die Straße gehörte und nicht in ein Büro, durfte wohl die einzige Gemeinsamkeit zwischen Pascal und Betrix sein. Betrix war mit dem Vorhaben, aus Lucasson das sicherste Dorf Frankreichs zu machen, sogar in den Wahlkampf gezogen.
Weder wollte sich Pascal dieser Erwartungshaltung ausliefern noch ein ständiger Spielball der Bürgermeisterlaunen sein, und so war er froh, seine Verbindung zur Police nationale in Apt zu haben, die ihn schon zweimal bei einem Mordfall um Hilfe gebeten hatte. Schon ihre erste Zusammenarbeit war einer Sensation gleichgekommen. In ganz Frankreich führte die bloße Nennung des Titels »Gendarmerie« bei der Police nationale zu einem abschätzigen Augenaufschlag. Möglich, dass Pascal der einzige Gendarm Frankreichs war, der bereits Mordfälle gelöst hatte.
»Allez, Bordeaux«, sagte er, als sein Hund sich den Treppenstufen des Rathauses näherte.
Den Weg kannte Bordeaux, doch an diesem Abend gab es keinen Grund, mit seinem Herrchen die Abendstunden im Büro zu verbringen, alles schien friedlich zu sein, und so folgte er Pascal. Gemeinsam setzten sie ihre Runde auf der Rückseite des Rathauses fort, um sie sogar noch zu verlängern. Pascal wusste nicht, dass sie in den nächsten Wochen weniger Zeit füreinander haben würden, niemand ahnte das Unheil, das über die gesamte Gegend bereit war einzubrechen.
2
Pascal fühlte sich frisch und ausgeruht, als er am nächsten Morgen um acht Uhr sein Büro betrat. Er hatte schon, bevor es hell geworden war, einen langen Spaziergang mit Bordeaux gemacht, hatte ein reichhaltiges Frühstück und einen Kaffee an dem kleinen Bistrotisch vor seinem Haus zu sich genommen und dabei die aufsteigende Sonne über den Weinbergen beobachtet. Noch war sie ein Freund, später würde sie jede Bewegung zur Qual machen, wieder waren über dreißig Grad vorausgesagt.
Jean-Paul Betrix saß bereits vor ihm am Schreibtisch und erläuterte die Wahlergebnisse. Wie schön es sei, dass die Grünen regelmäßig weniger Wähler für sich begeistern konnten. Waren sie doch ohnehin die Erzfeinde des konservativen Mannes. Sie stellten alles infrage, was er liebte. Die Jagd, den Trüffelhandel, die überteuerten Bauplätze am Dorfrand, bei deren Ausweisung Betrix jedes Mal mitverdiente. Überhaupt, die überzogene Vorstellung von Demokratie.
»Andere Länder führen es doch gerade vor, wie es ohne das ständige Einmischen der Bevölkerung geht. Ungarn, Polen, Russland, natürlich die Türkei, und auch Amerika war auf einem guten Weg.«
Wie leid Pascal diese Monologe war.
»Sie sind nur ein einfacher Dorfgendarm. Sie sehen aus Ihrer Komfortzone nicht die Realität, oder sind Sie mal morgens inmitten von Migranten in einer Metro zur Arbeit gefahren?«
In diesem Moment wurde Pascal klar, welchen Unsinn der Mann gerade redete. Immerhin war er lange genug bei der Pariser Polizei gewesen und hatte genau das unzählige Male getan. Quer durch Paris war er gefahren, und es waren nie die Migranten gewesen, die ihm Sorge bereitet hatten, sondern die Pariser Jugendlichen aus den Vororten mit ihren Trainingsanzügen und den ausgebeulten Taschen, in denen er nicht selten Messer oder Schlagringe gefunden hatte. Der Bürgermeister war es, der das Vaucluse nie verlassen hatte.
Wie gut Pascal ihn inzwischen kannte, wie er gelernt hatte, mit der Selbstherrlichkeit seines Chefs umzugehen, wie er sich dabei ertappte und abschaltete, wenn er sich seinen Reden hingab, in völliger Gleichgültigkeit, wer ihm gegenübersaß.
Und so kam es einer Erlösung gleich, als sein Telefon klingelte. Ein Klingeln, das Betrix zunächst zu ignorieren versuchte, indem er lauter sprach. Kurz legte Pascal den Finger auf den Mund, dann nahm er ab.
»Pascal.«
Sein Herz setzte für einen Moment aus, um den verloren gegangenen Herzschlag gleich darauf mit erhöhter Geschwindigkeit nachzuholen. Er war machtlos gegen dieses Gefühl, wenn er die Stimme vernahm, die Audrey von der Police nationale aus Apt gehörte.
»Audrey, was ist passiert?« Ihr war anzuhören, dass es ihr um mehr ging als um eine bloße Nachfrage nach seinem Befinden.
»Ich sitze im Auto, zusammen mit Frédéric Dubprée, wir fahren nach Vauvenargues.«
»Zum Picasso-Schloss?«
In den letzten Monaten war es zum Dauerthema in der Zeitung geworden. Die Erben des Künstlers hatten das gigantische Anwesen für einen begrenzten Zeitraum der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Das zweite Mal nach 2012. Bis zu seinem Tod 1973 hatte Picasso dort und in Mougins mit seiner letzten Frau Jacqueline gelebt. Er war sogar vor dem Schloss auf seinem eigenen Grundstück begraben worden.
»Oui, Pascal.« Audrey machte eine Pause. »Ich soll dir von Frédéric Dubprée sagen, dass du bitte kommen möchtest.«
Pascal hörte die Sirene des Polizeiwagens, dann ein Fluchen. Wahrscheinlich waren sie zu dritt im Auto. Frédéric Dubprée, den Chef der Police nationale in Apt, konnte er sich nicht fluchend vorstellen, er wirkte in der Regel ausgeglichen und überlegen.
»Eine junge Kunstführerin ist heute Morgen von einem Wärter tot im Schloss entdeckt worden. Es soll ziemlich blutig sein. Der Aufseher hatte gerade die ersten Gäste hineingeführt, einige von ihnen haben die Leiche gesehen, sie stehen unter Schock. Ärzte und Hilfskräfte sind bereits unterwegs. C’est une catastrophe.«
Als Pascal auflegte, griff er mit der anderen Hand schon zu seiner Uniformjacke. Es war seine Pflicht, den Bürgermeister zu informieren, der inzwischen in sein Büro auf der anderen Seite des Ganges gegangen war. Er fand ihn vertieft in die »La Provence«, eingetaucht in die Fotos von sich in Siegerpose.
»Monsieur Betrix, es gibt einen Mordfall in Vauvenargues. Dort ist die Leiche einer jungen Frau aufgefunden worden. Ich bin unterwegs.«
Im Rausgehen bekam Pascal noch die donnernde Bemerkung des Bürgermeisters mit: »Das ist doch gar nicht unser Bezirk!«
Grundsätzlich hatte er natürlich recht. Vauvenargues lag zwölf Kilometer nördlich von Aix-en-Provence und gehörte somit auch nicht zu den Orten rund um Apt, um die sich die Police nationale kümmerte, doch wenn Dubprée Pascal um Hilfe bat und er zum Tatort gerufen wurde, dann war die Anfrage von höchster Relevanz, wie man es in den Kreisen der Police nationale ausdrückte.
Er würde für die Strecke etwa eine Stunde benötigen. Wenn er seinen Megane allerdings bis zum Äußersten trieb, könnte er zumindest auf dem kurzen Stück der Autobahn ein bisschen Zeit hereinholen, sagte er sich, als er über die Brücke der Durance raste und links Richtung Autoroute steuerte. Die Straße, gesäumt von Platanen, war an dieser Stelle breit genug, die anderen Fahrer bequem zu überholen, wenn sie es denn zuließen. Der Südfranzose mag es rasant, was der Motor eben so hergibt.
Die Fahrt durch Aix dauerte gewohnt lange. Der Ring rund um die malerische Stadt war auch in den frühen Herbstwochen überfüllt, eilig hatte es niemand, die Altstadt lud zum Schlendern ein und lockte mit vielen Sehenswürdigkeiten. Vor allem das Cézanne-Museum stand immer wieder im Mittelpunkt des Interesses. Der Maler Paul Cézanne war der berühmteste Bürger der Stadt und hatte das Schloss Vauvenargues gern gemalt, sodass es unter Kunstkennern gleich eine doppelte Bedeutung erlangt hatte. Picasso hatte es gekauft und einige Jahre dort verbracht, so hatte es vor ein paar Tagen in der Zeitung gestanden. Jetzt war es von den Erben ein zweites Mal für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden. Seit Wochen gab es einen Run, vor allem von Kunsthistorikern und Kuratoren, die aus aller Welt angereist kamen.
Kein Wunder also, dass Pascal schon von Weitem den Menschenauflauf vor dem Schloss sehen konnte. Ein Kamerateam hatte sich so spektakulär wie möglich an der Straße positioniert, dass im Hintergrund das herrschaftliche Anwesen mit seinen roten Fensterrahmen für alle Fernsehzuschauer gut zu erkennen war. Der Ort Vauvenargues, der sich wie viele Dörfer in der Provence in das Bergmassiv gefressen hatte, lag ein Stück erhöht, mit Panoramablick auf das gesamte Geschehen.
Ein Restaurantbesitzer am Ortsrand war so clever gewesen, seine Tische und Stühle auf die gegenüberliegende Seite des Bistros zu stellen, von wo aus seine Gäste das Schloss bewundern konnten. In den Sommermonaten gab es hier in der Regel keine freien Plätze.
So auch an diesem Morgen. Schaulustige hatten sich an der Außenmauer der Terrasse versammelt. Die Meldung des Leichenfundes hatte schnell die Runde gemacht. Radio, Fernsehen und News-Apps überschlugen sich mit Nachrichten und Vermutungen.
Audrey wartete am Eingang des Schlosses. Die Spurensicherung ging bereits mit ihren Koffern und in ihren weißen Anzügen in das Gebäude oder kam wieder heraus. Überall standen Gruppen von Menschen, die wild diskutierten, andere hielten sich in den Armen, psychologische Betreuer saßen auf einer Steinmauer, sprachen ruhig mit den Besuchern und versorgten sie mit Wasser.
Audrey begrüßte Pascal mit drei Küssen. »Du bist geflogen.« Er meinte ein unmerkliches Lächeln zu erkennen, gerade noch dezent genug, um dem Moment gerecht zu werden, dann legte sie für einen Augenblick ihre Hand auf seinen Unterarm, er spürte den Druck ihrer Finger durch seine Jacke. »Frédéric Dubprée ist bereits drin und erwartet dich. Es sieht furchtbar aus.«
Ein kurzes Nicken von Pascal, ein letzter flüchtiger Blick auf das große Eingangsportal und der Versuch, Zuversicht auszustrahlen, dann ging er hinein. Wie sehr er in diesen Momenten litt, wie wenig es ihm in den vielen Jahren, in denen er bereits bei der Polizei gearbeitet hatte, gelungen war, sich an den Anblick von Menschen zu gewöhnen, die nicht mehr wie Menschen aussahen. Der leere Blick, der Mund oft verzerrt, die bleiche Hautfarbe, je nachdem wie lange sie dort schon gelegen hatten. Das Ende eines Lebens sieht in der Regel grausam aus.
Die junge Frau vor ihm lag auf dem Bauch, das Gesicht abgewandt. Ein Arm verdreht, abgespreizt, mit der Handfläche nach oben. Das viele Blut an ihrer Kleidung, neben ihr, unter ihr, um sie herum überzeichnete das Bild der Gewalt auf eine geradezu groteske Art und Weise.
Neben der Leiche ein umgekippter Stuhl. Natürlich war sie gestürzt, aber ein Unfall konnte das nicht gewesen sein. Ein großes Loch klaffte in ihrem Rücken. Eine Wunde, die nur eine große Waffe ausrichten konnte, eine Waffe, die Spuren hinterließ und das vielleicht auch sollte. Der Täter hatte sich nicht die geringste Mühe gegeben, etwas zu vertuschen, das war schon im ersten Moment für Pascal ersichtlich.
Die Spurensicherung machte die letzten Fotos, ihre Reagenzgläser hatten sie bereits wieder in ihre Koffer gepackt. Wie schnell sie waren, wie lautlos und dezent sie ihr Handwerk verrichteten. Wie sehr hatten sie sich an Anblicke wie diese gewöhnt? Wie sehr sahen sie bei einem Mordfall einfach nur einen Arbeitsplatz vor sich? Wie fühlten sie sich, wenn sie abends nach Hause kamen?
»Das Opfer, weiblich, ist mit einer Art Dolch erstochen worden. Es handelt sich um die Kunsthistorikerin Donia Boucanne. Der Wärter, der sie gefunden und bereits identifiziert hat, ist am Boden zerstört. Möglich, dass sie sich nahestanden. Der Tod trat am frühen Morgen ein, vor etwa vier oder sechs Stunden, würde ich sagen. Der Dolch oder die Lanze hat die Frau komplett durchbohrt. Es muss sehr schnell gegangen sein. Offensichtlich hatte sie gerade versucht, den Picasso aufzuhängen.« Der Mann von der Spurensicherung deutete auf den Boden zu einem Kunstwerk. Das Bild einer Frau mit einer Katze war zu sehen, die Proportionen aufgelöst – ein typischer Picasso. Gemälde in dieser Größe wurden im mehrstelligen Millionenwert gehandelt.
»Wir haben keine Mordwaffe gefunden, der Täter muss sie mitgenommen haben. Wie er in das Schloss gekommen ist, wissen wir nicht, alles ist unbeschädigt. Alles Weitere von der Gerichtsmedizin.« Er reichte Pascal ein paar Plastikhandschuhe.
Zu hören war nur das Geräusch von Plastik auf Stein, verursacht durch die Schritte der Kollegen von der Spurensicherung. Pascal war für einen Moment allein im Raum. Allein mit der jungen toten Frau auf dem Boden, der noch immer von Picassos Farbkleksen übersät und jetzt durch das Blut des Opfers nicht mehr überall sichtbar war. Kamen die Touristen doch im Wesentlichen auch, um genau diese Farbe auf dem Boden zu sehen. Oder sein Badezimmer mit der angemalten Wand, das Esszimmer mit der berühmten Mandoline, unzählige Male abgebildet. Doch jetzt hatte der Schrecken den Ort für sich erobert.
Der Salon befand sich im Obergeschoss, dort, wo auch das Atelier des Meisters lag. Die Besucher waren auf ihrem Rundgang direkt hineingeführt worden. Der Anblick war ihnen an diesem Morgen verwehrt geblieben, ihre Tour hatte mit einem Schock geendet.
Schon zum zweiten Mal waren die Tore des Schlosses für eine Picasso-Ausstellung geöffnet worden. Gezeigt wurde eine Sammlung von Bildern aus Picassos Spätphase – der »Vauvenargues-Phase«. Wochenlang waren die Werke aus Museen und Privatsammlungen an diesen Ort gebracht worden. Immer in der Absicht, die gesamte Atmosphäre von damals widerzuspiegeln.
Aufgehängt waren die Gemälde an einfachen Haken. Videokameras gab es in den Innenräumen keine, da das Anwesen ohnehin ausreichend gesichert war. Die Tochter von Picassos letzter Ehefrau Jacqueline lebte bis heute phasenweise hier, und so sollte die Führung in Vauvenargues auch ein Gang durch die letzten Jahre des Lebens von Pablo Picasso sein. Zwischen den Werken waren immer wieder Bilder des Berges von gegenüber zu sehen – des sogenannten Cézanne-Berges, an dem sich der Künstler unendlich viele Male versucht hatte. Einige der Bilder waren im Schloss zurückgeblieben und ein Teil der Ausstellung geworden. Die Besucher wussten das sicher zu schätzen, Cézannes Liebe zu der beeindruckenden Natur rund um Aix-en-Provence war bekannt in der Kunstszene. Auch Picasso hatte sich an dem Berg abgearbeitet.
»Weiblicher Akt unter Pinie« war eines seiner berühmten Werke, und auch das war hier ausgestellt. »Es sollte der Cézanne-Berg bleiben«, hatte Picasso einmal gesagt – es war sein Zeichen des Respekts gewesen, den Berg nie so darzustellen, wie Cézanne es getan hatte.
Pascal entdeckte das Gemälde am Eingang des Salons. Es zeigte eine Frau, wahrscheinlich Picassos Ehefrau Jacqueline, die er in den letzten Lebensjahren immer wieder gemalt hatte. Auf dem Bild stand sie vor der Gebirgslandschaft, mit einer Hand bildete sie die Westflanke des Bergmassivs und verschmolz mit ihm.
Doch warum hatte Donia das andere Bild von der Wand genommen?
Pascal las das handgeschriebene Schild: »›Femme au chat assise dans un fauteuil‹.«
Er ging im Saal auf und ab, konzentrierte sich und hing seinen Gedanken nach. Wie immer, wenn er nachdachte, zog er seine Uhr ein Stück weit nach unten in Richtung Handgelenk, als er das Allerheiligste, das Atelier von Pablo Picasso, durchschritt. Hier standen noch alte Filmscheinwerfer, mehrere Staffeleien, bemalte Polsterstühle, die wahrscheinlich die Öffentlichkeit nie zu Gesicht bekommen hatte. Mittendrin ein großer Landhaustisch, überall Farbtöpfe und Pinsel in einem durchsichtigen Glas, die seit Jahrzehnten auf das Ausspülen warteten.
Auf dem Tisch lag noch die aufgeschlagene Zeitung des Todestages. Berührend und verstörend zugleich. Alles wirkte so, als sei hier nie etwas verändert worden, beinahe wie konserviert, nur von Staub überzogen. Vielleicht war der Raum seit über vierzig Jahren nicht betreten worden. Der Bereich, der die letzten Minuten von Picassos Leben dokumentierte, war durch ein Sicherheitsband abgesperrt. Eine gelbe Linie auf den Fliesen verbot das Übertreten. Möglich, dass Pascal in diesem Moment der erste Mensch außerhalb der Familie war, der allein an diesem Ort stand. Ein kurzer Augenblick des Innehaltens, der Demut, ehe er sich von dem Anblick lösen und zurück in den Raum des Grauens begeben musste.
Pascal kniete sich neben die junge Frau, zog sich die Gummihandschuhe an und drehte ihren Kopf ein Stück zur Seite. An der Stirn klaffte ebenfalls eine Wunde, wahrscheinlich vom Sturz, auch hier hatte sie Blut verloren, viel Blut.
Ihre Augen starrten ins Leere. Sie war schön, selbst jetzt noch im Tod. Ihre Wangen waren mit einem leichten Rouge überzogen, das Kinn dagegen weiß, bleich, farblos.
»Warum ist das Bild nicht mehr an seinem Platz? Hat es einen Streit gegeben? Was hattest du mit dem Bild vor?«, fragte Pascal in die Stille hinein. »Wolltest du es umhängen? Warum? Hatte es eine besondere Bedeutung für dich? Wolltest du es aufhängen oder abnehmen? Warst du eine Diebin? Es verkaufen? An wen? Was ging in dir vor? Einen echten Picasso verkaufen? Wusstest du als eine der ausgewählten Expertinnen für diese Sammlung nicht, dass der Verkauf von Kunstwerken in dieser Preisklasse als geradezu unmöglich gilt? Das musst du doch gewusst haben. Nein, einen Diebstahl hattest du nicht geplant. Es muss einen anderen Grund gegeben haben.«
Er sah an die Wand, dorthin, wo die Lücke zwischen den anderen Gemälden klaffte. Der Nagel nackt und unansehnlich. Der Anblick des Kunstwerkes vor ihm, einfach heruntergerissen, achtlos oder sogar bewusst, musste jedem Kunstliebhaber Schmerzen bereiten. Hatte jemand genau das erreichen wollen?
Noch immer kniete Pascal zwischen der Frau und dem Bild »Femme au chat assise dans un fauteuil«, inspizierte es genau. Er mochte Picassos Bilder. Schon immer erfassten ihn starke Gefühle, eine Hochachtung für das technische Können und die Ausdrucksgewalt des bedeutendsten Malers des 20. Jahrhunderts, des großen Avantgardisten der Moderne. Pascal war ein Bauchmensch, einer, der die Dinge mit dem Herzen und nicht mit dem Kopf entschied. Picasso hatte beides gekonnt, vereinte beide Seiten in sich.
Sorgfältig studierte er das Bild, wollte sich gerade wieder umdrehen und noch einmal Donia Boucanne betrachten, ohne festes Ziel, sich einfach nur jedes Detail einprägen, so wie er es immer tat. Doch sein Blick blieb an der leeren Stelle an der Wand hängen. Wie hoch mochte sie sein? Einen Meter fünfzig sicher, eher zwei Meter. Dann sah er auf das Gemälde auf dem Boden. Vielleicht war es unbedeutend, aber es schien trotz der Höhe unversehrt. Vollkommen unversehrt. Es hatte nicht den geringsten Schaden genommen.
Spielte das jetzt eine Rolle, in einem Moment, in dem es um eine getötete junge Frau ging?
Fragen wie diese verboten sich, aber Pascal musste das Kunstwerk dennoch untersuchen. Behutsam bewegte er es über den Boden und beugte den Kopf ganz nahe über die Steinplatten, als würde er daran riechen, doch es war absolut nichts zu sehen. Schließlich erhob er sich und schaute sich um. Ganz anders als das Atelier nebenan, das in seinem Zustand nach Picassos Tod nie verändert worden war, wirkte dieser Bereich des Schlosses klinisch sauber. Er bestellte per Handy die Spurensicherung ein zweites Mal, um den Raum untersuchen zu lassen.
»Das ergibt alles keinen Sinn.«
Er hatte seine letzten Worte in Donias Richtung geflüstert. Noch standen ihm wertvolle Minuten zur Verfügung. Der einzige Moment der Nähe zum Opfer, den er jedes Mal an einem Tatort herzustellen versuchte und der ihm schon so oft bei seinen Ermittlungen geholfen hatte.
Du standest also auf diesem Stuhl? Es war früher Morgen, was hast du hier getan? Dein Mörder wusste, wo du warst, du aber nicht, wo er war. Warum? Kanntest du ihn? Warum hatte der Mörder es ausgerechnet auf dich abgesehen? Und warum hier an diesem Ort, auf den die Kunstwelt schaut? Und wo ist die Waffe?
Er beugte sich erneut über die junge Frau und betrachtete das Loch in ihrem Rücken. Seine Finger schwebten über der Wunde, als würde er prüfen wollen, ob sie noch Wärme ausstrahlte.
Es musste eine so große Waffe gewesen sein, dass sie nicht unbemerkt hier hatte hereingebracht werden können. Oder war sie schon vor dem Mord hier gewesen und war es jetzt sogar immer noch? Was bedeutete es schon, wenn die Spurensicherung sie noch nicht gefunden hatte?
Pascal trat an das Fenster und ließ seinen Blick über das Tal schweifen, hinüber nach Vauvenargues, dorthin, wo die Touristen standen, sicher auch Einheimische und Reporter. Vom Straßenrand starrten sie auf das Schloss. Von hier aus sah es aus, als würden sie sich nicht bewegen, als würde die Zeit stillstehen in Demut vor dem Tod. Doch die Erregung und das Entsetzen waren bis zu ihm herüber zu spüren.
Er trat zurück in den Raum, näherte sich Donia, als sich die Tür öffnete und Frédéric Dubprée den Salon betrat. Neben ihm ein Kollege der Spurensicherung, der gereizt wirkte. Was bildet der Dorfgendarm sich ein, mich zu überprüfen? Wir übersehen nichts, schien er zu denken.
»Bitte schön.« Frédéric Dubprée forderte den Mann auf, seine Instrumente erneut auszupacken.
»Wo?«, fragte der schroff.
Pascal deutete auf das Bild. »Warum ist es so unversehrt? Es müsste etwas Farbe abgesplittert sein oder Holzsplitter vom Rahmen, zumindest einen Knick in der Leinwand müsste es geben. Doch es ist nichts zu sehen. Es kann nicht aus dieser Höhe heruntergefallen sein. Es muss später hierhergelegt oder ausgetauscht worden sein.«
Der Mann von der Spurensicherung holte ein Vergrößerungsglas aus seiner Tasche und studierte sorgfältig den Fußboden. »Nichts«, sagte er schließlich. »Keine Spuren des Aufpralls, auch auf dem Gemälde nicht.«
»Voilà.« Frédéric Dubprée beobachtete die Szenerie eine Weile, bis der Kollege auch die letzten Stellen auf der Erde und auf der Vorder- und Rückseite der Leinwand kontrolliert, seine Dinge wieder zusammengepackt hatte und Pascal anerkennend zunickte.
»Gut gemacht, Gendarm«, sagte Frédéric Dubprée. »Wir sollten das im Auge behalten.«
Der Mann von der Spurensicherung verschwand.
»Monsieur Chevrier, Sie sind wieder an Bord? Mittendrin?« Frédéric Dubprées Gesichtszüge ließen sich kaum lesen, lediglich im Tonfall lag eine gewisse Bewunderung. Niemand würde jemals erkennen, was der Chef der Police nationale wirklich dachte oder wusste. Wie immer war er akkurat frisiert und gekleidet. Trotz seiner geringen Körpergröße strahlte er Autorität aus. Pascal mochte ihn. »Ich habe mich gerade der Presse gestellt, wie Tiere warten sie auf uns. Ich habe Interviews gegeben, aber nur das Offensichtliche erklärt. Wir sprechen mit den Erben, dem Personal, dem Wärter und den Besuchern, von denen wir uns aber nicht viel erwarten. Kaum denkbar, dass der Täter sich in einer Touristengruppe ein zweites Mal an den Tatort führen lässt, es sei denn, er ist pervers veranlagt.« Er sah den Picasso am Boden an. »›Femme au chat assise dans un fauteuil‹«, murmelte er fast unhörbar. »Ein Meisterwerk.«
»Es ist mir eine Ehre, für die Police nationale zu arbeiten, Monsieur«, sagte Pascal.
Frédéric Dubprée schaute ihn an, er hatte verstanden. »Ermitteln Sie im Umfeld des Opfers, Monsieur Chevrier. Audrey wird Sie unterstützen.«
»Bien sûr.« Pascal hatte zu dem Zeitpunkt noch keine Ahnung, welche Risse sein persönlicher Sehnsuchtsort, seine geliebte Provence, durch diesen Fall bekommen würde.
»Ich informiere Jean-Paul Betrix«, sagte Dubprée noch, dann drehte er sich in der Tür um. »John Updike sagte einst: ›Alle Seelen weinen, wenn sie auf die Erde kommen und realisieren, wie weit sie vom Himmel entfernt sind.‹ Solche Sätze können einem helfen. In Momenten wie diesem.« Dann ging er.
3
Um neunzehn Uhr stand das Dîner im »La Louche à Beurre« in Lourmarin auf dem Plan. Hier gab es das beste Tartare de boeuf in der Gegend.
Pascal hatte bereits in der vergangenen Woche einen Tisch für Audrey und sich bestellt. Beide freuten sich auf ein Abendessen zu zweit ohne einen beruflichen Hintergrund. Doch die Situation hatte sich seit dem Morgen geändert. Es würde um den Fall gehen, nicht um das, was zwischen ihnen war, sein könnte oder auch nicht.
Audrey hatte sich eine Strickjacke mitgenommen, sie war offensichtlich auf ein langes Zusammensein vorbereitet, ein gutes Zeichen. Noch war es warm, für die späteren Stunden war Mistral angesagt, jener Wind, der je nach Laune und Jahreszeit die Temperatur in der Provence empfindlich absenken konnte.
Pascal hatte einen der wenigen Tische vor dem Restaurant reserviert, von denen aus es nichts Schöneres gab, als auf dicken Kissen den Sonnenuntergang hinter den Platanen zu genießen. Der perfekte, romantischste Platz des Lokals.
»Ein Abend wie gemalt«, sagte er, was Audrey schon bei der Begrüßung zum Lachen brachte.
»Ich wusste gar nichts von deinem schwarzen Humor.«
»Und ich habe gar keinen Witz machen wollen, ich hatte für den Moment, in dem ich dich sah, den Morgen vergessen.«
»Mon bien-aimé, du bist in Hochform.« Sie küsste ihn auf die Wange, bevor sie sich auf ihre Plätze fallen ließen.
»Deux coupes de champagne, Juliette, s’il vous plaît«, sagte Pascal zu der Kellnerin, die auch die Besitzerin des Restaurants war. Sie hatte sich mit ihrer korsischen Familie in Lourmarin niedergelassen und betrieb mit Erfolg das »La Louche à Beurre«, das neben dem Tartare de boeuf auch für seine Crêpes in allen Varianten bekannt war. Die Crêpe Suzette würde heute am Abschluss des Abends stehen und ihn zumindest kulinarisch würdevoll beschließen.
Audrey rückte näher an Pascal heran, wie zufällig berührten sie sich mit den Beinen. Den Ordner mit den Unterlagen, den sie wohl für Pascal vorbereitet hatte, legte sie zunächst unbeachtet auf den Tisch vor sich.
Die Gläser klirrten, sie schauten sich in die Augen, dann zum Schloss von Lourmarin, das von hier aus nur teilweise zu sehen war, die dicken Mauern und Türme ins Abendlicht getaucht. Vor ein paar Monaten noch hatte Pascal dort von einem gewissen Monsieur Perieux erfahren, dass dessen Vater, der bedeutendste Trüffelhändler in der Gegend, einen Mord an einem amerikanischen Immobilienhai verübt hatte. Festnehmen hatte er ihn nicht mehr können, denn er war während der Ermittlungen verstorben. Seitdem hatte Pascal das Schloss nie mehr betreten. An diesem Ort hatte sein erster Fall in seiner neuen Wahlheimat sein Ende gefunden.
»Ende des Monats wird im Innenhof das letzte Open-Air-Konzert des Jahres stattfinden. Brahms. Würdest du mich begleiten, chéri?«
»Mit Vergnügen.« Pascal fragte sich, ob die dunkelhaarige Polizistin neben ihm, deren warmes Bein er wahrnahm, so etwas wie eine Gedankenleserin war. Hatte sie gespürt, dass er an das Schloss gedacht hatte?
»Bringen wir es hinter uns, damit wir uns dann ganz dem Essen widmen können«, sagte sie schließlich, stellte das Glas auf den Tisch und nahm den Ordner mit den Unterlagen auf ihren Schoß. Sie blätterte in den Zetteln, dann gab sie Pascal ein Foto. »Das ist Donia. Schön ist sie.«
Pascal kannte die Anziehungskraft, die attraktive Frauen auf Audrey ausübten. Ihre glücklichste Beziehung hatte sie mit einer gewissen Lydia geführt, bis diese am Mont Ventoux verunglückt war. Audrey hatte ihm vor Monaten in einer emotionalen Nacht nach vielen Gläsern Wein die Geschichte erzählt. Zunächst war Pascal am Boden zerstört gewesen, da sie noch so sehr an jemand anderem zu hängen schien, bis er begriffen hatte, dass Audrey eine sehr eigene Definition von Liebe und Zärtlichkeit hatte. Er wusste, würde es jemals zu einer Beziehung zwischen ihnen kommen, müsste er sich in Toleranz und Geduld üben.
Doch Audrey hatte recht, Donia war schön.
Das Foto zeigte eine Frau Anfang dreißig mit einem offenen Lächeln, leicht geröteten Wangen im Abendlicht und einem roten Band im Haar, das ihre Locken bändigte. Ihre dunklen Augen waren auf die Kameralinse gerichtet.
Pascal bemerkte, wie Audrey ihn beobachtete, als er das Foto ansah und sich an die tote Frau erinnerte, wie sie heute Morgen in ihrem Blut und mit der klaffenden Wunde im Rücken dagelegen hatte. Auf dem Foto war sie noch voller Lebensfreude.
»Das Bild ist etwa vier Jahre alt«, sagte Audrey. »Wir waren bei ihren Eltern in Roussillon, es war …«, ihre Stimme kippte, »grausam. Die Welt der Eltern ist jetzt eine düstere, von einer Sekunde auf die andere herrscht Dunkelheit.« Wieder machte Audrey eine kurze Pause. »Hast du jemals ein Herz brechen hören? Es macht ein Geräusch.«
Pascal kannte jene schlimmste aller Aufgaben der Police nationale, die Benachrichtigung der Hinterbliebenen. Er kannte diesen Blick der Menschen, den es nur in der einen Sekunde gab, jene Ungläubigkeit, die tiefste jeder Verzweiflung, und dann der letzte erwartungsvolle Schimmer in den Augen, dass es sich möglicherweise um eine Verwechslung handeln könnte, ja müsste, dann aber das Kopfschütteln des Beamten und der tiefe Fall in das Loch, das sich dort auftat, wo gerade noch die Füße gestanden hatten, und schließlich in das große Nichts.
Beide wussten für einen Moment nicht, was sie sagen sollten. Sie bestellten Tartare de boeuf und zur Sicherheit schon das Dessert, die Crêpe Suzette, dazu eine Flasche Château Constantin von dem Weinberg direkt vor den Toren von Lourmarin. Wenn Pascal von Lucasson nach Lourmarin fuhr, führte ihn der Weg jedes Mal am Château vorbei, oft hatte er schon selbst eine Kiste mitgenommen. Ein nicht allzu teurer Wein, der in der Gegend sehr beliebt war, es aber mit seinem Ruhm nicht weit über die Grenzen der Provence geschafft hatte.
Audrey zog einen Zettel aus der Mappe. »Donia Boucanne stammte aus Roussillon. Ihre Eltern hatten eine Kunstgalerie, sie haben selbst gemalt, und so ist sie zwischen Bildern mit dem Geruch von der Farbe in der Nase aufgewachsen. Ihre Mutter hatte Tränen in den Augen, als sie darüber sprach. Später, nach der Schule, ist Donia nach Aix gegangen, um Kunstgeschichte zu studieren, auch sie hat immer wieder gemalt. Nach und während ihres Studiums hat sie viele Jahre im Musée du Sud gearbeitet. Weil dort die einzigen Cézanne-Bilder ausgestellt werden, die es in Aix gibt. Acht Ölgemälde. Stell dir vor, von dem bedeutendsten Künstler der Stadt gab es bis 1984 kein einziges Bild in seiner Heimatstadt.« Audrey trank den letzten Schluck ihres Champagners.
Ein Korb mit Worcestershiresoße, Ketchup und Tabasco wurde auf den Tisch gestellt. Das Tartare de boeuf würzte jeder nach seinem Geschmack.
»Doch dann kündigte sie, um für kleinere Galerien zu arbeiten«, fuhr Audrey fort. »Zuletzt war sie wohl für Henry Pegod tätig, der eine Galerie in Roussillon betreibt. In ihrer Freizeit ist sie in alle Museen der Welt gereist, immer auf der Suche nach irgendwelchen Picassos. Sie musste ein enormes Wissen über ihn haben. Dann erfuhr sie von der Ausstellung in Vauvenargues. 2012 ist sie noch zu jung gewesen, jetzt hat sie ihre Chance genutzt und sich erneut beworben. Das war ihre Traumanstellung, wenn auch eine zeitlich stark begrenzte. Nur drei Monate lang, dann sollten sich die Tore für die Öffentlichkeit wieder schließen. Die Sammlung muss zurück nach Paris und in das Musée du Sud. Für Donia war die Anstellung im Schloss ihr Todesurteil. Sie wurde nur zweiunddreißig Jahre alt.«
Pascal sah auf das Foto, dann zu Audrey. Ihr Gesichtsausdruck zeigte, wie sehr sie Geschichten wie diese berührten, auch sie wollte sich nicht an das Unmenschliche gewöhnen.