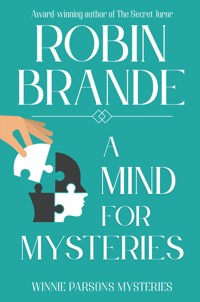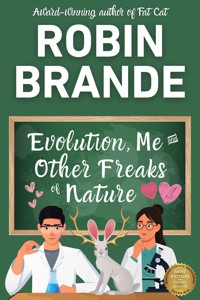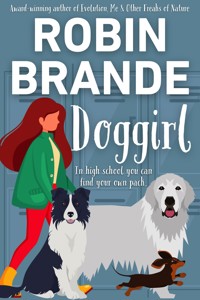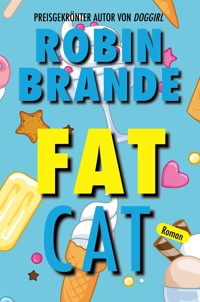
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ryer Publishing
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Ein Experiment, so kühn, dass man es auch für ziemlich verrückt halten könnte …
Catherine Locke ist klug, ehrgeizig und … okay, sie ist nicht gerade schlank. Aber ihr waren immer andere Dinge wichtiger als ihr Aussehen. Und das hat sie an ihr großes Ziel gebracht: Sie hat einen Platz im begehrten Forscherkurs an ihrer Schule ergattert, wo sie wieder einmal ihrem Erzrivalen Matt McKinney gegenübersteht.
Dem Typen, der ihr das Herz gebrochen hat.
Wenn Cat's Plan aufgeht, dann wird sie alles erreichen: eine enorme Veränderung ihres Körpers und ihres Lebensstils, den Sieg im Forscherwettbewerb, eine Zulassung am College ihrer Wahl und, am allerbesten, Rache zu nehmen an Matt McKinney.
Aber wie jeder Forscher weiß, selbst die besten Experimente können ziemlich aus dem Ruder laufen …
»›Fat Cat‹ ist der Wahnsinn! Ich konnte nicht mehr aufhören zu lesen!«
Meg Cabot
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
FAT CAT
ROBIN BRANDE
Übersetzt vonFRIEDERIKE ZEININGER
RYER PUBLISHING
FAT CAT
By Robin Brande
English Copyright © 2009 by Robin Brande
German Translation Copyright © 2011 by Robin Brande
International German Language Edition published by Ryer Publishing, 2018
www.ryerpublishing.com
Cover art by rea_molko/Deposit Photos
Cover design Ryer Publishing
ISBN:
All rights reserved.
No part of this book may be reproduced in any form or by any electronic or mechanical means, including information storage and retrieval systems, without written permission from the author, except for the use of brief quotations in a book review.
Erstellt mit Vellum
INHALT
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65
Kapitel 66
Kapitel 67
Kapitel 68
Kapitel 69
Kapitel 70
Kapitel 71
Kapitel 72
Kapitel 73
Kapitel 74
Kapitel 75
Kapitel 76
Kapitel 77
Kapitel 78
Kapitel 79
Kapitel 80
Kapitel 81
Kapitel 82
Kapitel 83
Kapitel 84
Kapitel 85
Kapitel 86
Kapitel 87
Über den Autor
Bücher von Robin Brande
1
»Sie sind alle gut funktionierende kleine Maschinen«, erklärte Mr Fizer eines Nachmittags. Er saß in seinem Tweedjackett, seinem weißen Hemd und der karierten Fliege vor uns und starrte uns über den Rand seiner Lesebrille hinweg an. Ein echt furchterregender Anblick.
»Sie wissen, wie man Klausuren schreibt«, sagte er. »Sie wissen, wie man Stoff auswendig lernt, und Sie machen alles so, wie wir Lehrer es Ihnen beigebracht haben – aber hat irgendjemand von Ihnen eine Ahnung, wie man wirklich denkt? Genau das wollen wir herausfinden.«
Ich weiß, dass ich mich hätte konzentrieren sollen. Ich hätte meinen Blick fest auf Mr Fizer richten sollen, damit mir auch ja kein Wort entging. Sein Unterricht würde eine der größten Herausforderungen werden, denen ich mich in meinem Leben je gestellt hatte.
Aber manchmal gehorchte mein Körper einfach nicht. Und dann wanderten meine Augen nach rechts und suchten nach dem einen Gesicht in der Menge – auch wenn ich ihnen schon ein paarmal gesagt hatte, das gefälligst bleiben zu lassen. Und weil die fragliche Menge aus nur neun Schülern bestand, war dieses Gesicht dummerweise leicht aufzuspüren.
Leider sah Matt McKinney genau in dem Moment zu mir herüber und unsere Blicke trafen sich für den Bruchteil einer Sekunde. Und obwohl ich sofort wieder wegsah, war es schon zu spät. Aus den Augenwinkeln bemerkte ich noch sein blödes Grinsen, und am liebsten hätte ich ihm etwas Spitzes, Schweres an den Kopf geworfen.
»Kommen wir nun zu den Regeln«, sagte Mr Fizer.
Als ob er uns die Regeln noch hätte erklären müssen. Jeder von uns kannte sie längst – Fizers Projektaufgaben im Fach Wissenschaft und Forschung waren legendär, nicht zuletzt deshalb, weil alle paar Jahre mal jemand gleich am ersten Tag aus dem Klassenzimmer rannte und sich wegen dem ganzen Stress übergab.
In weiser Voraussicht hatte ich also kaum etwas zu Mittag gegessen.
»Wenn ich Sie gleich aufrufe«, erklärte Mr Fizer, »kommen Sie nach vorne und ziehen mit geschlossenen Augen ein Bild. Dann gebe ich Ihnen eine Stunde Zeit, um eine Fragestellung zu formulieren. Internet oder andere Quellen sind verboten. Sie dürfen sich auch nicht mit Ihren Klassenkameraden besprechen. Einzig Ihre Fantasie steht Ihnen zur Verfügung.« Er machte eine Pause. »Echte wissenschaftliche Ergebnisse«, fuhr er dann fort, »erzielt man nämlich durch intensives Nachdenken, nicht durch bloßes Wiederkäuen dessen, was andere Wissenschaftler vor uns herausgefunden haben. Oder, wie Albert Einstein einmal ganz richtig gesagt hat: Die Fantasie ist wichtiger als Wissen. Unser ganzes Streben sollte darauf ausgerichtet sein, die ausgetretenen Pfade zu verlassen, um zu wirklich neuen Erkenntnissen zu gelangen. Verstanden?«
Wir blieben ihm die Antwort schuldig, denn wir waren alle viel zu sehr damit beschäftigt, auf die Mappe zu starren, die er in diesem Moment aufschlug und die die Karten für dieses Schuljahr preisgab.
Die Karten. Unsere ganze Zukunft lag in der richtigen Wahl. Nur dass in Mr Fizers Fall die Karten kein Satz Spielkarten waren, sondern ein Stapel mit Abbildungen und Fotos, die er im Lauf des Jahres gesammelt hatte – herausgerissene Seiten aus Fachzeitschriften wie ›National Geographic‹, ›Nature‹ oder ›Science‹.
Wer Glück hatte, der zog ein Thema, das ihn ohnehin schon interessierte – in meinem Fall, Insekten und Pflanzen und ihre wechselseitige Anpassung im Lauf der Evolution. Ich hatte in den Sommerferien ein Praktikum in einem College-Labor gemacht, und wenn ich ein Foto ziehen würde, auf dem irgendwelche Pflanzen oder Käfer zu sehen waren, würde ich alles verwenden können, was ich dort über Feigenwespen gelernt hatte.
Aber man konnte natürlich auch mit irgendetwas zu tun kriegen, was vollkommen jenseits von dem lag, was einen interessierte. Und das war der Grund dafür, dass Leute wie George Garmine im vergangenen Jahr aus dem Klassenzimmer rannten, um erst einmal zu kotzen.
Wer das Projekt nämlich vermasselte, der konnte sich gleich auf eine Karriere als kleiner Angestellter an einem unbedeutenden Labor irgendwo in der Provinz einstellen. Einen Spitzenposten würde er garantiert nie ergattern. Wer seine Sache aber gut machte – ich meine, richtig gut –, der bekam nicht nur eine Empfehlung von Mr Fizer für die renommierten Colleges, sondern er gewann möglicherweise sogar den Schulwettbewerb und konnte danach auf nationaler Ebene antreten. Damit hatte man gute Chancen, ein Stipendium zu bekommen und die Professoren zu beeindrucken, die für die Studienplatzvergabe an den richtig guten Colleges verantwortlich waren. Und so konnten sogar Schülerinnen wie ich an der Duke oder Harvard University landen. Einige von Mr Fizers Schülern hatten das jedenfalls geschafft. Das Projekt war also echt wichtig.
Wir wollten, dass es endlich losging, aber Mr Fizer hatte noch eine letzte Regel zu verkünden.
»Hier ist keine Teamarbeit gefragt«, sagte er. »Sie treten gegeneinander an. Das ist Ihre Chance zu zeigen, dass Sie klar denken und wirklich an Ihrem Thema arbeiten können. In den nächsten sieben Monaten werden Sie also für sich allein arbeiten und ohne darüber zu sprechen. Ich bin der Einzige, mit dem Sie sich über irgendwelche Einzelheiten austauschen können, bis Sie Ihr Projekt beim Wettbewerb im März vorstellen. Alles klar?« Mr Fizer blickte in die Runde. »Gut. Lindsay, wir fangen bei Ihnen an.«
Lindsay wischte sich ihre feuchten Hände an der Hose ab und ging langsam nach vorne, gerade so als hätte man ihr gerade gesagt, sie müsse dort einen Giftbecher leeren. Vor Mr Fizers Pult wischte sie sich die Hände noch einmal ab und griff dann in die Karten.
Mr Fizer beobachtete sie genau, damit sie auch ja die Augen geschlossen hielt. Nachdem Lindsay ein Bild gezogen hatte, drückte sie es unbesehen gegen ihre Brust und ging zu ihrem Platz zurück. Das schien eine gute Strategie zu sein – man musste ja nicht gerade vor allen ausflippen, wenn man ein schlechtes Los gezogen hatte.
Als Nächstes rief Mr Fizer Farah, Alexandra, Margo und Nick auf.
Und dann mich.
So cool wie möglich ging ich zwischen den Tischen hindurch nach vorne. Und genau in diesem Moment fing ich an über meinen Hintern nachzudenken. Ganz bestimmt starrt Matt McKinney genau jetzt darauf und stellt fest, dass mein Allerwertester um einiges fetter geworden war, seit er ihn sich das letzte Mal angeschaut hatte. Drei Kilo mehr über den Sommer, wirklich Klasse, Cat. Wer hart in einem Labor arbeitete, wie ich das in den Ferien getan hatte, dem blieb am Abend nur noch Zeit für irgendwelches Junkfood. Alle dort waren ganz schön gepolstert.
Ich stand also vor Mr Fizers Pult. Meine Hände zitterten. Ich dachte an meine Zukunft, die sich jetzt gleich entscheiden würde. Aber dann dachte ich wieder an meine Schenkel und an meinen Riesenhintern und versuchte, meine Bluse ein bisschen runterzuziehen, um ihn zu kaschieren. Und schließlich schloss ich die Augen und griff nach dem Stapel mit Karten. In diesem Moment hörte ich, wie Matt sich räusperte, so als würde er ein Lachen unterdrücken, und meine Hand zuckte zurück. Und mit dem Bild, das ich dann zog, war mein Schicksal besiegelt.
Ich konnte nicht hinsehen. Ich drückte die Karte fest gegen meine Brust und ging zu meinem Platz zurück, während ich versuchte, gleichmäßig zu atmen.
Matt war als Nächster an der Reihe. Mr Großmaul, Mr Lässig, Mr Ich-hab-schon-viel-mehr-Forschungswettbewerbe-gewonnen-als-jeder-von-euch. Er zog ein Bild, sah es sich an und grinste. Er grinste tatsächlich. Kein gutes Zeichen.
Schnell linste ich nach meinem eigenen Bild. Ach du heilige Scheiße. Das ging ja gar nicht. Ich klatschte das Bild verdeckt auf den Tisch. Das Blut sauste mir in den Ohren.
Matt McKinney durfte in diesem Jahr einfach nicht besser sein als ich. Bitte! Es musste doch so etwas wie ausgleichende Gerechtigkeit geben, schließlich hatte ich ihn bislang nur einmal geschlagen, und zudem war das der schrecklichste Tag meines ganzen Lebens gewesen. Es wäre wirklich nur fair, noch einmal zu gewinnen und den Sieg dieses Mal länger als fünf Minuten zu genießen.
Kiona und Alyssa mussten als Letzte nach vorne. Sie sahen genauso miserabel aus, wie ich mich fühlte. Und dann ging es los.
»Jeder sucht sich ein Plätzchen«, wies Mr Fizer uns an und sah auf die Uhr. »Die Zeit läuft.«
Alle stieben auseinander, um einen Platz zu finden, an dem sie ungestört nachdenken konnten. Ich entschied mich für eine kleine Nische zwischen der Wand und einem Aktenschrank und ließ mich die Wand hinunter zu Boden gleiten. Dann drehte ich die Karte um und stellte mich der Realität.
Das Bild war schrecklicher, als ich befürchtet hatte.
Nackte Neandertaler.
Nein, stopp. Keine Neandertaler, sondern etwas noch Älteres – Homo erectus, um genau zu sein. »Hominini vor 1,8 Millionen Jahren« lautete die Bildunterschrift. Na super. Extrem wichtig für mein Leben und ganz nah dran an den Feigenwespen.
Ich blickte verstohlen zu Matt hinüber. Seinem selbstgefälligen Grinsen nach zu schließen, hatte er wohl etwas gezogen, was genau zu seinem Hobby passte – Astronomie. Wahrscheinlich ein Foto vom Hubble-Teleskop oder eines von der Marsexpedition oder vielleicht der Computersimulation eines schwarzen Lochs. Eine einfache, passende Aufgabe, für die er sich nicht besonders anstrengen musste. So war das immer bei Matt.
Aber ich durfte jetzt keine Zeit an Matt verschwenden, sondern musste an mich denken. Ich starrte wieder auf mein Bild.
Irgendein Künstler hatte dargestellt, wie diese Frühmenschen wohl gelebt haben. Auf dem Gemälde waren drei Männer und eine Frau auf einer Art Wiese. Sie waren alle hager und muskulös und von der Sonne gegerbt – sagte ich schon, dass sie nackt waren? - und standen um einen toten Hirsch herum, den sie vor ein paar Hyänen bewachten, die danach schnappen wollten. Einer der Männer schrie und die Frau hatte als Einzige eine Waffe – einen Stein – , den sie gleich auf die Hyänen werfen wollte. Eine super Action-Szene, wenn man sich für die Entwicklungsgeschichte des Menschen interessierte, bei der es mehr um die Toten als um die Lebenden ging. Mein Thema war es allerdings nicht und würde es auch nicht werden.
Nackte Frühmenschen und Hyänen. Wirklich super. Darum würde sich also mein Leben in den nächsten sieben Monaten drehen, dachte ich. Matt würde einen weiteren Erfolg für sich verbuchen und ich die nächste Niederlage.
Zu dem Zeitpunkt konnte ich noch nicht wissen, wie genial sich die Sache tatsächlich entwickeln würde.
2
»Wie war’s?« Amanda hatte nach der Stunde auf mich gewartet.
»Super. Ich brauche jetzt auf der Stelle ein Snickers.«
»Ach, echt?«, fragte sie erstaunt. »Heißt das, du bist nicht mehr auf Diät?«
»Ja, so ungefähr.« Ich wusste, dass ich sie mit der Wahrheit schockieren würde.
»Gott sei Dank«, erwiderte Amanda. »Ich will dir ja nicht zu nahe treten, Kit Cat, aber du warst die letzten Tage echt schlecht gelaunt. Weißt du, manche Leute brauchen einfach Zucker und Kohlenhydrate.«
In dem Moment kam Matt aus dem Klassenzimmer und nickte uns zu. »Hallo, Amanda. Bis dann, Cat.«
Natürlich reagierte keine von uns. Normalerweise war Matt nur dann nett zu uns, wenn Amandas Freund Jordan in der Nähe war. Die beiden waren in derselben Schwimmmannschaft, und Jordan erzählte uns andauernd, wie zuverlässig und »klasse« Matt war, was auch immer das heißen sollte. Was es auf jeden Fall hieß, war, dass Matt nach wie vor den meisten Leuten weismachen konnte, ein süßer, charmanter Typ zu sein, der zufälligerweise auch gleich noch ein brillanter Wissenschaftler war.
Aber Amanda und ich kannten die Wahrheit. Nur konnten wir die leider nicht mit Jordan oder sonst irgendjemandem teilen. Sollten die anderen doch von Matt halten, was sie wollten.
»Ich finde, dass er sich ein kleines bisschen gemacht hat«, meinte Amanda und sah Matt nach, wie er den Korridor hinunterschlenderte. »Vielleicht hat er entdeckt, dass es Kämme gibt.«
»Können wir bitte das Thema wechseln?«
»Na klar«, erwiderte sie. »Ich habe in der letzten Stunde ein Gedicht geschrieben. Willst du’s hören?«
Sie trug es vor, während wir zum Süßigkeitenautomaten gingen. Es gehörte zu einer Serie von Gedichten, in denen sie die geheimen Gedanken von Gegenständen beschrieb. Dieses Mal ging es um einen Saftmixer.
Nicht lachen. Oder vielleicht doch. Ihre Gedichte waren witzig gemeint, aber sie waren auch liebenswert und manchmal auf eine gewisse Weise ein bisschen traurig. So wie das vom Mixer. In dem Gedicht hieß es, dass er die Lebensmittel zwar berühren, sie aber nie probieren konnte. Wenn er alles soweit zerkleinert hatte, dass es flüssig war, goss jemand den Inhalt einfach aus.
»Immer am Kauen«, schloss Amanda ihren Vortrag, »und wird trotzdem nie satt.«
Wir nickten beide in stiller Zustimmung.
»Ich find’s super«, sagte ich schließlich. »Fast so gut wie das über den Fernsehsessel.«
»Ja«, stimmte Amanda zu, »das war ziemlich gut.«
Wir waren am Automaten angekommen, und ich ließ mir nicht nur ein Snickers heraus, sondern auch noch einen Butterfinger und M&Ms.
»Wow!«, meinte Amanda. »Das war also kein Scherz.«
Ich biss ungefähr die Hälfte von meinem Snickers ab. »Du wirst mich gleich verstehen«, sagte ich mit vollem Mund
Ich wartete, bis wir in ihrem Auto saßen, mit dem sie mich zu meinem Nachmittagsjob im Krankenhaus bringen wollte. Ich durfte auf keinen Fall riskieren, dass Mr Fizer oder sonst irgendjemand sah, wie ich ihr das Bild zeigte. Seine Geheimhaltungsregel war ja schön und gut, ich war sogar ziemlich froh darüber, denn das hieß auch, dass niemand mitkriegen würde, was ich machte, bis ich das Ganze im März vorstellte. Doch Amanda musste ich auf jeden Fall in meine Pläne einweihen.
»Oh«, sagte Amanda, kaum hatte ich das Bild aus meinem Rucksack gezogen.
»Genau«, erwiderte ich.
Amanda zeigte auf den Typen gleich neben dem toten Hirsch. »Der da sieht echt geil aus.«
»Spinnst du?«
»Wieso?«, meinte sie. »Knackiger Hintern, muskulöse Beine – auf so was steh ich.«
»Gut zu wissen.«
»Wehe, du sagst es Jordan.«
Die zweite Hälfte des Snickers hatte ich noch auf dem Parkplatz aufgegessen. Jetzt wickelte ich den Butterfinger aus dem Papier, während ich Amanda alles haarklein erzählte – auch dass ich erst kurz vor Ende der Stunde die rettende Idee gehabt hatte, was ich tun konnte.
Die Leute wollen immer gerne wissen, wie wissenschaftliche Entdeckungen gemacht werden. Alle lieben die Geschichte vom Apfel, der auf Newtons Kopf fiel (ein Mythos), oder die von Archimedes, der aus der Badewanne sprang und nackt auf die Straße lief, um »Heureka! Ich hab’s!« zu schreien. (Stimmt.) (Die armen Nachbarn.)
Bei mir war der Auslöser der tolle Hintern eines Frühmenschen gewesen.
Nicht der des Mannes, der Amanda so entzückt hatte, sondern der der Frau.
Als Mr Fizer »Noch zehn Minuten« gerufen hatte, war ich von extremer Panik ergriffen worden. Ich hatte bis dahin nicht einen einzigen guten Gedanken gehabt.
Alle anderen dagegen kritzelten hektisch Notizen in ihre Hefte. Alle außer Matt natürlich, der schon fertig war und in aller Ruhe durchlas, was er geschrieben hatte.
Es war schrecklich. Ich kniff die Augen zusammen und flehte lautlos meine neuen nackten Freunde an, mir eine Idee zu liefern – irgendeine, was auch immer.
Als ich meine Augen wieder aufmachte, fiel mein Blick auf den Frauenhintern. Und dann auf die ganze Frau. Und aus irgendeinem Grund ging mir in diesem Moment durch den Sinn, dass sie eigentlich ganz cool war – sie wirkte stark und entschlossen, den Stein zu schleudern, während die Männer nur herumbrüllten und eine besorgte Miene machten.
Und sie war schlank. Nicht mager. Und auch nicht so dürr wie ein Model. Nein, sie war sportlich schlank, wie man es von Athletinnen kannte, und sah so aus, als könnte sie mindestens genau so gut laufen und jagen und kämpfen wie ihre männlichen Gefährten – wenn nicht sogar noch besser.
Und in diesem Moment kam mir die zündende Idee: Ich wollte so sein wie sie!
Nicht dass ich mir wünschte, mich mit geifernden Hyänen um eine anständige Mahlzeit balgen zu müssen. Nein, ich wollte so aussehen wie sie. Ich wollte – ich weiß, dass das jetzt unglaublich platt klingt, aber die Wissenschaft verlangt nun mal nach der Wahrheit – ich wollte nur einmal in meinem Leben erfahren, wie es sich anfühlte, wenn man wirklich … gut aussah. Oder zumindest besser als jetzt. Vielleicht ja sogar hübsch, falls das möglich war.
Es war ja nicht so, dass ich hässlich war, aber ich war auch nicht dumm. Ich wusste, was die Leute dachten, wenn sie mich sahen. Ich konnte jeden Tag eine Stunde damit zubringen, meine Haare zu glätten, mich zu schminken und Klamotten auszuwählen, die zumindest einige meiner Speckrollen überdeckten, doch änderte das alles nichts an der Tatsache, dass ich dick war und dass alle das wussten. Wenn ich morgens aufwachte, dann kam es mir manchmal so vor, als würde ich in einem riesigen Pyjama aus Fett stecken. Wenn ich nur den Reißverschluss finden würde, dann könnte ich herausschlüpfen und endlich zu leben beginnen.
Das war mein »Heureka!«.
Als ich diese prähistorische Frau in ihrer ganzen Schönheit ansah, mit den nackten Brüsten und dem Hintern und dem Bauch und allem, und feststellte, wie schlank und fit und stark sie war, hatte ich den genialen Geistesblitz.
Wenn Paläoanthropologen ein Skelett finden, dann können sie damit im Labor einen prähistorischen Menschen aus Lehm rekonstruieren. Sie überlegen sich, wie viel Muskelmasse und Fleisch sie draufpacken müssen, damit er echt wirkt, aber eins ist klar: Ein dicker Mensch kommt nie dabei heraus.
Aus einem einfachen Grund: Das Skelett eines jeden Menschen ist nämlich für ein ganz bestimmtes Körpergewicht gemacht. Ein schmaler Knochenbau ist für wenige Kilos geschaffen, ein kräftiger hingegen für viel mehr.
Und das brachte mich auf den Gedanken, was eine Wissenschaftlerin wohl mit meinem Skelett anfangen würde, wenn sie es in tausend Jahren fände. Sie würde natürlich einen Körper formen, der zu meinen Knochen passte, und glauben, dass ich so ausgesehen hätte. Was nicht stimmte. Denn sie hätte all die Pizzen und die Eiscreme und Schokolade vergessen und was ich sonst all die Jahre noch als Material verwendet hatte, um diese spezielle Version von mir zu modellieren.
Da wusste ich, was ich tun konnte. Wenn ich das Thema allerdings zu meiner Forschungsarbeit machen wollte, dann musste ich das Ganze wirklich ernst nehmen. Dann durfte es keinen Rückzieher und kein Mogeln geben. Sobald ich meine Idee an diesem Nachmittag auf einen Zettel geschrieben und diesen zu den Themen der anderen gelegt hatte, hatte ich keine Wahl mehr: Ich musste durchhalten. Schließlich wollte ich eine gute Note bekommen und den Schulwettbewerb gewinnen.
Mr Fizer hatte erklärt, er wolle großartige Ideen sehen. Wir sollten kreativ sein, uns wirklich anstrengen und uns mit Leib und Seele unserem Projekt verschreiben.
Nun, mit mehr Leib und Seele konnte sich keiner der Forschung widmen.
»Ich tu’s«, sagte ich entschlossen zu Amanda. »Ich werde mich in eine Hominini-Frau verwandeln.«
3
»Und … was heißt das genau?«, fragte Amanda.
»Keine Süßigkeiten mehr, zum einen«, antwortete ich und verdrückte den letzten Rest meines Butterfingers. Die M&Ms stopfte ich mir für später in meinen Rucksack. »Und kein Essen, wie wir es heutzutage gewohnt sind – nur Lebensmittel, die sie damals in der Natur gefunden haben, so wie Nüsse oder Beeren -«
»Du willst dich sieben Monate lang nur von Nüssen und Beeren ernähren?«, fragte Amanda. »Bist du wahnsinnig?«
»Ich bin mir sicher, dass sie auch noch was anderes gegessen haben«, sagte ich. »Auf dem Bild war doch noch der tote Hirsch.«
Amanda verzog das Gesicht. »Na toll.«
»Und wahrscheinlich Gemüse und anderes gesundes Zeug.«
»Dann machst du also wieder eine Diät«, folgerte Amanda.
»Nein, überhaupt nicht! Ich meine … nicht direkt. Es handelt sich um ein wissenschaftliches Experiment. An mir selbst. Es geht nicht nur ums Essen – ich werde auch auf alles verzichten, was unser modernes Leben prägt. Computer, Telefon, Auto, Fernse…«
»Und was soll das beweisen?«, unterbrach Amanda mich. »Außer, dass du verrückt geworden bist?«
»Dass wir Mist gebaut haben«, erklärte ich. »Dass wir an irgendeinem Punkt der Evolution den Bogen überspannt haben und deshalb viel zu faul und behäbig geworden sind.«
»Entschuldige mal«, protestierte Amanda, »aber ich finde, mein iPod ist durchaus ein toller Fortschritt.«
»Ja, schon, aber sieh dir nur unsere Körper an«, sagte ich und meinte damit natürlich vor allem meinen. »Und dann all die Zivilisationskrankheiten wie Übergewicht und Diabetes und Krebs und Herz-Kreislauf-Erkrankungen …«
»Früher haben die Leute einfach nicht lange genug gelebt, um solche Krankheiten zu bekommen«, argumentierte Amanda. »Sie sind vorher von den wilden Tieren gefressen worden.«
»Stimmt, aber ich glaube, wenn wir wieder ein einfacheres Leben führen würden, könnte es uns um einiges besser gehen.«
»Tut mir leid, dir das sagen zu müssen«, sagte Amanda aufgebracht, »aber ich als deine Freundin sehe es als meine Pflicht an. Ich finde, du gehst da wirklich zu weit!«
Ich lächelte nur. Je länger wir darüber sprachen, umso imponierender hörte sich mein Vorhaben an, und genau so was brauchte ich. Ein gewöhnliches Projekt würde Mr Fizer oder die Jury des Wettbewerbs nicht beeindrucken – erst recht nicht, wenn Matt dabei war. Alles sprach dafür: Ich sollte es wirklich angehen.
»Außerdem«, fuhr Amanda fort, während sie den Motor ihres alten gelben Mazda startete, »kannst du nicht auf alles verzichten. Ein paar Neuerungen sind ziemlich wichtig.«
»Zum Beispiel?«, fragte ich.
»Hallo? Fließendes Wasser? Strom? Seife? Willst du nachts im Dunkeln sitzen und dich wie die Schweine im Dreck suhlen? Und schläfst du in einem Bett oder auf dem Boden? Ist ein Teppich erlaubt?«
»Super«, sagte ich und kramte nach meinem Notizblock, während Amanda vom Schulparkplatz fuhr. »Ich muss eine Liste machen. Red weiter.« Mir blieben noch ungefähr siebenundvierzig Stunden bis zur nächsten Unterrichtsstunde bei Mr Fizer und ich musste die Zeit bis dahin nutzen, so viele Dinge wie möglich zu bedenken, bevor ich mein Forschungsvorhaben einreichte.
»Nun denn«, sagte Amanda resigniert. »Du hast also gesagt, kein Auto – aber vielleicht kannst du ja mit dem Fahrrad zur Schule fahren. Das Rad gab’s doch damals schon, oder? Und selbst wenn, so eng brauchst du’s ja nicht sehen.«
»Und mich von Mr Fizer erwischen lassen? Ich hör ihn schon: ‚Mir war nicht bewusst, Catherine, dass der Homo erectus bereits ein Fahrrad hatte.’ Vergiss es – ich muss überallhin zu Fuß gehen.«
»Überallhin?«, fragte Amanda. »Und wenn es draußen Nacht ist? Oder dein Date dreißig Kilometer entfernt ist und es schüttet und blitzt und donnert? Das ist gefährlich!«
»Okay, da hast du recht. Vielleicht muss ich ein paar Ausnahmen machen.«
»Ja, zum Beispiel bei deinem Handy«, sagte sie. »Ich sehe ein, dass du es nicht benutzen willst, aber für den Notfall solltest du es immer dabeihaben, finde ich.«
»In Ordnung.« Ich nickte zustimmend und machte mir schnell eine Notiz. Handy. »Warte kurz …« Mir kamen nun immer mehr Ideen. Die Sache war komplizierter, als ich gedacht hatte. Ich durfte mich nicht in Gefahr bringen, musste aber auch praktische Dinge erwägen, solche Annehmlichkeiten wie zum Beispiel duschen …
»Und wann willst du mit dem Wahnsinn anfangen?«, wollte Amanda nun wissen. »Ich meine, Blätter und Beeren essen und dem ganzen Kram?«
»Ich weiß noch nicht genau. Vielleicht am Mittwochabend. Vielleicht auch erst Donnerstag.« Seife, Shampoo, Zahnpasta. »Mr Fizer muss mein Projekt ja erst mal absegnen.«
»Das ist gut«, meinte Amanda. »Jordan und ich haben nämlich in der letzten Stunde noch über dich gesprochen.«
Ihre Stimme klang dabei so fröhlich und unschuldig, dass ich normalerweise stutzig geworden wäre, aber ich war ja durch mein Projekt abgelenkt. Ich wusste, dass sie und Jordan zusammen »Kreatives Schreiben« hatten, während ich bei Mr Fizer war, und dachte mir deshalb nichts dabei.
»Hast du morgen Abend schon was vor?«, fragte Amanda nun geradeheraus.
Dunkelheit, Wetter – »Ich werde bestimmt über meinem Projekt brüten. Warum?« Kühlschrank, ein weiches Bett, Kleidung, Schuhe –
»Na ja … ich dachte, du könntest ja vielleicht auch mal eine Pause brauchen«, meinte sie. »Bloß für ’ne Stunde oder so. Um was zu essen.«
Da endlich machte sich mein angeborener Selbsterhaltungstrieb bemerkbar und ich horchte auf. Amandas Stimme war etwa eine halbe Oktave höher als sonst – ein untrügliches Zeichen. Meine beste Freundin konnte schrecklich schlecht lügen. Ich ließ den Stift sinken und schenkte ihr meine ganze Aufmerksamkeit.
»Also, was ist los?«
»Nichts«, antwortete sie, ein bisschen zu harmlos. Angestrengt starrte sie durch die Windschutzscheibe auf den Verkehr vor uns, so als gäbe es nichts Interessanteres auf der Welt. »Es ist nur so, dass Jordan und ich morgen Jahrestag haben.«
Wir hatten in den vergangenen Tagen nur etwa ein Dutzend Mal darüber gesprochen, sie wusste genau, dass ich das wusste.
»Und weiter?«
»Nichts weiter, wir wollten nur morgen Abend essen gehen und dachten, du hättest vielleicht Lust, mitzukommen.«
»Äh, sorry«, wandte ich ein, »aber findest du das nicht ein bisschen seltsam? An eurem Jahrestag möchte Jordan doch bestimmt allein mit dir ausgehen. Vermute ich mal.«
»Es war sogar Jordans Idee.« Amanda warf mir einen nervösen Blick zu. »Echt. Er mag dich sehr.«
»Ich mag ihn ja auch, aber trotzdem finde ich, dass ihr beide an dem Abend zu zweit bleiben solltet.«
Sie bog nach links ab. »Oh, wir … wir würden uns nach dem Essen auch sofort verabschieden. Wir dachten nur …«
Amanda linste zu mir herüber und merkte, dass ich ihr das nicht abnahm. Sie seufzte ergeben. »Also gut, hör zu. Jordan hat da einen Freund …«
»O nein! Hör sofort auf.«
Doch Amanda redete nun nur noch schneller. »Jordan sagt, dass er ein wirklich netter Typ ist, er ist mit ihm in der Schwimmmannschaft. Ihr würdet euch sicher prima verstehen –«
»Nein, nein und nochmals nein!«, rief ich entschieden.
»Bitte, Cat, nur dieses eine Mal.«
Amanda war der felsenfesten Überzeugung, dass sich irgendwelche Jungs für mich interessieren könnten, dass es auf dieser Welt tatsächlich jemanden geben könnte, der sich mit einem dicken Mädchen verabreden mochte. Aber bevor ich mich wieder einmal auf dieser unsinnige Diskussion einließ, gebrauchte ich lieber eine Ausrede.
»Hast du mir nicht zugehört? Ich habe wahnsinnig viel zu tun! Das Thema zu formulieren ist echt schwer – und es muss einfach perfekt sein.«
»Das wird es auch! Komm schon, Kit Cat, es ist doch nur für ein, zwei Stunden.«
»Ich kann nicht«, erwiderte ich. »Das nächste Halbjahr wird ein wahrer Albtraum für mich, wenn ich nicht ackere. Ich habe den Unterricht bei Mr Fizer, Mathe, Chemie …«
»Ich weiß«, sagte Amanda, »und gerade deshalb mache ich mir ja auch Sorgen um dich. Wann hast du denn mal Zeit für etwas anderes als Schule, Job und Hausaufgaben?«
»Keine Bange, ich krieg das alles auf die Reihe.«
»Da bin ich mir sicher«, sagte sie, »aber es gibt auch noch etwas, das du völlig zu vergessen scheinst – ein Privatleben.«
»Das ist mir egal.«
»Und genau das bereitet mir Sorgen«, fuhr sie fort. »Du siehst doch, wie glücklich ich mit Jordan bin, oder?«
»Ja, und das freut mich auch für dich. Er ist ein echt netter Typ.«
»Und da draußen gibt es noch mehr nette Typen«, sagte sie, als sie vor dem Krankenhaus anhielt. »Cat, ich habe einfach Angst, dass du eines Tages als verbitterte alte Hexe aufwachst, die zwar eine Menge wissenschaftliche Auszeichnungen eingeheimst, aber überhaupt keine sozialen Kontakte mehr hat. Und dann wirst du dasitzen und Rotz und Wasser heulen, weil du dein Leben so vergeudet hast.«
»Danke«, sagte ich. »Das ist ’ne echt gute Horrorgeschichte.«
»Schön, dass du das auch findest. Sie heißt ‚Sie hat nicht auf ihre Freundin gehört’.«
Ich bedankte mich bei Amanda fürs Bringen und stieg aus. Aber sie gab nicht so schnell auf. Als ich schon die Stufen hinaufging, ließ sie das Seitenfenster herunter und rief mir nach: »Überleg dir’s wenigstens noch, okay?«
»Nein.«
»Cat! Wie sollen unsere Kinder denn gemeinsam groß werden, wenn du dich nie verabredest?«
Wortlos winkte ich ihr nur noch mal über die Schulter zu und verschwand dann im Foyer.
Amanda träumte davon, dass wir beide aufs selbe College gehen, dort unsere Ehemänner kennenlernen – »Jordan kann sich ja für den Posten bewerben, wenn er will«, meinte sie, »ich hätte nichts dagegen« – und danach in dieselbe Stadt ziehen würden, wo wir ein glückliches Leben führen würden und beide supererfolgreich wären: ich als Wissenschaftlerin oder Ärztin und sie als Schriftstellerin oder Englischprofessorin. In ihrer Vorstellung würden wir Tür an Tür wohnen, unsere Kinder würden zusammen spielen und unsere Ehemänner sich am Grill abwechseln, während Amanda und ich in der Küche wunderbare Desserts zubereiteten und bis spät in die Nacht über Gott und die Welt plauderten.
Es machte Spaß, Amanda zuzuhören, wenn sie sich unser künftiges Leben ausmalte. Ich mochte es, wie sie sich mich in der Zukunft vorstellte. Ich mochte es nur nicht, wenn ich in der Geschichte als alte verrunzelte Hexe vorkam.
Folglich war es sicher nicht das Schlimmste auf der Welt, wenn sie, und offenbar jetzt auch Jordan, einen Mann für mich finden wollte. Aber selbst wenn ich es wirklich gewollt hätte – und dem war definitiv nicht so –, übersahen die beiden doch eine eindeutige Tatsache: Noch nie hatte auch nur ein einziger Junge mich wirklich gemocht. Klar, es gab schon Jungs, die nett zu mir waren, Freunde eben, aber noch nie einen, der wirklich für mich geschwärmt hätte.
Vielleicht hatten sich Amanda und Jordan ja schon so an meinen Anblick gewöhnt, dass sie mich nicht mehr so wie all die anderen Leute sahen. Wahrscheinlich sollte ich das auch als Kompliment auffassen. Ich denke, den beiden war aber auch noch nie in den Sinn gekommen, dass es einfacher für mich war, mir erst gar keine Hoffnungen zu machen. Weil ich so nicht mehr enttäuscht werden konnte. Oder schlimmer noch, wirklich verletzt.
Ein gebrochenes Herz reichte völlig.
4
Bevor ich die Treppe zum Untergeschoss hinunterging, legte ich noch schnell einen Stopp in der Krankenhauscafeteria ein.
Meine Mutter hob die Augenbrauen, als sie mich mit der Ladung Süßigkeiten hereinkommen sah.
»Du wirst mich gleich verstehen«, erklärte ich ihr wie zuvor schon Amanda.
Aber in diesem Moment klingelte das Telefon und meine Mutter musste den Anruf entgegennehmen, denn ihre Kollegin Nancy sprach bereits auf dem anderen Apparat. Wortlos legte ich beiden je eine Tüte Doritos und ein paar Rolos hin, bevor ich mich mit dem restlichen Süßkram an meinem eigenen Schreibtisch niederließ.
Meine Mutter war Pharmazeutin und arbeitete in der Giftnotrufzentrale des Krankenhauses. Dort rief man an, wenn man als Babysitter plötzlich merkte, dass das Kind, das man beaufsichtigen sollte, gerade Hundefutter gegessen hatte, oder wenn man wissen wollte, ob der Ausschlag vielleicht von der Selbstbräunungslotion kam, die man über die Aknesalbe aufgetragen hatte. Und sie sagten einem auch, was man tun sollte, wenn man von einer Klapperschlange oder einem Skorpion gebissen oder von Killerbienen angegriffen worden war. Es gab wirklich eine ganze Menge Katastrophen auf der Welt. Es war gut, wenn man wusste, wo man dann anrufen und einen Hilfeschrei ausstoßen konnte – »Mein Gesicht sieht aus wie ein Baseball!« – und eine ruhige Stimme einem sagte, was man tun konnte.
Gerade empfahl Nancy jemanden mit ruhiger Stimme, sofort ins Krankenhaus zu kommen. Und meine Mutter erklärte einer Anruferin mit gleichfalls ruhiger Stimme, dass ihre Haare nicht schneller wuchsen, wenn sie sie mit Grapefruitsaft übergoss, auch wenn sie das auf irgendeiner Website gelesen hatte. Ein Beispiel, das den Rat meiner Mutter stützte, nicht automatisch alles zu glauben, was ich im Internet fand.
Als die beiden aufgelegt hatten, lehnten sie sich zurück. Ich ging zu meiner Mutter und umarmte sie.
»Hallo, Liebling. Wie war’s in der Schule?«
»Ganz okay.«
Wieder läutete das Telefon und sie hob ab.
»Coole Klamotten hast du an«, sagte Nancy. »Neu?«
»Ja.«
»Die machen dich schlank.«
»Danke.«
Nancy und ich wussten beide, dass es gar nicht genug Schwarz auf der Welt geben konnte, um mich schlank wirken zu lassen, aber es war trotzdem nett von ihr, mir ein Kompliment zu machen.
In der nächsten halben Stunde klingelten die Telefone dann ununterbrochen. Ich verwendete die Zeit dazu, die Post zu öffnen und zu sortieren, und machte mich danach an die Ablage.
Endlich wurden die Anrufe weniger. Es war schon komisch: Irgendwie schienen Katastrophen immer in Wellen zu kommen.
»Und?«, erkundigte sich Nancy. »Irgendwelchen Tratsch zum Schuljahresbeginn zu vermelden?«
»Nein, eigentlich nicht.«
»Keine Messerstechereien, keine Pärchen, die Schluss gemacht haben, oder irgendwelche Modesünden?«
»Nee.«
»Wer ist in deiner Klasse?«, erkundigte sich meine Mom.
»Die Gleichen wie immer.«
»Matt auch?«, wollte Nancy wissen.
»Klar.«
So war das nun mal, wenn man die anspruchvollen Kurse besuchte. Man war immer mit denselben Leuten zusammen. Auf meine High School gingen fast zweitausend Schüler, aber ich kannte eigentlich nur dreißig davon. Und wirkich zu tun hatte ich lediglich mit zwei.
Ich stopfte mir schnell die letzten Chips in den Mund, die bei meiner Mutter auf dem Tisch lagen.
»Irgendwann muss ich den Kerl mal kennenlernen«, sagte Nancy. »Ich stelle ihn mir immer mit Hörnern und einem Buckel vor.«
»Nah dran«, erwiderte ich.
»Cat, hör auf«, sagte meine Mom. »Ich weiß wirklich nicht, warum du immer so schlecht über ihn redest – ihr wart einmal so gute Freunde.«
»Ja, ja, ich bin gemein.«
»Auf mich machte er immer einen sehr netten Eindruck.«
»Sicher.«
In diesem Moment klingelten wieder beide Telefone und wir wandten uns alle drei erneut unserer Arbeit zu.
Es war nicht das erste Mal, dass meine Mutter mich zurechtwies, weil ich über Matt lästerte. Ich hatte ihr nie erzählt, was er mir angetan hatte – Amanda war die Einzige, die davon wusste, und das auch nur, weil sie dabei gewesen war. Kein Wunder also, dass es für meine Mutter kaum nachvollziehbar war, was sich verändert hatte. Sie hatte nur mitbekommen, dass Matt bei mir auf einmal unten durch war und seither Amanda an seine Stelle getreten war. Und ich war, ehrlich gesagt, auch sehr froh darüber – ich war viel enger mit Amanda befreundet, als ich es mit Matt je hätte sein können.
Was ich jedoch nicht mehr länger für mich behalten konnte, war meine Idee. In der nächsten Telefonpause zog ich das Bild aus meinem Rucksack und erzählte ihnen von meinem Forschungsprojekt.
Meine Mutter und Nancy warfen sich einen bedeutungsvollen Blick zu.
»Was denn?«, fragte ich.
»Bist du dir da wirklich sicher?«, begann meine Mom vorsichtig. »Vielleicht solltest du dir ein einfacheres Thema suchen.«
»Wieso?«, fragte ich. »Das ist doch ein super Projekt! Ich dachte, du wärst begeistert. Außerdem ist es jetzt eh zu spät. Ich habe Mr Fizer mein Vorhaben schon mitgeteilt. Sobald ich sein Okay zu meinem Konzept habe, fange ich an.«
»Lass uns später noch einmal darüber sprechen«, meinte sie beschwichtigend.
»Nimm’s mir nicht übel«, mischte sich Nancy nun vorsichtig ein. »Aber ich bezweifle, dass du das länger als eine Woche durchhältst.«
»Warum?«, fragte ich.
»Der Körper ist für eine solche Art von Missbrauch nicht gemacht.«
»Das ist kein Missbrauch!«, entgegnete ich. »Im Gegenteil: Ich werde wieder so leben, wie wir das eigentlich alle tun sollten.«
Nancy zeigte auf meine Dose Cola light.
»Wie viele trinkst du jeden Tag davon?«
»Keine Ahnung. Vielleicht vier oder fünf …«
Sie pfiff nur durch die Zähne. Und meine Mutter schüttelte den Kopf.
»Das wird richtig schwer werden, Liebling.«
»Warum?«
»Ich habe vor ein paar Jahren mal versucht, mir das Kaffeetrinken abzugewöhnen«, sagte Nancy jetzt. Sie hob zur Demonstration ihren Becher. »Du siehst, was daraus geworden ist.«
»Die Entzugserscheinungen können etwas heftig sein«, pflichtete meine Mutter ihr bei.
»Etwas?«, spottete Nancy. »Mein Mann drohte schließlich damit, ins Hotel zu ziehen, wenn ich nicht sofort mit ihm zu Starbucks fahre. Und, Cat, ich sag’s nicht gerne, aber für dich wird es noch schwieriger werden.«
»Wieso das denn?«
»Dieses Cola-light-Zeug ist voller Süßstoff – das ist noch eine zusätzliche Droge. Es ist echt schwer, davon runterzukommen. Bist du dir sicher, dass du dazu bereit bist?«
»Ich muss«, erwiderte ich und mein Mund fühlte sich plötzlich ganz trocken an. »Es ist mein Projekt.«
»Nun denn«, meinte Nancy und zuckte resigniert die Schultern, »dann kann ich dir wohl nur noch viel Glück wünschen.«
»Wir reden nachher noch einmal darüber«, schloss meine Mutter und dann klingelten auch schon wieder die Telefone. Gott sei Dank gab es bei anderen Leuten wieder irgendwelche Katastrophen.
Als wir nach der Arbeit zusammen nach Hause fuhren, bombardierte mich meine Mutter die ganze Zeit mit allen möglichen Fragen – genau wie Amanda: Was ist hiermit? Was ist damit? Und obwohl ich ein paar Mal passen musste, wusste ich genau: Sobald ich mich zu Hause hinsetzen und am Computer zu recherchieren beginnen würde, würden die Antworten schon von alleine kommen.
Das war zumindest mein Plan.
Nur dass zuerst einmal noch viel mehr Fragen auftauchten.
5
Es ist schon komisch, wie dumm man sein kann und es erst merkt, wenn es schon zu spät ist.
Tatsächlich war mir aber alles andere als komisch zumute.
Nachdem ich stundenlang im Internet recherchiert hatte, musste ich mir eingestehen, dass ich eine Riesendummheit begangen hatte.
Denn was hatte der Homo erectus gegessen? Schmackhafte Früchte und Grünzeug und Nüsse und Beeren?
Ähm … nein, weit gefehlt.
Der Homo erectus hatte sich von Aas ernährt. A-a-s: das stinkende Fleisch verendeter Tiere.
Und das Bild? Nun, das zeigte die Hominini nicht dabei, wie sie ihre Nahrung vor den Hyänen verteidigten, sondern wie sie es ihnen zu stehlen versuchten! Sie hatten die Sache mit dem Jagen nämlich offensichtlich noch gar nicht drauf. Sie lebten überwiegend von Wurzeln, Knollen und sonstigen Pflanzen – und eben von dem faulenden Fleisch, das sie vielleicht noch ergattern konnten, sobald die Raubtiere satt waren. Was bedeutete, dass das Fleisch, wenn sie dann schließlich an der Reihe waren, schon mehrere Tage alt und voller Maden war.
Natürlich hatten die Frühmenschen auch Frischfleisch gegessen – Insekten, junge Vögel, die sie aus den Nestern stahlen, und hin und wieder einen Hasen, den sie in eine Falle locken und mit einem Stock totschlagen konnten –, aber meistens lauerten sie den erfolgreicheren Kreaturen der Schöpfung auf und versuchten, ihnen die Beute wegzunehmen.
Und sie kannten noch kein Feuer. Kein Feuer! Und das hieß: rohes Fleisch! Na super! Das war mein sicherer Tod!
»Dann schmeiß doch einfach den Kurs hin«, riet Amanda mir, als ich sie anrief.
»Das kann ich nicht.«
»Was willst du denn dann tun? Willst du in den Müllcontainern nach Abfall wühlen? Komm, Cat, manchmal muss man einfach Leine ziehen.«
Es war nicht der Gedanke an verdorbenes Fleisch, der mir den Magen umdrehte. Ich hatte einfach noch nie einen Kurs sausen lassen, und ich würde ganz bestimmt auch dieses Mal nicht kneifen.
»Es muss eine Möglichkeit geben«, sagte ich.
»Sicher. Wenn du gern in der Notaufnahme landest«, entgegnete Amanda. »Schau den Tatsachen ins Gesicht, Cat – es geht nicht.«
»Ich muss einfach noch genauer recherchieren«, erklärte ich verbissen. »Tschüs dann, bis morgen.«
Es musste eine Möglichkeit geben.
Matt durfte nicht kampflos gewinnen.
6
»Wow, das habe ich ja lange nicht mehr an dir gesehen.« Amanda zeigte auf meine Mähne, die ich unordentlich zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden hatte. Weil ich in der vergangenen Nacht nur vier Stunden geschlafen hatte, war ich am Morgen zu spät dran gewesen, um mir die Haare noch zu fönen und dabei glatt zu ziehen.«
»Gewöhn dich dran«, krächzte ich. Der mangelnde Schlaf ließ meine Stimme ziemlich rau klingen. »Frühmenschen hatten keine Haarpflegeprodukte.«
»Du hast also noch nicht aufgegeben?«
»Ich weiß noch nicht«, antwortete ich. »Ich muss mir einfach noch über einiges klar werden. Im Moment ist mein Schädel allerdings völlig leer.«
»Hier.« Amanda reichte mir eine ihrer beiden Dosen Cola light. »Kannst du bestimmt gut brauchen.«
»Oh – danke.«
Ich nahm einen großen Schluck. An diesem Morgen brauchte ich so viel Koffein wie nur irgend möglich. Dienstags hatte ich in der ersten Stunde Amerikanische Geschichte bei Mr Allen, dem weltweit einzigen Zombielehrer. Amanda war es gelungen, ihn dieses Schuljahr zu umgehen, weil sein Kurs nicht in ihren Stundenplan passte. Glück gehabt.
»Und was«, fragte Amanda, »machst du, wenn dir das nicht gelingt?«
»Ich weiß nicht. Betteln. Heulen. Durchfallen.«
Es läutete und wir stürzten den letzten Schluck Cola hinunter.
»Wir sehen uns dann nachher in Englisch«, sagte Amanda noch, bevor sie mich behutsam an den Schultern fasste und mich in Richtung von Mr Zombies Klassenraum schob.
Obwohl ich eine geschlagene Stunde in seinem Unterricht saß, konnte ich mich hinterher an keinen einzigen Satz erinnern, den er von sich gegeben hatte. Ich glaube, er hatte über Toast gesprochen.
Zumindest war die Schulstunde danach immer gut, weil Amanda und Jordan ebenfalls in dem Kurs waren. Allerdings auch Matt, leider, aber da war nichts zu machen.
Amanda und Jordan waren an diesem Tag im Englischunterricht definitiv die Superstars. Die beiden hatten während der Sommerferien einiges veröffentlicht. Ein paar von Amandas Gedichten waren in verschiedenen Zeitschriften erschienen und sie hatte einen Schreibwettbewerb in ›Seventeen‹ gewonnen, und Jordan hatte schon einige Artikel für ein Snowboard-Magazin geschrieben. Unsere Lehrerin, Ms Sweeney, bat sie, kurz zu erzählen, wie sie das geschafft hatten und wie es sich anfühlte.
Was ich an den beiden wirklich schätzte – offen gestanden gab es eine Menge Dinge, die ich an ihnen mochte, doch irgendwo musste ich ja anfangen – , war, dass weder Jordan noch Amanda sich etwas auf ihren Erfolg einbildeten. Ich war mir sicher: Hätte Matt McKinney schon etwas in einer Zeitschrift veröffentlicht, wir würden ohne Ende davon hören. Bei den beiden musste Ms Sweeney hingegen ihre ganze Überredungskunst aufbieten, damit sie über ihre Erfahrungen sprachen. Sowohl Amanda als auch Jordan waren dann aber unglaublich bescheiden und spielten das Ganze herunter.
Nach der Stunde zog Matt eine große Show ab, indem er auf Jordan zuging, ihn, wie bei Jungs üblich, Faust gegen Faust grüßte und ihm gratulierte. Einen Moment lang sah es so aus, als wollte er auch Amanda beglückwünschen, sie ließ ihn jedoch abblitzen. Meine Freundin hielt echt zu mir.
Als ich das Klassenzimmer verließ, signalisierte Amanda mir noch schnell mit den Fingern: Wir sehen uns in Gebärdensprache.
Ich bewegte meine Faust ein paarmal auf und ab, was so viel wie Okay hieß, und machte mich auf den Weg zum Unterrichtsraum meiner Klassenlehrerin.
Ich hatte den langen Flur bereits halb durchquert, als ich merkte, dass Matt mir folgte.
»Und?«, sagte er, kaum hatte er mich eingeholt, »hast du dein Projekt schon ausformuliert?«
»Nein.«
Das war ja klar, dass er mir das unter die Nase reiben musste. Wie ich ihn kannte, war er wahrscheinlich schon am Abend fertig gewesen und hatte noch locker Zeit gehabt zu lesen und fernzusehen. Ich versuchte ihn zu ignorieren, während ich mich durch die Menge schlängelte.
Doch er blieb mir auf den Fersen. »Gefällt dir das Bild, das du gezogen hast?«
»Nein.«
Als ob ihn das etwas angehen würde. Wetten, er wollte, dass ich ihn frage, ob ihm sein Foto gefiel? Aber diesen Gefallen würde ich ihm nicht tun!
»Na dann tschüs«, meinte er und blieb stehen.
So ging das mit uns nun schon seit der siebten Klasse. Er wusste genau, dass ich nicht mit ihm reden wollte, aber er ließ mich einfach nicht in Ruhe. Ich glaube sogar, es bereitete ihm irgendwie ein krankhaftes Vergnügen, mir auf die Nerven zu gehen.
Ich erwiderte nichts und lief einfach weiter. Und da machte es bei mir auf einmal Klick: Jordan und Matt, die nach dem Unterricht miteinander geredet hatten; Matt, der plötzlich so freundlich tat; Amanda, die gestand, dass Jordan ein Treffen mit jemandem aus seinem Schwimmteam arrangiert hatte …
Ich hätte Amanda augenblicklich eine erboste SMS geschrieben, wenn ich denn das Handy hätte benutzen dürfen, aber das war auf dem Schulgelände absolut verboten. So musste ich abwarten, bis die Mittagspause und der Klavierunterricht vorbei waren, um der Sache endlich auf den Grund gehen zu können. Was mir echt nicht leicht fiel: Wen interessierten schon irgendwelche Arpeggios, wenn der Freund der besten Freundin einen gerade an den Feind verraten hatte?
Die Regel im Gebärdenunterricht lautete, dass man alles per Zeichensprache sagen musste, sobald man über die Schwelle des Klassenzimmers trat – selbst wenn man sich vor der Stunde bloß schnell mit seiner Freundin unterhalten wollte. Amanda war schon da. Meine Hände flogen nur so durch die Luft.
Jordan mich Matt verkuppeln?, sagten meine Hände, während meine Lippen lautlos den ganzen Satz formten: Will Jordan mich mit Matt verkuppeln?
Amanda zog ihre Augenbrauen hoch und strich dann mit ihrem Zeigefinger über die Handinnenfläche der anderen Hand. Was?
Du hast gesagt …, fing ich an und hielt dann inne. Ich musste nachdenken, wie ich mich mit den Zeichen, die ich kannte, ausdrücken konnte. Wir beide hatten erst im vergangenen Schuljahr begonnen, Gebärdensprache zu lernen, weshalb mein Wortschatz noch nicht sonderlich groß war. Amanda hingegen schien mit einer Art Sprachenchip in ihrem Gehirn auf die Welt gekommen zu sein; sie merkte sich die Zeichen derart schnell, dass es geradezu schockierend war. Im Spanischunterricht hatte man sie schon nach einem Semester zu den Fortgeschrittenen aufrücken lassen. Dieses Jahr hatte sie den Intensivkurs in Spanisch belegt und besuchte gleichzeitig das zweite Jahr Gebärdensprache.
Jordan fragt Matt essen heute Abend?, versuchte ich es nun.