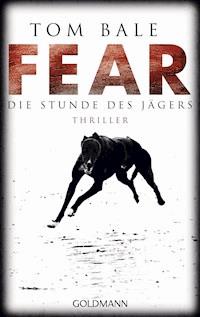
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Eine Kleinstadt im Griff des Verbrechens
Seit der ehemalige Detective Sergeant Joe Clayton vor vier Jahren den Sohn eines Bandenchefs erschoss, ist er auf der Flucht. Nachdem er seinen Verfolgern erneut knapp entkommen kann, findet er bei einer Freundin im beschaulichen Städtchen Trelennan in Cornwall Unterschlupf. Es ist eine Bilderbuchidylle. Doch Joes Instinkt sagt ihm, dass der Schein trügt. Und tatsächlich: Bereits zwei Frauen sind in Trelennan verschwunden, und es herrschen Angst und Misstrauen. Der Ort ist fest in der Hand des skrupellosen Unternehmers Leon Race. Und der würde den neugierigen Ex-Cop Clayton am liebsten aus dem Weg räumen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 677
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Tom Bale
Fear – Die Stunde des Jägers
Buch
Bristol, England. Seit der ehemalige Detective Sergeant Joe Clayton vor vier Jahren den Sohn eines Bandenchefs erschoss, ist er auf der Flucht: Die Familie des Verbrechers will seinen Tod. Nachdem er seinen Verfolgern erneut mit knapper Not entkommen kann, sucht er bei einer Freundin in der Kleinstadt Trelennan in Cornwall Unterschlupf. Ein ungewöhnlicher Ort. Schon bei seiner Ankunft wundert Clayton sich über den Argwohn und die offene Ablehnung, die ihm entgegengebracht werden. Die Stadt selbst jedoch ist ein Touristenmagnet wie aus dem Hochglanzprospekt. Doch Joes Instinkt sagt ihm, dass die Idylle trügerisch ist. Welchen Preis zahlen die Einwohner dafür, dass hier alles so sauber und ordentlich ist, dass es praktisch keine Ausländer gibt und die Kriminalitätsrate bei null liegt? Und was hat der mächtige Unternehmer Leon Race mit der Angst und dem Misstrauen zu tun, die unter den Einwohnern herrschen? Joes Unbehagen vertieft sich, als er sich mit der jungen Alise unterhält. Sie ist auf der Suche nach ihrer verschwundenen Schwester und davon überzeugt, dass Leon Race sie entführt hat. Kurz darauf wird auch Alise vermisst. Joe nimmt die Suche nach den beiden Frauen auf − und muss dafür seine lebenswichtige Deckung verlassen …
Autor
Tom Bale, geboren 1966, hat in den unterschiedlichsten Berufen gearbeitet, wollte aber schon als Kind Schriftsteller werden. Mit seinen Spannungsromanen eroberte er nicht nur die Leser, sondern auch die Herzen der Kritiker im Sturm. Tom Bale lebt mit seiner Familie in Brighton.
Von Tom Bale außerdem bei Goldmann lieferbar:
Amok. Thriller
Overkill. Thriller
Tom Bale
Fear
Die Stunde
des Jägers
Thriller
Aus dem Englischen von Andreas Jäger
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen. Die Originalausgabe erschien 2011
unter dem Titel »Blood Falls« bei Preface Publishing, London, an imprint of The Random House Group Limited.
1. Auflage
Deutsche Erstveröffentlichung Februar 2013
Copyright © der Originalausgabe 2011 by Tom Bale
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2013
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München
Umschlagbild: plainpicture/Arcangel/
Robert Jones – aus der plainpicture Kollektion Rauschen
Redaktion: Ilse Wagner
LT ∙ Herstellung: Str.
Satz: IBV Satz- und Datentechnik GmbH, Berlin
ISBN: 978-3-641-08643-5V003
www.goldmann-verlag.de
Meinem Sohn James
1
Sie hatten ihm eine Falle gestellt, und fast wäre er hineingetappt. Trotz all seiner Vorsichtsmaßnahmen, trotz der Jahre, die er gelebt hatte wie ein gehetztes Tier, hatte er es nicht kommen sehen.
Er war eine Nadel in einem Heuhaufen. In diesem Glauben hatte er sich gewiegt. Sie würden ihn niemals finden, weil es ihnen sowohl an Organisation als auch an Entschlossenheit mangelte. Weil sie nicht schlau genug waren.
Aber er hatte sich geirrt. Er hatte übersehen, dass sie gar nicht so sonderlich schlau sein mussten. Alles, was sie brauchten, waren Geduld, Hartnäckigkeit und ein kleines bisschen Glück. Wenn sie den Heuhaufen nur lange genug durchkämmten, würde ihnen die Nadel früher oder später in die Hände fallen.
Ob sie dann flach landete oder sie beim Zugreifen stach, war eine andere Frage …
Es war die Ecke, die ihn rettete. Die Ecke, das hohe Gerüst und eine ganz erhebliche Portion Glück.
Fünf Minuten zuvor hatte er noch unten auf der Straße gestanden und einen Kaffee getrunken, den ihm die Hauseigentümerin vor die Tür gebracht hatte. Als er die Leiter hinaufstieg, um sich wieder an die Arbeit zu machen, hatte Ryan gesagt: »In zehn Minuten machen wir Mittag.«
»Echt?«
»Ja – warum nicht?« Ryan schien selbst ein wenig verblüfft über seine Großzügigkeit; er arbeitete oft von morgens bis abends ohne Pause durch. »Wir schuften schließlich schon seit halb acht.«
Da hatte er auch wieder recht. Und so verbrachte Joe die nächsten paar Minuten in freudiger Erwartung einer dampfenden Lasagne und eines kühlen Glases Lager im Pub.
Die beiden Männer bogen an der Einmündung von Sion Hill um die Ecke, keine zehn Meter entfernt. Sie waren zu Fuß, und dank des spitzen Winkels zwischen dem Gehsteig und der obersten Plattform des Gerüsts war Joe von unten nicht zu sehen. Hätten sie in einem Auto gesessen, oder wären sie von weiter oben die Straße heruntergekommen, hätten sie ihn sofort entdeckt.
Und sie unterhielten sich. Joe konnte zwar nicht genau verstehen, was sie sagten, doch er registrierte sofort den vulgären Londoner Slang – einen Tonfall, der bei ihm stets die Alarmglocken läuten ließ. Er duckte sich und nutzte den Moment, um seinen Pinsel in die Farbe zu tauchen. Einer der Männer rief: »Ey, du da!«
Joes Magen krampfte sich zusammen, als er den Ruf hörte. Er verharrte in Kauerstellung, während die Männer näher traten, und hörte ein leises metallisches Klirren, als jemand mit einer Armbanduhr oder einem Ring gegen die Gerüststange stieß.
Joe beugte sich vor, gerade so weit, dass er einen Blick auf die beiden Männer unten auf dem Gehsteig erhaschen konnte. Das eine Gesicht war ihm völlig unbekannt, doch das andere war ihm nur allzu vertraut.
Es war das Gesicht eines Mannes, den er getötet hatte.
Zwanzig vor zwölf an einem kühlen, trüben Dienstag Anfang Oktober – in einem Herbst mit heftigen Regenfällen, von denen in den nächsten Tagen noch mehr erwartet wurden. Ryan schätzte, dass diese Woche noch die besten Chancen bot, die Außenarbeiten abzuschließen. Bisher hatte er recht behalten, wenngleich sich den ganzen Vormittag über die Wolken über der Avon-Schlucht zusammengeballt hatten.
Ryan setzte Leitern ein, wann immer es möglich war; ansonsten einen leichten, transportablen Gerüstturm. Aber das Gebäude, das sie derzeit renovierten, war ein dreigeschossiges georgianisches Stadthaus. Da musste es schon ein festes Stangengerüst sein.
Im Gegensatz zu den meisten anderen Häusern in der Straße, deren Fassaden mit feinem Tüpfelputz gestaltet waren, wies dieses hier eine dicke Rauputzschicht auf. Joe hatte angenommen, dass sie mit der Sprühpistole arbeiten würden, aber Ryan hatte ihm erklärt, das sei Zeitverschwendung.
»Um die Farbe in die Ritzen zu kriegen, musst du ganz, ganz langsam sprühen. Und dann fängt es überall an zu tropfen, sodass du andauernd unterbrechen musst, um die Farbe aufzuwischen. Da ist es leichter, wenn du gleich mit dem Pinsel rangehst.«
Joe merkte bald, dass leichter ein relativer Begriff war, wenn es darum ging, den Pinsel immer wieder in zwei, drei Zentimeter tiefe Spalten zu schieben und ihn dann so lange hin und her zu bewegen, bis die ganze Oberfläche mit Farbe bedeckt war.
Und dann war es auch noch eine ziemliche Sauerei – nicht viel besser, als wenn sie mit der Sprühpistole gearbeitet hätten. Zusätzlich zu seinem Overall trug Joe Handschuhe, eine Schutzbrille und eine Wollmütze. Jedes Mal, wenn er die Pinselborsten auf den Putz drückte, gab es einen feinen Sprühnebel; und bis zum Abend würde er wahrscheinlich von Kopf bis Fuß mit kleinen Farbpünktchen übersät sein.
Aber im Augenblick empfand er nur Dankbarkeit für diesen mühseligen Job. Ein glatter Putz hätte bedeutet, dass er hoch oben auf einer Leiter gestanden hätte, weithin sichtbar und exponiert.
Er achtete sorgfältig darauf, kein Geräusch zu machen, als er die Schutzbrille abnahm und auf das Brett legte. Dann zog er die Mütze ab und wischte sich den Schweiß vom Gesicht. Seine Aufmerksamkeit war zur Hälfte auf das Gespräch unten auf der Straße gerichtet, zur anderen auf das Abwägen seiner Möglichkeiten.
Der Mann, den er noch nicht kannte, sprach als Erster. »Wir suchen den Kerl hier. Haben Sie den irgendwo gesehen?«
Eine Pause. Joe riskierte noch einen Blick über die Kante. Der Mann hatte graue Haare, die er glatt zurückgekämmt trug, und eine kahle Stelle am Hinterkopf. Er trug eine Jeans und eine abgewetzte, alte braune Lederjacke. Gerade zeigte er Ryan ein Foto.
Joe konnte es nicht genau erkennen, aber das war auch nicht nötig. Er wusste genau, hinter wem sie her waren.
Ryan schniefte. »Kenn ich nicht.«
»Aber er soll hier irgendwo arbeiten.«
»Gelegenheitsjobs«, warf der andere Mann ein. »Schwarz, höchstwahrscheinlich.«
Das war Danny Morton – ein schmächtiger, reizbarer Mann mit schmalen Schultern und langen, knochigen Fingern. Kurz geschnittene braune Haare, die in alle Himmelsrichtungen abstanden, und ein dünnes Gesicht mit einer rosafarbenen runzligen Narbe von der Größe einer Erbse in der Mitte seiner linken Wange.
»Von so was lass ich die Finger«, erwiderte Ryan. »Lohnt sich heutzutage doch gar nicht mehr zu bescheißen – ist den ganzen Stress nicht wert. Was weiß denn ich, ob ihr Burschen nicht von der Steuerfahndung seid?«
»Seh’ ich etwa aus wie so ein Steuerfuzzi?«, knurrte Danny.
Ryan ignorierte die Frage. »Wer soll das überhaupt sein?«
»Er heißt Joe Clayton«, antwortete der andere. »Sind Sie sicher, dass Sie ihn nicht kennen?«
»Kann sein, dass er inzwischen anders aussieht als auf dem Foto«, fügte Danny hinzu. »Neue Frisur. Ein paar Jahre älter.«
»Ich kenn ihn trotzdem nicht. Tut mir leid.«
Joe fand, dass Ryan ziemlich überzeugend klang, aber er sehnte das Ende des Gesprächs herbei. Je länger es dauerte, desto größer wurde die Gefahr, dass Ryan sich verplapperte.
Ein schlurfendes Geräusch – der Typ mit der Lederjacke hatte das Foto wieder an sich genommen und sich vielleicht schon in Bewegung gesetzt, aber Joe spürte die Anspannung, die in der Luft lag. Er stellte sich vor, wie Ryan das Gehörte verarbeitete, und ihm war klar, vor welchem Dilemma der junge Mann stand. Es gab genau eine Frage, die jemand, der nichts zu verbergen hatte, einfach stellen musste.
»Was wollt ihr denn eigentlich von ihm?«
Es war Danny Morton, der antwortete. »Er hat meinen Bruder ermordet.«
2
Joe wagte nicht, sich zu rühren. Angesichts dessen, was Ryan gerade gehört hatte, könnte schon ein kurzer, unbewusster Blick nach oben ihn verraten.
Seine Möglichkeiten zur Selbstverteidigung waren, gelinde gesagt, begrenzt. Er könnte vielleicht warten, bis Danny oder sein Kumpel oben auf der Leiter angekommen war, um ihm dann einen Farbeimer um die Ohren zu schlagen …
Der Haken daran war, dass sie es gar nicht nötig hatten, das Gerüst zu erklimmen. Joe wusste, dass Danny gewohnheitsmäßig eine Waffe trug – und er war durchgeknallt genug, sie auch zu benutzen.
Das bedeutete, dass Flucht die bessere Alternative war. Ein Schlafzimmerfenster einschlagen, zur Gartentür raus und über das Nachbargrundstück fliehen. Zwanzig oder dreißig Sekunden Vorsprung würde ihm das wohl verschaffen – vielleicht gerade eben genug.
Er hoffte, weder das eine noch das andere tun zu müssen. Es hing jetzt alles von Ryan ab. Ob er loyal bleiben oder einknicken würde.
»Mein Gott«, sagte Ryan. »Also ist er auf der Flucht?«
»Vier Jahre schon.«
»Und ist er gefährlich oder so? Ich meine nur, weil die Polizei doch immer sagt, man soll Abstand halten …«
»Wir wissen, dass er hier irgendwo ist, und wir wollen ihn uns kaufen.« Danny klang ungeduldig, und dazu hatte er auch allen Grund. Ryans neugierige Art hatte Joe in den vergangenen Wochen schon zuweilen in den Wahnsinn getrieben; in diesem Moment war sie eine taktische Meisterleistung.
»Ich werde die Augen offen halten«, versprach Ryan. »Ich nehme an, die Polizei ist auch hinter ihm her?«
Von Danny kam nur ein Brummen.
Sein Kumpel hatte Ryan offenbar eine Karte oder einen Zettel gegeben. »Wenn Sie ihn sehen, rufen Sie diese Nummer an. Wir lassen uns auch nicht lumpen.«
»Oder haben Sie was gegen steuerfreie Zuwendungen?«, murmelte Danny verächtlich.
»Nee, doch, passt schon. Ich helfe gerne. Ich meine, niemand will doch, dass ein Mörder frei rumläuft.«
Übertreib’s nicht, dachte Joe. Glücklicherweise hatten die beiden das Interesse an Ryan verloren und gingen weiter. Die schlechte Nachricht war, dass sie ihren Weg über die Princess Victoria Street fortsetzten. Die Straße führte hier leicht bergauf – nur eine geringe Steigung, aber für Joe potenziell tödlich.
Er legte sich flach auf den Bauch und zuckte zusammen, als die Gerüstbretter auf den Querträgern wackelten und knarrten. Den Kopf zur Seite gedreht lag er da und kam sich vor wie ein aufgespießter Schmetterling in einer Vitrine. Er konnte nur beten, dass die Fußleiste hoch genug war, um ihn vor ihren Blicken zu verbergen.
Ryan hatte sich wieder an die Arbeit gemacht und pfiff laut, während er den Pinsel schwang. Joe fasste das als eine Art Signal auf: Bleib, wo du bist.
Und tatsächlich: Nach ein paar Minuten hörte er, wie Ryan den Pinsel hinlegte und an eine Gerüststange klopfte.
»Sie sind weg.«
»Bist du sicher?«
»Ja. Willst du jetzt vielleicht runterkommen und mir erzählen, was da los ist?«
Ryan Whittaker war klein von Gestalt, aber ausgesprochen charakterstark. Mit seinen vierundzwanzig Jahren war er bereits ein erfolgreicher Unternehmer; neben seiner Bau- und Malerfirma investierte er auch in erheblichem Umfang in die Friseursalonkette seiner älteren Schwester, und kürzlich hatte er eine Website eingerichtet, auf der er, man höre und staune, Designer-Babykleidung und Umstandsmode verkaufte.
Er war bereit gewesen, Joe probeweise einzustellen, nachdem er ihn mehrere Tage lang sorgfältig beobachtet hatte und zu dem Schluss gekommen war, dass an seiner Geschicklichkeit und seinem Eifer nichts auszusetzen war. Anders, als er es Danny Morton gegenüber dargestellt hatte, war er sehr wohl bereit, ihn schwarz zu bezahlen. Das Einzige, was zu Spannungen hätte Anlass geben können, waren Joes unklare Angaben zu seiner Vergangenheit, aber Ryan hatte akzeptiert, dass er auf diese Informationen ohne Weiteres verzichten konnte. Er war einfach nur froh, jemanden gefunden zu haben, der bereit war, ebenso hart zu arbeiten wie er selbst.
»Und du bist ja auch nicht mehr der Allerjüngste«, hatte er mit vollendeter Taktlosigkeit hinzugefügt.
»Uralt, verglichen mit dir«, hatte Joe erwidert.
»Tja, mag sein. Aber du kannst anpacken, nicht wahr? Nicht wie manche Typen in meinem Alter, die ihren Lohn versaufen und sich am nächsten Tag krankmelden, weil sie bis Mittag gepennt haben. Was ist denn das für eine Einstellung?«
In barschem Kommisston hatte Joe verkündet: »Führt die Wehrpflicht wieder ein!«
»Führt die …?«
»Vergiss es.«
Ryan grinste verschlagen. »Nee, hab schon verstanden. Ich klinge wie ein verbiesterter alter Sack, der über die Jugend von heute herzieht.«
»Sind doch nicht alle so übel, wie? Du jedenfalls nicht. Und deine Schwester auch nicht.«
»Hast wohl recht«, hatte Ryan eingeräumt. »Als Arbeitgeber siehst du die Dinge irgendwie in einem anderen Licht. Ist einfach so verdammt frustrierend, wenn man mitkriegt, wie Leute ganz bewusst nicht das tun, was das Beste für sie ist.« Er seufzte. »Na ja, den Fehler macht wohl jeder von uns dann und wann, wie? Wir sind doch alle ein bisschen gaga.«
»Ja, das stimmt«, hatte Joe ihm beigepflichtet. »Aber wir geben uns alle Mühe, es nicht zu sein.«
Unten angekommen zog Joe seine Handschuhe aus und begann sich aus seinem mit Farbe bespritzten Overall zu schälen.
»Es tut mir leid. Ich schulde dir eine bessere Erklärung, als ich dir im Moment geben kann.«
»Ist es wahr, dass du den Bruder von dem Typen umgebracht hast?«
»Die Wahrheit ist ein ganzes Stück komplizierter, aber ja, es stimmt.«
»Und du wirst von der Polizei gesucht?«
»Nein. Ich war zu der Zeit selbst Polizist.«
»Ahhh.« Ryan war sichtlich erleichtert. Er hob die Hand an seine Wange. »Was hat es denn mit seiner Narbe auf sich?«
»Ein Schraubenzieher. Das ist passiert, als er versucht hat, mich umzubringen.«
»Ach du Scheiße. Und wie sind sie dir auf die Spur gekommen?«
»Das muss ich noch rausfinden. Wenn ich erst mal weit genug weg von hier bin.«
Joe behielt seine Turnschuhe an, als er aus dem Overall stieg. Darunter trug er eine Jeans und ein schwarzes T-Shirt. Er legte den Overall zusammen und deponierte ihn auf der untersten Plattform des Gerüsts neben ihren leeren Kaffeetassen.
»Irgendeine Idee, wohin du …« Ryans Mundwinkel verzogen sich zu einem Lächeln. »Nein, das kannst du mir nicht sagen, oder?«
»Besser nicht.«
»Ist schon in Ordnung. Aber es tut mir leid, dich ziehen zu lassen.«
Als sie sich die Hand gaben, blieb Joes Blick noch einmal an dem Overall hängen. Irgendetwas ließ ihm keine Ruhe. Irgendetwas, das er übersehen hatte.
Die Kaffeetassen.
Vielleicht hatte er ja Glück gehabt, dachte er. Vielleicht hatten sie die Tassen gar nicht bemerkt, oder sie hatten sie gesehen, aber nicht den entscheidenden Schluss daraus gezogen: dass Ryan nicht allein arbeitete.
»Was ist?«, fragte Ryan.
Joe gab keine Antwort. Er horchte. Aus den Straßen um sie herum kamen alle möglichen Verkehrsgeräusche, aber ein Motor klang lauter, aggressiver als der Rest.
Er drehte sich um und sah einen Wagen auf sie zurasen. Es war ein verbeulter alter Ford Granada – das sah den beiden ähnlich, dachte er. Wahrscheinlich legal erworben, aber nicht angemeldet, würde er auf dem Schrottplatz landen, sobald er seinen Zweck erfüllt hatte.
Im Wagen saßen zwei Männer. Auf diese Entfernung waren ihre Gesichter nicht genau zu erkennen, aber der Fahrer trug eine braune Lederjacke.
3
Der Wagen beschleunigte. Auf der Beifahrerseite lehnte Danny Morton sich aus dem Fenster, den linken Arm zu Joe hin ausgestreckt. Es ergab nicht viel Sinn – bis Joe begriff, dass Danny etwas in der Hand hielt.
»Deckung!« Joe stieß Ryan von sich weg und hechtete in die andere Richtung. Beide Männer gingen in dem Moment zu Boden, als der Schuss knallte – eine schockierend laute Explosion in der Stille dieser Wohnstraße. Die Kugel schlug in die Fassade des Hauses ein und riss einen Brocken Rauputz heraus, Splitter regneten auf sie herab. Der Granada fuhr schlingernd vorbei, und der Fahrer gestikulierte wild in Dannys Richtung; offenbar waren sie sich über die Taktik uneins.
Auch wenn Morton nur wahllos herumballerte, war Joe bewusst, dass ein Querschläger genauso tödlich sein konnte, und das Gitterwerk aus Gerüststangen bot keinen wirklichen Schutz. Er sprang auf.
»Ich locke sie weg«, sagte er zu Ryan, der mit dem Gesicht nach unten auf dem Gehsteig lag und offenbar zu geschockt war, um zu antworten.
Joe lief geduckt auf die Straßenecke zu, wobei er die Reihe von parkenden Autos als Deckung benutzte. Dannys kopflose Aktion überraschte ihn ein wenig. Er hatte sich immer eingebildet, dass die Mortons es bevorzugen würden, ihn lebend zu fangen. Besonders Danny hatte eine äußerst unangenehme Neigung zum Foltern; allerdings waren sein alter Herr, Doug, und selbst Valerie, seine abgebrühte, mit allen Wassern gewaschene Mutter, kaum weniger blutdürstig.
Aber für solche Überlegungen hatte er jetzt keine Zeit. Er musste sich darauf konzentrieren, einen Fluchtweg zu finden. Joe bog in den Sion Hill ein, direkt gegenüber der imposanten georgianischen Fassade des Avon Gorge Hotels, und sprintete den Berg hinauf auf den östlichen Pylon der Clifton-Hängebrücke zu. Aus dieser Perspektive wirkten die dicken Ketten durch eine Art optischer Täuschung dünn wie Spinnweben.
Vielleicht sollte er versuchen, über die Brücke zu fliehen, dachte er, und sich dann irgendwie ein Fahrzeug besorgen. Einen geparkten Wagen knacken oder den Fahrer überwältigen, wenn es sein musste. Was immer nötig war, um zu überleben.
Nein. Das mit der Brücke war keine gute Idee. Viel zu exponiert und alles voller Menschen. Und Kameras gab es da auch jede Menge. Joe brauchte eine Route, auf der sie ihm mit dem Auto schlecht folgen konnten.
An der nächsten Einmündung schlug er einen Haken nach rechts, lief eine Grasböschung hinauf und fand sich schließlich in der Sion Lane, einer engen Gasse mit pittoresken Cottages und etwas heruntergekommenen Werkstätten. Sie war ganz mit parkenden Autos zugestellt. Und was noch besser war: Auf halber Strecke machte die Straße einen Knick nach links, sodass er binnen Sekunden außer Sichtweite sein würde.
Kurz vor der Kurve riskierte er einen Blick zurück, und das Herz rutschte ihm in die Hose. Danny Morton verfolgte ihn zu Fuß. Der einzige Trost war, dass er die Waffe nicht mehr in der Hand hielt.
Joe legte einen Zwischensprint ein. Er hatte keine Ahnung, wo der Granada abgeblieben war, ob der Fahrer so clever war – oder einfach das Glück hatte –, ihn am oberen Ende von Sion Hill abzufangen. Er machte sich auf einen Hinterhalt gefasst, als er aus der Gasse heraustrat, die Brücke nunmehr zu seiner Linken. Rasch blickte er sich um – von dem Granada keine Spur.
Er rannte über die Straße und konnte im letzten Moment einem Pick-up ausweichen. Der Fahrer hupte, als Joe sich auf den gegenüberliegenden Grünstreifen rettete. Jetzt befand er sich am Rand von Clifton Down, einer Art Parklandschaft mit reichlich alten Bäumen, die ihm Deckung bieten konnten, falls Danny noch einmal einen Schuss riskieren sollte.
Es ging steil bergauf. Obwohl Joe bei Ryan schwer geschuftet hatte, war sein gewohntes Trainingsprogramm seit einigen Wochen zu kurz gekommen, und jetzt wurde er für seine mangelnde Fitness bestraft: Seine Lunge brannte, der unebene Untergrund setzte seinen Kniegelenken zu. Aber er wusste, dass er um sein Leben lief, und das hieß, jeden Schmerz auszuhalten.
Er lief quer über den grasbewachsenen Hügel in die ungefähre Richtung der Christ Church. Mehrmals warf er einen Blick über die Schulter und sah, dass er seinen Vorsprung ausbaute, aber die rasende Wut, die Entschlossenheit in Mortons Zügen waren nicht zu übersehen. Jetzt, da er schon so dicht an Joe dran war, würde er nicht einfach aufgeben.
Dann hörte Joe ihn plötzlich schreien: »Hier! Hier lang, du Idiot!«
Er sah sich um. Danny stand zur Gloucester Row gewandt, und er gestikulierte wild. Er war stinksauer, und Joe konnte sehen, warum. Der Granada war falsch abgebogen und steckte jetzt im Verkehr fest, der in Richtung Brücke fuhr.
Dann zog ein kurzes doppeltes Hupsignal seine Aufmerksamkeit auf sich. Es kam nicht von dem Granada, sondern von irgendwo links von Joe, nahe der Kirche.
Auch Danny reagierte darauf. Joe sah das triumphierende Grinsen auf seinem Gesicht, als er nickte und eine ausladende Bewegung mit dem Arm machte. Es war klar, was die Geste bedeutete: Fahr um die Ecke und schneid ihm den Weg ab.
Für Joe war es wie ein Schlag in die Magengrube. Sie hatten einen zweiten Wagen.
Es war ein alter Vauxhall Astra. Wie der Granada hatte er schon bessere Tage gesehen, aber für den Zweck war er mehr als ausreichend. Es schien nur eine Person im Wagen zu sitzen. Der Fahrer reagierte prompt auf Dannys Kommando und raste die Clifton Down Road hinunter. Er war nur noch fünfzig, sechzig Meter von Joe entfernt.
Als Joe die Canynge Road erreichte, hörte er hinter sich kreischende Reifen und wildes Gehupe – zweifellos als Reaktion auf irgendein verbotenes Manöver des Granada-Fahrers. Bald würde er die Verfolgungsjagd wieder aufnehmen können.
Zum Glück führte Joes Weg nun bergab. Selbst wenn er sich die Lunge aus dem Leib rannte, schätzte er, dass der Astra ihn in zehn bis fünfzehn Sekunden würde eingeholt haben. Er musste abtauchen.
Die Gelegenheit bot sich ihm auf halbem Weg die Straße hinunter. Zur Rechten passierte er ein Bürogebäude, dann einen schmalen Parkplatz, dessen Rückseite an ein halbes Dutzend kleine Reihenhausgärten grenzte, abgetrennt durch eine etwa anderthalb Meter hohe Backsteinmauer. Perfekt.
Ein kurzer Blick zurück: niemand zu sehen. Joe sprintete über den Parkplatz und ließ sich hinter einem roten Minibus in die Hocke fallen. Einen Augenblick später hörte er den Astra vorbeibrausen. Sobald der Wagen vorbei war, schwang Joe sich auf den hintersten Mauerabschnitt. Von hier aus konnte er über einen schmalen Durchgang hinweg auf ein Gebäude mit Flachdach springen.
Geduckt lief er zur hinteren Ecke und ließ sich auf einen weiteren Flachdachbau hinuntergleiten, der auf die nächste Straße hinausging. Als er schwer atmend innehielt, stieg ihm leiser Chlorgeruch in die Nase.
Erst als er auf den Gehsteig hinuntersprang, stellte er fest, dass er über das Schwimmbad und die Sporthalle der Clifton High School geklettert war. Als seine Sohlen auf den Asphalt klatschten, drehte sich eine Frau, die gerade ihren Wagen abschloss, zu ihm um und starrte ihn mit großen Augen an. Er richtete sich auf, schenkte ihr ein höfliches Lächeln und lief gleich weiter, obwohl seine Knöchel bei jedem Schritt protestierten.
Am unteren Ende der Clifton Park Road bog er links ab und hielt in beiden Richtungen Ausschau nach Morton oder den Autos. Immer noch nichts. Er überquerte die Straße und wandte sich nach rechts. Jetzt war er auf der Zielgeraden: College Fields.
Es war eine herrliche Wohngegend; eine breite ruhige Straße mit dem Schulsportgelände auf der einen Seite und einer Reihe stattlicher Anwesen auf der anderen. Große, klotzige Villen mit Erkerfenstern, die Fassaden verblendet mit hellem Bath-Stein. Manche waren in Wohnungen aufgeteilt worden, andere wurden weiter als Einfamilienhäuser genutzt.
Joes Vermieter war Lindsey Bevan, ein Professor der Philologie im Ruhestand. Jahrzehntelang hatte er Zimmer an Studenten vermietet, doch irgendwann hatte er den Ärger sattgehabt, und heute führte er eine Art Mittelding zwischen einem modernen B&B und einer altmodischen Privatpension. Er hatte zwei Dauermieter, Audrey und William, beide pensionierte Universitätslehrer, im gleichen Alter wie er. Alle drei waren geradezu überschwänglich nett zu Joe, selbst wenn sie sich untereinander des Öfteren wie kleine Kinder stritten.
Joe war Ende August in Bristol eingetroffen und hatte einen attraktiven Deal aushandeln können, indem er für die ersten zwei Monate im Voraus gezahlt hatte. Lindsey hatte sich überaus empfänglich gezeigt für Joes Angebot, im Gegenzug für die Benutzung der Waschmaschine und anderer Geräte kleine Reparaturen und Hausmeisterarbeiten zu übernehmen.
Es war kein Zuhause – Joe war längst nirgendwo mehr zu Hause –, aber es war die beste Unterkunft, die er seit über einem Jahr gehabt hatte.
Als er sich dem Haus näherte, war weit und breit kein Auto zu sehen bis auf einen Müllwagen, der die Einmündung zur Percival Road passierte. Der Sportplatz lag verlassen da. Er konnte nichts entdecken, was nicht hierhergehört hätte, absolut nichts Ungewöhnliches, und doch spürte er ein Kribbeln, als die Härchen in seinem Nacken sich aufrichteten.
Er verlangsamte seinen Schritt. Unmittelbar vor ihm trat eine Frau mittleren Alters aus ihrem Gartentor. Ein kleiner Hund trippelte neben ihr her. Sie registrierte Joes Anwesenheit mit missbilligendem Naserümpfen und wechselte dann die Straßenseite, um ihm aus dem Weg zu gehen. Und da entdeckte er das Mädchen.
Sie stand auf der Straße neben einem uralten Peugeot mit Schrägheck, der am Bordstein gegenüber parkte, fast auf gleicher Höhe mit Lindsey Bevans Haus. Sie war schätzungsweise um die zwanzig, klein, aber stämmig und trug eine flauschige rosa Strickjacke über einem engen Jeansrock. Blonde Stachelfrisur mit dunklem Haaransatz und jede Menge billige Klunker.
Sie wandte Joe den Rücken zu und blickte über das Autodach hinweg auf den Sportplatz. Dabei hielt sie ein Handy ans Ohr gedrückt, und Joe fiel auf, dass sie ungewöhnlich angespannt lauschte.
Joe erreichte die Grenze von Lindseys Grundstück. Das Haus wirkte ganz friedlich. Lindseys Volvo Kombi parkte in der Einfahrt neben einem nagelneuen Seat, der einer deutschen Familie gehörte – entfernte Verwandte von Audrey, die für zwei Nächte zu Besuch waren.
Bevor Joe durch das Tor trat, warf er noch einen Blick auf das Mädchen. Im gleichen Moment drehte sie sich um, entdeckte ihn und zuckte zusammen, um sich gleich wieder abzuwenden und leise, aber eindringlich ins Telefon zu sprechen. Joe konnte die Worte nicht verstehen, doch der nachdrückliche Ton und ihre angespannte Körpersprache waren wie ein Leuchtsignal: Er ist hier. Der Mann, den ihr jagt, ist hier.
4
Joe wollte es nicht glauben, aber im Grunde seines Herzens war er sich sicher: Sie hatten nicht nur seine Spur bis nach Bristol verfolgt. Sie hatten auch herausbekommen, wo er wohnte.
Wenn er richtiglag, dann war klar, dass das Mädchen sie in diesem Moment herholte, und das bedeutete, dass ihm keine Zeit blieb, seine Sachen aus dem Haus zu holen.
Er hatte sich angewöhnt, mit leichtem Gepäck zu reisen; alle seine Kleider und Toilettenartikel hatten in einem Rucksack Platz. Er besaß zwei gefälschte Ausweise; den einen hatte er immer bei sich, zusammen mit ein paar hundert Pfund in bar. Der andere Ausweis und der Rest seiner Ersparnisse waren in seiner Wohnung, ebenso wie die einzigen persönlichen Gegenstände, die ihm irgendetwas bedeuteten: Fotos seiner Töchter.
Als selbstverständliche Vorsichtsmaßnahme in einem Haus, das er mit Fremden teilte, hatte Joe dafür gesorgt, dass seine Wertgegenstände gut versteckt waren. Sie lagen in der hintersten Ecke des Dachbodens unter einer Schicht Steinwolle, die Joe selbst verlegt hatte, nachdem er Lindsey angeboten hatte, das Dach neu zu dämmen. Dort würde sie so schnell niemand finden, aber das machte die Aussicht, sie hier zurücklassen zu müssen, auch nicht erträglicher.
Er blieb auf dem Gehsteig, bis er auf gleicher Höhe mit dem Mädchen war, und überquerte dann unvermittelt die Straße. Wieder drehte sie sich um, las augenblicklich die Entschlossenheit in seiner Miene und wich einen Schritt zurück, wobei sie gegen ihr Auto stieß.
»Gib das her.« Joe packte ihre rechte Hand und entwand ihr das Telefon.
Sie schrie auf und schlug mit ihrer freien Hand nach ihm, doch er blockte den Schlag ab und hielt den Arm oben, um weitere Angriffe abzuwehren. Als er das Handy ans Ohr hielt, hörte er Mortons Stimme: »Stacey? Bist du noch da? Stace?«
Joe trennte die Verbindung und warf das Handy in hohem Bogen über den Maschendrahtzaun auf den Schulsportplatz. Das Mädchen stürzte sich auf ihn, krallte nach seinem Gesicht und kreischte: »Du blödes Arschloch!«
Er wehrte ihre Schläge ab. Zwar lag ihm nichts daran, sich zu rächen, doch ihm war bewusst, dass die Zeit knapp wurde. Er packte ihre Schultern, drehte sie um die eigene Achse und klemmte sie zwischen sich und dem Auto ein. Dann drückte er ihr die Arme an den Körper und hielt ihr mit der freien Hand den Mund zu. Sie stieß ein ersticktes, kehliges Kreischen aus.
»Sei still, Stacey, sonst bin ich gezwungen, dir wehzutun. Nick, wenn du mich verstanden hast.«
Sie sträubte und wand sich, versuchte den Mund weit genug aufzubekommen, um ihn zu beißen. Er packte sie noch fester, bis ihr Widerstand nachließ. Endlich nickte sie.
»Dein Auto nehme ich mir auch«, sagte er. Als er die Hand von ihrem Mund wegnahm, spuckte sie ihm in den Handteller.
»Das gehört meinem Freund. Er bringt mich um …«
»Dann hättest du dich nicht mit ihm einlassen sollen.« Joe drehte sie um, bis sie mit dem Gesicht zur anderen Straßenseite stand, und schleuderte sie dann vom Wagen weg. Sofort sprang sie wieder auf ihn zu und funkelte ihn wütend an.
»Danny erwischt dich schon noch. Ich hoffe, er macht Hackfleisch aus dir!«
Joe ignorierte sie, öffnete die Fahrertür und stieg ein. Zum Glück steckte der Schlüssel. Er ließ den Motor an, während er mit dem Hebel herumhantierte, um den Sitz zurückzuschieben. Da registrierte er im Außenspiegel eine Bewegung. Der Astra war in die College Fields eingebogen und näherte sich ihm von hinten.
Joe legte den ersten Gang ein und löste die Handbremse. Er hatte den Fuß auf dem Gas und wollte schon losfahren, doch da hatte er plötzlich eine bessere Idee. Er blieb einfach, wo er war.
Stacey hatte sich mitten auf der Straße aufgebaut, winkte triumphierend den Astra heran und zeigte mit dem Finger auf Joe. Da ist er.
Im Außenspiegel sah Joe den Astra näher kommen: vierzig Meter, dreißig, zwanzig. Der Fahrer drosselte das Tempo, allerdings nicht zu sehr. Joe schätzte, dass er in einer Situation wie dieser erst im allerletzten Moment auf die Bremse treten würde, nachdem er so dicht herangefahren war, dass er Joe den Weg versperrte.
Da begriff Stacey, dass Joe nicht davonfahren würde, und kam auf den Wagen zugerannt, ihre Züge von Hass verzerrt.
»Jetzt bist du tot, du Dreckschwein!«
In diesem Moment trat Joe das Gaspedal durch. Der Peugeot schoss vom Bordstein weg, als der Astra fast neben ihm angelangt war. Stacey war zwischen den beiden Autos gefangen.
Unter anderen Umständen hätte Joe sich Gedanken um ihr Wohlergehen gemacht. Doch in diesem Augenblick war es ihm vollkommen gleichgültig. Als er den Wagen diagonal in die Straßenmitte lenkte, sprang sie zurück, genau vor den Astra. Der Fahrer reagierte instinktiv und riss das Steuer nach rechts, um ihr auszuweichen. Er stand bereits voll auf der Bremse, und das jähe Manöver ließ den Wagen über die Straße schlittern. Er geriet auf den Bordstein und rammte einen steinernen Pfosten, der die Einfahrt zu Lindsey Bevans Grundstück markierte.
Der Aufprall war wie die Explosion einer Bombe. Die Schnauze des Astra wurde eingedrückt, und eine Dampffontäne entwich aus dem geplatzten Kühler. Beide Vorderreifen waren platt, und das reichte Joe. Es hieß, dass der Astra aus dem Rennen war.
Als er die Einmündung zur Cecil Road erreichte, warf er einen Blick nach links und sah den Granada auf sich zurasen. Danny Morton saß wieder auf dem Beifahrersitz und schrie auf den Fahrer ein, als er seine Beute erspähte.
Joe bog rechts ab und beschleunigte, so gut er konnte. Ein tiefes Knirschen war zu hören, als er hochschaltete, und der Motor klang nicht allzu gesund. Joe hoffte inständig, dass er ihn in den nächsten paar Minuten nicht im Stich lassen würde.
Er wusste, dass es aus taktischen Gründen wenig sinnvoll wäre, den Wagen zu behalten. An Schnelligkeit und PS-Leistung war er dem Granada hoffnungslos unterlegen. Im Augenblick glich das Terrain diesen Vorteil noch aus: kurze Wohnstraßen mit vielen Kreuzungen und Abzweigungen. Doch wenn Joe versuchte, mit dem Peugeot einen Weg aus der Stadt heraus zu finden, würden sie ihn bald eingeholt haben.
Bei der nächsten Gelegenheit bog er rechts in die College Road ab und dann links in die Guthrie Road. Das Fahrwerk knarzte bedenklich. Er spürte, dass die Reifen immer wieder durchzudrehen drohten. Mit dem Lärm und der überhöhten Geschwindigkeit zog er besorgte Blicke einer Gruppe von Frauen auf sich, die ihre Kinderwagen über den Gehsteig schoben. Er fuhr jetzt am Zoogelände entlang, was bedeutete, dass in diesen Straßen eine wesentlich höhere Fußgängerdichte herrschte – wenn da einer der Fahrer die Kontrolle verlöre, wäre die Katastrophe programmiert.
Aber er hatte seine Wahl getroffen. Jetzt musste er wohl oder übel weiterfahren.
Der Fahrer des Granada hatte zu spät gesehen, dass Joe abgebogen war. Er musste bremsen und zurücksetzen, während Joe am Zoo vorbeiraste und wieder rechts abbog. Im letzten Moment musste er selbst auf die Bremse steigen, als er einen Motorroller herannahen sah. Das Hinterrad des Rollers war kaum vorbei, da gab Joe schon wieder Gas. Der Granada kam rasch näher.
Dann steuerte Joe den Wagen nach links in die All Saints’ Road, wo er fast einen Wagen rammte, der an der Ecke in der zweiten Reihe parkte. Es gelang ihm, das Hindernis zu umkurven, doch beim Geradeauslenken brach das Heck aus, und der rechte hintere Kotflügel streifte eine Schuttmulde mit einem Geräusch wie von Fingernägeln, die über eine Schiefertafel kratzen. Zwei Bauarbeiter liefen auf die Straße und starrten ihm entgeistert nach, als er davonraste. Im Rückspiegel sah Joe den Granada hinter den beiden auftauchen. Er zuckte zusammen und machte sich auf einen fürchterlichen Zusammenstoß gefasst.
Hätte Danny Morton am Steuer gesessen, dann hätte er die Bauarbeiter vermutlich einfach über den Haufen gefahren, doch sein Fahrer war ein wenig gnädiger. Er drückte auf die Hupe, bis die beiden Männer den Weg freimachten. Der Granada musste abbremsen, was Joe ein paar kostbare Sekunden verschaffte. Jetzt musste er das Beste aus der gewonnenen Zeit machen.
Die All Saints’ Road war eine weitere ruhige Wohnstraße mit viel Grün. Sie verlief ein paar hundert Meter weit schnurgerade und schwenkte dann leicht nach rechts. Bis Joe die Kurve erreichte, hatte er es irgendwie geschafft, den altersschwachen Peugeot auf fast hundert Stundenkilometer hochzujagen – ein irrsinnig waghalsiges Tempo.
Gott sei Dank war die Straße frei. Er näherte sich rapide der Einmündung in die St. John’s Road. Hohe Bäume und ein vierstöckiges Gebäude nahmen ihm vor der T-Kreuzung die Sicht, doch er wusste, dass er ein kalkuliertes Risiko eingehen musste.
Er trat auf die Bremse, ging auf achtzig herunter, auf fünfundsechzig, dann schaltete er in den zweiten Gang zurück und wechselte wieder aufs Gas. Der Motor heulte auf, als der Wagen auf die falsche Straßenseite schlingerte. Die St. John’s Road war jetzt unmittelbar vor ihm. Ein Auto fuhr von links nach rechts vorbei, doch aus der anderen Richtung kam nichts.
Joe betete, dass es so bleiben möge, und steuerte in weitem Bogen die Einmündung an, ohne das Tempo zu drosseln. Er schlitterte mit kreischenden Reifen um die Kurve. Er war froh um den Lärm – denn der »kalkulierte« Teil des Risikos bestand darin, dass jeder, der in diesem Moment die St. John’s Road entlangkam, ihn kommen hörte und Zeit hatte auszuweichen.
Der Verkehr in Richtung Norden bestand nur aus einem einzigen Radler, einem jungen Mann mit dicker Brille und neongrünem Helm, der wenige Meter vor der Einmündung eine wacklige Bremsung hinlegte. Joe hob eine Hand – nicht um ihm zu danken, sondern um ihn zu warnen, indem er in Richtung All Saints’ Road gestikulierte: Da kommt noch einer.
Als Zugeständnis an die Straßenverkehrsordnung setzte er den rechten Blinker, blieb im zweiten Gang und bremste noch etwas ab, bevor er wieder abbog, diesmal auf den Parkplatz des Bahnhofs Clifton Down. Als er um die Kurve fuhr, warf er einen Blick in den Spiegel und sah die Schnauze des Granada aus der All Saints’ Road lugen, dahinter den verdatterten Radfahrer, der zum Glück nach wie vor unversehrt war.
Der Parkplatz war lang und schmal und fiel in Längsrichtung steil ab. Rechter Hand waren die Parkbuchten, am unteren Ende des Abhangs lag der Eingang zum Bahnhof. Joe lenkte den Peugeot auf den ersten freien Platz und sprang hinaus. Den Schlüssel ließ er stecken.
Er rannte den Berg hinunter und zog dabei scheele Blicke einer Gruppe von Studenten auf sich, die vor der Roo Bar herumlungerten. Sobald er das Pub hinter sich hatte, schwenkte er nach links und hielt sich dicht an der Begrenzungsmauer. Er befand sich jetzt auf einem weiteren Parkplatz, der für Universitätsangehörige reserviert war. Aber was noch wichtiger war: Von dem öffentlichen Parkplatz aus war er jetzt nicht mehr zu sehen.
Er war völlig außer Atem und sah sich gezwungen, sein Tempo etwas zu verlangsamen, als er den Hang hinauflief. Oben angekommen blickte er sich um und sah den Granada hinter dem Peugeot stehen. Der Typ mit der Lederjacke stand zwischen den beiden Autos, die Hände in die Hüften gestemmt. Von Danny Morton war nichts zu sehen.
Joe trat auf die Whiteladies Road hinaus. Er hoffte, in der Menge untertauchen zu können, die jetzt zur Mittagszeit die Gegend um das Clifton-Down-Einkaufszentrum bevölkerte. Es wimmelte von Menschen, doch alle machten einen großen Bogen um ihn. Als er sein Spiegelbild in einem Schaufenster erblickte, wusste er, warum.
Er schwitzte, seine Haare waren zerzaust, das verdreckte T-Shirt klebte ihm an der Haut, sein Gesicht war gerötet und mit weißen Farbspritzern gesprenkelt. Mit seinen eins achtzig, den breiten Schultern und dem muskulösen Körperbau sah er aus wie ein ungepflegter, randalierender Schlägertyp.
Zeit für Plan B, dachte er, als die ideale Lösung mit ächzenden Druckluftbremsen auf der anderen Straßenseite anhielt. Joe rannte zwischen den fahrenden Autos durch, warf noch einen Blick über die Schulter, um sich zu vergewissern, dass Morton ihn nicht eingeholt hatte, und kramte dann in der Hosentasche nach Kleingeld.
Der Bus hatte die Haltestelle gegenüber dem Bahnhof angefahren. Joe wusste nicht genau, welche Linie es war, nur dass er, wenn er in südlicher Richtung auf der Whiteladies Road fuhr, irgendwann im Zentrum landen würde. Das war für den Augenblick gut genug.
Von dem kühlen, feuchten Wetter waren die Scheiben beschlagen. Joe wählte einen Platz in der Mitte auf der Fahrerseite, wischte mit dem Zeigefinger ein Guckloch in das Kondenswasser und spähte hindurch.
Danny stand an der Einfahrt zum Uni-Parkplatz und stampfte ungeduldig mit den Füßen, während er die Straße hinauf- und hinunterblickte. In Danny Mortons Welt waren Busse ganz klar nur etwas für die Armen und Schwachen. Er würde gar nicht auf die Idee kommen, dass Joe ein so langsames und unpraktisches Fluchtfahrzeug wählen könnte.
Als der Bus sich in den Verkehr einfädelte, erhaschte Joe einen letzten Blick auf Danny, wie er auf den Bahnhof zumarschierte und sich dabei mit einer Faust wütend die Narbe an der Wange rieb. Joe seufzte gedehnt und schloss einen Moment lang die Augen. Das war verdammt knapp.
Dann griff er nach seinem Handy und wählte eine Nummer. Ryan meldete sich; seine Stimme klang gedämpft. »Also bist du okay?«
»Gerade so, aber die sind bestimmt stinksauer. Ich kann mir denken, dass sie dir vielleicht noch einen Besuch abstatten werden.«
»Ja, die Idee ist mir auch schon gekommen. Ich habe ein paar Innenbaustellen auf diese Woche vorgezogen. Und ich habe gerade meinen Cousin Dex als Aushilfe angeheuert.«
»Den Rausschmeißer?«
»Er arbeitet inzwischen als Wrestler.« Ryan lachte kurz auf. »Er ist ein miserabler Anstreicher, aber er wird auf mich aufpassen.«
»Ryan, es tut mir leid, dass ich dich in diesen Schlamassel reingezogen habe.«
»Ist ja nicht wohl nicht deine Schuld. Ich hoffe nur, du kommst da irgendwie wieder raus. Ich meine, kannst ja nicht dein ganzes Leben auf der Flucht sein, oder?«
Die Bemerkung entlockte Joe ein bitteres Lächeln. »Eigentlich hab ich gedacht, ich könnte das. Ganz schön blöd von mir.«
5
Sie erwachte mit Kopfschmerzen, wie sie sie noch nie erlebt hatte, so heftig, dass ihr der Atem stockte. Sie sehnte sich danach, wieder in Bewusstlosigkeit zu versinken, doch das schien mehr, als sie hoffen durfte.
Ihre Lider flatterten, und vielleicht hatte sie auch die Augen offen, doch kein Licht drang herein. Sie kniff sie fest zu, atmete so flach wie möglich, ihr ganzer Körper angespannt und vollkommen still, als ob die Reglosigkeit das Hämmern in ihrem Schädel lindern könnte. Es machte keinen Unterschied.
Etwas Zeit verstrich, und vielleicht nickte sie wieder ein. Es war kein Schlaf, vielmehr eine Art Loslösen von ihrer Situation. Sie trat einen Schritt zurück von dem Schmerz, flüchtete sich in einen Zustand, in dem sie ihn mit einer gewissen Objektivität beurteilen konnte.
Ein Schlag auf den Kopf vielleicht. Aber dann wäre der Schmerz doch wohl stärker eingegrenzt? Das hier war ein Gefühl, das ihren Schädel zum Bersten auszufüllen schien; es strahlte in ihr Rückgrat aus, es quoll ihr zu den Augen heraus wie Tränen oder Blut.
Blut. Sie hob eine Hand ans Gesicht, berührte zögerlich die Haut, als ob sie einer anderen Frau gehörte. Sie fühlte sich heiß und verschwollen an, stellenweise feucht und ein wenig klebrig. Aber sie glaubte nicht, dass es Blut war; es fühlte sich eher wie Schweiß und Schmutz an.
Dann vielleicht am Hinterkopf? Sie konnte den Kopf nicht heben, nicht solange ihr Schädel wie mit flüssigem Blei gefüllt war, aber sie konnte ihn drehen, sie konnte das trockene Knirschen ihrer Haare vernehmen, als sie ihn bewegte. Es fühlte sich normal an, nichts zu spüren von dem klebrigen Ziehen, das sie erwartet hätte, wenn sie in einer Blutlache läge.
Sie blutete also nicht. Sie klebte nicht fest, war nicht gefesselt. Warum also …?
Sie driftete wieder ab. Ihr Gehirn war irgendwie verstopft, wie in Öl getaucht. Alle Gedanken waren davon verpestet, kontaminiert von den schmierigen Nachbildern eines Alptraums: schmutzige Witze und schmutzige Hände; Straßenlaternen, die unter dem Dach eines Autos vorüberglitten.
Wenn sie nicht verletzt war, dann war ihr Zustand vielleicht selbst verschuldet? Mein Gott, sie hatte schon öfter einen fürchterlichen Kater gehabt, aber so schlimm war es noch nie gewesen. Sie dachte an ihre Eltern, mit ihren üblichen Warnungen vor den Folgen des exzessiven Trinkens. »Jetzt hör mal zu … wir wissen …«
Die Erinnerung riss jäh ab.
Ihr Name war weg.
Wie heiße ich?
Sie hätte lachen können, wenn sie nicht solche Angst gehabt hätte. Sie hatte ihren eigenen Namen vergessen, so wie man manchmal den Namen eines Schauspielers im Fernsehen vergisst. Ihrer Mutter ging es ständig so: Ist das nicht der, der in diesem Film mit Soundso mitgespielt hat – der Detektiv? Im wirklichen Leben ist er mit der Frau aus dieser albernen Werbung verheiratet, du weißt schon, wen ich meine. Hat lange Haare und so eine total nervige Stimme …
Okay. Fang mit Mum und Dad an. Sie waren besorgt wegen ihres übermäßigen Alkoholkonsums. Sie bemühte sich, vor ihrem inneren Auge ein Bild der beiden aufzurufen, doch alles, was sie zustande brachte, war ein typisches Paar in mittleren Jahren: graue Haare, keine besonderen Kennzeichen. Wer waren sie?
Die Lücke war so verstörend, dass sie die Frage wieder in der Teerbrühe versinken ließ. Ein weiterer verirrter Gedanke tauchte an die Oberfläche wie eine Luftblase.
Party.
Da war eine Party gewesen – nein, es war von einer Party die Rede gewesen. Sie war in einem Pub gewesen oder vielleicht in einem Café, und jemand hatte die Idee gehabt, woanders hinzugehen.
Schmutzige Witze und schmutzige Hände; Straßenlaternen, die über sie hinwegglitten, als sie auf den Sitz niedersank …
Etwas Besseres als das hier, hatte er gesagt. In einer anderen Stadt, nicht allzu weit von hier. »Komm schon, Jenny, etwas Besseres kriegst du nicht geboten.«
Jenny. Sie hieß Jenny.
Erleichterung durchflutete sie. Sie hatte einen Namen. Eine Identität.
Und vielleicht, ganz vielleicht, ließ der Schmerz in ihrem Kopf ein wenig nach. Sie gab das Grübeln auf und konzentrierte sich stattdessen darauf, besser zu atmen: langsam und tief, nicht schnell und flach. Die Minuten verstrichen, allmählich zogen die Schmerzen sich zurück wie das Meer bei Ebbe. Sobald sie etwas ruhiger war und das Gefühl hatte, wieder relativ klar im Kopf zu sein, schlug sie die Augen auf und sah …
Nichts.
Sie blinzelte, spürte das Kitzeln ihrer Wimpern. Da war nichts auf ihren Augen; nichts, was ihre Sicht behinderte. Sie lag in völliger Dunkelheit.
Sie hob einen Arm vor ihr Gesicht, nur Zentimeter vor ihren Augen entfernt, und konnte absolut nichts erkennen. Panik schnürte ihr das Herz zusammen. Sie lag vielleicht in einer Höhle oder in einem Sarg.
Nicht in einem Sarg. Bitte, alles, bloß nicht das …
Zögernd hob sie wieder den Arm, streckte ihn aus, schwenkte ihn und spürte keinen Widerstand. Der Luftzug, den sie auslöste, war kühl und ein wenig feucht. Modrig. Sie hörte kein Echo ihrer Atemgeräusche. Sie lag nicht in einem Sarg – immerhin. Wahrscheinlich in einer Art Kammer. Einer unterirdischen Kammer.
Einer Zelle.
Und ihr war warm: eine fiebrige Hitze. Sie legte sich die Hände aufs Gesicht. Ihre Wangen brannten, doch ihre Handflächen waren wesentlich kühler, fast kalt. Sie tastete ihren Hals ab, ihre Brust – und hielt erschrocken die Luft an. Ihre Hände wanderten rasch nach unten, und sie fand bestätigt, was sie bereits befürchtet hatte.
Sie war nackt. Jemand hatte sie splitternackt ausgezogen.
Behutsam schob sie die Hand zwischen ihre Beine – und löste damit eine neue Welle des Schmerzes aus, so heftig, dass sie würgen musste. Ihre Oberschenkel waren mit etwas Klebrigem verschmiert, das zu trockenen Bröseln zerfiel, als sie mit den Fingern daran rieb. Das war Blut.
Sie musste ihm vertraut haben. Aber sie war doch nicht dumm. Wie hatte sie so unvorsichtig sein können?
Komm schon, Jenny, etwas Besseres kriegst du nicht geboten.
Er hatte sie irgendwohin gebracht. Sie musste auf den Namen kommen. Er fing mit T an. Tre … Treb … Tren …
Nein. Trel … Die ersten Buchstaben waren TREL.
Konzentrier dich, verdammt noch mal. Erinnere dich an den Namen.
Das war Jennys mutige Stimme, die Stimme, die sie nach Unabhängigkeit streben ließ. Aber da war immer auch eine widerstreitende Stimme, träge und zynisch, die fragte: Warum? Was macht es schon für einen Unterschied?
Es bedeutet, dass ich klar denken kann. Und wenn ich klar denken kann, habe ich eine Chance …
Sie war ganz dicht dran. Der Name der Stadt schwebte über ihr wie ein von einem Flugzeug gezogenes Transparent, nur ein kleines bisschen zu hoch, um es lesen zu können. Aber sie erinnerte sich, dass er ihr gesagt hatte, wo es war. Von Port Isaac ein Stück die Küste entlang, nicht weit von dem Ort, wo dieser berühmte Koch wohnte.
Padstow. Der Koch wohnte in Padstow.
Und Jenny, Jenny war in …
6
Trelennan.
Joe war nicht gleich auf den Namen gekommen. Im Bus nach Weston-super-Mare war er ihm schließlich eingefallen. Später, in der Bahnhofsbuchhandlung, hatte er ihn in einem Straßenatlas nachgeschlagen und seine Reiseroute zur Nordküste Cornwalls geplant.
In Bristol Temple Meads war er vorsichtshalber doch nicht in einen Zug gestiegen. Die Gefahr war zu groß, dass Morton und seine Leute die Bahnhöfe überwachten. Stattdessen hatte er wieder einen Bus genommen. Die Fahrt nach Weston dauerte eine Stunde, was ihm reichlich Zeit gab, über sein nächstes Ziel nachzudenken.
Das Bargeld, das er bei sich trug, würde nicht lange reichen. Er brauchte jemanden, der ihm Unterschlupf gewährte. Keine Verwandten oder Freunde, das war zu gefährlich. Es musste eine Bekanntschaft sein, die in die Zeit vor seiner fatalen Begegnung mit den Mortons zurückreichte.
Ein Name kam ihm in den Sinn: Diana Bamber.
Vor seiner Abreise aus Bristol waren noch weitere Vorsichtsmaßnahmen erforderlich gewesen. In der Toilette von Marks & Spencer hatte er sich ein wenig zurechtgemacht und sich die Farbspritzer aus dem Gesicht gewaschen, und in der Herrenabteilung hatte er sich eine beigefarbene Jacke mit Reißverschluss sowie eine Schiebermütze gekauft.
Zusammen mit einem Sandwich, einer Tafel Schokolade und einer Flasche Wasser belief sich die Rechnung auf etwas über sechzig Pfund. Eine Menge Geld unter den gegebenen Umständen, doch die Kleidungsstücke stellten eine einfache, aber wirkungsvolle Verkleidung dar. Wenn er langsamer und in gebeugter Haltung ging, konnte er sich damit gut zwanzig Jahre älter machen. Von jetzt an wollte er es vermeiden, von irgendjemandem erkannt zu werden – und das schloss auch Überwachungskameras ein.
In Weston angelangt machte er noch einen letzten Anruf mit seinem Handy. Lindsey Bevan klang längst nicht so aufgeregt, wie Joe erwartet hatte. Der Astra war vor seinem Grundstück zurückgelassen worden, aber weil es keine Meldungen über Verletzte gab und ansonsten lediglich der Torpfosten beschädigt worden war, hatte die Polizei nur geringes Interesse gezeigt.
»Sie schicken jemanden vorbei, aber wann, weiß der Himmel«, erklärte Lindsey. »Hat das etwas mit den Männern zu tun, die heute schon einmal nach Ihnen gefragt haben?«
»Kann sein«, gab Joe zu. »Was haben die denn gesagt?«
»Sie haben behauptet, ein Verwandter von Ihnen sei gestorben. Angeblich haben sie schon monatelang nach Ihnen gesucht, weil sie sicherstellen wollten, dass Sie Ihre beträchtliche Erbschaft auch ausbezahlt bekommen.« Er schnaubte. »Ich war äußerst skeptisch, nicht zuletzt wegen ihres Auftretens und ihres äußeren Erscheinungsbilds. Alles ein Haufen Lügen, oder?«
»Ja.«
»Es tut mir leid. Sie haben mir ein Foto gezeigt. Mein Instinkt hat mir gesagt, dass ich leugnen sollte, Sie zu kennen, aber leider ist in diesem Augenblick Audrey vorbeigekommen.« Lindsey schnalzte missbilligend mit der Zunge. »Also wirklich, diese Frau. Kein Gespür für die Situation – nein, sie platzt gleich lauthals heraus: ›Oh, das ist doch unser Joe, nicht wahr?‹«
Joe seufzte. »Sie kann ja nichts dafür. Das hab ich mir selbst eingebrockt.« Er erklärte Lindsey, dass er sein Zimmer aufgeben müsse und dass er nicht genau wisse, wann er eine Möglichkeit finden würde, seine Kleider abzuholen. Die Wertgegenstände auf dem Dachboden erwähnte er nicht. Was Lindsey nicht wusste, konnte er auch niemandem verraten.
Joe versprach auch, dass er irgendwann für den Schaden an der Grundstücksmauer aufkommen würde. Aber Lindsey wollte nichts davon wissen.
»Ich bin mehr als ausreichend versichert. Passen Sie nur gut auf sich auf, Joe. Wenn Sie irgendetwas brauchen, wissen Sie ja, wo sie mich finden.«
Nach dem Telefonat warf Joe das Handy weg und kaufte sich ein neues für dreißig Pfund, worin ein Guthaben von zehn Pfund enthalten war. Dann machte er sich auf den Weg zum Bahnhof, wo der Preis für die Fahrkarte und die komplizierte Verbindung ihn fast gezwungen hätten, seine Pläne zu ändern – wenn er nicht gewusst hätte, dass es keine wirkliche Alternative gab.
Also blieb es bei Trelennan. Wieder vierzig Pfund weniger in seiner rapide schrumpfenden Reisekasse.
Und wenn er dort ankäme und Diana nicht finden könnte – weil sie vielleicht weggezogen oder verreist war –, dann würde ihm wohl nichts übrig bleiben, als die Nacht auf der Straße zu verbringen.
Die Fahrt dauerte über sechs Stunden, und er musste zweimal umsteigen: Von Weston ging es nach Taunton und von dort weiter nach Plymouth mit einem modernen Schnellzug, der aus dem fernen Dundee kam. Sie waren noch nicht lange durch die eintönige Herbstlandschaft gerast, als Joe einnickte und ihm das Kinn auf die Brust sank.
Als er wieder aufwachte, regnete es in Strömen, und es wurde bereits dunkel – die tief hängenden Wolken sorgten für eine vorgezogene Dämmerung. Der Schlaf hatte ihn kaum erfrischt; er war müde und benommen, und seine Haut klebte vor Schweiß.
Um Viertel vor sechs kamen sie in Plymouth an, wo er in einen Regionalzug nach Bodmin stieg. Er beneidete die heimkehrenden Pendler um die banale Gewissheit ihrer Pläne für den Abend: ein warmes Zuhause, Partner und Kinder, die sich auf sie freuten. Essen und Trinken und Abschalten vor dem Fernseher. O seliger Alltagstrott …
Fast wäre er in Selbstmitleid abgedriftet. Er wehrte es ab, indem er sich auf die Frage konzentrierte, die ihn am meisten beschäftigte und die er sich dennoch kaum zu stellen wagte:
Wie hatten sie ihn gefunden?
Irgendwo musste er einen Fehler gemacht haben. Entweder das, oder er hatte ganz, ganz großes Pech gehabt. Die dritte Möglichkeit, vor der er am liebsten die Augen verschlossen hätte, war, dass jemand ihn verraten hatte.
Niemand in Bristol kannte seine wahre Identität. Er war einfach nur Joe Carter, ein fahrender Hilfsarbeiter. Und niemand sonst, niemand aus seinem früheren Leben, wusste, wo er war.
Es gab nur einen ehemaligen Kollegen, dem er so weit vertraute, dass er mit ihm in Kontakt geblieben war: Maz Milani. Und auch mit ihm kommunizierte er meist nur via E-Mail, wobei Joe den diversen Bristoler Internetcafés den Vorzug vor dem Computer seines Vermieters gab.
Seit Joes erzwungenem Untertauchen stellte Maz die einzige Verbindung zu seinem früheren Leben dar. Vor zwei Wochen hatte Joe auf Maz’ Veranlassung seinen Bruder Peter angerufen, der traurige Nachrichten hatte. Bei ihrer Mutter Ruth, die jetzt vierundsiebzig war, war Magenkrebs diagnostiziert worden. Die Krankheit war noch in einem frühen Stadium, und die Prognose war gut, aber Pete hatte ihn gedrängt, sich bei ihr zu melden. Das wäre genau das Stärkungsmittel, das sie jetzt braucht. Wenn du es irgendwie einrichten kannst, ruf sie doch bitte an.
Also hatte er sie angerufen; aus einer Telefonzelle in Newport, einem Ort, den er willkürlich ausgewählt hatte, in sicherer Entfernung von Bristol, wie er glaubte.
Sie hatte sich riesig gefreut, von ihm zu hören, wenngleich Joe fast zehn Minuten auf sie einreden musste, bis er sie endlich davon überzeugt hatte, dass er wohlauf war. Wann immer er das Gespräch auf ihre Krankheit bringen wollte, wischte sie seine besorgten Nachfragen beiseite und bestand darauf, das Wichtigste sei doch, dass es ihm gut gehe.
Er hörte Tränen in ihrer Stimme, als sie sagte: »Ich habe noch nicht aufgegeben, weißt du.«
»Das ist gut. Pete sagt, die Therapie hat eine hohe Erfolgsquote.«
»Das meine ich nicht. Ich rede von dir und Helen und den Mädchen. Ich bete immer noch, dass ich euch eines Tages doch noch alle als Familie vereint sehen werde.«
»Ich auch, Mum«, hatte er erwidert. »Ich auch.«
Es war streng genommen keine Lüge, aber Joe hatte das Gefühl gehabt, dass es seiner Stimme an Überzeugungskraft mangelte. Seinen Traum von jemand anderem ausgesprochen zu hören unterstrich nur, wie unwahrscheinlich es war, dass er je in Erfüllung gehen würde.
An diesem Abend hatte er sich nach seiner Rückkehr nach Bristol sinnlos betrunken in dem Wissen, dass seine gesamte Familie durch seine Dummheit und Sturheit auseinandergerissen worden war, verdammt zu einem Leben in quälender Isolation voneinander. Und anstatt mit der Zeit nachzulassen, schien der Schmerz dieser Isolation mit jedem Jahr, das verging, mit jedem Monat und jeder Woche immer noch intensiver zu werden.
Und jetzt musste Joe der Tatsache ins Auge sehen, dass die Mortons ihm möglicherweise über die Menschen, die ihm am meisten bedeuteten, auf die Spur gekommen waren.
7
Von Bodmin nahm er einen Bus nach Wadebridge, wo er feststellen musste, dass es an diesem Tag keinen Anschluss mehr in Richtung Küste gab. Man nannte ihm die Nummer eines örtlichen Taxiunternehmens, und er handelte einen Preis aus: fünfzehn Pfund für die Fahrt nach Trelennan.
Fünf Minuten später traf das Taxi ein. Der Fahrer war Mitte fünfzig, hatte einen rasierten Schädel und starkes Übergewicht mit schwabbeligen Fettpolstern über untrainierten Muskeln. Seine dicken Unterarme waren mit primitiven Tätowierungen übersät, und er trug ein schweres goldenes Kruzifix um den Hals. Als er das Geld im Voraus verlangte, stritt Joe nicht lange herum.
Die ersten paar Kilometer vergingen mit freundlichem Smalltalk, bis sie auf das Thema Einwanderung zu sprechen kamen. Schon nach wenigen Sekunden wetterte der Taxifahrer geifernd über »diesen Abschaum der Menschheit, der uns ausnimmt wie Weihnachtsgänse«, und klagte über die Schwäche der Politiker, denen es an dem Willen mangele, »diese Schmarotzer einzukassieren und dahin zurückzuschicken, wo sie herkommen«.
»Und was ist, wenn sie von hier kommen?«, fragte Joe.
»Ist mir doch egal, was für Lügenmärchen die …«
»Sie würden sie trotzdem zurückschicken?« Als der Fahrer eifrig nickte, immer noch in der Annahme, einen Gleichgesinnten vor sich zu haben, fügte Joe hinzu: »Hat irgendjemand aus Ihrer Familie im Zweiten Weltkrieg gekämpft?«
»Hm? Ja, mein Großvater und sein Bruder. Wieso fragen Sie?«
»Ich find’s halt einfach nur ironisch, das ist alles. Die beiden haben gegen Völkermord und Rassismus gekämpft, und Sie sitzen hier und reden über Einwanderer genauso, wie die Nazis über die Juden geredet haben.«
Der Fahrer schwieg. Der Rest der Fahrt verlief in angespanntem, mürrischem Schweigen. Das einzige Licht kam von den Scheinwerfern des Taxis, die einzelne Regentropfen silbern aufblitzen ließen. Hohe, dichte Hecken säumten die Straße zu beiden Seiten und verdeckten die umgebende Landschaft vollständig. Es war, als führe man durch einen langen, düsteren Tunnel.
Mit röhrendem Motor erklomm der Wagen eine sanfte, aber langgezogene Steigung. Als sie den höchsten Punkt erreichten, kamen die Lichter eines Pubs in Sicht; die Straße verbreiterte sich und war ab jetzt mit einem Mittelstreifen versehen. Hier und da passierten sie Abzweigungen zu Bauernhöfen oder Landhäusern.
»Wo soll ich Sie absetzen?«, fragte der Fahrer in einem Ton, als hätte er seinen Fahrgast am liebsten die nächste Klippe hinuntergestürzt.
»Irgendwo im Zentrum.«
Der Fahrer schnaubte. »Wissen Sie was, von hier können Sie eigentlich zu Fuß gehen.« Er trat abrupt auf die Bremse und fuhr an den Straßenrand. »Sie wollten nach Trelennan. Wir sind in Trelennan.« Er streckte den linken Arm aus, wobei er Joe fast den Ellbogen ins Gesicht rammte. »Zum Zentrum geht’s da lang.«
Er war ganz offensichtlich auf Streit aus, aber Joe hatte nichts zu gewinnen und eine Menge zu verlieren, wenn er auf die Provokation einging. So stieg er einfach aus und murmelte: »Kommen Sie gut zurück.«
Der Fahrer gluckste hämisch und erwiderte ebenso unaufrichtig: »Hier wird’s Ihnen gefallen, jede Wette.«
Joe sah zu, wie der Taxifahrer in drei stotternden Zügen wendete und davonbrauste. Der Abend war kühl, es wehte ein frischer Wind, aber wenigstens war der Regen leicht genug, um erträglich zu sein. Joe war ohnehin schon durchgefroren, müde und hungrig, da machte ihm ein bisschen Nässe auch nicht mehr viel aus.
Soweit er erkennen konnte, lag die Stadt an einem steilen Berghang, der eine schmale Bucht einfasste. Die Straße, auf der er stand, schlängelte sich offenbar in Serpentinen den Berg hinunter, und Joe nahm an, dass sie ihn zur Uferpromenade führen würde. Das schien ihm der beste Ausgangspunkt für seine Suche zu sein.
Er kam an einer Wohnsiedlung mit relativ modernen Bungalows vorbei, dann wurde die Straße schmaler und verlief durch einen älteren Teil der Stadt: ein reizvolles Labyrinth aus steinernen Cottages, größtenteils gut in Schuss, geschmückt mit Blumenampeln und dekorativen Wandtafeln. Jede Menge parkende Autos, in jede verfügbare Lücke gezwängt, aber kein Verkehr auf der Straße, keine Fußgänger. Es war noch nicht einmal acht Uhr, und die Stadt schien schon zu schlafen.
Das starke Gefälle belastete Joes Sprunggelenke und Knie. Er lehnte sich unwillkürlich nach hinten, um nicht in Laufschritt zu verfallen. Die Lichter von Häusern, die er links und rechts in der Ferne aufblitzen sah, vermittelten ihm den Eindruck einer kesselförmigen Ansiedlung, verborgen vor den Blicken der Außenwelt. Direkt vor ihm verdeckten Wolken und Regen den Horizont. Irgendwo darunter lag dunkel und bedrohlich die See – weniger eine fassbare Präsenz als eine Abwesenheit von Land.
Er bog nach links in eine breitere Straße ein, die auf direkterem Weg zum Strand zu führen schien. Die Häuser hier waren größer, zumeist verputzt und weiß gestrichen mit gemauerten Schornsteinen und Schiefer- oder Ziegeldächern. Zum ersten Mal gab es Gehsteige und Randstreifen, und auch das eine oder andere Auto fuhr vorbei. Joe beobachtete sie alle ganz genau, und jedes Mal spannten sich seine Muskeln an, bereit zur Flucht.
Zehn Minuten später hatte er den Strand erreicht. Eine Küstenstraße verlief parallel zu einer breiten Promenade mit einem kleinen Hafen ungefähr in der Mitte. Joe überquerte die Straße, um einen besseren Blick auf die Häuser zu haben, die aufs Meer hinausblickten.





























