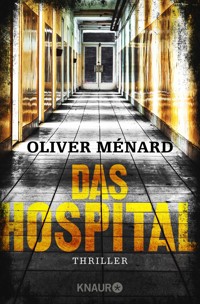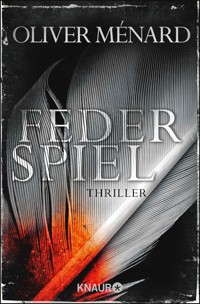
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Ein Fall für Christine Lenève
- Sprache: Deutsch
Er liebt junge Frauen. Er holt sie sich. Niemand kann ihn stoppen. Als die Fernsehmoderatorin Sarah Wagner spurlos verschwindet, nimmt eine Journalistin die Jagd nach dem unbekannten Entführer auf: Christine Lenève. Eine Frau, die kämpft, die gewinnt, die verlieren kann - aber niemals aufgibt. Die Spur führt sie zurück in die Vergangenheit - zu Ikarus, dem gefährlichsten Serienmörder der DDR, der seine Opfer brutal zurichtete. Hat der Psychopath wieder zugeschlagen? Bei ihrer Suche bewegt sich Christine auf brüchigem Eis ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 447
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Oliver Ménard
Federspiel
Thriller
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Er liebt junge Frauen. Er holt sie sich. Niemand kann ihn stoppen.
Als die Fernsehmoderatorin Sarah Wagner spurlos verschwindet, nimmt eine Journalistin die Jagd nach dem unbekannten Entführer auf: Christine Lenève. Eine Frau, die kämpft, die gewinnt, die verlieren kann – aber niemals aufgibt. Die Spur führt sie zurück in die Vergangenheit – zu Ikarus, dem gefährlichsten Serienmörder der DDR, der seine Opfer brutal zurichtete. Hat der Psychopath wieder zugeschlagen? Bei ihrer Suche bewegt sich Christine auf brüchigem Eis …
Inhaltsübersicht
Erster Teil
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
Zweiter Teil
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
Dritter Teil
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
13 Tage, 14 Stunden und 28 Minuten später
Dank
Erster Teil
Asche
1
Die Nacht roch gut. Anders als all die Nächte zuvor. Er schloss die Augen und atmete die frische Luft ein. Er spürte, wie der Sauerstoff über das Blut in seine Muskeln gelangte. Es war einsam hier oben, auf dem Dach. Eine wolkenlose, kalte Herbstnacht in Berlin.
Er lehnte sich an einen Schornstein. Die kühlen Ziegel drückten gegen seine Schulterblätter. Das Sakko war zu dünn für diese Temperaturen. Aber er musste beweglich sein.
Er schob die Gummihandschuhe bis über die Ärmel seines Jacketts. Er überprüfte ihren Sitz ganz genau, zog an der Gummihaut, streckte dann die Finger und horchte auf das feine Knacken seiner Knöchel. Er lächelte.
Fast ein halbes Jahr lang hatte er sich vorbereitet. Zweifel oder Ängste, die ihm ohnehin fremd waren, würden ihn nicht aufhalten. In seinem Kopf war es schon längst geschehen. Er musste nur noch einen Knopf drücken, damit es auch in dieser Realität wahr wurde. Gleich war der Moment gekommen. Ein Augenblick noch.
Auf der Straße rumpelte ein Auto über das Kopfsteinpflaster. Geräusche von einem Fernseher drangen aus dem Mietshaus gegenüber. Eine kleine Gruppe Abendschüler diskutierte laut. Hunde bellten, Haustüren klappten. In diesem Viertel nahm das Leben keine Auszeit.
Er konzentrierte sich auf sein Atmen. Ein. Aus. Ein. Aus.
Sein Atem durchschnitt die kalte Luft. Nebliger Rauch, der sich aus seiner Lunge wand, feine Schwaden, die zerfaserten und in der Nacht verschwanden. Die Ruhe in ihm war absolut. Sein Geist war nur auf ein Ziel gerichtet. Es musste passieren. Es war unausweichlich und folgerichtig.
Eine Windböe fegte über das Dach, zerrte an seinem Jackett und zog hastig weiter über die Dächer Berlins.
All die Fenster und die Menschen dahinter. Träge Gesichter, die im bläulichen Licht flimmernder Fernsehbilder dahindämmerten. Sie waren nur Insekten. Die da unten ergötzten sich an den täglichen Katastrophen, während die wahre Bedrohung direkt über ihren Köpfen schwebte. Fast hätte er laut gelacht.
In der Dachgeschosswohnung unter ihm brannte eine kleine Lampe. Sie ließ das Licht immer an. Auch wenn sie schlief. Selbst wenn sie weg war. Es gab ihr ein Gefühl von Sicherheit. Ein törichter Selbstbetrug.
Er blickte durch die Glasscheibe der Luke und hauchte warme Luft gegen das Fenster. Sein Atem schlug sich auf der Scheibe nieder. Mit dem Finger zeichnete er ein Herz in das kondensierende Wasser.
Er erkundete ihr Schlafzimmer durch die Dachluke. Die schwache Lichtquelle reichte ihm dafür aus. Schon oft hatte er hier oben gestanden, aber heute war es etwas Besonderes.
Die Strumpfhose hing über ihrem Stuhl. Aus einer geöffneten Schublade quoll ihre schwarze Unterwäsche. Die Stiefel lagen auf dem Boden. Er konnte ihr schweres, süßes Parfum fast riechen. Ihre Haut spüren.
»Ja«, flüsterte er, und sein Puls ging schneller.
Ihr Bett war noch so zerwühlt wie am Morgen. Er mochte ihr Schlafzimmer nicht. Er hatte hier zu viele fremde Männer beobachtet. Leptosome Muttersöhnchen, die bei ihr ein und aus gingen. Direkt vor seinen Augen. Es widerte ihn an.
Wenn sie mit einem Mann schlief, behielt sie komplett die Kontrolle. Sie bestimmte, wie weit es ging. Sie entschied, wann Schluss war.
Ihre Lustschreie waren kurz. Verhalten. Als würde sie sich dafür schämen. Wenn sie kam, warf sie ihren Kopf weit in den Nacken und hielt sich am Kopfende ihres Bettes fest, verkrallte sich in den schmalen Holzstäben, aber nie an dem Körper des Mannes, der es ihr besorgte.
Sie suchte sich grundsätzlich nur zierliche Männer mit femininen Zügen aus. Und er wusste auch, warum. Wie könnte er das nicht wissen?
Monatelang hatte er sie beobachtet, ihre Post kontrolliert, ihre Briefe gelesen, sie durch die Dachluke betrachtet. Er wusste, welches Wasser sie gern trank, welches Make-up sie benutzte, welche Musik sie hörte, wie viel Zeit verging, bevor sie einschlief. Er kannte ihre Stimmungen. Er hatte sie lachen und weinen sehen. Er wusste, wer sie wirklich war.
Er war Perfektionist. Für sie nahm er sich viel Zeit. Sie hatte nicht weniger verdient. Nicht sie. Sie würde sein Meisterstück werden.
Der Kirchturm mit seiner alten Uhr ragte zwischen den Häusern auf der anderen Straßenseite hoch in den Himmel. Das Licht einer Supermarktreklame fiel auf das Ziffernblatt: zweiundzwanzig Uhr.
Gleich.
Der schwarze Nylonstrumpf in seiner Hand hatte kein Gewicht. Er zog ihn sich über den Kopf, zerrte am unteren Ende, strich ihn am Hals glatt und verschloss darüber den Kragen seines Hemdes. Mit der Zungenspitze berührte er den feinen Stoff. Sein zweites Gesicht.
Im Hof hörte er Schritte. Endlich. Das Klappern der Absätze, der unruhige Gang – er würde ihn überall erkennen. Es waren ihre Schritte.
Er ging in die Knie und wischte über das kleine Herz auf der Dachluke. Keine Spuren.
Mit einer schnellen Bewegung zog er aus seiner schwarzen Ledertasche die Spritze hervor. Prüfend hielt er die Kanüle hoch. Die helle Flüssigkeit war selbst in der Dunkelheit noch gut zu erkennen. Er ließ den kleinen Glaskörper in der Innentasche seines Jacketts verschwinden und ertastete von außen die Konturen der Spritze.
Alles war gut.
Im Treppenhaus ging das Licht an, es reflektierte in den Fensterscheiben des gegenüberliegenden Hauses. Ihre Silhouette hob sich dunkel in den Fenstern ab. Stufe um Stufe kam sie herauf. Näher zu ihm. Der Stoff über seinem Glied spannte sich. Er ignorierte die Erektion. Die Schließgeräusche an der Tür unter ihm lösten eine warme Welle aus, die seinen ganzen Körper ergriff.
Endlich konnte er ihr Gesicht durch die Scheibe der Dachluke sehen. So nah.
»Wollen wir beginnen?«, flüsterte er.
Er klammerte sich mit einer Hand an den Mauersteinen des Schornsteins fest und zog seinen Oberkörper hastig zurück. Sie durfte ihn nicht sehen. Niemals.
Und tatsächlich. Sarah Wagner ahnte nichts von dem Mann, der über ihr, verborgen zwischen Schornsteinen und Hochantennen, auf sie wartete.
2
Die Einkaufstüten ließ Sarah im Flur fallen. Ihre Pumps schleuderte sie im Gehen von den Füßen; sie polterten gegen die Wand. Ihr Mantel segelte auf den Boden. Sarah war fertig. Komplett erledigt.
Im ovalen Spiegel im Flur prüfte sie ihr Aussehen. Ihre Augen waren glanzlos, sie sah übermüdet aus. Sarah richtete sich kurz die Haare. Der Friseur hatte meisterhaft gearbeitet. Das Dunkelblond war wunderbar gelungen, eine Spur von Weizen und Honig im Ton. Perfekt. Sie drehte den Kopf nach rechts, dann nach links und richtete noch eine lose Strähne, die ihr in die Stirn gefallen war. Sie fühlte sich zwar völlig erschöpft, aber gut sah sie immer noch aus.
Es war fünf Minuten nach zehn. Finsterste Nacht. Sarah lief ins Wohnzimmer und ließ sich auf ihr Sofa fallen. Die Fernbedienung lag zwischen zwei zerknautschten Kissen. Sie drückte eine Taste, und sofort erklang das sonore Brummen des Flatscreens an der Wand. Gleißendes Licht flutete den Raum und brannte ihr in den Augen. Sarah blinzelte und betrachtete sich selbst im Fernsehen.
Ihr Talk-Magazin war vor fünf Stunden aufgezeichnet worden. Wieder einmal war es um ein sehr bewegendes Thema gegangen. Ein kleines Promiluder hatte allen Ernstes behauptet, sie würde mit in saurer Milch aufgelösten Krokodilexkrementen verhüten. Vor viertausend Jahren hätten das schon die alten Ägypter so gemacht. Das bewegte die Menschen. Das wollten sie hören. Da war sich Sarah sicher.
»Talk nach zehn« stand in dicken, roten Buchstaben unter dem Senderlogo. Kein besonders origineller Name, aber es ging ja um den Inhalt. Natürlich wäre »Talk mit Sarah« ein deutlich besserer Titel gewesen. Aber die Produzenten weigerten sich hartnäckig, eine Personalisierung der Sendung zuzulassen. Natürlich wusste Sarah, dass schon die nächste, jüngere Frau in den Startlöchern stand, auf der Jagd nach der großen Fernsehkarriere. Das würde dann nur ein Namenschaos geben. Und so etwas wollte natürlich niemand.
Sie rappelte sich vom Sofa auf. Auf dem Fensterbrett standen eine Flasche italienisches Mineralwasser und ein benutztes Glas. Sie ging über die knarrenden Dielen, goss sich etwas ein und nahm einen tiefen Schluck. Die Mattscheibe ließ sie nicht aus den Augen.
Sarah verschränkte die Arme vor der Brust. Ihre Interviewfragen konnte sie fast lippensynchron mitsprechen. Die Welt, die sich ihr im Licht der Scheinwerfer zeigte, erschien ihr viel natürlicher als das echte Leben. Sie liebte ihren Job. Wenn sie ganz ehrlich war, hätte sie ihn auch für viel weniger Geld gemacht. Aber natürlich würde sie das keinem verraten.
Sie nickte der Sarah im Fernsehen zustimmend zu und ging in die Küche. Vor dem Kühlschrank hielt sie inne. Sarah spiegelte sich in der Scheibe des Küchenfensters. Sie drehte den Kopf, überprüfte noch einmal den Sitz ihrer Frisur und strich sich mit der flachen Hand über den Bauch. Sie hatte zugenommen, nur zwei Kilo. Aber es ärgerte sie. Der tägliche Stress und die Schokolade, die sie in sich hineingestopft hatte, ließen sich nicht verleugnen. Essen musste sie jetzt trotzdem, zumindest eine Kleinigkeit. Mit den wenigen Zutaten, die der Kühlschrank hergab, belegte sie sich ein Brot. Die vergammelte Milch im Seitenfach warf sie in ihre Designermülltonne.
Sarah biss von ihrem Brot ab und ging ins Bad. Sie drehte den Wasserhahn über der Wanne auf und hielt eine Hand prüfend unter den heißen Strahl. Dann bewegte sie den Armaturhebel bis zum Anschlag in den roten Bereich. Sie zog sich langsam aus.
Das Blinken des Anrufbeantworters im Schlafzimmer nebenan fiel ihr erst jetzt auf. Drei neue Nachrichten, zwei von ihrer Mutter. Sarah setzte sich nackt auf ihr Bett. Seitdem sie nicht mehr bei ihren Eltern in Brandenburg lebte, meldete sich ihre Mutter im Minutentakt bei ihr. Eigentlich merkwürdig. Als Sarah noch bei ihr gewohnt hatte, war das anders gewesen. Von der schweigsamen und zurückhaltenden Frau, die ihre Mutter einmal gewesen war, spürte sie heute nicht mehr viel. Was Sarah so aber besser gefiel.
Der Anrufbeantworter knisterte, als er die Nachrichten abspielte. Viel Bedeutsames hatte ihre Mutter nicht zu erzählen. Es ging wieder einmal um ihren Vater, der sich mit seinen nervenden Klienten im Ausland herumärgerte. Der typische Alltag eines Anwalts. In der zweiten Nachricht ging es um den Baum hinter dem Haus, den der Herbststurm zum Wanken gebracht hatte und der in ein Blumenbeet gekippt war. So sahen sie aus, die schrecklichen Probleme in einem Potsdamer Nobelviertel.
Die dritte Nachricht stammte von Tom. Er schwärmte in seiner vorsichtigen Art von der vergangenen Nacht mit ihr.
Das war das Schönste, was ich je erlebt habe, echt, flüsterte die Stimme aus der Maschine.
Es waren deutliche Worte über Liebe und große Gefühle; sie mussten Tom viel Überwindung gekostet haben. Sie kannten sich seit einem halben Jahr. Die erste gemeinsame Nacht hatte ihn so bewegt, dass er offenbar gleich eheähnliche Zustände herbeisehnte. Heute Abend wollte er schon wieder bei ihr vorbeikommen.
Nein. Nicht heute. Vor allem nicht heute – an diesem Tag. Sie brauchte Abstand, zu viel Nähe bekam ihr nicht. Sie drückte den Knopf des Anrufbeantworters. Die Maschine war nun wieder bereit für neue Nachrichten.
Die Badewanne war halb voll. Sarah öffnete eine braune Glasflasche und träufelte ätherisches Lavendelöl ins Wasser. Es roch holzig, strohig; ein bisschen erinnerte sie der Duft an den Geruch frischer Leinentücher. Sie atmete tief ein, reckte sich und legte sich in die Wanne. Das einlaufende Wasser plätscherte laut über ihren Körper. Dampfschwaden stiegen auf. Sie badete grundsätzlich sehr heiß. Vielleicht, weil sie immer das Gefühl hatte, schmutzig zu sein. Sarah strich sich die Haarsträhnen aus dem Gesicht und tupfte mit einem Lappen den Schweiß von der Stirn. Dann drehte sie den Hahn zu und schloss die Augen.
Weit entfernt hörte sie das Geschrei eines Kindes, das wohl nicht ins Bett wollte. Der Kühlschrank in der Küche brummte. Die Uhr über dem Schreibtisch tickte. Sarah legte den Lappen über ihr Gesicht und atmete tief ein und aus.
Morgen wartete ein anstrengender Tag auf sie. Mehrere Klamottenproben vor laufender Kamera standen an, und eigentlich war es auch an der Zeit, sich die schnippische Maskenbildnerin vorzuknöpfen. Aber das war ja erst morgen, und wahrscheinlich würde ihr wieder der Mut dazu fehlen. Sie hasste Konfrontationen und ging ihnen gern aus dem Weg, auch wenn dies in ihrer Branche fast unmöglich war.
Das Badewasser reichte Sarah bis zum Kinn. Ihre Muskeln entspannten sich. Sie spürte, wie ihre Gedanken langsamer wurden. Das dumpfe Geräusch nahm sie nur unbewusst wahr. Es war eines dieser beiläufigen Geräusche, das die Sinne nur nebensächlich ansprach. Es schien von oben zu kommen. Das war im Herbst nicht ungewöhnlich. Bei starken Winden knickten oft dünnere Äste vom Baum nebenan ab und fielen polternd aufs Dach.
Beunruhigend war nur, dass diesem Geräusch ein weiteres folgte.
Diesmal irgendwie näher.
Sarah öffnete unter dem Lappen die Augen und starrte in die Dunkelheit. Es kam aus dem Zimmer nebenan. Ein dumpfes Knarren, das normalerweise nur entstand, wenn jemand ganz langsam mit Gummisohlen über den Dielenboden ging. So langsam, wie sich nur jemand bewegte, der nicht gehört werden wollte.
Ein weiteres Knarren. Noch näher.
Sarah riss sich den Lappen vom Gesicht. Die Wohnungstür hatte sie verschlossen. Ihr Nachbar war im Urlaub, ihre Mutter zu Hause. Tom hatte keine Schlüssel. Es gab keine Erklärung. Keine, die sie beruhigen konnte.
Die Tür zum Badezimmer wurde knarrend geöffnet. Sarah spürte den kalten Lufthauch auf ihrem Gesicht. Sie wollte sich an der Kante der Badewanne hochziehen. Doch das ließ er nicht zu.
Der Mann mit der schwarzen Strumpfmaske.
Er umklammerte mit beiden Händen ihren Hals und drückte sie nach unten in die Wanne. Ihr Hinterkopf schlug gegen den Wannenrand. Sie schnappte nach Luft, zappelte hin und her und versuchte, seinen Griff zu lockern. Seine Finger steckten in hautfarbenen Gummihandschuhen, wie sie Sarah von den Putzfrauen im Sender kannte. Sie riss an den Ärmeln des Mannes, verkrallte sich im Stoff seines Sakkos und zerrte daran. Vergeblich. Seine Hände lagen starr wie eine Stahlmanschette um ihren Hals.
Er musste ein Einbrecher sein. Erst vergangene Woche war die Tür im Nachbarhaus aufgebrochen worden. Aber das Licht in ihrer Wohnung musste er doch gesehen haben. Das alles ergab keinen Sinn.
Sein Gesicht unter dem Nylonstrumpf war verzerrt, sein Mund unnatürlich weit aufgerissen. Sarah suchte seine Augen. Sie lagen wie schwarze Löcher hinter der Strumpfmaske. Er hielt sie reglos in dieser Position fest, als würde er sich diesen Moment für alle Ewigkeit einprägen wollen.
Sarah spürte den Lappen zwischen ihren Zehen. Das Wasser war lauwarm. Die Emaillewanne drückte hart gegen ihren Rücken. Sie roch den Schweiß des Mannes. Sein warmer Atem schlug ihr ins Gesicht.
Der Mann mit der Strumpfmaske lockerte seinen Griff. Ihr Herz raste. Jetzt musste sie reagieren. Sie riss den Mund auf. Sie wollte um Hilfe schreien. Das Fenster im Badezimmer war gekippt. Irgendjemand da draußen würde sie hören.
Sie schrie, doch nur rauhe, hilflose Laute kamen über ihre Lippen. Sie schlug mit den Armen wild um sich. Mit ihren Beinen suchte sie nach Halt, verkantete sich mit den Füßen am Wasserhahn, wand sich nach rechts und nach links und versuchte so, sich aus der Umklammerung zu lösen. Vergeblich.
Das Wasser schlug über den Badewannenrand und spritzte auf den Mann mit der Maske. Sarah hörte sein schweres Atmen. Der Druck an ihrem Hals nahm wieder zu. Ihr Kehlkopf knackte leise, als er ihn mit seinen Händen zusammenpresste. Sie wurde nach unten auf den Badewannenboden gedrückt. Das Wasser schlug über ihrem Kopf zusammen. Es klatschte gegen ihre Ohren, drang in ihren Mund ein, in ihre Augen. Vor ihren Pupillen tanzten schwarze Flecken auf und ab. Ihr war schwindelig. Sie klammerte sich an den Ärmeln des Mannes fest, wollte sich daran hochziehen – und erkannte im nächsten Moment, dass ihr Widerstand zwecklos war. Sie ließ den Stoff los, ließ zu, dass ihre Arme auf den Badewannenboden sanken. Um sie herum wurde es still. Der Kopf des Mannes sah durch das Wasser eigentümlich verzerrt aus – wie ein schwarzer Fleck, der näher kam und sich nach allen Seiten ausdehnte.
Dann verlor sie das Bewusstsein.
Zehn Minuten. Nicht mehr. Zehn Minuten, in denen sie die Kontrolle über ihren Körper komplett verloren hatte.
Ihre Augenlider flatterten, als sie langsam aus der Ohnmacht erwachte.
In ihrem Mund steckte ein Knebel. Er presste ihre Zunge gegen den Gaumen. Sie wollte sprechen, schreien, doch mehr als ein Gurgeln brachte sie nicht heraus.
Sie lag nackt auf ihrem Bett.
Ihre Arme und Beine waren jeweils mit ummantelten Drahtschlingen an den Bettpfosten befestigt.
Sie lag auf einer Plastikfolie.
Und vor ihr stand der Mann mit der schwarzen Strumpfmaske.
Er hielt die Arme vor seiner Brust verschränkt und betrachtete sein Werk.
Sarah war kalt. Sie zitterte. Das war nur ein Traum, den sie durchlebte. Morgen wäre alles vergessen. Sie wollte es glauben. Doch im hölzernen Spiegel vor ihrem Bett sah sie ihren nackten, weit gespreizten Körper wie in einem obszönen Bild, das der Mann mit der Strumpfmaske gemalt hatte. Das alles geschah wirklich. In ihrer Wohnung. In ihrem Leben.
Der Mann nahm eine Spritze aus seiner Sakkotasche, setzte die Nadel mit einem kurzen Stich in ihrer Armbeuge an und drückte mit seinem Daumen den weißen Stempel in den Kolben.
Sarah spürte den Druck. Sie riss an den Drahtschlingen, sie bäumte sich auf. Doch da war der Inhalt der Kanüle schon längst in ihren Blutbahnen unterwegs.
Der Mann steckte ihr vorsichtig zwei Finger in den Mund, eine fast schon zärtliche Geste. Mit einer schnellen Bewegung zog er den Knebel heraus und streichelte ihr Kinn. Es war diese eine Berührung, die Sarah erneut an den Schlingen zerren ließ. Sie musste weg von diesem Irren, sich mit aller Gewalt irgendwie befreien. Mit den Beinen um sich treten. Ihrem Angreifer das Gesicht zerkratzen.
Doch nichts geschah.
Sarahs Arme hingen schlaff in den Schlingen. Ihre Beine rührten sich nicht. Sie wollte schreien. Ihr Mund war geöffnet. Mit ihrer Zunge versuchte sie, die Luft zum Vibrieren zu bringen, Worte zu bilden, doch mehr als ein Zittern der Lippen brachte sie nicht zustande. Ihr Schrei raste ungehört durch ihren Körper.
Eine Träne lief ihr übers Gesicht, verschwand an ihrem Hals und tropfte auf die Plastikfolie. Sie war völlig hilflos.
Der Mann mit der Strumpfmaske hatte sie stumm beobachtet. Nun setzte er sich auf die Bettkante und strich mit seinen behandschuhten Fingern über ihren Hals, dort, wo ihre Träne eine feuchte Bahn hinterlassen hatte.
Er folgte dem Verlauf mit dem Zeigefinger. Sarah empfand die Berührung seiner Hand wie die Spitze eines Messers, das über ihre Haut gezogen wurde. Der Mann legte seinen Zeigefinger auf ihre Lippen.
»Pst … reg dich nicht auf. Entspann dich. Alles andere ist sowieso sinnlos«, flüsterte er.
Seine Stimme klang beruhigend, als ob er einem kleinen Kind Mut machen wollte. Er strich über ihr Haar, über ihre Stirn.
»Du bist intelligent. Du weißt doch, dass unausweichlich ist, was nun kommt. Das war es schon immer.«
Die Stimme klang auf irritierende Weise angenehm. Sie war dunkel. Wie eine gehauchte Melodie in C-Dur. Doch die langen Pausen zwischen seinen Sätzen nahm Sarah als bedrohlichen Unterton wahr.
»Als kleines Mädchen hast du geglaubt, dass nur bösen Menschen schlimme Dinge passieren. Das hast du geglaubt damals. Nicht wahr?«
Seine Stimme, seine Bewegungen. In ihnen lag etwas Vertrautes. Sie begegneten sich nicht zum ersten Mal. Sarah war sich sicher.
Der Mann mit der Strumpfmaske stand auf.
Neben dem Bett lag eine kleine schwarze Ledertasche. Er legte behutsam die Schlaufen zur Seite, um am Reißverschluss zu ziehen. Mit beiden Händen griff er hinein. Es raschelte. Eine undefinierte weiße Masse quoll aus den Fäusten des Mannes. Er näherte sich Sarah, beugte sich über sie und streckte die Finger aus. Wie Schnee rieselte etwas auf ihren nackten Körper hernieder.
Es waren Federn.
Weiße Federn.
Und endlich hatte Sarah verstanden. Ein Alptraum war zurückgekehrt. Sie wollte schreien, sie sehnte sich nach einem erlösenden, langen Schrei. Doch ihr Körper war betäubt.
Der Mann mit der Maske steckte ihr einige der langen, festen Federkiele ins Haar und bettete Sarahs Kopf vorsichtig auf ein Kissen. Er begutachtete sein Werk. Er schien zufrieden zu sein. Über Sarahs Gesicht liefen Tränen. Sie füllten ihre Augen, bis alles vor ihr verschwamm.
Das Lächeln hinter der Strumpfmaske zeugte von Mitleid.
»Du hast dich geirrt, Sarah. Auch guten Menschen können böse Dinge passieren.«
Dann begann er.
3
Sie war zweifelsohne intelligent. Nicht diese plumpe Intelligenz, die einen Menschen in die Lage versetzt, Zahlenkombinationen sinnvoll zu ergänzen oder trigonometrische Funktionen bis ins letzte Detail zu bestimmen. Ihre Intelligenz war gefährlich. Sie sah in ein fremdes Gesicht und kannte die ganze Geschichte dieses Menschen. Die Ängste. Die Hoffnungen.
Vielleicht hätte jemand anders diese Art Intelligenz als friedensstiftende Gabe verstanden. In Christine Lenèves Händen war sie jedoch eine Waffe. Ein Skalpell, das sie in ihrem journalistischen Alltag millimetergenau einzusetzen vermochte.
Vor allem unter männlichen Kollegen hatte Christine sich den Ruf einer unberechenbaren und kompromisslosen Frau erarbeitet. Ihr Gespür war untrüglich. Wo andere aufgaben, kam sie zum Ziel. Wo die anderen nichts sahen, entdeckte sie Intrigen und Verschwörungen.
Sie hatte korrupte Politiker im EU-Parlament zu Fall gebracht, Verstrickungen zwischen Pharmakonzernen und deutschen Drogenkartellen aufgedeckt und sogar einen Serienmörder gestellt. Christine lebte für diese Geschichten. Sie war berüchtigt. Sie war voller Leidenschaft. Sie war nicht gern allein.
Vielleicht kam sie deshalb hierher ins Casa Molino. Im schummrigen Licht des Restaurants fühlte sie sich wohl. Sie lief gern über das alte, knarrende Parkett und atmete den Duft von frischem Teig ein, der aus der Küche drang. Obwohl sie schon oft hier gewesen war, staunte sie jedes Mal wieder über die Glasamphoren auf den Fensterbrettern, die der italienische Hausherr mit Hunderten Korken gefüllt hatte. Eines Tages würde sie sie zählen. Das hatte sie sich vorgenommen.
Und dann war da noch Luigi. Ihr Luigi.
Eine halbe Stunde lang ließ sie sich von ihm ausgiebig beraten und diverse Weine vor ihrem Tisch auffahren und entkorken. Nach der Beratung entschied sie sich für einen zwanzig Jahre alten, sehr teuren Bordeaux Supérieur. Christine lehnte sich zurück und genoss Luigis bangen Blick, während sie den Wein mit einer gehörigen Portion Skepsis im Glas kreisen ließ. Nach dem ersten Schluck griff sie in das Wasserglas auf ihrem Tisch, um den guten Tropfen mit ein paar Eiswürfeln abzukühlen. Luigi ließ sie dabei nicht aus den Augen. Die Eisbrocken klirrten im Weinglas, während sich der kleine Italiener die Hände vor die Stirn schlug und wie eine zornige Stubenfliege vor sich hin brummte. Christine zerknackte einen Eiswürfel mit den Backenzähnen und strahlte Luigi an. Er reagierte auf das Geräusch mit einem wütenden Schnaufen, fuhr sich durch die pomadisierten Haare und verschwand in der Küche.
Es war ein gutes Spiel. Gut genug. Es verlangte Technik und Feingefühl.
Christine praktizierte dieses Spiel seit drei Jahren. Zweimal die Woche öffnete sie die Holztür des Restaurants, nahm ihren Lieblingsplatz unter dem »Dynamismus eines Radfahrers« ein, einem uneleganten Replikat von Umberto Boccioni, und freute sich im Kerzenschein auf Luigi.
Als er einmal wegen einer Nierensteinoperation für mehrere Wochen ins Krankenhaus musste, war sie besorgt gewesen. Das Casa Molino ohne Luigi passte nicht in ihre liebgewonnene Welt der Rituale und Gewohnheiten. Jeden Tag hatte sie ihr Gesicht an die Fensterscheiben des Restaurants gepresst, um nach Luigi zu spähen. Und wie groß war ihre Erleichterung gewesen, als sie ihn endlich wieder zwischen all den alten Holztischen herumgleiten sah, als hätte er sich Fettstreifen unter die Lackschuhe montiert.
Alles war wieder beim Alten. Welch ein Glück.
Christine brauchte diese Momente von Beständigkeit in ihrem Leben, doch das würde sie Luigi nie verraten. Ihr Spiel würde dadurch nur komplizierter, und genau das wollte sie vermeiden.
Christine lehnte sich auf dem Holzstuhl zurück. Ihre Stirn schmerzte noch immer. Sie strich über den verkrusteten Schnitt an ihrer Schläfe und ertastete die feine Schorfspur. Die Erinnerungen an ihren letzten Auftrag in Verona ließen sie nicht los. Sie hatte die Messerattacke eines gesuchten Frauenmörders nur knapp überlebt, und das alles bloß für ihre Zeitungs-Story. Fast wäre sie zu weit gegangen. Wieder einmal. Sie seufzte leise. Ihr Gesicht spiegelte sich in dem blank polierten Suppenlöffel, der vor ihr auf dem Tisch lag. Sie schüttelte ihr Haar. Die Strähnen verdeckten die schmale Wunde: ein roter Strich. Gut.
Am Nachbartisch saß ein Paar, beide um die vierzig. Ein dünner, hagerer Mann und seine wohlbeleibte Gespielin. Die Frau hatte die Schinkenröllchen mit überbackenem Fetakäse, das Ofenschnitzel alla Bolognese und den Thunfischsalat wie einen Altar vor sich aufgebaut. Zumindest wirkte es so auf Christine. Umso erstaunter war sie, als die Frau sämtliche Teller zur Seite schob und mit ihren lackierten Fingernägeln über den Handrücken ihres Begleiters strich. Christine beobachtete, wie sich der Hagere der Berührung hingab. Die beiden blickten sich in die Augen und küssten sich.
Christine schaute aus dem Fenster in die Dunkelheit. Der Herbst fegte die Blätter durch die Straßen Berlins und rüttelte an den Hochantennen. Wintermäntel wurden wieder aus den hintersten Ecken der Kleiderschränke herausgekramt. Fast in allen Wohnungen brannten die Lichter. Familien und Freunde kamen zusammen. Die Türen wurden von innen verschlossen.
Christine nippte an ihrem Rotwein und verschluckte sich fast, als ihr Handy klingelte. Sie erwartete keinen Anruf, nicht so spät. Sie klappte ihr Handy auf. Die Nummer auf dem Display war ihr nicht bekannt. »Ja? Wer ist da?«
»Spreche ich mit Christine Lenève? Sind Sie allein?«
Die Stimme am anderen Ende klang weit entfernt. Es rauschte in der Leitung. Christine war sich allerdings sicher, dass die Stimme einem älteren Mann gehörte. »Wer ist denn da?«
»Ich bin Ralf Breinert.« Ein Räuspern war zu hören. »Sie wissen schon, oder …?«
Christine stutzte und starrte ihr Handy an. Ralf Breinert war der Chefredakteur eines Berliner Fernsehsenders. Ein unangenehmer Typ, der ausschließlich Journalisten einstellte, die ihm zutiefst ergeben waren und die aus karrieretechnischen Gründen die Darmwindungen ihres Vorgesetzten liebkosten. Ekelhaft und doch ganz alltäglich.
»Ach, Sie sind Breinert? Können Sie das beweisen?«
Einen Moment lang herrschte Stille am anderen Ende der Leitung, dann sagte der Mann: »Die Geschichten von Ihrer unerträglichen Arroganz scheinen wohl zu stimmen. Na, vielleicht trifft dann ja auch der Rest zu. Ich würde es begrüßen.«
»Woher haben Sie meine Nummer, und was wollen Sie von mir?«
Die Stimme am anderen Ende schwieg. Was Christine nervte. Sie betrachtete die futuristischen Farbspielereien des Bildes an der Wand und wischte mit dem Zeigefinger die Reste eines Spinnennetzes weg, das am Rahmen hing.
Vom anderen Ende der Leitung kam ein Seufzen. »Wenn Sie Lust auf einen Job haben, dann kommen Sie morgen um zehn in meinen Sender. Und ich meine Punkt zehn. Nicht früher. Nicht später.«
Christine presste den Hörer an ihr Ohr, bis es ihr weh tat.
»Um zehn? Ach, das passt mir ja eigentlich gar nicht. Da frühstücke ich immer, und darauf verzichte ich wirklich ungern.«
Der Mann ließ sich Zeit.
»Um Punkt zehn. In meinem Büro. Ich habe hier etwas, das Sie interessieren wird. Glauben Sie mir.«
Bevor Christine noch etwas erwidern konnte, hatte er aufgelegt. Sie klappte ihr Handy zu.
Sie hatte viele Gerüchte und Mutmaßungen über Breinert gehört. Er war politisch ein erklärter Rechtsaußenspieler. Ein Steinbeißer. Einer, der Dokumentationen über den Zweiten Weltkrieg liebte und in seinem Hobbykeller ein Waffenarsenal hortete. Warum er ausgerechnet ihr einen Job anbot, war ihr ein Rätsel.
Am Nachbartisch knallte eine Gabel auf den Teller. Christine zuckte zusammen. Es war die Dicke. Sie japste nach Luft, hustete und zitterte am ganzen Körper. Ihr Begleiter unternahm einen verzweifelten Rettungsversuch. Er sprang vom Stuhl auf und trommelte mit beiden Händen auf dem Rücken der Frau herum. Das animierte sie aber nur zu einem noch stärkeren Hustenanfall. Ihr ganzer Körper wurde in Zuckungen versetzt. Sie klammerte sich mit den Fingern an der Tischkante fest und japste nach Luft.
Luigi huschte mit einer riesigen Serviette heran, in die die Frau einen Moment später abstrakte Muster hineinwürgte.
So wäre es wahrscheinlich ewig weitergegangen. Christine nickte dem verzweifelten Luigi zu. Sie fingerte die zusammengeschrumpften Eiswürfel aus ihrem Glas und schob sie ihrer Tischnachbarin ins Kleid. Die Frau erstarrte. Der unappetitliche Schwall aus ihrem Mund versiegte, und sie sackte erschlafft in ihrem Stuhl zusammen.
Christine war mit dem Ergebnis zufrieden. »Schocktherapie. Wirkt immer. Hat mir mein Vater beigebracht.« Sie kramte ein paar zerknüllte Scheine aus ihrer Lederjacke und entschied sich für ein großzügiges Trinkgeld. Das war sie Luigi schuldig. Zweimal trommelte sie mit ihren Fingern gegen das Weinglas, wie sie es immer tat, wenn sie sich verabschiedete. Beim Hinausgehen hörte sie Luigis Stimme.
»Zum Verrücktwerden, diese Frau, einfach nur zum Verrücktwerden.«
Christine blickte die Straße hinunter. Der Herbstwind wehte ihr ins Gesicht. Die Straßenlaternen gingen an. Sie dachte an ihre leere Wohnung und machte sich auf den Weg.
4
Stimmengewirr. Knallende Telefonhörer. Umgekippte Kaffeetassen. Flimmernde Bildschirme. Papierberge.
Der achte Stock des Fernsehsenders glich einer journalistischen Vorhölle. Christine genoss es. Das Chaos in der Redaktion erinnerte sie an ihre ersten Laufübungen als Reporterin und die Menschen, die ihr damals begegnet waren. Klischee-Typen. Zweidimensionale Abziehfiguren. Die gab es hier auch.
Eine falsche Rothaarige feilte ihre quallengrün lackierten Fingernägel, während sie bei einem Telefongespräch die neueste Haute Couture verriss. Im Hintergrund rätselte eine Redaktionspraktikantin mit beeindruckender Oberweite über die Funktionsweise des Fotokopierers; ihr gutes Verhältnis zum Chefredakteur dürfte diese Unfähigkeit ausgleichen. Direkt neben Christine saß eine Frau, die sich in eine Zeitung vertieft hatte. Sie murmelte mit gerunzelter Stirn unverständliche kantonesische Wortfetzen vor sich hin. Nur einmal blickte sie kurz auf und warf Christine einen abschätzigen Blick zu, als würde sie eine mögliche Konkurrentin nach Schwächen abtasten. Dann senkte sie wieder den Kopf.
Christine kam am Schreibtisch eines Mannes vorbei, dessen dunkler, lockiger Haarschopf nach allen Seiten abstand. Er war in die Analyse einer Nikkei-Kurve vertieft. Auf seinem Tisch stapelten sich Börsenberechnungen, aktuelle Goldkurse, Aufstellungen über die Brokerhäuser in Hongkong, Korea und Malaysia. Die Schnürsenkel des Mannes waren offen. Der Morgenkaffee hatte ein eigenwilliges Muster auf seinem Hemdsärmel hinterlassen. Seine Augenbrauen erstreckten sich wie die Tentakel eines Kraken über seine Stirn. Das längste Brauenhaar brachte es auf eine Länge von an die sechs Zentimeter. Christine hatte es einmal nachgemessen. Rekordverdächtig. So konnte nur einer aussehen.
Sie tippte dem Mann mit dem Zeigefinger auf die Schulter. Er zuckte zusammen und fuhr hoch. »Gott, was machst du denn hier? Bitte, sag nicht, dass du jetzt hier arbeitest. Bitte, bloß das nicht …«
Christine beugte sich etwas vor. »Keine Panik, Albert, es ist doch schon drei Jahre her. Bist du immer noch traumatisiert?«
Er stand langsam auf, wie in Zeitlupe. Die beeindruckende Farbpalette in seinem Gesicht reichte von einem blutleeren Schneeweiß bis zu einem rustikalen Kalkweiß.
Er zischte: »Du hast mich damals einfach sitzenlassen. Wir waren Partner. Du hast mich benutzt und einfach weggeworfen, und dann …« Albert stutzte. »Gott, wie siehst du überhaupt aus? Dieser Kratzer an deiner Stirn. Stammt der von dieser Geschichte in Verona?«
Christine schwieg.
»Bist du irre? Total durchgeknallt? Wann hörst du mit dieser Scheiße endlich auf?«
Christine studierte das Gesicht ihres früheren Partners. Sie zerlegte es in viele kleine Details, auf der Suche nach Spuren von Veränderungen, die die Jahre hinterlassen hatten. Die Denkfalte auf Alberts Stirn war tiefer geworden, typisch für einen hartnäckigen Grübler. Er trug die Haare länger. Sein Dreitagebart ließ ihn reifer erscheinen. Aber seine Augen waren noch immer dieselben. Sie mochte diesen Blick, der immer leicht verschlafen wirkte, dem jedoch selten etwas entging. Christine nickte Albert zu. »Du bist immer noch der Alte. Du hast dich nicht wirklich verändert. Und ich auch nicht. Hast du eine Freundin?«
»Natürlich. Und sie ist großartig.«
»Und sehr langweilig?«
Albert verschränkte die Arme vor der Brust. »Was willst du hier überhaupt?«
»Ich habe einen Termin bei Breinert.«
Er sackte zusammen. »Bitte nicht. Bitte, Christine, ich kann das nicht ertragen. Du hier … das geht nicht …«
Christine klopfte Albert auf die Schulter. »Nun entspann dich doch. Ich habe bloß einen Termin. Mehr nicht. Pass auf dich auf. Du hast ein kleines bisschen zugenommen.«
Sie verschwand in Richtung Donnerbalken – so hieß der lange Tisch in der Mitte der Redaktion, der Platz des Chefredakteurs.
Wenn die Geschichten stimmten, dann saß Ralf Breinert normalerweise am Kopfende und steuerte von dort die Geschicke des Senders. Er hatte ein eigenes Büro, doch das benutzte er nur selten. Sein Platz war bei seinen Leuten. Das beteuerte er immer wieder, aber niemand glaubte ihm. Es war die Angst vor Intrigen, die ihn in die Weite des Raumes trieb. Grundsätzlich war er der Letzte, der die Redaktion verließ. Der letzte Gast auf einer Party. Der Erste, über den heimlich gelästert wurde.
Und dort an dem langen Tisch, nur wenige Meter weiter, stand er nun also, die Hemdsärmel bis zum Ellbogen hochgekrempelt. Breinert war zu klein geraten. Die fünfzig hatte er überschritten. Sein akkurat geschnittener Vollbart verlieh ihm den Charme eines mexikanischen Banditen und verfinsterte seinen Gesichtsausdruck zusätzlich. Selbst bei strahlendem Sonnenschein würde sich auf seinem Gesicht immer ein Schatten finden.
Vor ihm stand eine junge Frau mit Korkenzieherlocken. Ihr Köper wirkte verkrampft, die Augen hatte sie weit aufgerissen. Ralf Breinert schwenkte mehrere Blätter über seinem Kopf hin und her und schlug mit der Faust auf den Tisch. »Liebe Frau Metzold, wissen Sie, was ich hier in meinen Händen halte? Wollen Sie es wissen? Oder sind Ihre eintausendzweihundertundvierzig Gramm Hirn überfordert? Antworten Sie. Oder warten Sie, nein … ich will es Ihnen sagen.«
Breinerts Stimme war außergewöhnlich rauh, fast heiser. Am Ende einer Frage kippte sie in eine höhere Tonlage, was ihn noch bedrohlicher wirken ließ. Christine sah trotz der Entfernung, wie der Gescholtenen die Hände zitterten. In der Redaktion war es still. Die Frau starrte auf den kleinen Mann hinab, der wütend vor ihr auf und ab tanzte.
»Gegendarstellungen, Frau Metzold. Ein ganzer Stapel entzückender Gegendarstellungen. Ihre Story um den Aktendiebstahl im Außenministerium ist ein ausgemachtes Märchen. Eine Geschichte, die in Ihrem weiblichen Hohlkopf entstanden ist und meinen Sender mit Mist besudelt.«
»Das ist einfach unfair«, sagte sie leise. »Ich habe recherchiert …«
»Was haben Sie recherchiert? Ein unbekannter Mann, der einen Dokumentensack mit geheimen Plänen für neue Anti-Terror-Gesetze direkt unter der Nase von über hundertfünfzig Leuten hinausbefördert? Ein mysteriöser Fremder, der Ihrer kindlichen Phantasie entsprungen ist. Aber ich will Ihnen auf die Sprünge helfen …« Breinert warf die Blätter auf den Schreibtisch und stemmte seine Hände in die Hüften. Die Barthaare unter seiner Nase vibrierten. »Wissen Sie, was die Sicherheitsprüfungen nach Ihrem kleinen Filmchen ergeben haben?«
»Ich weiß es wirklich nicht, aber …« Metzold drehte sich zu ihren Kollegen um, als würde sie sich von ihnen eine Antwort auf die Frage des Chefredakteurs erhoffen. Es war eine hilflose Geste. Christine sah die geröteten Gesichtszüge der Frau. Sie stand kurz vor einem Weinkrampf. Ralf Breinert schien das nicht zu stören.
»Ich verrate es Ihnen«, brüllte er in die Redaktion. »Der Wäschejunge ist an einem Dienstag ins Ministerium gekommen und hat getan, was er an jedem verdammten Dienstag zweiundfünfzigmal im Jahr macht: Er sammelt die Drecklappen der Putzfrauen ein, entsorgt sie in seinem Lieferwagen und verschwindet. Das ist alles. Keine Agentenspielchen. Keine Weltverschwörungen. Ein bepisster Wäschejunge, Frau Metzold. Und das alles, nachdem sich das Außenministerium eingeschaltet hat. Ich stehe da wie ein Vollidiot. Sie haben mich und meinen Sender lächerlich gemacht!«
»Aber es war ein Tipp von Prohl. Sie haben mir doch selbst gesagt, dass man Prohl vertrauen kann.«
Breinert stampfte zweimal mit dem Fuß auf und verdrehte die Augen. Er beugte sich vor. »Prohl ist Alkoholiker. Ein Scheißtyp, der für fünfzig Euro seine Mutter verkauft. Frau Metzold, Sie haben auf das falsche Pferd gesetzt. Ihre Schindmähre hat das Ziel nicht erreicht. Sie sind raus. Verschwinden Sie hier, räumen Sie Ihr Zeug zusammen. Und achten Sie darauf, dass sich unsere Wege nicht noch einmal kreuzen.«
Wie ein Kugelblitz verschwand Breinert in seinem Büro. Im Gehen nickte er Christine zu. Die Tür ließ er offen stehen. Bevor sie eintrat, schaute sie noch einmal in die verstummte Redaktion. Es war ein unwirkliches Bild. Die Journalisten wirkten, als wären sie mitten in der Bewegung eingefroren. Nur das Gluckern der Heizung durchschnitt die Stille des Raumes. Alle Augen waren auf Christine gerichtet. Mit einem Gefühl der Beschämung zog sie die Tür hinter sich zu.
Breinert tigerte durch sein Büro. Er schlug im Vorbeigehen mit der flachen Hand auf den Zweig eines Ficusbaumes. »Tja, wenn man seinen Laden nicht sauber hält, wachsen sich kleine Problemchen zu großen Katastrophen aus.«
Er warf sich in einen braunen Ledersessel und zupfte an seiner Krawatte herum. Sein Doppelkinn schaukelte mit unheimlicher Eigendynamik hin und her. Breinert wirkte nervös. Er griff in eine kleine Mahagonikiste auf seinem Tisch, angelte mit zwei Fingern eine Zigarre heraus und köpfte sie mit einer Stahlklinge. Es roch nach Butangas, als er die Spitze mit seinem Brenner röstete. Dunkle Rauchringe stiegen aus seinem Mund auf.
Christine konnte Breinerts Selbstzufriedenheit und seine Obermacker-Attitüde kaum ertragen. Am liebsten hätte sie ihn an seinem Schlips über den Tisch gezogen. »Sie haben sich da draußen aufgeführt wie der Diktator einer Bananenrepublik. Ein vertrauliches Gespräch mit Ihrer Reporterin kam wohl nicht in Frage, wie?«
»Schon. Aber dann hätten die anderen ja nichts mitgekriegt. Ich bin der Chefredakteur. Wo bleibt denn da der Spaß, wenn man seinen Job heimlich macht? Und wissen Sie was? Ich halte Demokratien ohnehin für überschätzt.«
Er nahm einen langen Zug an seiner Zigarre und sondierte Christines Gesicht. Er wollte sie provozieren. Christine durchschaute ihn. Es war ein plumper Versuch, ausgeführt ohne jegliche Raffinesse. Sie blieb gelassen.
Breinert seufzte, als würde er sich geschlagen geben. Mit ernster Stimme sagte er: »Frau Lenève, wir sind Journalisten. Wir sind der Wahrheit verpflichtet. Und das da draußen«, mit seiner Zigarre fuchtelte er in Richtung Redaktion, »das konnte ich einfach nicht hinnehmen. Auf gar keinen Fall.«
Breinerts Füße steckten in handgenähten, klobigen Schuhen. Nach jedem Satz trat er einmal mit dem Absatz auf dem Boden auf, als wollte er seinen Worten besonderen Nachdruck verleihen. Das braune Leder ließ seine Füße seltsam deformiert wirken. Was Christine schon in der Redaktion aufgefallen war. »Sagen Sie mal, wie lange tragen Sie schon diese Schuhe aus Italien, die für ihre versteckten Einlagen berühmt sind? Diese Dinger kosten doch ein Vermögen, oder? Der Importweg soll auch umständlich sein. Ist das nicht etwas übertrieben? So viel Mühe für nur drei Zentimeter Zuwachs? Ich meine ja nur. Für einen Mann, der vorgibt, jeden Tag die Wahrheit zu suchen, investieren Sie jedenfalls viel Zeit und Geld in Vertuschungsmanöver.«
Breinert betrachtete seine Schuhe, als würde er sie zum ersten Mal sehen. Er nestelte wieder an seinem Schlips herum, zog zweimal an der Zigarre, und dann hatte er seine Fassung wiedergefunden. Er musterte Christine. »Ja, Sie sind genau so, wie man Sie beschrieben hat. Genau so.«
Er schwenkte seine Zigarre wie einen Taktstock durch die Luft auf der Suche nach den passenden Worten und schnalzte dann mit der Zunge. »Sie sehen ein bisschen aus wie dieses französische Mädchen aus dem Film, diese … wie hieß sie doch?«
Christine verdrehte die Augen. »Amélie. Nicht sehr originell. Das habe ich jetzt schon oft genug gehört.«
Breinert lachte mit seiner rauhen, wie von Teer gepolsterten Stimme. »Ja, wie die dunkle Version von Amélie. Eine sehr dunkle Version. Aber das kann ja auch seinen Reiz haben, glauben Sie mir. Ich habe einiges über Sie gelesen. Mutter Deutsche, Vater Franzose. Studium der Journalistik. Einsätze in Äthiopien, Mexiko, Moskau, Italien und, und, und … Sie arbeiten gern allein, und Sie sind schnell. Verdammt schnell. Ich habe großen Respekt vor Ihnen. Diese Geschichte in Verona hat mich wirklich umgehauen. Es passiert selten, dass eine Journalistin einen Serienmörder stellt. Wie viele Frauen hat der Typ eigentlich erledigt?«
Christine blickte aus dem Fenster. Die Erinnerung an die nackten, mit Klebeband gefesselten Leichen der jungen Frauen begleitete sie noch immer. Vor allem nachts ließen sich die Bilder schwer verdrängen. Ihre Finger zitterten. Sie steckte die Hände in die Taschen und ballte sie zu Fäusten. Sie wollte vor Ralf Breinert keine Schwäche zeigen.
»Vier. Es waren vier Frauen. Bis jetzt. Die Polizei in Verona hat die Suche noch immer nicht abgeschlossen«, sagte sie leise.
Breinert tippte sich mit dem Ende der Zigarre gegen die Stirn. »Ich krieg das hier oben nicht rein. Sie haben den Lockvogel für den Irren gespielt. Sie sind dabei fast draufgegangen. Warum haben Sie das gemacht? Keiner meiner Reporter würde das wagen. Die sitzen sich lieber den Hintern auf ihren Designerstühlen breit. Und ich kapier nicht, wie Sie so schnell auf den Täter gekommen sind. Ich komm da einfach nicht drauf.«
Christine holte tief Luft. Sie wollte das Thema so schnell wie möglich beenden. »Es war offensichtlich. So offensichtlich, dass sich niemand mit einer derart billigen Wahrheit begnügen wollte.« Sie ging auf Breinerts Schreibtisch zu. »Und es ist offensichtlich, dass Sie mich für etwas brauchen, das Sie selbst nicht lösen können. Etwas, das Ihnen schreckliches Kopfzerbrechen bereitet. Habe ich recht?«
Breinert nickte. Er kniff die Lippen zusammen. Wortlos legte er ein Foto auf den Tisch. Es zeigte eine junge Frau mit dem typischen mediengerechten Lächeln. Sie hatte langes, dunkelblondes Haar, blaue Augen und für Christines Geschmack ein viel zu tiefes Dekolleté.
»Sarah Wagner. Unsere Moderatorin.« Breinert legte die Zigarre in den Aschenbecher, erhob sich und stellte sich vor das Fenster, das einen weiten Blick auf das morgendliche Berlin bot. Die Hände faltete er hinter dem Rücken. Seine erklärte Lieblingspose, da war sich Christine sicher.
»Sarah … Frau Wagner – sie ist seit drei Tagen verschwunden. Weg. Es gibt keine Spur. Zwei Männer von der Schutzpolizei haben gestern ihre Wohnung durchsucht. Nichts Auffälliges. Keine Anzeichen eines Verbrechens. Die haben nicht mal die Kripo geschickt. Sie wollen erst mal bis zum Ende der Woche abwarten. Ich kann das nicht akzeptieren. Da ist was passiert.« Er tippte mit dem Zeigefinger auf seine Nase. »So was riech ich.«
Christine nahm das Foto in die Hand. Sarah Wagners Gesicht wirkte glatt und maskenhaft. Ihre Wimpern waren unnatürlich lang. Die Hände hatte sie gefaltet wie auf einem Heiligenbildchen. Die Geste sollte wohl unschuldig und mädchenhaft wirken, doch für Christine war sie nur affektiert und peinlich. Nichts an Sarah Wagner erschien ihr echt.
»Ich vermute schmerzhafte Chemo-Peelings im Gesicht. Falsche Wimpern, unechte Fingernägel. Diese Frau ist komplett karrieregeil. So ein Mensch verschwindet nicht einfach unangemeldet und riskiert seinen Job, nachdem er alles dafür getan hat.« Sie legte das Foto wieder zurück auf den Tisch. »Ich verstehe. Ich soll Sarah Wagner für Sie finden. Geht es darum?«
Breinert starrte noch immer aus dem Fenster. Er nickte. Christine gab sich mit dieser Antwort zufrieden.
»Ich bin keine Ermittlerin. Das dürfte Ihnen klar sein. Ich bin Journalistin. Fragen Sie doch in einer Detektei, ob …«
Breinert drehte sich um und warf seine Hände in die Luft.
»Christine, darum geht es hier doch. Verstehen Sie mich? Ich gehe davon aus, dass wir es mit einem Verbrechen zu tun haben. Sarah würde niemals einfach so verschwinden. Und wenn sie einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist, wer würde bitte aus dieser Redaktion in der Lage sein, über eine Kollegin zu berichten?«
Christine verschränkte die Arme vor der Brust. Auf ihrer privaten Skala der unbeliebtesten Menschen nahm Breinert nun einen der ersten Plätze ein. »Sie wollen das mögliche Verbrechen an Ihrer Moderatorin vermarkten? Habe ich das richtig verstanden?«
Breinert schwieg.
Christine schwieg ebenfalls.
Von draußen war in weiter Ferne das Hupen eines Autos zu hören. Im Raum nebenan ratterte ein Fotokopierer. Auf dem Gang klingelte ein Handy.
Breinert atmete mit einem Seufzer aus. »Ich werde Sie exorbitant gut bezahlen. Und sehen Sie die Sache doch einmal unter journalistischen Gesichtspunkten: Nur ein Außenstehender kann objektiv über so einen Fall berichten. Das klingt doch logisch, oder?«
Breinert suchte den Blickkontakt zu Christine. Seine Hände hingen schlaff an seinem Körper herab, dann steckte er sie mit gespielter Entschlossenheit in die Hosentaschen. Er war unsicher, das spürte Christine genau.
»Ich habe die Redaktion belogen. Die glauben alle, dass Sarah krankgeschrieben ist. Auch wenn Sie es mir nicht abnehmen: Ich lüge nur ungern. Sie halten mich für einen Unsympathen, das merke ich schon. Das brauchen Sie mir nicht ins Gesicht zu sagen. Und ändern kann ich es sowieso nicht. Aber Sie könnten darüber hinwegsehen und einfach diesen Job machen. Sind Sie so professionell?«
Christine griff in ihre Jackentasche, holte ihr Zippo heraus und spielte daran herum. Immer wieder ließ sie den Deckel auf- und zuklappen. Das metallische Geräusch durchschnitt die Stille im Büro. So ging es eine ganze Weile, und dabei ließ Christine die Fakten vor ihrem inneren Auge wie auf einer achtspurigen Autobahn bei vollem Tempo vorbeirasen.
Sie wog ab. Sie prüfte. Sarah Wagner würde niemals freiwillig auf einen Einsatz vor der Kamera verzichten oder ihren Job riskieren. Nein. Das passte nicht. Ihr musste etwas zugestoßen sein. Kein Zweifel. Diese Geschichte hier war gut. Vielleicht sogar sehr gut. Jedenfalls viel zu gut, um darauf zu verzichten. Ralf Breinert war nur ein alberner Giftzwerg auf hohen Hacken. Ihm musste sie nichts beweisen. Aber ihren Jagdtrieb konnte sie nicht austricksen.
»Ich mache es. Ich mache es, weil mich die Story interessiert.«
Breinert zog die Augenbrauen hoch. Er wirkte überrascht.
»Aber damit eines klar ist: Das wird teuer für Sie, siebenhundert am Tag; und es ist nur die Recherche, die Sie von mir bekommen. Ich behalte die Rechte für alle Print-Publikationen.«
Breinert streckte Christine die Hand hin. »Dann haben wir einen Deal.«
Sie betrachtete Breinerts fordernde Hand, die wie eine Haifischflosse im Raum schwebte. Sie steckte demonstrativ ihre geballten Hände in die Taschen und lächelte ihn an. »Und wieder einmal haben Sie recht behalten. Das ist Ihnen doch wichtig, oder? Ich halte Sie tatsächlich für einen unmoralischen Unsympathen.«
Breinert zog die ausgestreckte Hand zurück.
Christine genoss diesen Moment. Mit Sicherheit suchte Breinert nach einer passenden Antwort, um seine spürbare Kränkung zu überspielen, vielleicht ein wenig mit Ironie garniert, aber durchaus auch ernsthaft. Es musste schon eine gute Retourkutsche werden, schließlich war er ja der Chefredakteur. Christine erwartete nicht weniger. Doch ehe Breinert auch nur ein Wort verlauten ließ, hatte sie die Lust an diesem Gespräch verloren.
Sie verließ das Büro, lief am Donnerbalken vorbei und zwinkerte Albert noch einmal zu. Vor dem Fahrstuhl stand Frau Metzold. Tränen liefen ihr übers Gesicht. In den Händen hielt sie eine Pappkiste, in der wohl die Reste ihrer Fernsehkarriere ruhten. Schweigend fuhr Christine mit ihr die acht Stockwerke hinunter.
5
Ihr Atem ging ruhig, ihre Schritte waren kurz. Die Arme bewegte sie rhythmisch wie eine Aufziehpuppe. Sie lief schnell. Es war ihre dritte Runde im Volkspark Friedrichshain. Jeden zweiten Abend war Christine hier. Sie konzentrierte sich immer auf die nächsten drei Meter vor ihr. Runde für Runde. Aus den Augenwinkeln nahm sie ihre Umwelt dennoch mit ungeheurer Präzision wahr – eine über viele Jahre erlernte Fähigkeit.
Sie überholte gerade eine übergewichtige Joggerin, die einen scheppernden Schlüsselbund in ihrer Hosentasche spazieren führte. Das metallene Geräusch klang wie eine nervtötende Kindermelodie in Christines Ohren. Sie hasste dieses Scheppern. Es störte ihre Konzentration. Im Vorbeiziehen warf sie der Läuferin einen finsteren Blick zu und war überrascht, als sie in ihr die Frau erkannte, die sie am gestrigen Abend mit ihrem außergewöhnlichen Brechreiz so gut unterhalten hatte.
Die Dicke keuchte wie eine Lokomotive, die sich einen Hang hochkämpft. Ihre Haut quoll aus den engen Schuhen heraus.
Die Bemühungen der Frau stimmten Christine etwas milder. Sie warf ihr ein aufmunterndes Lächeln zu, das die Frau mit einem erschöpften Kopfnicken erwiderte.
Christine erhöhte die Geschwindigkeit. Nach einigen Metern wurde das Scheppern leiser, und sie konnte endlich wieder ihren Gedanken nachhängen, die um Sarah Wagner kreisten.
Wenn ein Mensch verschwindet, dann zählt jede Sekunde. Sofort nach dem Gespräch mit Breinert hatte Christine das Internet durchforstet. Sie fand Fotos von Sarah Wagner auf dem roten Teppich, Mitschnitte aus Sendungen, Foren, in denen alte Männer lebhaft über Sarahs Oberweite philosophierten. Und jede Menge Interviews, deren Inhalt beliebiger nicht sein konnte.
Wirkliche Fakten waren rar. Aber Christine entdeckte dann doch welche. Seit drei Jahren arbeitete Sarah in Breinerts Sender. Sie moderierte eine Lifestyle-Sendung: Modetrends, Promi-News und Beauty-Tipps. Ihr Moderationsstil war holprig. Sie wirkte künstlich und bemüht. Sarah war offenbar ein Mensch, der die Kamera brauchte, der nur diesen einen Lebenssinn hatte. Sie stammte aus einer einflussreichen Anwaltsfamilie. Aufgewachsen war sie in Wiesbaden, dann nach Brandenburg umgezogen. Ihr Vater unterhielt eine Kanzlei in Berlin. Geld spielte in dieser Familie offensichtlich keine Rolle, gute Beziehungen dürften selbstverständlich sein. Das erklärte jedenfalls, wie Sarah trotz ihres dürftigen Talents den Sprung auf den Fernsehschirm geschafft hatte.
Sie war sechsunddreißig Jahre alt, eins neunundsiebzig groß, fuhr einen Sportwagen der Marke BMW und hielt sich grundsätzlich nur in Restaurants auf, die eine erhöhte Frequentierung durch Prominente nachweisen konnten. Über einen möglichen Freund sagte das Internet nichts. Auf Fotos von öffentlichen Terminen fand sich nur ein Friseur an ihrer Seite, der um mediale Aufmerksamkeit buhlte. Nichts Außergewöhnliches. Berlin war für einige seiner von Minderwertigkeitskomplexen geplagten Coiffeure bekannt.
Das waren Christines Fakten. Für einen recherchetechnischen Erfolg viel zu wenig. Die entscheidende Frage blieb: Was war Sarah wirklich zugestoßen?
Christine lief noch schneller. Fünf Runden hatte sie bereits geschafft. Sie setzte zu einem Sprint an und raste an einer Dreiergruppe schlapper Fünfzigjähriger vorbei, die mit ihren Nordic-Walking-Stöcken die Laufbahn komplett in Beschlag genommen hatten. Ihre Baseballkappen wackelten synchron im Abendwind, die kleinen Wasserflaschen an ihren Gürteln schaukelten dazu im Takt. Christine schnappte ein paar Wortfetzen auf. Die Männer unterhielten sich in schwäbischem Dialekt. Als sich eine kleine Öffnung zwischen ihnen auftat, hechtete sie hindurch. Der Protest der Schwaben-Gang hallte in ihren Ohren nach.
»Da werd ih kreiznarred. So a daube Hährschell.«
Christine verstand kein Wort. Vorsichtshalber wollte sie ihnen den ausgestreckten Mittelfinger zeigen, da fiel ihr abseits der Strecke ein Mann auf. Er hielt sich im Schutz eines Baumes auf und bewegte den Kopf in ihre Richtung. Merkwürdig. Sein Gesicht verbarg er unter einer dunkelgrauen Kapuze.
Christine schlug sofort einen Seitenweg ein, parallel zur Laufbahn. Sie sprang über feuchte Erde, passierte eine Statue, die einen martialisch wirkenden Mann mit einem Schwert darstellte, und warf einen Blick über die Schulter. Sie war sich absolut sicher: Der Unbekannte hatte seine Position verändert und bewegte nun, da sie im Dickicht verschwunden war, aufgeregt den Kopf hin und her.
»Alles klar«, flüsterte Christine. Da prallte sie auf einen Widerstand.
Es war ein junger Typ mit eng anliegender Jogginghose, wie sie bevorzugt Männer trugen, die sich den Anstrich des Profiläufers geben wollten. Christine lächelte und fasste den Mann vertraulich am Arm. »Tut mir leid. Dir ist nichts passiert, oder?«
Der überraschte Jogger warf einen Blick auf Christine und drückte seine Brust heraus.
»Nein, natürlich nicht«, sagte er mit fast übertriebener Freundlichkeit. »Laufen wir eine Runde?«
Natürlich lief Christine mit ihm. Perfekt.
Meter für Meter bearbeitete der Typ ihre Gehörgänge, prahlte mit seinem Job in einer PR-Agentur und feierte seinen letzten Urlaub auf Kuba als bestmögliche Entspannung. Christine heuchelte Interesse, während sie in Wirklichkeit mit höchster Konzentration den Park durchforstete.
Sie entdeckte den Kapuzenmann während ihrer sechsten Runde neben dem Ausgang. Er stand hinter einem Zaun und schaute mit gesenktem Kopf zur Laufbahn. Als er Christine mit ihrem Joggingpartner sah, wandte er sich ab und verschwand zwischen den Autos auf der Straße. Christine hatte nichts anderes erwartet.
Bei ihrer siebten Runde fehlte jede Spur von ihm. Sie grübelte während des Laufens über den Mann nach. Da war etwas Auffälliges an ihm gewesen. Etwas Bekanntes. Eine Runde später war sie zu einer Lösung gekommen. Wieder einmal war es offensichtlich. Als ob sie so leicht auszuspionieren wäre. Und einen Aufpasser brauchte sie schon gar nicht.
Sie verabschiedete sich von ihrem Laufpartner, doch der sagte nichts. Er starrte Christine in die Augen und nestelte am Bund seiner Jogginghose herum.
Christine atmete hörbar aus. Das tat sie normalerweise nur, wenn ihr Briefkasten bis oben mit Werbung vollgepfropft war und sie den Papierkram wütend in den Mülleimer stopfte. Andere Situation, gleiche Reaktion.
»Hör zu, du bist wirklich ein netter Typ. Gleich wirst du mich fragen, ob ich mit dir essen gehe. Ich habe dich hier schon vor zwei Tagen gesehen. Nur, da hast du einen Kinderwagen vor dir hergeschoben. Stell mir die Frage also besser nicht. Behalt sie für dich. Denk doch einfach mal eine Sekunde an deine Würde, oder zumindest an die Mutter deines Kindes.«
Der Typ starrte sie verdutzt an. Christine lief zum Ausgang des Parks. Von dort waren es noch gut sechshundert Meter bis zu ihrer Wohnung. Sie blieb wachsam.
In den kleinen Cafés im Bötzowviertel gingen die Lampen an. Klappernd wurden Stühle vor den Restaurants nach drinnen geräumt. Hier und da hörte Christine die raschelnden Einkaufstüten, die die Heimkehrenden durch das Viertel schleppten.
Sie winkte im Vorbeigehen Luigi zu, der gerade eine riesige Pizza über seinem Kopf balancierte. Der kleine Italiener verdrehte die Augen und machte, dass er aus dem einsehbaren Bereich des Fensters verschwand.
Christine stapfte langsam durch die Straßen und atmete die frische Luft ein. Das Herbstlaub raschelte unter ihren Sportschuhen. Sie zählte die Schritte auf dem Nachhauseweg. Das tat sie immer. Es war eine Angewohnheit, ein Ritual. Ein Psychologe hätte ihr vermutlich eine krankhafte Zwangsneurose attestiert, daran hatte Christine keinen Zweifel. Für sie aber war es eine von vielen kleinen Inseln der Sicherheit, die sie sich in ihrer unbeständigen Welt geschaffen hatte. Sie brauchte solche Momente. Sie waren verlässlich.