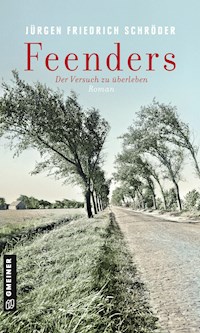
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Romane im GMEINER-Verlag
- Sprache: Deutsch
Deutschland 1935. „Die Gestapo hat Theo abgeholt!“ Mit diesen Worten endet das beschauliche Leben auf dem Bauernhof der Familie Feenders. Theo, ein Verwandter, bezahlt einige Witze über Parteigrößen mit sechs Wochen Lagerhaft und kehrt als gebrochener Mann zurück. Die Familie Feenders ist schockiert von der Gewalt der NS-Herrschaft, der sich in Deutschland niemand entziehen kann. Schließlich stürzen die Nazis die Welt in den Krieg und der Alltag der Familie, ihrer Freunde und Verwandten wird immer mehr zum Kampf ums Überleben zwischen innerer Ablehnung und Mitschuld.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 452
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jürgen Friedrich Schröder
Feenders
Der Versuch zu überleben
Impressum
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2021 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Daniel Abt
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © ullstein bild – mauritius
ISBN 978-3-8392-6738-7
Vorbemerkung
Die Handlung des Romans ist fiktiv,
orientiert sich jedoch teilweise am Schicksal
und den Erlebnissen verschiedener Menschen,
die zu dieser Zeit gelebt haben, ohne deren Namen,
Ansichten und tatsächlichen Lebensverlauf wiederzugeben.
*
Die ebenso fiktive Ortschaft Rheidersum liegt
nördlich der Stadt Leer in Ostfriesland.
Die Personen
Cornelius Holtkamp: Sohn eines armen Landbauern aus Heisfelde/Burfehn
Fräulein Marlene Degenhardt: später Buchhalterin
*
Familie Feenders
Elisabeth, genannt Lilli: Krankenschwester
Georg: Gymnasiast, später Flakhelfer und Marinesoldat
Eltern Ilse und Helfried
Großeltern Melitta und Gottfried
*
Familie Strodthoff
Margarethe, genannt Marga, geb. Feenders: Schwester von Helfried Feenders
Theodor Strodthoff: Saatguthändler
Heinrich Strodthoff: Major und Stabsingenieur der Luftwaffe, Bruder von Theodor Strodthoff
*
Otto Tammen: Kriminalrat a. D.
*
Familie Dijkstra
Marijke: Lilli Feenders’ beste Freundin aus Nieuweschans, Nederland
Eltern Harriet und Bernhard
*
Gerhard Thedinga: Berufsoffizier und Sohn des Tierarztes aus Leer/Loga
*
Flakbatterie Groß Midlum bei Emden
Oberleutnant Schirrmacher: Batteriechef
Hauptfeldwebel Wegener
Marineobermaat Benthien
Diverse Flakhelfer und russische Hilfswillige
*
Marinestützpunkt auf dem Dänholm vor Stralsund
Oberleutnant Friedrichsen
Weitere Marineoffiziere und -soldaten
*
Captain Paul Kramer, Kommandeur einer US-Panzereinheit
Prolog – Tod eines Piloten
Stralsund, Sonnabend, 28. April 1945
Sein Blick ging in der kargen Zelle umher. Eine Holzpritsche, darauf zwei grob gewebte Decken, ein kleiner Tisch, ein Stuhl und natürlich der unvermeidliche Eimer für die Notdurft. Auf dem Tisch lagen einige Bogen billigsten Briefpapiers und ein abgenutzter Bleistift. Wie viele vor ihm hatten hier schon ihre letzten Zeilen an die Angehörigen geschrieben?
Die letzten Zeilen, wie sich das anhörte! Er war gerade einmal sechsunddreißig Jahre alt und hatte vielleicht noch ein, zwei Stunden zu leben. Vielleicht – er lachte bitter. Gestern hatte man ihm lapidar mitgeteilt, dass sein Gnadengesuch abgelehnt worden war und das Todesurteil heute in aller Frühe vollstreckt werden würde.
»Wegen Befehlsverweigerung werden Sie zum Tod durch Erschießen verurteilt!«, hatte der Kriegsgerichtsrat verkündet. »Sie haben unserem obersten Kriegsherren die notwendige Hilfe verweigert! Sie haben …« An die restlichen Worte der Urteilsbegründung konnte er sich nicht mehr erinnern. Es war auch vollkommen egal. Und – was hatte er getan bei diesem Flug, der ihm zum Verderben werden sollte?
Als er die Situation am Boden erblickte, hatte er die Gashebel seiner Junkers 352 nach vorne geschoben und das bereits ausgefahrene Fahrwerk wieder eingeholt. Mit leicht angezogenem Steuerhorn und aufheulenden Motoren hatte er die Maschine im stetigen Steigflug wieder auf Höhe gebracht. Rund dreißig junge Soldaten, kaum einer älter als zwanzig, hatte er damit vor einem schlimmen Schicksal, wahrscheinlich sogar vor dem Tode bewahrt.
»Einer für dreißig!«, hatte er dem Militärkaplan geantwortet, der gerade noch bei ihm gewesen war.
»So solltest du nicht denken! Ich weiß, du bist verzweifelt – ich wäre es auch an deiner Stelle –, aber wenn du vor deinen Schöpfer trittst, wirst du es reinen Gewissens tun!«
Wie war er denn in diesen Irrsinn hineingeraten? Die pure Lust am Fliegen war es gewesen. Die Nationalsozialisten hatten es ihm ermöglicht. Sein Talent wurde ihm letztlich zum Verhängnis. Er hatte eine steile Karriere hinter sich, die eigentlich nur auf Ausnahmegenehmigungen beruhte und ihn zur Lufthansa gebracht hatte. Die Krönung kam zu Beginn des Jahres 1939. Als Flugkapitän durfte er eine der brandneuen viermotorigen Condor-Maschinen übernehmen. Sein Glück kannte keine Grenzen mehr, als ihm der Direktor der Bremer Flugzeugwerke persönlich die Maschine übergab und allzeit guten Flug wünschte.
Ein halbes Jahr der Glückseligkeit – dann war Krieg.
Reinen Gewissens – was wusste denn dieser Pfarrer? Den größten Teil des Krieges hatte er junge Leute in die Hölle geflogen. Ob die Hölle nun Norwegen, Belgien, Kreta oder wie auch immer hieß, dem großen Schnitter war es egal. Dieser hielt reichlich Ernte. Und er war sein Werkzeug gewesen.
Einmal hatte er einen stillen Triumph erlebt. Abkommandiert zur Erprobungsstelle Rechlin sollte er daran mitarbeiten, die schöne Condor zum Bomber umzukonstruieren. Sie hatte sich geweigert, die Condor! Da konnten die Herren Ingenieure ihre Rechenschieber noch so sehr bemühen – dafür eignete sich die Konstruktion einfach nicht. Kriegsdienst mussten diese Flugzeuge dennoch tun – als Fernaufklärer über dem Atlantik und als persönliche Maschine dieses größten Feldherrn und Führers aller Zeiten, der Deutschland so konsequent in den Untergang geführt hatte.
Der Endsieg konnte eigentlich nur noch eine Frage von wenigen Tagen sein, dann hatten die Alliierten es geschafft, das Ungeheuer niederzuringen, in das dieses Land der Dichter und Denker sich verwandelt hatte.
Dies würde er nicht mehr erleben.
Marianne! Ihr Bild lag vor ihm. Das Gesicht verschwamm vor seinen Augen. Er würde sie nicht wiedersehen. Auf dem ersten Linienflug mit der Condor hatten sie sich kennengelernt. Komischerweise war dies erst während des Fluges nach London geschehen. Auf einmal hatte diese unbekannte junge Dame in der Lufthansa-Uniform hinter ihm gestanden und nach den Wünschen des Herrn Flugkapitäns gefragt. Das hübsche Gesicht, das herzliche Lächeln, der dunkle Bubikopf mit der schicken Mütze, ihre bezaubernde Stimme … Er hatte sich Hals über Kopf in sie verliebt.
In die Realität hatte ihn die Stimme des zweiten Piloten zurückgeholt. »Wir müssen langsam den Sinkflug einleiten, dort hinten kommt schon die Themsemündung in Sicht!«
Er hatte nur mit einer gewissen Verzögerung reagiert. »Ja – ich hatte gerade …«
»… eine reizende Erscheinung!«, ergänzte sein Kollege lachend und meldete die Maschine zur Landung in Croydon Airport an.
Die Begegnung mit der hübschen Marianne stellte sich als purer Zufall heraus. Sie war in letzter Minute für ihre erkrankte Kollegin eingesprungen. Daher waren sie sich vor dem Start in Frankfurt nicht begegnet. Der Abend in London war jedenfalls unvergesslich geworden und fortan sah man die beiden, soweit die Dienstpläne dies zuließen, nur noch als Paar. Einige Monate später hatten sie geheiratet, ein Jahr darauf wurde ihr Sohn geboren.
Knallende Stiefeltritte näherten sich der Zelle. Die Riegel wurden zurückgeschoben, der Schlüssel knirschte im Schloss, die Tür wurde aufgerissen.
»Raustreten! Hände auf den Rücken!«
Einer für dreißig!
*
Zwei Tage später, am 30. April 1945, setzte Adolf Hitler seinem Leben ein Ende.
1 – Von einem, der auszog, ein besseres Leben zu finden
Im Jahre 1898 wurde der Knabe Cornelius geboren. Seine Eltern, die Eheleute Meta und Garrelt Holtkamp, besaßen eine kleine Landstelle nahe dem Ort Heisfelde. Das Haus existiert nicht mehr und die Sandgrube Burfehn, in der der Vater manchmal arbeitete, ist längst zugeschüttet.
Cornelius war von untersetzter kräftiger Statur. Die dunklen flinken Augen verrieten seinen wachen Geist. Er besuchte die achtklassige Volksschule in Heisfelde mit gutem Erfolg. Ein ansehnliches Zeugnis war Lohn der Mühe. Eigentlich war sein Leben vorbestimmt. Da sein älterer Bruder sich freiwillig zum Militär gemeldet und es mittlerweile zum Unteroffizier gebracht hatte, sollte er eines Tages die bescheidene Landwirtschaft seiner Eltern übernehmen. Er würde seine Geschwister abfinden müssen und mehr schlecht als recht durchs Leben gehen. Alles – nur das nicht! In ihm rumorte es. Wie konnte er dem entkommen? Diese Frage ließ sich kaum beantworten. Der Besuch des Realgymnasiums und gar einer anschließenden Hochschule war für ihn undenkbar, obwohl der Dorfschullehrer meinte, er hätte den Kopf dafür. Wer sollte das bezahlen? Selbst eine Lehre würde vermutlich schon am Lehrgeld scheitern. In seiner Verzweiflung ging Cornelius zum Pastor des Ortes und schilderte ihm sein Problem. Der gute Mann wiegte den Kopf schwer hin und her. Schließlich riet er ihm, trotzdem einen Lehrherren zu suchen und – dieser Rat konnte nur von einem Geistlichen kommen – auf Gott zu vertrauen.
Cornelius war fast genau so klug wie vorher. Da ihm jedoch auch nichts Besseres einfiel, befolgte er diesen Ratschlag. Sein erster Weg führte ihn zum Bäckermeister. Dieser hätte ihn sogar genommen – das Thema Lehrgeld wurde nicht angesprochen –, aber der Bäcker hatte bereits einen Lehrjungen eingestellt. Der Meister gab ihm den Rat, es einmal bei den Mühlenbetrieben in der Umgebung zu versuchen. Cornelius bedankte sich artig und wandte sich zum Gehen. Da fiel der Satz, der sein ganzes weiteres Leben bestimmen sollte.
»Cornelius!«, rief der Bäckermeister ihm nach. »Mir fällt da noch etwas ein. Im Ammerland gibt es einen ganz ungewöhnlichen Müller …«
Die nachfolgende Schilderung ließ die Augen des Jungen immer größer werden.
»So etwas gibt es?«
»So wahr ich hier stehe!«, bekräftigte der Bäcker. »Wenn du bei dem antreten und bestehen solltest, kannst du dich gegen dein weiteres Glück im Leben gar nicht mehr wehren!«
Cornelius konnte an nichts anderes mehr denken. Abends erzählte er seinen Eltern davon.
»Warum sollte dieser Müllermeister ausgerechnet dich nehmen?«, wandte der Vater ein. »Der wird sich vor Lehrjungen gar nicht retten können! Außerdem, wie sollen wir das Lehrgeld bezahlen?«
»Bitte, Vater, lass es mich versuchen. So kann es nicht weitergehen. Wir arbeiten uns krumm und kommen auf keinen grünen Zweig!«
»Das hier ist also unserem Herrn Sohn nicht gut genug?«
»Nein!«
Es gelang schließlich der Mutter, die sonst höchst selten widersprach, ihren Mann zwar nicht zu überzeugen, aber zumindest zu überreden.
»Cornelius! Schreib dem Müller einen Brief in deiner schönsten Handschrift und bitte ihn, dass du dich vorstellen darfst!«
»Mutter, mit solchen Briefen kann sich der Mann bestimmt seine Wohnstube tapezieren! Nein, ich fahre dorthin und überzeuge ihn, sodass er gar nicht anders kann, als mich zu nehmen!«
»Und wenn es schiefgeht?«
»Dann habe ich es wenigstens versucht!«
Die Mutter steckte ihm das Fahrtgeld für die Eisenbahn zu. Wenige Tage später lief Cornelius zum Bahnhof in Leer, löste ein Billett dritter Klasse mit Rückfahrt nach Ocholt, um von dort aus wiederum nach Torsholt zu laufen.
Gerhard Hisje1, so hieß der gute Müllermeister, hatte einen Ruf weit über die heimischen Gefilde hinaus, denn er ging nicht nur mit der Zeit, er war ihr deutlich voraus. Er war nicht nur Windmüller. Da es nicht immer Getreide zu mahlen gab, hatte er sich beizeiten ein zweites Standbein aufgebaut, eine Holzsägerei. Das war zwar schön und gut, nur spielte der Wind nicht immer mit. Zu oft hatte er genügend Arbeit, aber die launische Energiequelle versagte. Als Ausweg schaffte er eine Dampfmaschine an. Doch die hätte auch arbeiten können, wenn es nichts zu mahlen oder zu sägen gab. Im Jahre 1906 kam der große Sprung. Gerhard Hisje investierte in einen Generator, der zweihundertzwanzig Volt Gleichstrom lieferte, freilich nicht, ohne sich vorher entsprechender Abnehmer versichert zu haben. Auf diese Weise kam das kleine Dorf Torsholt im Ammerland zum eigenen Energieversorgungsnetz, vier Jahre nach der Reichshauptstadt Berlin. Eines sei weit vorweggenommen – dieses Netz war unglaubliche fünfzig Jahre in Betrieb, bis es von der Oldenburger Energieversorgung Weser-Ems übernommen und auf Wechselstrom umgestellt wurde. Nebenbei erwähnt – Meister Hisje beschäftigte auf diese Weise ein halbes Dutzend Gesellen.
Aber noch befand man sich im Jahre 1912.
Der Müller staunte nicht schlecht, als Cornelius so einfach bei ihm aufkreuzte. Da ihm der Schneid des Jungen imponierte, hörte er ihn wenigstens an. Auf das Zeugnis gab er nicht viel, sondern unterhielt sich während der Arbeit mit ihm. Nicht nur die gescheiten Antworten des Jungen, sondern auch der Umstand, dass dieser unterdessen ebenfalls kräftig mit anpackte, bewogen ihn, außer der Reihe noch einen zweiten Lehrjungen aufzunehmen.
Cornelius war selig. Er sang auf dem Rückweg nach Ocholt, er sang in der Eisenbahn, er sang auf dem Weg zum Elternhaus. Die Leute schauten ihn komisch an und er hätte die ganze Welt umarmen können. Der Vater war weniger frohgestimmt, schließlich verlor er einen guten Arbeiter. Andererseits konnte und wollte er dem Lebensglück seines Sohnes nicht im Wege stehen.
Eine Woche später stand Cornelius wieder vor dem Müllermeister.
»So, da bin ich!«, verkündete er.
»Das seh ich!«, antwortete Gerhard Hisje trocken. »Du kannst es wohl gar nicht abwarten. Der Monatserste war doch ausgemacht!«
»Nee, ran an die Arbeit!«, gab Cornelius kurz und bündig zurück.
Der Müllermeister wusste zunächst nicht recht, welch einen Vogel er sich da eingefangen hatte. War das ein Windbeutel, dem bald die Luft ausging? Oder würde er durchhalten? Der Junge arbeitete von früh bis spät, manchmal mit einer gewissen Hast und wirkte oft bedrückt. Gerhard Hisje nahm ihn nach einiger Zeit beiseite. »Sag, Cornelius, dir liegt doch etwas auf der Seele?«
Der Junge zuckte regelrecht zusammen und nickte schließlich. »Ich kann das Lehrgeld nicht bezahlen. Meine Eltern sind zu arm.«
»So, und das sagst du mir jetzt?«, antwortete der Müller recht bedächtig.
»Bitte, Meister! Schickt mich nicht weg! Das ist meine einzige Möglichkeit, einmal zu einem besseren Leben zu kommen! Ich werde bis zum Umfallen arbeiten!«
»Das geht schon gar nicht!«
Cornelius schaute ihn entsetzt an. Gerhard Hisje bemerkte die erschrockene Reaktion des Jungen.
»Nee, so meine ich das nicht. Ich mach dir einen Vorschlag. Du nimmst mal ’n büschen Fahrt aus deiner Arbeit, arbeitest mit Bedacht und Sorgfalt und alles Weitere wird sich finden!«
Cornelius schaute ihn nur fragend an.
Der Meister merkte, dass er den Jungen auf einen anderen Kurs bringen und ihm die Sorgen nehmen musste. »Setz dich mal hin!« Er deutete auf einen niedrigen Bretterstapel und nahm ihm gegenüber Platz. »Du musst ’n büschen ruhiger werden. Denk vorher zweimal nach und mach mit Bedacht voran. Da schaffst du genauso viel, sollst mal sehn. Sonst fällst du mir wirklich noch um. Und davon hab ich auch nichts!«
Cornelius sah den Meister überrascht an, lächelte und nickte. Gleich darauf wurde er wieder ernst. »Aber das Lehrgeld, Kost und Logis?«
»Ach, Junge. Das ist ganz einfach! Solange du mich weniger kostest, als du einbringst, passt das schon!«
Cornelius’ Gesicht war ein einziges Fragezeichen.
»Du Dösbaddel!« Gerhard Hisje lachte. »Bist doch sonst nicht so schwer von Begriff! Du machst wieder ein fröhliches Gesicht, arbeitest ordentlich und in Ruhe – und ich verlange kein Lehrgeld!«
»Meister!« Der Junge schrie es fast, überglücklich.
»Unter einer Bedingung. Davon erzählst du niemandem etwas. Und wenn deine Eltern fragen sollten, sagst du ihnen einfach, es sei alles geregelt. Und nun ran an die Arbeit! Wir haben schon viel zu lange geredet!«
Cornelius lernte dadurch nicht nur, ruhiger zu arbeiten, sondern noch etwas anderes. Der Pastor hatte es Gottvertrauen genannt.
Bald begann der große Krieg und die Jüngeren unter den Gesellen mussten einer nach dem anderen ins Feld ziehen, wie man damals sagte. Cornelius Holtkamp lernte drei Jahre und machte seine Prüfung als Müllergeselle. Die Kenntnisse in diesem Handwerk hatte er mehr nebenbei erworben, denn sein ganzes Interesse galt der modernen Elektrotechnik. Eigentlich hätte er 1916 ebenfalls zum Militär einrücken müssen. Da jedoch sein älterer Bruder bereits bei einer in Hage stationierten Luftschifferabteilung diente, blieb Cornelius davon verschont. Er arbeitete weitere Jahre bei seinem Lehrmeister, bevor er in einigen der zahlreicher werdenden Elektrounternehmen zusätzliche Erfahrungen sammelte. Eine Gesellenprüfung im Bereich dieser neuen Technik legte Cornelius jedoch niemals ab.
Im Jahre 1934 stand in Leer ein kleiner ehemaliger Bäckereibetrieb zum Verkauf. Da die Ersparnisse bei Weitem nicht reichten, ging er zur Bank, um eine Hypothek aufzunehmen. Als man dort zögerte und nach Sicherheiten fragte, legte Cornelius seine Zeugnisse auf den Tisch. Oben drauf das Arbeitszeugnis von Gerhard Hisje.
Der Bankmitarbeiter machte große Augen: »Sie haben bei diesem sagenhaften Elektromüller gelernt? Ja, das ist natürlich etwas anderes! Warum haben Sie das nicht gleich gesagt?«
Wenige Wochen später eröffnete Cornelius Holtkamp sein Elektro- und Installationsgeschäft in der ehemaligen Bäckerei, die er zuvor weitgehend eigenhändig umgebaut hatte.
Eine Hürde hatte er allerdings noch nehmen müssen. Bedingung für die Eröffnung seines Unternehmens war die Mitgliedschaft in der NSDAP. Cornelius, der sich nie einen Deut um die Politik geschert hatte, wurde Parteimitglied.
Jahre später sollte er damit ein Problem recht eigener, oder besser gesagt, sehr eigenwilliger Art haben.
1 Gesprochen: Hische.
2 – Fräulein Marlene Degenhardt
Geboren wurde Marlene als einziges Kind des Studienrates Paul Degenhardt und seiner Frau Helene in einem Vorort Hannovers im Jahre 1913. Über ihre Kindheit und frühe Jugend gibt es nichts Besonderes zu berichten. Dies änderte sich jedoch schlagartig in ihrem sechzehnten Lebensjahr. Sie lernte einen jungen Mann kennen. Man kam sich näher, die Eltern ahnten nichts davon. Die Natur nahm ihren Lauf und Marlene wurde schwanger. Als sich die verstörte junge Dame ihrer Mutter anvertraute, war sie schon im vierten Monat. Normalerweise hätte man sich arrangieren können, ohne dass es zu einem gesellschaftlichen Skandal gekommen wäre. Hier lagen die Dinge jedoch ein wenig anders. Ein vertrauliches Gespräch zwischen Paul Degenhardt und dem Vater des möglichen Schwiegersohnes in spe ergab zweierlei. Zum Ersten war der junge Mann nur zwei Jahre älter als Marlene, konnte ihr also noch keine gesicherte Zukunft bieten, zum Zweiten hatte schon dessen Nachname offenbart, dass dieser mosaischen Glaubens war. Ein Jude als Schwiegersohn war für die Degenhardts ebenso wenig vorstellbar wie für die Familie Salomon die Eheschließung ihres Sohnes mit einer Gojah, einer Nichtjüdin.
Nun war guter Rat, besser gesagt ein Ausweg, im wahrsten Sinne des Wortes teuer. Bei einem kurz darauf stattfindenden Gespräch der Elternpaare – die beiden jungen Leute durften nicht daran teilnehmen – stand für einen Moment der Gedanke an den Gang zur Engelmacherin im Raum. Für einen sehr kurzen Moment, denn er wurde im nächsten Augenblick von beiden Frauen entrüstet verworfen. Von den Männern wollte später keiner dieses Wort in den Mund genommen haben.
Vater Salomon präsentierte daraufhin eine Lösung, die er sich schon zuvor sorgfältig überlegt zu haben schien. Da er zusagte, die finanzielle Seite dieses Planes zu übernehmen, ließ sich dieser flugs in die Tat umsetzen. Den Salomons fiel das nicht schwer, besaßen sie doch zwei große florierende Fertigungsateliers für feinste Damen- und Herrenkleidung.
Marlene verließ das Lyzeum nach Beendigung der Untersekunda und blieb in den folgenden Monaten daheim. Ein Vierteljahr später reiste sie zusammen mit ihrer Mutter in die Tschechei, ins schöne Marienbad. Ein verschwiegenes Privatsanatorium wurde für die nächsten beiden Monate ihr Zuhause. Dort brachte Marlene, mittlerweile siebzehn Jahre alt, ein kleines Mädchen zur Welt.
Nun kam der eigentliche und entscheidende Punkt. Vater Salomon, dem nichts Menschliches im Leben fremd zu sein schien, hatte beizeiten die entsprechenden Stellhebel betätigt. Der Inhaber des Privatsanatoriums, ein angesehener Mediziner, kannte natürlich die Honoratioren der Stadt, deren Verbindungen unter anderem in das zuständige Standesamt reichten.
Drei Wochen später verließen Helene Degenhardt, zu diesem Zeitpunkt siebenunddreißig Jahre jung, ihre Tochter Marlene und deren gerade geborenes Schwesterchen Karin die Stadt Marienbad. Wer es in der Heimat nicht glauben wollte, durfte die vom Marienbader Standesamt ausgestellte Geburtsurkunde in Augenschein nehmen, die von den deutschen Behörden problemlos anerkannt wurde. Zufrieden waren alle, auch die beteiligten tschechischen Beamten. Vater Salomon war ein vorausschauender Mann und schrieb ein zweites Kapitel dieser eigenartigen Geschichte.
Wenig später wurde Paul Degenhardt aufgrund seiner hervorragenden pädagogischen Fähigkeiten außer der Reihe zum Oberstudienrat befördert. Die entsprechende Stelle befand sich allerdings am Ubbo-Emmius-Gymnasium in Leer in Ostfriesland. Marlene Degenhardt und David Salomon sollten sich nicht wiedersehen, so lautete der Plan.
Drittes und letztes Kapitel der seltsamen Geschichte war die Versorgung von Marlene Degenhardt. Vater Salomon kaufte in Leer ein Haus auf ihren Namen. Dieses kleine Gebäude war vor wenigen Jahren erbaut worden, dem neuesten Stil entsprechend mit einem quadratischen Grundriss, zweistöckig und mit einem Dach in Form einer flachwinkligen Pyramide. Unten zogen die Eltern und die kleine Karin ein, oben wohnte Fräulein Marlene. Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, dass sie in den folgenden Jahren den Beruf der Buchhalterin erlernte.
Und hier endet die merkwürdige Geschichte, denn man schrieb mittlerweile das Jahr 1932.
Wie schon erwähnt, war Vater Salomon ein sehr kluger und weitsichtiger Mann. Viele seiner Glaubensbrüder konnten sich nicht vorstellen, welches Schicksal wenige Jahre später über sie hereinbrechen sollte, Vater Salomon schon. Mit dem Kauf des Hauses für Marlene hatte er sein letztes Geld ausgegeben. Die Fertigungsateliers waren bereits verkauft, der Erlös in die USA transferiert und im Herbst des letzten Jahres der Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in Deutschland verließ die gesamte Familie Salomon ihre Heimat.
Marlene arbeitete für einige Zeit in einem größeren Leeraner Industrieunternehmen. Als ihr jedoch der Hauptbuchhalter in sehr unangenehmer Weise zu nahe kam, ergriff sie die Flucht. Sie kam auf die Idee, kleineren Firmen, oftmals Familienbetrieben, die sich keine eigene Buchhalterin leisten konnten, ihre Tätigkeit tageweise anzubieten. Zunächst waren ihre potenziellen Kunden wenig erbaut, befürchteten sie doch das Entstehen gewisser Interessenskonflikte. Dieses Problem löste Marlene auf einfache Art. Sie arbeitete niemals für zwei Firmen in derselben Branche gleichzeitig, legte außerdem die Namen ihrer Auftraggeber jeweils offen und hielt sich strikt an ihre selbst auferlegte Schweigepflicht. Mögliche Probleme brauchte daher keiner zu fürchten, da sie auf diese Weise gar nicht erst entstanden.
Im Übrigen mochte Marlene, diese aparte Erscheinung mit ihren feinen Gesichtszügen und langen dunkelbraunen Haaren, mit Männern nichts mehr zu tun haben. Sie kleidete sich fortan sehr unvorteilhaft und band ihre Haarpracht zu einem strengen Dutt. Zeit ihres Lebens bestand sie darauf, als Fräulein angesprochen zu werden.
Marlene Degenhardt wird in dieser Erzählung noch bei zwei eigenwilligen, den jeweiligen Zeitgeist geradezu karikierenden Ereignissen eine Rolle spielen.
3 – Wotans Mickymaus
Im November 1928 erschien der erste Micky-Maus-Film unter dem Titel »Steamboat Willie« in den US-Kinos. Im Jahre 1930 kam der Streifen über den Atlantik und wurde auch in Deutschland schnell populär. Hier entwickelte sich eine besondere Version der Trickfilmfigur, die im folgenden Kapitel eine Rolle spielen wird.
*
Rheidersum, Mittwoch, 15. Mai 1935
Die mechanische Türglocke läutete Sturm, unterbrochen nur von einem Hämmern gegen die Haustür, gefolgt von verzweifelten Rufen, und das morgens um halb sechs. Ilse Feenders lief zur Tür, öffnete sie und wurde fast umgerannt. Marga Strodthoff, ihre Schwägerin, stürzte in den Flur, zitternd am ganzen Körper, weinend, völlig aufgelöst.
»Marga, was ist mit dir, was ist passiert?«
»Sie haben ihn abgeholt. Wo ist mein Bruder? Er muss helfen!«, stieß sie hervor.
»Helfried ist noch im Stall beim Melken. Und wer hat wen abgeholt?«
»Theo haben sie gerade geholt! Die Gestapo!«
»Warum? Moment eben!« Mit lauter Stimme rief Ilse Feenders: »Lilli, hol Papa aus dem Stall. Es ist etwas passiert. Er soll schnell kommen!«
Elisabeth, die fünfzehnjährige Tochter, hastete die Treppe herunter, lief durch den langen Flur, riss die Tür auf und verschwand in der Diele, die in den angrenzenden Stall führte.
Keine Minute später stand Helfried Feenders vor seiner von Weinkrämpfen geschüttelten Schwester: »Marga, nun komm. Wir gehn jetzt in die Stube, da vertellst du uns alles!« Er schob sie zum Sofa, drückte sie auf die Polster und setzte sich neben sie: »Was ist passiert?«
Marga antwortete schluchzend und stoßweise: »Die – Gestapo – hat – Theo – abgeholt!«
»Warum? Haben sie etwas gesagt?«
»Nee, das würde er schon auf der Dienststelle erfahren!«
Ilse Feenders drückte ihrer Schwägerin ein Glas Korn in die Hand: »Trink das, damit du wieder beikommst!«
Helfried ergriff das Glas und führte es seiner Schwester zum Mund.
»Bah, Schnaps am frühen Morgen!«
»Wenn die Gestapo kommt, reicht ’ne ganze Buddel nicht!«, entgegnete Helfried. »Mal ehrlich, hat Theo vielleicht den Schnabel wieder zu weit aufgemacht?«
»Du meinst …?«
»Ich weiß es nicht, ist nur so ’ne Vermutung. Was er von den Braunen hält, hat er ja oft genug gesagt.«
»Was machen wir denn nun? Ich muss doch wissen, was mit ihm ist!«
»Bei der Gestapo nachfragen? Das macht keiner, Marga! Und die Schupos wissen meist nicht, was die Ledermäntel treiben.«
»Aber ich muss doch …«
»Ganz ruhig, Marga. Lass mich eben ’n Moment überlegen … Erinnerst du dich noch an den alten Kriminalrat Tammen aus Leer?«
»Das war doch der, der Berend die Mane als den Mörder der kleinen Gesa Hellmann überführt hat!«
»Genau der!«
»Tammen ist aber nicht mehr im Dienst.«
»Egal, wenn hier einer helfen kann, dann er! Und dass er nicht mehr im Dienst ist, kann sogar von Vorteil sein. Denn unserem Dorfpolizisten möchte ich mit der Bitte nicht kommen. Aber der weiß vielleicht, wo Tammen wohnt.«
Kriminalrat Tammen war in seiner Dienstzeit eine Kapazität auf seinem Gebiet gewesen, in den Kreisen seiner Kundschaft geachtet und gefürchtet zugleich. Bekannt wurde er durch seine rasche Ermittlungsarbeit und sein Verhalten in dem bereits erwähnten Mordfall, der sich im Frühjahr 1930 nahe dem sonst so friedlichen Ort Rheidersum zugetragen hatte. Die zehnjährige Gesa Hellmann, Tochter des Dorfschullehrers, war abends nicht nach Hause gekommen. Ein eilig zusammengetrommelter Suchtrupp fand kurz darauf ihre entsetzlich zugerichtete Leiche an einem Weg nahe der Bahnstrecke zwischen Leer und Emden. Das Kind war missbraucht und mit einem großen harten Gegenstand erschlagen worden. Recht bald geriet der jugendliche Berend de Buhr ins Visier des Kriminalrats. Berend war von Geburt an schwachsinnig, galt aber als harmlos. Seinen Beinamen »die Mane« hatte der Junge erworben, als er eines Abends auf die untergehende Sonne deutete und sagte: »Dat is die Mane!«, was so viel heißen sollte wie: »Das ist der Mond!«
Lehrer Hellmann hatte sich sehr um den Jungen bemüht, letztlich aber keinen Erfolg gehabt. Selbst einfachste Rechenaufgaben, mit Knöpfen dargestellt, konnte der Junge nicht verstehen. Er starrte nur fasziniert auf die Knöpfe und stotterte: »Dat is ja ’n heel anner Knoob!«2
Danach gab der Lehrer auf. Entgangen war ihm jedoch, dass der in die Pubertät gekommene Berend ein gewisses ungutes Interesse an seiner Tochter, der kleinen Gesa, entwickelte. Dies endete schließlich in der Katastrophe.
Tammen, der im Umfeld der Lehrersfamilie genauestens recherchierte, stieß auf Berend de Buhr. Er fand sich in die eigenartige Sprache des Jungen, der ihm schließlich den ganzen Hergang erzählte, inklusive des Wissens, das nur der Täter haben konnte. Den Stein, mit dem Gesa erschlagen worden war, fand man unter seinem Bett.
Als Berend de Buhr von Polizeibeamten abgeführt werden sollte, stürzte der Lehrer Hellmann, mit einer Axt bewaffnet, wie von Sinnen auf den Mörder seiner Tochter los. Kriminalrat Tammen trat ihm in den Weg, hob nur die Hände ein wenig und sagte ruhig: »Das wirst du nicht tun, Hellmann. Und auf mich gehst du ja schon gar nicht los.«
Die beiden Schupos, die bereits ihre Pistolen gezogen hatten, brauchten nicht mehr einzugreifen. Tammen nahm dem Lehrer, der wie erstarrt stehen geblieben war, die Axt aus den Händen. Hellmann brach weinend zusammen. Vom Kriminalrat mühsam wieder aufgerichtet, wurde er zum Haus des Pastors gebracht, der sich weiter um ihn kümmerte.
Kriminalrat Otto Tammen hatte noch eine andere Seite, die wenig später zutage trat. Mit den braunen Flegeln, wie er sie gelegentlich zu nennen pflegte, konnte er rein gar nichts anfangen. Vor der Machtergreifung hatte er einige SA-Leute nach einer Schlägerei, die mit einem toten Kommunisten endete, vorläufig festnehmen lassen. Die neuen Herren im Lande wollten ihn loswerden und hatten ihn kurzerhand vom Dienst suspendiert. Da der verdiente Kriminalrat aber einflussreiche Fürsprecher besaß, hatte man ihn schließlich mit voller Pension anderthalb Jahre eher in den Ruhestand geschickt.
Und dieser Mann sollte nun nach dem Verbleib von Theodor Strodthoff, dem Saatguthändler aus Rheidersum, forschen.
Der Dorfpolizist wunderte sich zwar ein wenig über Helfried Feenders’ Ansinnen, stellte aber keine weiteren Fragen und nannte ihm die Adresse des alten Kriminalrates.
»Was wünschen Sie?« Eine ältere Frau hatte Helfried Feenders die Tür geöffnet. Misstrauisch schaute sie ihn an.
»Frau Tammen? Moin, Feenders ist mein Name, aus Rheidersum. Könnt ich wohl Ihren Mann sprechen?«
»Worum geht es denn?«
»Das möcht ich ihm lieber selber sagen. Ist eine ziemlich vertrackte Geschichte. Vielleicht weiß Ihr Mann einen Rat.«
Die Verzweiflung musste Helfried Feenders im Gesicht gestanden haben, denn die Frau antwortete nach kurzem Zögern: »Na, denn kumm Se man rin. Hoffentlich bring’ Se kien’ Ärger mit!«
Der alte Kriminalrat saß in der Küche und sah von der Zeitung auf, als seine Frau mit dem Besucher hereinkam. Er stand auf. »Moin, Herr Feenders!« Tammen freute sich über das verblüffte Gesicht. »Wir hatten im Mordfall Hellmann kurz miteinander gesprochen!«
»Dass Sie sich noch an mich erinnern?«
»Ich bin zwar ’n büschen älter geworden und außer Dienst, aber hier oben funktioniert noch alles!« Er tippte sich leicht an den Kopf. »Schreckliche Sache damals mit der kleinen Gesa. Aber deshalb sind Sie bestimmt nicht hier!«
»Nee, da haben Sie recht! Könnte ich eben mit Ihnen allein sprechen? Nichts für ungut, Frau Tammen, aber das ist, wie ich eben schon sagte, eine sehr vertrackte Sache.«
Henrike Tammen nickte nur vielsagend und verließ die Küche. Helfried Feenders schloss die Tür leise und vorsichtig hinter ihr.
»Na, nun nehm’ Se man erst mal Platz. Tass’ Tee?«, fragte Otto Tammen.
»Danke, gern. Das ist so, Herr Kriminalrat …« Helfried Feenders erzählte die Sache mit der Verhaftung seines Schwagers und stellte die Frage, was wohl aus ihm geworden sei.
»Gestapo, sagten Sie?« Tammen atmete hörbar ein und schwieg eine Weile. »Mit denen habe ich rein gar nichts zu tun, möchte ich auch nicht! Aber ich werde versuchen, Ihnen zu helfen – unter einer, nein, zwei Bedingungen!« Er sah den Besucher prüfend an.
Der nickte nur wortlos.
»Wenn ich etwas herausgefunden habe, melde ich mich bei Ihnen. Sie warten und rühren sich nicht in der Sache, auch wenn es ein paar Tage dauert. Und die zweite Bedingung: völliges Stillschweigen!«
»Natürlich, Herr Kriminalrat!« Helfried Feenders wirkte erleichtert. »Danke, dass Sie uns helfen wollen. Meine Schwägerin ist schon völlig durch ’n Wind!«
»Ich werde tun, was ich kann. Also, Ohren steifhalten!« Mit diesen Worten verabschiedete Otto Tammen seinen Besucher.
Eine Woche war vergangen und in den Familien Strodthoff und Feenders wurde man immer nervöser.
»Helfried, meinst du, dass Tammen etwas unternimmt?«, fragte seine Schwester.
»Ja, Marga, in den Mann habe ich absolutes Vertrauen! Der wird schon kommen!«
Er kam und seine Botschaft war kurz und knapp: »Also, er lebt. Das ist die Hauptsache! Man hat ihn ins Konzentrationslager Börgermoor gebracht, zur Umerziehung!«
»Umerziehung?«
»Ja, Frau Strodthoff! Ihr Mann muss sich schon des Öfteren sehr negativ über die neuen Herren geäußert haben. Die Gestapo hatte ihn bereits einmal vorgeladen und verwarnt. Aber das hat ihn wohl nicht beeindruckt. Daher jetzt die Verhaftung.«
»Was bedeutet das? Kommt er irgendwann wieder frei?«
»Wenn er sich entsprechend führt, denke ich mal, haben Sie ihn in sechs Wochen wieder!«
»Und woher wissen Sie das – ich meine, dass er lebt und dass es ihm gut geht!«
»Von gut gehen habe ich nichts gesagt. Die Häftlinge müssen im Moor arbeiten bis zur Erschöpfung. Aber er lebt, so viel weiß ich. Und die Frage, woher ich das weiß, werde ich Ihnen nicht beantworten. Haben Sie einfach Geduld!«
»Vielen Dank, Herr Kriminalrat!«
»Noch etwas – es ist doch allgemein bekannt, dass unsere neuen Herren ihre Gegner in Arbeitslager stecken. Verharmlosend werden sie auch Konzertlager genannt.«
»Gegner! Wie sich das anhört! Er hat nur seine Meinung über das braune …«
»Sehen Sie, das kann schon zu viel sein!« Otto Tammen hatte warnend die Hand erhoben. »Sie sollten vorsichtiger sein!«
*
Kriminalrat a. D. Otto Tammen hatte mit seiner Vermutung richtiggelegen. Anfang Juli tauchte Theodor Strodthoff wieder zu Hause auf.
Elisabeth Feenders erschrak, als sie ihren Onkel Theo zum ersten Mal wiedersah. Diese graue Gestalt, dieser Mensch, der gar nichts mehr von dem ausstrahlte, das ihn vorher ausgemacht hatte, das sollte ihr Onkel sein? »Onkel Theo?« Lilli stand in der Wohnzimmertür. »Geht es dir einigermaßen?«
»Ooch, mien Deern, danke, recht gut!«
»Darf ich dich mal was fragen?«
»Wenn es wegen meiner Haft ist, nein! Deinen Eltern habe ich schon gesagt, was ich sagen darf. Jeden Tag zig Stunden Arbeit im Moor bis zum Umfallen und häufige Misshandlungen!«
»Das haben sie mir erzählt. Furchtbar, das sind keine Menschen, die so etwas machen. Ich weiß, dass du nichts weiter erzählen darfst. Sonst holen sie dich wieder und du kommst nicht zurück!«
»Dann ist doch alles klar!«
»Das ist es ja gerade, nichts ist klar! Warum machen die das? Das hat es doch früher nicht gegeben!«
»Wie sagt unser werter Führer? Wir leben in einer großen Zeit! Und da scheint alles erlaubt zu sein, was die Herrschaften sich herausnehmen.«
»Ja, aber der Führer tut auch viel Gutes. Dein Bruder hat eine gute Arbeitsstelle gefunden und dein Geschäft läuft wieder!«
»Kind, das ist alles richtig, aber …«
»Oh, Onkel Theo! Nenn mich doch nicht immer Kind!«
»Verzeihung, Lilli, du bist ja schon eine richtige junge Dame«, antwortete Theodor Strodthoff mit einem leichten Lächeln. »Das hätte ich bald vergessen! Setz dich mal hin. Ich will versuchen, dir das zu erklären, so gut ich kann.«
Die beiden nahmen am Wohnzimmertisch Platz.
»Sieh mal, nach dem verlorenen Krieg, an dem die damalige deutsche Regierung und der Kaiser einen großen Teil der Schuld trugen, haben die Sieger im Vertrag von Versailles …«
»Das ist ein Schandvertrag, sagt unsere BDM-Führerin. Ein richtiges Diktat wird er genannt!«
»Ja, aber weißt du, dass dieser Vertrag ein deutsches Vorbild hatte?«
»Wieso?«
»Als 1917 die Bolschewiken mit ihrer Oktoberrevolution in Russland Erfolg hatten – übrigens mit deutscher Hilfe –, war im Osten der Krieg zu Ende. Die Russen bekamen von Deutschland den Vertrag von Brest-Litowsk aufgezwungen und der war knapp zwei Jahre später in großen Teilen die Vorlage in Versailles!«
»Das wusste ich zwar nicht, aber was hat das mit den Nationalsozialisten zu tun?«
»Das will ich dir ja gerade erklären, soweit das kurz gefasst möglich ist!«
Lilli rutschte unruhig auf dem Sofa herum, das konnte dauern, wie sie ihren Onkel kannte. Außerdem passte ihr das so gar nicht in den Kram, wenn sie an die vielen schönen Erlebnisse beim BDM dachte, dem »Bund deutscher Mädel«. Irgendetwas stimmte da nicht!
»Die Sieger wollten Deutschland wirtschaftlich nicht wieder hochkommen lassen«, sprach Theodor Strodthoff weiter. »Sie wollten ein für alle Mal verhindern, dass sich so etwas wiederholte. Dass sie selber erheblich zum Ausbruch des Weltkriegs beigetragen hatten, interessierte dabei nicht. Deutschland lebte weit über zehn Jahre in mehr oder weniger großer Not und die gemäßigten Politiker fanden keine Lösung. Einer der wenigen, der etwas bei den Siegern erreichte, Gustav Stresemann, starb leider zu früh. 1929 kam, ausgehend von Amerika, die große Weltwirtschaftskrise …«
»Wir hätten bald unseren Hof verloren …«, unterbrach Lilli ihn.
»… und ich stand kurz vor der Pleite!«, ergänzte Strodthoff ihren Satz. »So ging es vielen Leuten! Die Radikalen in Deutschland lieferten sich Straßenschlachten und es gab jede Menge Mord und Totschlag!«
»Und dann kam der Führer und es war Ruhe!«
»Das ist zwar richtig, aber du übersiehst dabei, dass er und seine SA-Schläger die eine Seite der Radikalen waren und es heute noch sind!«
»Hauptsache, Ruhe. Sagt mein Papa!«
»Eben, und so denken die meisten Leute. Außerdem hat niemals eine Mehrheit des Volkes die Braunen gewählt, selbst in der letzten Wahl am 5. März ’33 nicht, bei der noch mehrere Parteien zugelassen waren. Erst durch eine Koalition mit der schwarz-weiß-roten Kampffront unter der Führung der Deutschnationalen hatten die Braunen die parlamentarische Mehrheit. Und um welchen Preis haben wir jetzt diese trügerische Ruhe?«
Oh je, jetzt doziert er wieder, dachte Lilli, das kann anstrengend werden. Sie fragte: »Wie meinst du das, um welchen Preis?«
»Man darf nicht mehr sagen, was man denkt! Wenn ich früher auf Brüning und Papen geschimpft habe, machte das gar nichts. Da hätte man es schon recht toll treiben müssen. Und heute? Ein paar falsche Sprüche und man landet im Konzentrationslager!«
»Onkel Theo?« Lilli schaute ihn an. »Was hast du denn gesagt, dass sie dich eingesperrt haben?«
»Lilli!«
»Ja, ich weiß, du darfst nicht darüber reden.«
»Eigentlich ist das Ganze lächerlich, aber wenn du das zum Beispiel unter dem Siegel der Verschwiegenheit deiner besten Freundin erzählst und die sagt es weiter, dann war es das mit mir.«
Elisabeth zuckte ratlos die Achseln.
»Was soll’s, das ganze Wirtshaus hat es ohnehin mitbekommen. Aber du hältst wirklich den Mund?«
Lilli nickte wortlos.
»Ich habe erzählt, der dicke Hermann …«
»Göring?«
»Ja! Der ist doch so eitel mit seinen vielen Orden. Die habe er sich noch einmal aus Gummi anfertigen lassen, damit er sie auch in der Badewanne tragen kann.«
Elisabeth kicherte leise.
»Und unseren hochverehrten Reichspropagandaminister Dr. Joseph Goebbels habe ich als Wotans Mickymaus bezeichnet.«
Lilli presste sich die Hand vor den Mund und prustete los: »Goebbels als Mickymaus! Das ist gut!«
»Schließlich ist mir noch der Satz rausgerutscht: ›Lieber Gott, mach mich blind, dass ich Goebbels arisch find!‹«
Lilli lachte schallend: »Ich werd nicht wieder!«
»Ja, du lachst. Und fast alle anderen auch. Aber mir hat es sechs Wochen Arbeitslager eingetragen.«
»Wegen solcher Lappalien?«
»Ja!«
»Und wer hat dich verpetzt?«
»Weiß ich nicht. Das kann jeder gewesen sein. Es haben genügend Leute gehört.«
»Und nun?«
»Und nun?«, echote Theodor. »Halte ich meinen Rand und gehe nicht mehr ins Gasthaus! Wem soll man noch trauen? Und genau das ist es, was die heutigen Herren wollen!«
»Aber warum?«
»Verstehst du denn nicht, Lilli? Je mehr Leute aus Angst den Mund halten, desto ungenierter können die Braunen schalten und walten, wie sie wollen.«
»Aber was haben sie davon?«
»Hast du das Buch unseres geliebten Führers gelesen? ›Mein Kampf‹?«
»Ooch nee, der Wälzer hat über siebenhundert Seiten! Ich hab mal reingeschaut, als unsere BDM-Führerin sagte, jedes deutsche Mädel und jeder deutsche Junge sollte die Gedanken unseres Führers kennen.«
»Da hat sie völlig recht!«
»Wieso, ich denke, du magst die Braunen nicht?«
»Man sollte trotzdem – oder gerade deshalb – wissen, was unser glorreicher Führer vorhat.«
»Und? Was hat er vor?«
»Beispielsweise will er Land im Osten gewinnen, weil wir angeblich ein Volk ohne Raum seien. Weißt du, was das in letzter Konsequenz bedeutet? Krieg, das gibt den nächsten Krieg!«
»Ach, Onkel Theo, du bist immer so schrecklich pessimistisch. Das macht der Führer bestimmt nicht. Er redet doch immer vom Frieden!«
»Und warum schreibt er in seinem Buch etwas anderes?«
Lilli schaute nur ratlos.
»Oder die Sache mit den Juden.«
»Die Juden sind unser Untergang, sagt der Führer!«
»Und warum?«
»Papa ist mal von einem jüdischen Viehhändler übers Ohr gehauen worden!«
»Und bei mir haben treudeutsche Bauern ihre Rechnungen nicht bezahlt!«
»Das war in der Weltwirtschaftskrise. Und daran ist die jüdische Hochfinanz in Amerika schuld!«, antwortete Lilli mit leichtem Triumph in der Stimme.
»Und selbst wenn es so wäre. Sollen wir deshalb nicht mehr in jüdischen Geschäften kaufen? Was hat etwa der Kaufhausbesitzer Rosenfeld damit zu tun?«
»Der Führer wird es schon wissen!«
»Der Führer, der Führer«, räsonierte Strodthoff. »Weißt du, wie er mit den Juden umgehen will? Ziemlich am Ende des Buches schreibt er, man hätte einige Tausend von ihnen unter Gas halten sollen. Das empfiehlt unser famoser Führer, auch wenn er das in seinem Buch auf das Ende des Weltkrieges bezogen hat.«
»Das kann nicht wahr sein. So wie an der Front mit Giftgas?«
»Lilli, ich kann das jetzt nicht wörtlich wiedergeben, aber sinngemäß – ja! Jeder sollte dieses Buch lesen, denn wie ich diese Herrschaften kennengelernt habe, werden sie das so oder ähnlich umsetzen. Krieg und Massenmord!«
Elisabeth schaute ihren Onkel entsetzt an und schwieg.
»Lilli, ich hätte dir das gar nicht sagen dürfen. Eine versehentliche Bemerkung von dir an der falschen Stelle und ich bin geliefert! Die schlagen mich tot!«
*
1935 begann das Fernsehzeitalter in Deutschland. Geräte in Privathaushalten gab es kaum. Dafür konnten die braven deutschen Volksgenossen das Programm des Fernsehsenders Paul Nipkow in sogenannten Fernsehstuben sehen. Im Jahre 1936 erschien – mitten im Verlauf einer Varietésendung – ein sardonisch grinsender Kerl auf der Mattscheibe und gab Folgendes zum Besten:
Um mal wieder über die Musik zu sprechen:
Ich freue mich eigentlich,
dass es heute alles so wunderbar im Takt geht, nicht wahr?
Wenn es auch hier und da immer noch so etliche Querpfeifer bei uns gibt und vielleicht auch mal solche,
die gerne mal wieder die Zentrummel rühren möchten,
sogenannte Devisenmusikanten, nicht wahr,
da machen wir wenig Federlesen.
Die kommen zu ihrer weiteren Ausbildung
in ein Konzertlager,
wo man ihnen dann so lange die Flötentöne beibringt,
bis sie sich an eine taktvolle Mitarbeit gewöhnt haben!
*
Ende Februar 1936 ratifizierte Frankreich den sowjetisch-französischen Beistandsvertrag. Adolf Hitler nahm dies zum Anlass, das bis dahin entmilitarisierte Rheinland zu besetzen. Seitens der Ententemächte gab es keine sonderlichen Proteste, obwohl es sich um einen klaren Bruch sowohl des Versailler Vertrages als auch des von Deutschland freiwillig unterschriebenen Vertrages von Locarno handelte. Frankreich und Großbritannien versäumten damit die letzte Möglichkeit, durch entschlossenes Handeln die nationalsozialistische Diktatur in die Schranken zu weisen. Zu ernsthaftem Widerstand wäre die zu diesem Zeitpunkt noch relativ schwache Wehrmacht kaum in der Lage gewesen.
2 Das ist ja ein ganz anderer Knopf!
4 – Der schreiende Punkt
Rheidersum, im Frühjahr 1936
»Lilli?« Georg Feenders, dieser kleine drahtige Kerl, hatte sich vor seiner großen Schwester aufgebaut. »Wo bist du denn gerade mit deinen Gedanken?«
»Weit weg!«, antwortete Elisabeth. »Ich habe ein Problem!«
»Und welches?«
»Dabei kannst du mir sowieso nicht helfen mit deinen acht Jahren!«
»Wenn du es mir nicht sagst, bestimmt nicht!«
»Du hast ’ne Art, einen auszufragen. Aber wenigstens bist du nicht neugierig.«
Georg grinste. »Erzähl schon!«
»Ich würde so gerne mit der NS-Frauenschaft zum Reichserntedankfest auf dem Bückeberg fahren! Alwine Oltmanns war letztes Jahr schon da und hat mir davon vorgeschwärmt.«
»Wo ist denn das? Und wann?«
»Das findet in der Nähe von Hameln statt, am 4. Oktober.«
»Da hast du ja noch ’n büschen Zeit.«
»Das schon, aber ich habe mal bei Mama vorgefühlt und die war nicht gerade begeistert! Da wird Papa bestimmt ablehnen.«
»Was bekomme ich, wenn ich dir ’nen todsicheren Tipp gebe?«
»Georg!«
»Lass hören, Schwesterherz!« Georg grinste schon wieder.
»Na gut, eine Tafel Schokolade.«
»Abgemacht! Also, du erklärst unseren Eltern, dass du unbedingt zur Olympiade nach Berlin möchtest. Die ist im August.«
»Was soll das denn? Das will ich gar nicht. Außerdem, in die Großstadt lassen sie mich garantiert nicht.«
»Bist du heute schwer von Begriff. Du sollst doch nur so tun!«
»Und wozu?«
»Na, du gehst ihnen ordentlich auf den Wecker damit. Du erklärst ihnen, dass deine Glückseligkeit davon abhinge! Und wenn sie so richtig genervt sind, sagst du schließlich, du würdest dich notfalls auch mit dem Reichserntedankfest zufriedengeben, obwohl das ja kein vollwertiger Ersatz sei. Sollst mal sehn, wie sie dir dann zustimmen.«
»Georg, du bist vielleicht ein Schlitzohr!«
Das freche Lausbubengrinsen ihres kleinen Bruders wurde noch breiter und er sagte ganz trocken: »Tja, man kann ruhig dumm sein, man muss sich nur zu helfen wissen. Denk an die Schokolade!«
Elisabeth fuhr zum Reichserntedankfest. Das Borromäus-Hospital3, in dem sie seit einiger Zeit als Lernschwester arbeitete, hatte ihr außer der Reihe und ausnahmsweise freigegeben. Am besagten Tag wanderte sie mit ihrer Nachbarin in aller Herrgottsfrühe zum Bahnhof in Leer.
Zwei Tage später, gegen Abend, kehrte sie todmüde, aber sehr vergnügt zurück.
»Und?«, fragte Georg. »Wie war’s?«
»Fantastisch!«
»Ja, nun erzähl schon!«
»Also, einen durchgehenden Zug gab es nicht. Wäre ja auch zu schön gewesen. Oldenburg, Hannover, dort haben wir schnell etwas gegessen. Endlich kamen wir in Hameln an. Dieser letzte Zug war brechend voll. Zuerst sind wir in die Innenstadt gegangen. So schöne Fachwerkhäuser hab ich überhaupt noch nicht gesehen. Einfach toll. Und alles geschmückt mit Fahnen, Girlanden und Birkenzweigen. Nun wollten wir Kaffee und Kuchen haben, aber alle Cafés waren …«
»… brechend voll!«, unterbrach Georg sie.
»Schlauberger! Schließlich fanden wir einen Platz. Wir hatten unseren Kuchen gerade mal halb auf, da kam der Kellner schon wieder und sagte zu uns, wir möchten jetzt bitte gehen, andere deutsche Volksgenossen wollten sich auch noch stärken. Wir haben dort nicht einmal eine Viertelstunde sitzen können! Egal. Wir also wieder zum Bahnhof und rein in den nächsten Sonderzug, der uns zum Festgelände brachte. Man hatte dort extra eine kleine Station gebaut. Die hatte so einen komischen Namen, Tündernscher Bahnhof. Danach mussten wir noch ein ziemliches Stück laufen, bis wir endlich zum Bückeberg kamen. Ein Fesselballon zeigte uns den Weg in dem Gewühl. Solche Menschenmassen hast du noch nicht gesehen. Dort traten Trachtengruppen und Musikkorps der SA und Wehrmacht auf. Das wollte ich einfach mal erlebt haben. Es war wundervoll!«
»Und?«, fragte Georg gespannt. »Hast du unseren Führer gesehen?«
»Den Adolf?« Lilli lachte. »Ja, den habe ich gesehen. Oder besser gesagt gehört. Das war nämlich der kleine schreiende Punkt in der Ferne!«
Alle aus der Familie hörten sich gerne Lillis Erlebnisse an. Nur Theodor Strodthoff wechselte mit seiner Nichte kein einziges Wort darüber. Ihr Onkel ging ihr in den folgenden Tagen geradezu aus dem Weg. Der überzeugte Sozialdemokrat hatte schon vor Zeiten in seinem nunmehr stummen Protest im Kontor ein Porträt von Otto Wels angebracht. Onkel Theo hatte ihr einmal vom früheren Vorsitzenden der SPD erzählt. Dieser hatte in seiner letzten freien Rede im Deutschen Reichstag gesagt, man könne ihnen Freiheit und Leben nehmen, die Ehre aber nicht. Nach dem Ausschluss der KPD aus dem Parlament hatte nur noch die SPD gegen das Ermächtigungsgesetz gestimmt. Es reichte nicht mehr, die Nationalsozialisten von der uneingeschränkten Macht fernzuhalten.
Elisabeth war ein wenig unglücklich über das Verhalten ihres Onkels. Sie wagte es aber nicht, ihn darauf anzusprechen. Sicher, im Umerziehungslager hatten sie ihn schrecklich gequält. Andererseits, hatte sie nun irgendetwas Schlimmes getan, weil sie zu diesem größten Fest der nationalsozialistischen Bewegung gefahren war? Sie hatte doch nur ihren Spaß haben und diese gewaltige Veranstaltung einmal selbst erleben wollen, von der ihr schon mehrfach vorgeschwärmt worden war. Und es war auch wirklich beeindruckend, so viele begeisterte Menschen, so viele schöne Darbietungen.
Nur eines hatte ihr zu denken gegeben auf dieser imposanten Kundgebung. Das war die Vorführung der Wehrmacht. Die Truppen eroberten ein Dorf, das daraufhin in Flammen aufging. Natürlich waren es Theaterkulissen, die dort zerstört wurden. Unwillkürlich hatte sie bei diesem Anblick wieder an Onkel Theos Worte denken müssen. Wie hatte er gesagt? Hitler will Land im Osten gewinnen, weil wir angeblich ein Volk ohne Raum seien. Weißt du, was das in letzter Konsequenz bedeutet? Krieg – das gibt den nächsten Krieg!
Ihrer Familie hatte sie von dieser Inszenierung militärischer Gewalt nichts erzählt. Ihr war es wie ein Menetekel erschienen.
Elisabeth fand keinen gedanklichen Schluss zu den Eindrücken dieses Festes, die sich letztlich als zwiespältig erwiesen. Ein Jahr später fuhr sie nicht mehr zum Reichserntedankfest, dem letzten, das die Nationalsozialisten am Bückeberg bei Hameln veranstalteten.
3 Späteres Marinehospital beziehungsweise Marinelazarett. Nach dem Krieg wieder in Borromäus-Hospital umbenannt.
5 – Was geschah in der Pfännergasse?
Nachdem die Nationalsozialisten im März 1933 in Deutschland endgültig die Macht übernommen hatten, setzten sie sehr bald alles daran, sich diese auch in Österreich anzueignen, dem Heimatland Hitlers. Ihre intensive Untergrundarbeit gipfelte am 25. Juli 1934 zunächst im sogenannten Juliputsch. Etwa einhundertfünfzig illegale Nationalsozialisten, getarnt als Offiziere und Soldaten des Bundesheeres, überrumpelten die Wache des Kanzleramtes in Wien. Bei dem nachfolgenden Handgemenge wurde Bundeskanzler Dollfuß von zwei Kugeln zweier Putschisten tödlich getroffen. Das österreichische Bundesheer lief keineswegs zu den Aufrührern über, sondern schlug den zeitgleich an mehreren Orten losgebrochenen Aufstand blutig nieder. Es folgten weitere Jahre der NS-Untergrundarbeit. Am 12. Februar 1938 zitierte Hitler den amtierenden Bundeskanzler Österreichs, Kurt Schuschnigg, zu sich nach Berchtesgaden. In einem zweistündigen Gespräch setzte Hitler den österreichischen Kanzler derart unter Druck, dass dieser der Berufung von Arthur Seyß-Inquart zum Innenminister und der Legalisierung der österreichischen Nationalsozialisten zustimmte. Am 9. März kündigte Schuschnigg für den 13. März überraschend eine Volksabstimmung über die weitere Unabhängigkeit Österreichs an. Diese wollte er mittels restriktiver Teilnahmevoraussetzungen zu seinen Gunsten entscheiden. Hitler setzte Schuschnigg erneut unter Druck. Unter der Drohung eines Einmarsches deutscher Truppen erklärte der österreichische Kanzler am 11. März seinen Rücktritt und benannte den bisherigen Innenminister Arthur Seyß-Inquart zu seinem Nachfolger. Der Diktator, dem seine Versprechen zu keiner Zeit etwas bedeuteten, gab in der Frühe des 12. März 1938 der 8. Armee den Befehl, Österreich zu besetzen. Die deutschen Truppen wurden allenthalben bejubelt und mit offenen Armen empfangen. Es gab keinerlei Gegenwehr. Die wenigen Gegner der Nationalsozialisten verhielten sich stumm, denn offener Widerstand wäre einem Selbstmord gleichgekommen. Als »Blumenfeldzug« ging die Besetzung Österreichs in die Geschichte ein und wurde verharmlosend als »Anschluss an das Deutsche Reich« bezeichnet.
*
Linz, Österreich, Sonntag, 13. März 1938 am Vormittag
Matthias Holiczek, der elfjährige Bub, war unterwegs zu seinem Freund, dem um ein Jahr jüngeren Stefan Holzner. Die Ereignisse des gestrigen Samstags gingen ihm nicht mehr aus dem Kopf. Schule? Ach wo! Schon am Vormittag waren deutsche Militärfahrzeuge in Linz eingetroffen. Spähpanzer vorneweg, danach voll besetzte Mannschaftswagen und schwere Zugmaschinen mit angehängten Kanonen. Aber wie ein Krieg – den kannte er nur aus den Erzählungen seines Vaters, der mit seinen Kameraden wieder und wieder die Italiener an der Isonzofront zurückgeschlagen hatte – war ihm das wahrlich nicht vorgekommen. Kaum standen die Fahrzeuge auf dem Hauptplatz, da waren sie schon von begeisterten Menschen umringt gewesen. Blumensträuße wurden den Soldaten überreicht, manchmal gleich in die Läufe der Gewehre und Kanonen gesteckt. Lachende deutsche Soldaten, lachende Österreicher – es ging zu wie auf dem Kirtag4. Eigentlich konnte man die Piefkes ja nicht so recht leiden, doch das spielte jetzt keine Rolle mehr.
Matthias und Stefan waren den ganzen Tag auf dem Hauptplatz geblieben und auf den Militärfahrzeugen herumgeklettert, bis ein energischer Feldwebel sie heruntergescheucht hatte: »Des is koa Spuizeug, machts, dass ihr ’nunterkummt, bevor’s an Unglück gibt!« Ein Bayer, na ja.
Der größere Teil der Kolonne hatte sich bald wieder in Bewegung gesetzt, weiter ins Landesinnere. Stefan stieß den Matthias auf einmal an: »Host g’hert? Der Führer kummt!«
Es war die Sensation des Tages. Blitzschnell sprach es sich herum. Aber wann er kommen sollte, das konnte keiner sagen. Nachdem beim Überschreiten der Grenze durch die ersten deutschen Truppen kein Schuss gefallen war, das österreichische Bundesheer sich nicht blicken ließ und allenthalben nur Begeisterung herrschte, hatte Hitler sich spontan entschlossen, über Braunau am Inn, seinen Geburtsort, nach Linz zu fahren, in die Stadt seiner Jugendjahre. Immer wieder wurde die Wagenkolonne von seinen jubelnden Landsleuten aufgehalten, sodass er Linz erst am Abend erreichte.
Gegen neunzehn Uhr trat Hitler auf den Balkon des Rathauses am Hauptplatz, um seine Rede zu halten, nachdem er von Arthur Seyß-Inquart und August Eigruber, dem gerade ernannten Gauleiter von Oberösterreich begrüßt worden war: »Ich danke Ihnen für Ihre Begrüßungsworte. Ich danke aber vor allem euch, die ihr hier angetreten seid und die ihr Zeugnis ablegt dafür, dass es nicht der Wunsch und der Wille einiger weniger ist, dieses große volksdeutsche Reich zu begründen, sondern dass es der Wunsch und der Wille des deutschen Volkes selbst ist …«
Immer wieder wurde Hitler durch lang anhaltenden Jubel, Applaus und das Skandieren von Beifallsrufen unterbrochen, bis seine Rede schließlich in einem geradezu religiösen Bekenntnis geendet hatte:
»… für unseres Reiches Macht, für seine Größe und für seine Herrlichkeit, jetzt und immer – Deutschland, Sieg Heil!«
Heute gab es kein anderes Thema. Der Führer weilte noch in Linz! Matthias Holiczek hatte mittlerweile die Wohnung seines Freundes erreicht: »Du, kummst mit? Hab g’hert, der Führer isst im Hotel Weinzinger zu Mittag. Da können wir ihn noch mal sehen und vielleicht sogar mit ihm sprechen!«
Außer Atem trafen die beiden Buben nach einiger Zeit vor dem Hotel ein, nachdem sie sich durch Hunderte wartender Menschen bis zum Eingang vorgedrängt hatten.
Aber dort war eine Wache aufgezogen, die niemanden hineinließ.
»Könn’ wir bittschön den Herrn Führer noch oamal sehn?«
Der Wachposten, ein bayrischer SS-Mann, wehrte sie lachend ab: »Schauts, Buben, seids vernünftig. Der Führer muss amal in Ruhe essen kenna. Außerdem hat er mit einigen wichtigen Herren etwas zu besprechen. Da könnts ihr net stören. Gehts halt hoam, eure Mütter warten b’stimmt scho!«
Wie zwei begossene Pudel schlichen die beiden nach Hause, ohne ein Wort miteinander zu wechseln. Zu betroffen waren die beiden. Bis – ja, bis sie die Pfännergasse erreichten. Ein Menschenauflauf, aber kein jubelnder. Schreie und Schluchzen, ein Stöhnen erklang aus der Menge. Dazwischen SS-Leute: »Hier gibt’s nichts zu sehn. Schleichts euch, gehts weiter, Leut!«
Die beiden Buben schauten sich an. Ein Unfall?
Da sahen sie es: Eine Frau lag in einer großen Blutlache. Sie rührte sich nicht mehr. Daneben eine zweite, augenscheinlich ebenfalls schwer verletzt. Sie stöhnte noch, wimmerte und bewegte sich dann ebenfalls nicht mehr. Matthias und Stefan kannten die beiden. Es waren die Frau des Buchhändlers Silberstein und ihre Schwester. Wie vor den Kopf geschlagen, standen die beiden Buben dort. Rund um sich sahen sie nur betroffene Mienen.
Wortfetzen …
»Die armen Frauen … aus dem Fenster gesprungen … aus dem Fenster geworfen … Holts oana den Sanka5!«
Matthias Holiczek blickte nach oben: An der Front des nahen Bürgerhauses stand ein Fenster offen. Die Gardinen bauschten sich im Wind. Die Frauen waren allem Anschein nach aus dem dritten Stock …
… ein SS-Mann beugte sich über die beiden reglosen Gestalten: »Ooh, Sarah, des tut ma jetzt leid. Wenn mir mit eich fertig san, brauchts koane von eich no an Sanka!«
Ein Aufschrei aus der Menge: »Ihr verdammten Schweine, was habt ihr mit den beiden gemacht?«
Der SS-Mann ging drohend auf die Leute zu: »Passts bloß auf, sonst kummts ihr nach Dachau!«
Weitere Schreie: »Ihr habt sie misshandelt … missbraucht … aus dem Fenster geworfen!«
»Ja spinnts ihr denn«, knurrte der SS-Mann erbost. »Wir werden uns doch nicht an solchen Judenv… vergreifen!«
Die SS-Leute begannen, die Menge mit Schlagstöcken auseinanderzutreiben. Auch Matthias Holiczek und sein Freund suchten ihr Heil in der Flucht. Es war nicht klar – und offiziell verlautbart wurde später schon gar nichts –, ob es sich um einen Selbstmord der beiden Frauen handelte oder ob die SS daran beteiligt gewesen war. Aber das schockierende Erlebnis und die menschenverachtenden Reaktionen der SS-Leute brannten sich den beiden Buben geradezu unauslöschlich ins Gedächtnis ein. Für sie stand fest, die hatten es getan!
Jahre später – um genau zu sein, kurz vor Ende des Krieges – sollte aus diesem Erlebnis und den Reaktionen der jungen Österreicher darauf eine Situation entstehen, in der es zumindest für den Älteren der beiden um Leben und Tod ging.
*
Am 29. September 1938 wurde zwischen Deutschland, Großbritannien, Frankreich und Italien das Münchner Abkommen unterzeichnet. Die Tschechoslowakei musste das großenteils von Volksdeutschen bewohnte Sudetenland an das Deutsche Reich abtreten. Dies wurde über die Köpfe der tschechischen Regierung hinweg beschlossen, die an den Verhandlungen nicht teilnehmen durfte. Deutsche Truppen besetzten das Gebiet am 2. Oktober 1938.
Aufgrund der dafür erforderlichen Transportkapazitäten sagte man das Reichserntedankfest kurzfristig ab. Und 1939 wurde diese größte nationalsozialistische Propagandaveranstaltung wegen des Polenfeldzuges gestrichen. Eine Wiederaufnahme der jährlichen Veranstaltung war für die Zeit nach dem Endsieg vorgesehen …
4 Kirchweih, Jahrmarkt.
5 Sanitätskraftwagen.
6 – Mord und Brand
Rheidersum, Freitag, 11. November 1938
Elisabeth starrte auf den Zeitungsartikel. Wild schossen ihr die Gedanken durch den Kopf. Vor vier Tagen hatte das Unheil seinen Anfang genommen.
Die Stimme des Sprechers im Großdeutschen Rundfunk hatte sich regelrecht überschlagen.
Herschel Feibel Grynszpan, ein polnischer Jude von siebzehn Jahren, hatte am 7. November 1938 in Paris auf den deutschen Legationsrat Ernst Eduard vom Rath geschossen. Dieser starb zwei Tage später an seinen schweren Verletzungen.
Gestern Morgen, kurz nach Melkzeit, war Onkel Theodor plötzlich im Stall aufgetaucht, absolut ungewöhnlich für diese Stunde. Helfried, ihr Vater, hatte ihn erstaunt angeschaut.
»Was machst du denn schon hier in aller Herrgottsfrühe?«
»Den Herrgott lass lieber aus dem Spiel. Der hat damit nichts zu tun. Die Synagoge in Leer brennt! Und die SA hat sie angezündet!«
»Sind die jetzt völlig übergeschnappt?«
»Und weißt du, wer dabei war?« Ohne eine Antwort abzuwarten, hatte Theo hinzugefügt: »Unser lieber Herr Bürgermeister Drescher! Der soll persönlich die Vorhänge angezündet haben!«





























