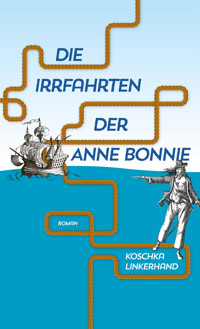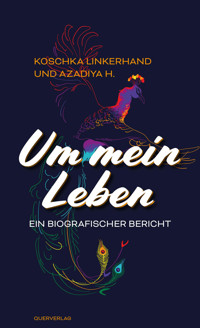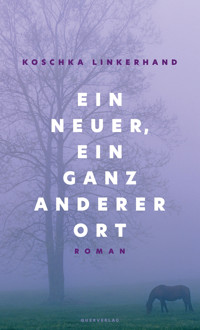Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Querverlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Trotz vielfältiger gesellschaftlicher Krisen bleibt der Feminismus hierzulande häufig auf Akademie und Subkultur, soziale Arbeit und neoliberale Selbstdarstellung begrenzt. Dabei bestimmt das kapitalistische Patriarchat überall auf der Welt das Leben von Frauen, Queers und Rassifizierten. Ein Feminismus, der die Verhältnisse umwälzen will, muss also transnational denken und handeln. Wie kommen wir aus unseren begrenzten Nischen heraus? Wie können wir uns feministisch aufeinander beziehen und organisieren? Welche sozialen Bewegungen eignen sich als Vorbilder? Und: Wer sind „wir“ überhaupt? Feministisch streiten 2 sucht nach Antworten – in den breiten Bewegungen gegen Femizide und für das Recht auf Abtreibung, in der Analyse von Arbeitsteilung und patriarchaler Gewalt und einer transnationalen Auseinandersetzung mit Religion, Ökologie, Transfeindlichkeit, Kolonialismus und Antisemitismus.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 443
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© Querverlag GmbH, Berlin 2024
Erste Auflage: September 2024
Lektorat: Regina Nössler
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Umschlag und grafische Realisierung von Sergio Vitale
ISBN 978-3-89656-706-2
Bitte fordern Sie unser Gesamtverzeichnis an:
Querverlag GmbH
Akazienstraße 25, 10823 Berlin
www.querverlag.de
Vorwort
Feministisch streiten 2 ist wie sein Vorgänger ein Sammelband, wenn auch eine Sammlung eigener Texte. Entstanden in den Jahren 2020 bis 2024, dokumentiert sie in assoziativer Reihung eine Entwicklung hin zur Bewegungstheorie und einer Theorie transnationaler Kämpfe, die in engem Zusammenhang mit den politischen Ereignissen dieser Jahre steht. Anders als im ersten Teil von Feministisch streiten handelt es sich weniger um einführende Texte. Es sind eher Haltungstexte, suchende Texte zu aktuellen feministischen Streitfragen. Weniger noch als vor fünf Jahren nehme ich in Anspruch, sie abschließend zu klären.
Das feministische Wir … und der Kampf um das Recht auf Abtreibung fußt auf einem Vortrag über das politische Subjekt Frau, den ich in den vergangenen Jahren immer wieder gehalten habe. Extraktivismus und die „tiefen Spaltungen“ im politischen Subjekt Frau erschien zuerst – zusammen mit drei Übersetzungen ökofeministischer Texte aus dem globalen Süden – in outside the box, Nummer 8, im Juli 2023. „Uns bewegt der Wunsch“ liegen zwei Texte für die Zeitschrift konkret vom August und September 2020 zugrunde. Über die Gewalt im Geschlechterverhältnis und Mit dem Staat oder gegen ihn? gehen in den Grundzügen auf einen Vortrag von 2021 zum Verhältnis von Patriarchat und Rechtssystem zurück. „Ich bin eine stolze jesidische Lesbe und will euch Mut machen“ resümiert die Zusammenarbeit mit Azadiya H., mit der ich im Herbst 2022 im Querverlag den biografischen Bericht Um mein Leben veröffentlicht habe. Der Text entstand für einen noch nicht erschienenen Sammelband, herausgegeben von Karin Stögner. Pro Kopftuch und kontra Abtreibung, mein Versuch zur vergleichenden Religionskritik, basiert auf einem Artikel in der Phase 2, Nummer 59, Herbst 2021. Warum Materialismus nicht Transfeindlichkeit bedeutet erschien zuerst in perspektiven ds. Zeitschrift für Gesellschaftsanalyse und Reformpolitik, Nummer 1/2023.
Der übliche blinde Fleck und die Exkurse, die einzelne Argumentationsfäden der größeren Texte weiterführen, entstanden eigens für dieses Buch. Einige Exkurse sind inspiriert von meiner Kolumne Der Stand der Bewegung, die ich 2022 und 2023 für die Wochenzeitung Jungle World geschrieben habe.
Eine Anmerkung zum Gendern: Ich verwende Sternchen, wenn ich Menschen unabhängig von ihren Geschlechtern meine (Leser*innen), und das generische Femininum (Leserinnen), wenn ich mich ausdrücklich auf Frauen oder das politische Subjekt Frau beziehe. In diesem Sinn schreibe ich z.B. von den Aktivistinnen oder Theoretikerinnen der Zweiten Frauenbewegung – weil diese Bewegung ausdrücklich und immer wieder Frauen als ihr Subjekt artikuliert hat. In dieser Schreibweise bleibt unberücksichtigt, dass sich einige wenige Männer, trans und cis, in der Frauenbewegung getummelt haben, und einzelne Autorinnen wie Monique Wittig argumentierten, Lesben seien keine Frauen. Von Queerfeminist*innen schreibe ich hingegen mit Sternchen, weil diese feministische Strömung sich ganz wesentlich über ihr Bekenntnis zur Geschlechtervielfalt definiert. Welches Subjekt eine feministische Bewegung zur Sprache bringt, finde ich die politisch relevantere Frage als die nach dem Geschlecht jedes Einzelnen ihrer Mitglieder.
Explizit von Männern bzw. struktureller Männlichkeit ist in Pluralformen wie Tätern und Polizisten die Rede. Die Schreibweise folgt patriarchatskritischen Erwägungen, die an den jeweiligen Stellen hoffentlich deutlich werden.
Ich habe versucht, den Texten eine möglichst leicht lesbare Form zu geben, weshalb sie z.B. keine Fußnoten enthalten. Im Interesse einer schlanken Form des Zitierens ist nicht extra vermerkt, dass ich manche Zitate aus dem Englischen oder Spanischen übersetzt habe. Diese Stellen sind an den englisch- oder spanischsprachigen Quellentiteln zu erkennen.
Zuletzt möchte ich meinen Dank und meine Liebe aussprechen: meinen Freundinnen und Genossinnen Jule und Katja Wagner, Maria Neuhauss, Carolin Krahl und Sabrina Zachanassian, dafür, dass sie in meinem Leben sind und mich politisch begleiten. Alle hier versammelten Texte haben von ihren Anmerkungen, ihrer Kritik und Ermutigung profitiert.
Einige wichtige Überlegungen, die in dieses Buch eingeflossen sind, verdanke ich meinem Lesekreis mit Jule und Conny. Viele schöne und erhellende Abende lang haben wir uns u.a. durch die Werke von Rita Segato, Verónica Gago, Bafta Sarbo und Eleonora Roldán Mendívil, Karl Marx, Rosa Luxemburg und Walter Rodney gekämpft. Constanze Stutz sei außerdem in ihrer hochgeschätzten Doppelrolle als Geliebte und Genossin dankend erwähnt.
Ich danke meinen Genossinnen der feministischen Zeitschrift outside the box für die Jahre der gemeinsamen Arbeit in der Redaktion, darunter besonders Katharina Lux und Veronika Lechner für ihre Anmerkungen zu Texten dieses Bandes. Merle Stöver danke ich für ihre Gedanken zu Der übliche blinde Fleck und Kim Posster für den Anstoß zu Warum Materialismus nicht Transfeindlichkeit bedeutet. Azadiya H. danke ich für die neuen Horizonte, politisch wie stilistisch, die sie mir eröffnet hat. Nicht zuletzt danke ich dem Querverlag für die Anregung, mich an eine Fortsetzung von Feministisch streiten zu setzen, und Regina Nössler für das angenehme Lektorat.
Leipzig, im Juni 2024
Koschka Linkerhand
Einleitung
Die Suche nach der Bewegung
Mehr als sechs Jahre sind seit dem Erscheinen von Feministisch streiten vergangen. Nach dem Skandalerfolg von Beißreflexe. Kritik an queerem Aktivismus, autoritären Sehnsüchten, Sprecherfolgen, herausgegeben von Patsy l’Amour laLove,habe ich 2018 meine eigene Skandalnudelsuppe gekocht. Es ging mir darum, die mit Beißreflexe in Stellung gebrachte Kritik am vorherrschenden Queerfeminismus weiter zu verfolgen, und zwar auf explizit feministische Weise. Vom einseitigen Fokus auf Sprachregelungen und richtiges Verhalten in Szenenischen wollte ich den feministischen Blick zurücklenken auf die gesellschaftlichen Verhältnisse, die unser Denken, Arbeiten, Begehren und Zusammenleben strukturieren. Deshalb trug ich einführende Artikel zu weiblicher Sexualität und Sozialisation, Prostitution, Religionskritik, lesbischem Feminismus und zu den Fragen nach Kapitalismus und Patriarchat sowie nach Feminismus und Antirassismus zusammen. Feministisch streiten sollte diese klassischen feministischen Streitfelder in Erinnerung rufen und die Debatte darüber aufs Neue anstoßen.
Vielerorts stieß dieses Vorhaben auf offene Ohren. Feministisch streiten hat mir unzählige Einladungen zu Lesungen und Vorträgen beschert, die die letzten sechs Jahre geprägt haben. An verschiedensten Orten in Deutschland, Österreich und der Schweiz, in Uniräumen, linken Zentren, Kneipen und Cafés, parteinahen Bildungszentren, in feministischen Bibliotheken und alternativen Jugendzentren habe ich mit Genoss*innen Bier getrunken und feministisch gestritten: über Identitätspolitik, das politische Subjekt Frau, Sternchen und Doppelpunkte, Essstörungen, biologische und soziale Geschlechter und Islamismus. Besonders gefreut habe ich mich über die zahlreichen Rückmeldungen, dass Feministisch streiten in Lesekreisen rezipiert wurde, häufig als Einstieg in feministische Theorie überhaupt. Genau das hatte ich bei der Konzeption im Sinn.
Während mein Altersunterschied zu den Organisator*innen der Veranstaltungen zunehmend größer wird, ist mir das gemeinsame Diskutieren über die Jahre immer wichtiger geworden. Vorträge und Podiumsbeiträge präsentieren nicht nur die Ergebnisse meiner theoretischen Arbeit, sondern sind ihr wichtiger Bestandteil und ihre wichtige Voraussetzung. Dazu gehört auch die Auseinandersetzung mit den Anfeindungen wegen meiner angeblichen Transfeindlichkeit und meines angeblichen antimuslimischen Rassismus, die die Vorträge immer wieder begleitet haben. Sie verweisen auf linke Konfliktgewohnheiten und diskursive Lücken, die im Interesse emanzipatorischer feministischer Politik überwunden werden müssen. Das kann nur im offenen Gespräch passieren, in dem alle – auch ich vorn im Referentinnensessel – das Risiko eingehen, ihre Ansichten zu überdenken. Insofern ist ein Vortrag, nach dem keine*r was sagt, für mich eine sehr unbefriedigende Angelegenheit geworden. Feministisches Streiten setzt ein Gegenüber voraus, das auch etwas vom Feminismus will, und das ist in keinem Fall völlig deckungsgleich mit meinen eigenen Ansichten. Ich mag es nicht mehr, eingeladen zu werden, um das Richtige zu sagen, das, was alle schon zu wissen meinen, und um die gewünschte Feindbestimmung vorzunehmen.
Materialismus gegen queer
Die Kritik am Queerfeminismus war für eine Weile eine geeignete Stoßrichtung, um meinen Wunsch nach Veränderung, nach Vorwärtsbewegung, ja überhaupt nach Bewegung zu artikulieren. Der aktivistische und akademische Queerfeminismus bot genügend Angriffsfläche, um linke Selbstbezüglichkeit und das Verharren im Status quo, das neoliberale Gefangensein in sich selbst und in den Verhältnissen, in denen man sich’s bei allem Unbehagen recht komfortabel eingerichtet hat, zu illustrieren. Ein materialistischer Feminismus, der sich in erster Linie am Queerfeminismus und seiner Begrenzung auf Identität und Sprachgebrauch abarbeitet, schien mir daher ein geeignetes Kritikinstrument zu sein. Schon als Schlagwort war Materialismus wichtig – um überhaupt eine andere Art von Feminismus wieder in die Diskussion zu bringen.
Vor zehn, zwölf Jahren, als noch recht unerfahrene Referentin, musste ich immer wieder feststellen, dass genau das eine provozierende Angelegenheit war. Auf feministischen Camps und Konferenzen herrschte mit überwältigender Mehrheit die Ansicht, es gebe a) den alten Feminismus der Zweiten Frauenbewegung, der in nahezu allen Positionen überholt sei, und b) den zeitgemäßen Queerfeminismus, der ganz neue, unerhörte Erkenntnisse bereithalte. Die meisten Leute waren eifrig bestrebt, ihren Feminismus zu queeren, um alle Menschen einzuschließen und niemanden zu diskriminieren. Wenn ich und meine Genossin Sabrina Zachanassian, mit der ich damals meist auf Vortragstour war, z.B. über Prostitutionskritik sprachen, herrschte grundsätzlich Aufruhr, warum wir Sexarbeiter*innen diskriminierten. Wenn wir über geschlechtsspezifische Sozialisation referierten, kam prompt der Vorwurf, wir schlössen trans, inter und nichtbinäre Menschen aus unserem Feminismus aus. Unsere Verwunderung wich schnell einem politischen und intellektuellen Trotz: Wir hatten uns doch belesen und alles durchdacht und besprochen! Wir hatten Simone de Beauvoir, Alice Schwarzer, Judith Butler und Jessica Benjamin gelesen. Diese Leute glaubten dennoch, uns über Identitäten belehren zu müssen – als lebten wir Kritikerinnen gesellschaftlicher Strukturen und Verhältnisse hinterm Mond! Als könnte man so mit emanzipierten Frauen umgehen!
Aus diesem Unbehagen und diesem Zorn speisten sich meine frühen theoretischen Texte, in denen ich an einer materialistischen Argumentation feilte. Mit Beißreflexe, als Queerkritik plötzlich populärer wurde, kam die Freude am Skandalnudeligen dazu.
Ein Blick auf die Texte in diesem Band zeigt, dass die Kritik am Queerfeminismus nicht mehr den Mittelpunkt meines politischen Denkens ausmacht. Zwar halte ich an vielen Punkten grundsätzlich fest. Nach wie vor denke ich nicht, dass Dekonstruktivismus, einseitige Identitätspolitik und eine Intersektionalität, die sich auf das Nebeneinanderstellen von Identitäten beschränkt, der Königsweg zur Befreiung der Geschlechter sind. Diese Kritikpunkte werden in Feministisch streiten 2 wiederaufgenommen.
Andere Punkte möchte ich im Folgeband revidieren – wie die Annahme, dass Queerfeminist*innen, egal auf welche Identitätsvariante sie sich stürzen, doch Frauen bleiben. Dieses Verständnis von gesellschaftlicher Realität und ihrer subjektiven Verarbeitung und Politisierung finde ich nicht mehr haltbar. Überdies wird das Beharren auf cis Frauen als einzig akzeptablem Subjekt des Feminismus heute stark von Radikalfeministinnen in Stellung gebracht. Der Radikalfeminismus hat mittlerweile eine sehr erfolgreiche Bewegung für ein Prostitutionsverbot auf die Beine gestellt, leider mit allzu staatsgläubiger sowie transfeindlicher Schlagseite. Das erfordert eine neue Positionierung und auch Abgrenzung eines materialistischen Feminismus.
Wieder andere Punkte möchte ich modifizieren, weil ich sie nicht mehr ausschließlich im Queerfeminismus verorte: wie die Selbstbezüglichkeit und Selbstgenügsamkeit der Kritik, der es gar nicht mehr um eine Veränderung der Verhältnisse zu tun ist. Solche Gleichsetzungen passieren schnell, wenn man erst eine schöne Abgrenzungsfolie wie Materialismus gegen queer auf die Beine gestellt hat. Dass selbstbezügliche Kritik auch in anderen Teilen der Linken vorherrscht, will ich im Folgenden anhand meiner politischen Sozialisation schildern. Neben der Queerkritik ergibt sich daraus ein zweiter Ausgangspunkt für das, was mittlerweile meinen hauptsächlichen theoretischen Fokus ausmacht: die Suche nach der feministischen Bewegung.
Politisierung im Lesekreis
Was suche ich in Gesellschaftstheorie, warum beschäftige ich mich damit? Um sich der eigenen Motive bewusster zu werden, hilft es, sich und Anderen die eigene politische Geschichte zu erzählen. Sich als denkendes Subjekt zu vergegenwärtigen und ernst zu nehmen, ist auch eine gute Übung in feministischer Selbstreflexion. Darum blättere ich in meiner autobiografischen Betrachtung übers feministische Streiten noch ein paar Seiten weiter zurück.
Sabrina, ich und einige meiner ehemaligen Genossinnen der feministischen Zeitschrift outside the box begannen unseren politischen Denkprozess in einer antideutschen Theorielinken in Ostdeutschland, die nach dem Niedergang der DDR mit keiner realexistierenden Linken noch etwas zu tun haben wollte. Die antideutsche Linke beschränkte sich weitgehend auf abstrakte Strukturkritik. Patriarchat bedeutete demzufolge eine reine, kapitalismusimmanente Strukturkategorie, gegen die man ohnehin nichts ausrichten konnte; oder es meinte die Kopftuchtyrannei der iranischen Mullahs, gegen die man von Leipzig aus auch nichts ausrichten konnte. Patriarchat war nicht hier und heute. Das hing damit zusammen, dass die antideutsche Theorie den Antisemitismus linker Bewegungen zum Kernpunkt ihrer Kritik gemacht hatte. Antisemitismus galt als nahezu unvermeidliche Begleiterscheinung linker Kollektive im postnazistischen und wiedervereinigten Deutschland. Allerdings hatten die Antideutschen ihm wenig mehr entgegenzusetzen als den empörten Rückzug aus jeder sozialen Bewegung und vielen linken Gegenentwürfen. Man ging selbstverständlich davon aus, dass es keine progressive linke Form gebe, sich gegen Kapitalismus und Patriarchat zusammenzutun. Der Staat Israel galt als hauptsächlicher emanzipatorischer Bezugspunkt – neben der kritischen Theorie v.a. Theodor W. Adornos.
Wenn man sich mit der Melancholie des späten Adorno aufs Sofakissen gestickt hat, dass Theorie die einzige Form der politischen Praxis ist, die noch Sinn macht, liegt die Versöhnung mit zutiefst bürgerlichen Formen von Politik und einer unpolitischen Lebensgestaltung nicht fern. Viele Bücher und viel Zeit zum Denken zu haben – ungebundener, kritischer Geist zu sein –, war auch meine Vorstellung von Glück. Immerhin lebte ich im antideutschen Hausprojekt, also nicht fernab autonom organisierter Strukturen, und war nicht ganz allein mit dem adornitischen Hochmut, mit dem ich auf die Welt und auf die übrige Linke blickte. Mit meiner Mitbewohnerin Bine las ich Adornos und Horkheimers Dialektik der Aufklärung in einem zweijährigen Lesekreis. Dieser Lektüre und den Diskussionen, die ich damals führte, verdanke ich meinen Anspruch, zwischen gesellschaftlichen Widersprüchen zu denken, und das Misstrauen gegen ein einfaches Dagegen-Sein.
Zum Misstrauen gegen politische Aktionsformen kam, dass mir Vorgänger*innen fehlten. Anders als in westdeutschen Städten gab es in Leipzig in den 2000er Jahren kaum ältere Linke und Feminist*innen. Die feministischen Einrichtungen, die wir kannten, ohne viel mit ihnen zu tun zu haben – die Frauenbibliothek, das Frauenkulturzentrum, der Frauenhausverein –, waren alle im Zuge von 1989/90 gegründet worden; ältere Organisationen gab es nicht. Aber auch mit den Frauen dieser Wendegeneration hatte ich nichts zu schaffen. Ich hielt mich an das Gerücht, dass sie Menstruationsgöttinnen töpferten und Bücher über sogenannte Indianerfrauen lasen. Meinen Genossinnen und mir hingegen war glasklar, dass Frausein nichts Natürliches, kein Widerständiges, sondern in erster Linie eine Strukturkategorie ist.
Trotzdem ging aus der antideutschen Jugendgruppe, zu der einige meiner Schulfreundinnen gehörten, eine Frauengruppe hervor – weil es am Ende doch die Jungs waren, die über Schulkritik und Israel und die Notwendigkeit des Irakkriegs referierten und im Marx- und Adorno-Lesekreis die Wortführer bildeten. In der von Sabrina ins Leben gerufenen Frauengruppe trieben wir weiter Strukturkritik, lasen die Wertabspaltungskritikerin Roswitha Scholz, Martha C. Nussbaum, Necla Kelek und feministische Psychoanalytikerinnen und näherten uns der Zweiten Frauenbewegung an.
Das Besprechen und Theoretisieren eigener Erfahrungen nahm einen gewissen Raum ein. Aber im Ganzen blieben wir dem Modell einer einerseits abstrakten, andererseits hochpolemischen Kritik treu, die jeder Art von Kollektivierung, auch der frauensolidarischen, mit großem Misstrauen begegnete. Wir kritisierten lediglich bestimmte Auswirkungen davon, etwa die antideutschen Totalverrisse des Definitionsmachtskonzepts. Man sollte Frauen, die sexuelle Gewalt erlebt hatten, grundsätzlich Glauben schenken und sie unterstützen, fanden wir, statt in solchen Fällen auf den Rechtsstaat zu vertrauen. Aber unsere hauptsächliche Praxisform blieb es, zusammen zu lesen und zu diskutieren.
Distanzierte Annäherung
Ich habe oft darüber nachgedacht, warum mein Zugang zum Feminismus ein derart theoretischer war. Als Materialistin gehe ich davon aus, dass Gesellschaftskritik keine noble oder uneigennützige Angelegenheit ist, sondern aus Unzufriedenheit mit der Gesellschaft, ja aus Leiden an ihr erwächst. Es wäre also naheliegend, dass feministisches Engagement aus Unterdrückungserfahrungen rührt, die mit Geschlecht und Sexualität zu tun haben.
Für mich selbst aber fällt mir die Beweisführung nicht leicht. Natürlich habe ich mich als Jugendliche darüber geärgert, wenn ich häufiger Geschirr abtrocknen musste als mein Bruder oder der Physiklehrer sexistische Sprüche klopfte. Aber mit 18, als mich eine Schulfreundin zur Frauengruppe einlud, glaubte ich mich erhaben über solchen Alltagskram. Ich wollte Schriftstellerin werden und begriff mich als stolzes und freigeistiges Individuum, nicht als Mitglied irgendeiner sozialen Gruppe. Was hatte ich mit den Frauen zu schaffen? Ich stand kurz vorm Abitur und wollte danach Germanistik und Philosophie studieren und Romane schreiben und ansonsten in Ruhe gelassen werden. Laut Tagebuch ging ich zur Frauengruppe, „weil mir die Sache mit dem Feminismus so eigenartig fremd ist und ich ja immer Angst habe, den Kontakt zu meinen politischen Freunden zu verlieren.“
Aber dann ließ ich mich schnell von feministischen Theorien begeistern. Sie halfen mir, die Welt zu erklären – und hielten sie mir zugleich vom Leib. Der theoretische und dadurch recht distanzierte Weg, mich mit Weiblichkeit, patriarchaler Gewalt, Begehren zu beschäftigen, war genau meine Kragenweite. Ich hielt Distanz zu meiner Familie und legte mich auch kaum mit den Bildungsinstitutionen an, die ich besuchte. Arbeiten musste ich noch nicht; mit Männern ging ich kaum je eine so nahe Beziehung ein, dass ich mich mit ihnen hätte streiten müssen. Ich radelte nachts alleine und völlig bedenkenlos durch den Park. Der 8. März hatte für mich genauso wenig eine persönliche Bedeutung wie die Rechtswidrigkeit von Abtreibungen.
Ich hatte mich gewissermaßen vom gesellschaftlichen Frausein ausgenommen – wie ich es Queerfeminist*innen später vorwarf. Vielleicht musste meine erste Auseinandersetzung mit der Weiblichkeit abstrakt sein, damit sie mir überhaupt möglich wurde. In Fat is a Feminist Issue, unserem Text über Essstörungen im ersten Band von Feministisch streiten, haben Charlotte Mohs und ich die Distanzierung vom eigenen Körper und der eigenen Sexualität, die für Frauen der Preis intellektueller Emanzipation sein kann, ein Stückweit erkundet.
In der Zeitschrift des linken Kulturzentrums Conne Island wurde damals eine Debatte über den Gegensatz von (Real-)Politik und (Gesellschafts-)Kritik geführt. Kritikerin wollte ich sein: kühl, ironisch, wortgewandt, wie ich es von Thomas Mann kannte; nicht in realer und frontaler Opposition. Was mich anzog, war die grundsätzliche Negation zur bestehenden Gesellschaft, die ich bei Adorno und Roswitha Scholz fand: ein rabenschwarzes, aber dezentes, im Alltag fast unsichtbares Nicht-mit-mir.
Nebenbei ging ich zu Demos gegen Nazis und gegen Antisemitismus, die eher gesellige Spaziergänge waren. Anders als das sächsische Umland war Leipzig in diesen Jahren befriedet, wir spazierten am 1. Mai über den abgesperrten Ring und verrammelten nur mehr symbolisch die Tür vom Hausprojekt; die Nazis standen ohnehin eingekesselt am Hauptbahnhof und würden dort bleiben. Ansonsten nahm ich gelegentlich am Fraueneinlass bei der Disko freitagabends im Conne Island teil. Links und rechts der Tür standen Ladys mit kühler Miene und schwarzer Bomberjacke, das mochte ich; manchmal, wenn noch nicht viel los war, packten Bine und ich unseren Adorno aus.
Auf der Suche nach Kollektivität
Ich habe Formen und Inhalte meiner politischen Sozialisation, die immerhin fast 20 Jahre her ist, so detailliert geschildert, um meine Ausgangslage für die Suche nach einer transnationalen feministischen Bewegung zu beschreiben. Für andere Feminist*innen kann das ganz anders aussehen: Neulich sah ich eine Doku über die feministische Bewegung in Argentinien. Eine sehr junge Frau kam zu Wort, deren Mutter während der Militärdiktatur entführt worden und seither verschwunden war. Sie war bei der Großmutter aufgewachsen, die immer für die Aufklärung der Verbrechen während der Diktatur gekämpft hat. Eines Tages, erzählte das Mädchen, während sie sich ein Venussymbol auf die Wange malte, sei ihr klar geworden, dass das Traurige in ihrem Leben mit vielen anderen patriarchalen Missständen zusammenhing. Sie stieß die Tür auf, und da zogen abertausende Frauen mit Transparenten, Trommeln und lila Tüchern vorbei, zu denen sie sich gesellte. Soweit die ARTE-Dokumentation.
Mein Weg zu feministischer Kollektivität war umständlicher – nicht nur, weil vor meiner Tür keine abertausend Frauen vorbeizogen. Dabei treibt mich die Sehnsucht nach dem gemeinsamen Krawallschlagen, nach klaren Worten und klaren Kampflinien, nach einem Aktivismus, der auch den Alltag, den Körper und die Sehnsucht nach einem emanzipatorischen Miteinander einbezieht, schon seit vielen Jahren um. Bereits der erste Band von Feministisch streiten war ein großer Schritt in die Welt hinaus. Gegenüber der rabenschwarzen Negation war er ein überwältigendes Beziehungsangebot an andere Menschen, andere Feminist*innen über den engsten Szenekreis hinaus.
In den Jahren zuvor hatte ich erste eigene Texte veröffentlicht (in der Conne-Island-Zeitschrift, der outside the box und der Phase 2) und die Leipziger antideutsche Blase nach verschiedenen Richtungen hin verlassen. Ich hatte angefangen, als feministische Referentin herumzureisen und Thesen zur Debatte zu stellen. Zurück in Leipzig, trat ich der Redaktion der outside the box. Zeitschrift für feministische Gesellschaftskritik bei. Mittlerweile hatte ich Lust, nicht nur am stillen Schreibtisch zu sitzen, sondern auch mit realen Genossinnen in einem wöchentlichen Plenum praktisch zu werden, übers Zeitschriftenmachen. Die Redaktionsarbeit war mein Versuch, kollektiv feministisch zu arbeiten. Für Feministisch streiten, das parallel entstand, war ich allein verantwortlich.
In der outside the box wiederholte sich zum einen die Erfahrung aus der antideutschen Linken, dass der Zugang zu einer feministischen Bewegung verstellt ist und die Suche danach Züge einer nicht zeitgemäßen Sehnsucht trägt. Zum anderen aber erarbeitete sich die Redaktion der outside the box zwei Erkenntnisse, die für Feministisch streiten sehr wichtig waren: erstens, dass Feminismus sich Objekte setzen muss, also Kritikgegenstände, die außerhalb seiner selbst liegen. Dass er Außenwelt braucht, um Wirkung zu entfalten, überhaupt sinnvoll zu sein; dass Feminismus nicht nur ein Selbstverhältnis ist, sondern ein Verhältnis zur Welt, in der wir leben. Die zweite, damit zusammenhängende Erkenntnis lautete, dass es produktiv ist, Feminismus als intersubjektiv zu verstehen. Feminismus ist eine Bewegung auch zwischen Feminist*innen, die einander als politische Subjekte ernstnehmen und den Mut und das Vertrauen aufbringen, viel voneinander zu erwarten und dabei auch Kritik zu üben. Insofern kann feministische Geschichtsschreibung, ja überhaupt feministische Theorie als Konfliktgeschichte verstanden werden. Viele Konflikte reichen bis in die Gegenwart und werden immer wieder brisant, beispielsweise: Wer ist das Subjekt des Feminismus? Was ist eine Frau?
Auch aufgrund unserer Überlegungen in der outside the box denke ich mittlerweile, dass es weniger darum geht, hinter solche Konflikte einen vermeintlichen Schlusspunkt zu setzen und sich auf die richtige Seite zu schlagen. Vielmehr halte ich es für klug, historische Konflikte nachzuzeichnen, sie in Beziehung zu den gesellschaftlichen Bedingungen zu setzen, unter denen sie damals virulent wurden und es heute wieder werden, und daraus Positionierungen in aktuellen politischen Diskussionen abzuleiten. Die Hoffnung dieses Verfahrens liegt darin, dass streitende Feminist*innen ihre Standpunkte produktiv aneinander reiben, statt sich an immer denselben Konfliktpunkten die Köpfe einzuschlagen und einander unverzeihliche Kränkungen zuzufügen.
Eine Gefahr des feministischen Austauschs liegt darin, sich unter Frauen und Genoss*innen immer wieder gegenseitig in Frustrationserfahrungen mit dem Patriarchat zu bestätigen und dabei in erster Linie Trost und Verständnis voneinander zu erwarten, statt sich gemeinsam kämpferisch auf die Außenwelt zu beziehen. Dass das Streiten als feministische „Beziehungsweise“ (Bini Adamczak) keine leichte Übung ist, war der Hauptgrund, dass ich die Redaktion der outside the box 2021 wieder verließ. Seither versuche ich, das Scheitern am Kollektiv als Erfahrung in meine Suche nach der feministischen Bewegung zu integrieren.
Diesseits und jenseits des Internets: Aktivismus gegen sexuelle Gewalt
Gleichzeitig wurde die Sehnsucht nach einem kollektiven feministischen Aufbruch auch in breiterem Rahmen spürbar. Besonders augenfällig war das auf dem Streitfeld patriarchale Gewalt und Femizide. Bereits 2013 und 2017 hatten die Kampagnen #aufschrei und #metoo Sexismus in der Öffentlichkeit, am Arbeitsplatz und im Privaten thematisiert. Wohl weil sie großenteils online geführt wurden und entsprechend niedrigschwellig waren, schlossen sich viele Frauen und Queers an und teilten ihre Diskriminierungs- und Gewalterfahrungen. Die Erschütterung reichte bis in die großen Medien hinein. Dabei konnten ausgerechnet in einer Zeit, in der selbstbewusste Antifeministen wie Trump, Putin und Erdoğan höchste Staatsämter bekleideten, Täter patriarchaler Gewalt zur Rechenschaft gezogen werden, die sich aufgrund ihres Geschlechts und ihrer ökonomischen und kulturellen Machtstellung bisher sehr sicher hatten fühlen können: etwa der Filmproduzent Harvey Weinstein und die Regisseure Woody Allen und Dieter Wedel. Auch die sexuelle Gewalt gegen Kinder, die Michael Jackson und Amtsträger der katholischen Kirche mutmaßlich verübten, wurde in diesen Jahren aus der öffentlichen Verdrängung geholt.
Doch während #metoo in den USA in der Verurteilung Weinsteins wegen verschiedener Sexualverbrechen gipfelte, hatte die Kampagne in Deutschland kaum Auswirkungen auf die öffentliche Wahrnehmung von frauenfeindlicher Gewalt und auf das Alltagsleben. Das haben nicht zuletzt die schnell fallengelassenen Vorwürfe gegen die Band Rammstein im Jahr 2023 gezeigt. Die Medienberichte junger Frauen über sexuelle Gewalt, die sie auf Konzerten erlebt hatten, unterlagen der Klageflut von Rammsteins Anwält*innen – vor allem aber einer sehr großen Fangemeinschaft, die den Trumpismus des Sängers Till Lindemann, der sich alles erlauben kann, begeistert feierte.
Es ist leicht, über Hashtags und eine lila Schleife am Social-Media-Profilbild feministisches Engagement zu bekunden. Es gerät nicht so schnell in Widerspruch zu den patriarchalen Verdrängungs- und Rationalisierungsmechanismen im realen Leben: zu den eigenen Männer- und familiären Beziehungen, zur Benachteiligung am Arbeitsplatz oder auch nur zu den popkulturellen Vorlieben. Um Gesellschaft zu verändern, braucht es eine Praxis, die tiefer greift als reine Onlinekampagnen, die hauptsächlich identitäre Bekenntnisse hervorbringen: Ich bin gegen sexuelle Gewalt!
Eine wichtige Erfahrung, was es bedeutet, gegen sexuelle Gewalt zu sein, war für mich die Kundgebung gegen Till Lindemanns Solokonzert in Leipzig Ende 2023, die aus der Solidarität mit seinen mutmaßlichen Opfern erwuchs. Die gut besuchte und lautstarke Kundgebung führte mir lebhaft vor Augen, dass es gar nicht so schwierig ist, praktisch zu werden. Man kann sich über eine Sache informieren und sie mit den eigenen politischen Grundsätzen abgleichen; sich empören, einen Spruch auf ein Schild malen, und los geht’s. Nicht immer braucht es lange Texte, stellte ich fest, nicht immer ist die Sachlage überaus komplex. Alle, die sich ein wenig mit feministischer Kritik beschäftigt haben, wissen von den grundlegenden Mustern patriarchaler und sexueller Gewalt. Leider sind diese Muster seit ihrer Politisierung in den 1960er und 1970er Jahren weitgehend aktuell geblieben.
Ein feministisches Krawallschlagen, zu dem sich eine leidlich große Anzahl von Genoss*innen zusammenfindet, hat das Potenzial, in den Alltag der Einzelnen hereinzuschwappen. Es bietet eine Kollektivität, die über Lektüre und übers Internet kaum ins Leben zu rufen ist: weil sie draußen stattfindet, auf der Straße, in der Öffentlichkeit. Weil Kälte und Dunkelheit, Aufregung, Heiserkeit vom Parolen-Brüllen und vom Hochhalten des Schilds schmerzende Arme wettgemacht werden durch die auch körperliche Anwesenheit Anderer, die mein Anliegen teilen, die mir vermitteln, dass ich zumindest zu dieser Zeit und an diesem Ort nicht allein bin mit meiner Wut auf beschissene Sexisten wie Lindemann.
Feminismus im Streik
Ähnliches hatten bereits die Versuche im Sinn gehabt, zum 8. März einen Frauen- oder feministischen Streik auf die Beine zu stellen. Sie begannen 2018, brachen 2020 wegen der Corona-Pandemie ab und nehmen seit 2023 neue Fahrt auf.
Inspiriert von der lateinamerikanischen Streikbewegung, handelte es sich in den meisten deutschen Städten zunächst um zögernde Gehversuche, die noch keine klare Agenda hervorbrachten, warum feministische Frauen und Queers welche Arbeit verweigern sollten. Aber das Unbehagen an den Produktions- und Reproduktionsverhältnissen sowie der Wille, gemeinsam etwas zu verändern, waren vorhanden. Die feministischen Streiks fallen zeitlich mit der Streikwelle im Dienstleistungssektor zusammen, die seit einigen Jahren andauert: Kita-Erzieher*innen haben gestreikt, Pflegekräfte, Lehrer*innen, der öffentliche Nahverkehr und Lokführer*innen. Sie bezogen sich teils auf dieselben Missstände, etwa die neoliberale Privatisierung von Dienstleistungen und die damit verbundene Verschlechterung der Arbeitsbedingungen in Care-Jobs. Feminist*innen ergänzten diese Kritik, indem sie auf die zusätzliche Belastung von Frauen durch unbezahlte Haus- und Beziehungsarbeit verwiesen, auf transnationale Perspektiven, die Rassifizierung von Arbeitsverhältnissen, auf sexuelle Gewalt sowie sexistische und transfeindliche Diskriminierung im Job.
Die Frage, ob Prostitution bzw. Sexarbeit Arbeit sei und welche Forderungen daraus abzuleiten wären, war ein großer Streitpunkt vieler Streikbündnisse. Auf weitere Konflikte werde ich in diesem Band zu sprechen kommen. Obwohl sie, soweit ich es mitverfolgt habe, meist nicht inhaltlich und im Hinblick auf eine gemeinsame Praxis ausgetragen wurden, finde ich den bloßen Versuch aufregend, übergreifende feministische Bündnisse zu bilden, in denen sich linksradikale Gruppen mit Institutionen und ehrenamtlichen Initiativen verständigen. Umkreisend, manchmal intervenierend frage ich mich: Was ist die Rolle, die feministische Theorie im Streik einnehmen kann?
Die Bewegung gegen Femizide
Die Empörung über patriarchale Gewalt nahm mit dem Aktivismus gegen Femizide neue Fahrt auf. Während der Pandemie flammte die Diskussion um häusliche Gewalt wieder auf: In vielen Ländern thematisierten Feminist*innen, dass das eigene Zuhause für viele Frauen einen Ort der Gewalt bis hin zum Mord darstellt. Gegen die erzwungene Vereinzelung durch Lockdowns und Homeoffices bot sich damit ein Anlass zur Kollektivierung – digital und dann darüber hinaus.
In Leipzig fand im Mai 2020 die erste Demonstration gegen Femizide statt: nach der Ermordung von Myriam Z. durch ihren Ex-Partner. Die Gruppe #KeineMehr, die sie organisierte, hatte sich 2017 zuerst in Berlin gegründet, um Impulse aus der lateinamerikanischen und italienischen Femiziddebatte nach Deutschland zu holen. Drei Jahre später liefen einige hundert Demonstrant*innen, die Myriam Z. größtenteils nicht gekannt hatten, durch die pandemiebedingt stillgelegten Straßen.
Das Thema Femizide etablierte sich in der feministischen Debatte. Begünstigt durch die gesellschaftliche Gesundheitskrise, die auf viele Menschen direkte, nämlich körperlich, sozial und finanziell spürbare Auswirkungen hatte, kam eine neue Qualität feministischen Engagements auf, die sich in meinen Augen durch Alltags- und Lebensnähe auszeichnete. Die Lockdowns richteten den Blick auf das, was mitten unter uns stattfindet: Was hat patriarchale Gewalt mit der Stadt zu tun, in der ich lebe, mit meinem Viertel, meinem Haus? Wie verändert die Beschäftigung mit Femiziden mein Verhältnis zu feministischen Gewaltschutzeinrichtungen, zur Situation migrantischer und rassifizierter Frauen in Leipzig? Zur regionalen Presse, zur Polizei, zum Bordell in der Nachbarschaft? Zu der unausgesprochenen Vermutung, dass eine Freundin oder Nachbarin von ihrem Partner nicht gut behandelt wird?
Die neue Qualität wurde auch andernorts spürbar. Um nur zwei Beispiele von vielen zu nennen: In Wien gründete sich zur selben Zeit die Gruppe Claim The Space, die Kundgebungen gegen Femizide veranstaltete. 2022 konstituierte sich, ebenfalls nach einem Frauenmord im nahen Umfeld, die Initiative Feminizide stoppen, um belastbare Zahlen für Deutschland zu erstellen.
Mit dem Aktivismus und der Theoretisierung von Femiziden ist etwas in Bewegung geraten, das Anlass zur Hoffnung gibt, endlich aus dem bloßen Internetaktivismus und der neoliberalen Selbstverkapselung, die auch die politische Praxis formt, herauszukommen. Dass Gewalt gegen Frauen nicht nur grundsätzlich mit dem Kapitalismus zusammenhängt, sondern ganz konkret mit Regierungsentscheidungen, dem Gesundheitssystem und mit der ökologischen Krise, war für mich eine zentrale feministische Erkenntnis der letzten Jahre. In „Uns bewegt der Wunsch“ und Extraktivismus und die „tiefen Spaltungen“ im politischen Subjekt Frau habe ich versucht, diesen Erkenntnisprozess zu umreißen.
Theorie als Weg in die Welt
Die gesellschaftlichen Krisen der letzten Jahre – Pandemie, Klimawandel, Rechtsruck – haben mich also dazu gebracht, meine Sicht auf feministische Theorie neu auszurichten. Ich bin weit davon abgekommen, eine Theoriebildung anzustreben, die einfach freischwebende Kritik am Großen und Ganzen sein will. Ich habe kein Interesse daran, als kritischste aller Kritikerinnen Theorie als persönliches Trostpflaster gegen eine unveränderlich schlechte Welt zu benutzen. Dass die gesamte Linke in Deutschland – nicht nur die radikale, auch die parlamentarische – zu einem marginalen Grüppchen geschrumpft ist, adelt nicht die Haltung, auf einsamen Adlerschwingen über den Dingen zu segeln. Ich sehe feministische Theoriebildung vielmehr als Weg in die Welt hinein, zur emanzipatorischen Verständigung mit anderen Menschen, besonders Frauen und Feminist*innen.
Dass ich sie als Prozess der Öffnung begreife, als Möglichkeit, Eigenes nach außen hin zu vermitteln und darüber einen Platz in der Welt zu finden, hat auch persönliche Gründe, u.a. mein Selbstverständnis als Schriftstellerin. Sie sind sicherlich nicht verallgemeinerbar. Ich halte es aber für wichtig, sich klar zu machen, worin das eigene politische Begehren und die eigenen Abneigungen wurzeln: psychisch, historisch, sozioökonomisch. Der persönliche Nährboden hinterlässt seine Spuren in der Theorie und im Aktivismus. In meinem Fall ist es die Selbstabdichtung gegen die Welt; ich kenne sie allzu gut und halte sie vielleicht deshalb nicht mehr gut aus. Politisch findet sich eine solche Abdichtung in der adornitischen Attitüde wieder, Theorie als Flaschenpost an eine verständnisvollere Nachwelt zu verstehen. Aber sie steckt auch in der Tendenz queerfeministischer Sprachregelungen, zwischenmenschliche Begegnungen außerhalb der eigenen Politblase zu erschweren.
Wie kann eine welthaltige Theorie aussehen? Im Juli 2022 ging ich zu einem Vortrag von Katharina Oguntoye – der damaligen Schirmherrin des Leipziger CSD – über Audre Lorde und die afrodeutsche Frauenbewegung. Ich war sehr angetan von Oguntoyes kämpferischer, klarer, aber völlig unprätentiöser und auch entspannter Haltung. So zu sprechen, dass viele mich verstehen können, und dennoch das Schwierige und Widersprüchliche nicht zu meiden, ist mein Ideal als politische Schriftstellerin. Katharina Oguntoye und viele weitere Vertreterinnen der Zweiten Frauenbewegung können und konnten das. Als einem Kind der bewegungsfernen 1990er und 2000er Jahre, als zuallererst theoretische Feministin fällt es mir unglaublich viel schwerer, mich verständlich zu machen. Auch auf Vorträgen höre ich ab und zu, dass meine Kritik ja interessant wäre, aber schwierig zu verstehen, gerade abends nach der Arbeit oder einem langen Tag an der Uni.
Natürlich braucht es auch bei der Leser*in und Zuhörer*in eine gewisse Hartnäckigkeit, sich mit theoretischen Dingen befassen zu wollen. In Der lange Sommer der Theorie beschreibt der Historiker Philipp Felsch, dass die Linke in den 1960er bis 1980er Jahren – also auch die Zweite Frauenbewegung – noch sehr viel mehr Hoffnung damit verband, die Welt über Theorie zu verstehen und zu verändern, als es heute der Fall ist.
Augenfällig ist die Distanz aktueller feministischer Theorie zu Geschlechterfragen im Alltag. In „Uns bewegt der Wunsch“ habe ich in der Auseinandersetzung mit lateinamerikanischen Feministinnen untersucht, unter welchen gesellschaftlichen Bedingungen feministische Theorie im Hier und Jetzt produziert wird. Meist sind das die Universität und die Subkultur – Bereiche, die einen sehr begrenzten Teil der Gesellschaft ansprechen und häufig eher auf Abdichtung nach außen als auf Vermittlung bedacht sind. Ich habe versucht, dieses Buch auf eine Weise zu schreiben, die weder zu akademisch noch zu subkulturell geprägt ist. Ich wollte die einfachsten Wörter und Sätze benutzen, die einer feministischen Analyse der Verhältnisse gerecht werden; Wörter, die am ehesten aus dem Alltag und der Erfahrung kommen.
Ein transnationaler Ansatz
Aber wie kommt Erfahrung, wie kommt Welt in die Theorie? Ich will nicht einfach meine Erfahrung kundtun, sondern sie mit der Erfahrung anderer Frauen und Queers über Theorie vermittelbar machen. Daher ist Transnationalität ein zweites zentrales Stichwort dieses Bandes. Die These, die ich ihm voranstellen möchte, ist: Materialistischer Feminismus muss transnational sein, weil das kapitalistische Patriarchat global ist.
Im einleitenden Artikel von Feministisch streiten habe ich das Theorem von Gleichheit und Differenz innerhalb des feministischen Subjekts entwickelt. Die Lage von Frauen und LGBTI (Lesben, Schwulen und Bisexuellen sowie trans- und intergeschlechtlichen Menschen) weltweit ist nicht gleich, aber vergleichbar. So unterscheiden sich die Lebenssituation und der Möglichkeitsspielraum einer rassifizierten Frau in Deutschland von denen einer weißen deutschen Muttersprachlerin. Sie unterscheiden sich strukturell hinsichtlich ihrer Lohnarbeitsverhältnisse, sozialstaatlichen Absicherung, gesundheitlichen Versorgung und Möglichkeiten zur sexuellen Selbstbestimmung. Sie unterscheiden sich voneinander – und noch einmal stärker von einer indigenen Frau in einem argentinischen Erdölabbaugebiet. Auf der anderen Seite eint alle drei Frauen, ob cis oder trans, die Last der gesellschaftlichen Erwartung, dass Frauen im Rahmen der kapitalistischen Produktionsweise Haus- und Sorgearbeit verrichten sollen, die schlecht oder gar nicht bezahlt wird. Zugleich wiegt diese Last – im Rahmen der postkolonialen internationalen Arbeitsteilung – für rassifizierte Frauen häufig schwerer. Im Interesse eines breiteren Verständnisses der frauenfeindlichen Gesellschaft ist es wichtig, diese Gemeinsamkeiten und Unterschiede herauszuarbeiten. Nach wie vor glaube ich, dass wir uns nur so auf die Suche nach geteilten politischen Anliegen von Feminist*innen weltweit machen können. Auch für die Verständigung über Differenzen, die immer wieder in die Zusammenarbeit hineingrätschen, hilft es, Unterschiede und Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten.
Ich beziehe den Begriff des Transnationalen also auf die Annahme, dass Geschlecht und geschlechtliche Arbeitsteilung mit der globalen Durchsetzung des Kapitalismus überall auf der Welt dieselbe gesellschaftliche Form angenommen haben: ein binäres und hierarchisches Geschlechterverhältnis, das von einem männlichen, weißen Subjekt und seinen Abspaltungen ausgeht. Dadurch werden Frauen, Queers, Rassifizierte und Jüd*innen, aber auch Kinder in die schlechteren Positionen der Gesellschaft abgedrängt und erfahren ein besonders hohes Maß an Ausbeutung und Gewalt. Weil mir die Verknüpfung von Geschlecht und Produktionsweise besonders wichtig ist, spreche ich vom kapitalistischen Patriarchat. Damit soll nicht gesagt sein, dass ich etwa Rassismus für weniger grundlegend für die herrschende Gesellschaftsform halte; ich halte ihn vielmehr für genauso konstitutiv wie Sexismus oder Antisemitismus. Aber mein Erkenntnisinteresse ist ein primär feministisches. Andere Theoretiker*innen mögen andere Begriffe bevorzugen, um etwa eine zuvörderst antirassistische Theorie zu formulieren.
Als ich für dieses Buch tiefer und transnational vergleichend die kapitalistisch-patriarchalen Verhältnisse untersucht habe, fiel mir auf, dass bestimmte Kategorien, an denen ich Gleichheit und Differenz bisher angesetzt hatte, zu grob und nicht verallgemeinerbar sind. So hielt ich die bürgerliche Kleinfamilie als soziale Organisationsform des Kapitalismus lange für universell. Antirassistischen Theoretiker*innen wie Shulamith Firestone und Saidiya Hartman verdanke ich die Einsicht, dass es zur spezifischen Unterdrückung schwarzer Frauen gehört, in den reproduktiven Dienst weißer Kleinfamilien gestellt zu werden. Die Gründung einer eigenen Familie wurde und wird ihnen durch schlechtere, auf Überausbeutung gründende Arbeitsbedingungen und rassistische Kriminalisierung v.a. der Männer strukturell erschwert. Ich musste also mein analytisches Instrumentarium überprüfen und verfeinern.
Indem ich meine Annahme eines kapitalistischen Patriarchats in einen transnationalen Bezugsrahmen setze, knüpfe ich an den Internationalismus der Arbeiter*innen- und der Frauenbewegungen an. Dennoch hantiere ich überwiegend mit dem Begriff transnational, um auszudrücken, dass es mir weniger um Beziehungen und Verflechtungen zwischen kapitalistischen Nationalstaaten und ihren Staatsbevölkerungen geht, wie es der Begriff international häufig ausdrückt (etwa in „internationaler Arbeitsteilung“). Der Staat ist nicht Adressat meiner Analyse, und seine Kategorien, z.B. deutsche oder internationale Gesetze, geben nicht ihren Rahmen vor. Mir geht es um Geschlecht und geschlechtliche Arbeitsteilung als transnational wirksame Kategorien; und es geht mir um Feminismus als transnationales, staatenübergreifendes Projekt, das verschiedene und doch vielfach miteinander verbundene Analysen, Aktionsformen und Anknüpfungspunkte hervorbringt.
In dieser Hinsicht beschäftigte mich besonders die feministischen Revolutionsversuche im Iran in den Jahren 2022 und 2023. Während diese Bewegung sich nachdrücklich auf die universelle Geltung von Frauen- und Menschenrechten bezog, las und diskutierte ich in einem neuen Lesekreis antikoloniale Feminist*innen. Sie betonten, dass die universalistische feministische Perspektive häufig die Rolle des Kolonialismus vernachlässige, der das gesellschaftliche Frausein global sehr verschieden präge. Beide Perspektiven schienen mir wichtig und notwendig für einen transnationalen Ansatz. In Pro Kopftuch und kontra Abtreibung habe ich versucht, diesen Widerspruch anhand der universalistischen Forderung nach Selbstbestimmung zu entfalten.
Ich suche die Lektüre von und die Nähe zu Feminist*innen aus anderen Milieus, Orten und Zeiten. Vormals war es v.a. die Zweite Frauenbewegung, heute sind es exiliranische, lateinamerikanische und osteuropäische Feminist*innen oder welche aus der DDR. Obwohl ich aus Ostdeutschland komme, habe ich lange ausschließlich die Geschichte der westdeutschen Frauenbewegung als meine eigene gesehen. Mittlerweile halte ich ein Verständnis der Frauen- und Lesbenkämpfe der DDR und der widersprüchlichen realsozialistischen Emanzipation der Frauen für einen unerlässlichen Beitrag zum deutschsprachigen Feminismus. Es ist kein Zufall, dass mit dem transnationalen Ansatz zugleich der Fokus auf Leipzig als meinen geografischen und gedanklichen Ausgangspunkt größer geworden ist. Die Frage nach globalen Gemeinsamkeiten hinsichtlich der Arbeitsbedingungen und Freiheitsmöglichkeiten von Frauen schärft den Blick für die regionale Geschichte und Gegenwart – und umgekehrt.
Frau, Leben, Freiheit
Im September 2022 war ich überwältigt von den revolutionären Erhebungen im Iran. Der staatliche Femizid an Jina Mahsa Amini, die angeblich ihr Kopftuch nicht richtig getragen hatte, löste im gesamten Land Aufstände aus, die an Mut und Vielgestaltigkeit ihresgleichen suchen. Unter dem Ruf „Jin, jiyan, azadî!“, der der kurdischen Frauenbewegung entstammt, mischten sich die feministische Forderung nach der freien Entfaltung von Frauen, Mädchen und LGBTI mit der Kritik am islamistischen Mullah-Regime, das seine Bürger*innen terrorisiert. Zugleich prangerten Demonstrant*innen die brutale nationalistische Unterdrückung von Kurd*innen, Belutsch*innen, Araber*innen und Afghan*innen an, die wiederum eng mit ökonomischer Ausbeutung in den Fabriken und auf den Feldern verbunden war. Daran schloss sich die Kritik an der Zerstörung der natürlichen Ressourcen des Landes, die den Anbau von Nahrungsmitteln und den Zugang zu sauberem Wasser erschwert. Auch die stetige Verteuerung der Energie- und Lebensmittelpreise und eine Corona-Politik der Verleugnung, die vermutlich viele tausend Iraner*innen das Leben gekostet hat, trieben weitere Massen auf die Straße.
Mich begeisterte das Ineinandergreifen dieser vielen Themen, das jedem intersektionalen Ansatz zum Forschungsobjekt werden müsste. Auch dass es keine führenden Persönlichkeiten oder Organisationen gab, beschäftigte mich, und dass die Schnittmengen der Demonstrierenden zwischen Feminismus, Sozialismus, Arbeitskämpfen, Sozialismus, Antirassismus, Bürgerbewegung bis hin zu Nationalismus und Royalismus changierten. Genauso vielseitig waren die Protestformen: Massendemonstrationen, Fabrik-, Schul- und Universitätsstreiks, öffentliche Kritik von Prominenten, Online-Aktionen junger Frauen, die vor der Kamera tanzten, sich das Haar abschnitten, jemanden küssten oder andere illegale Dinge taten; Männer, die unverschleierte Frauen in der U-Bahn gegen Sittenpolizistinnen unterstützten oder Mullahs die Turbane vom Kopf stießen; Familien und Gemeinden, die an den Gräbern ihrer ermordeten Kinder sangen, tanzten und zu weiterem Widerstand aufriefen. In den meisten Fällen riskierten diese Iraner*innen ihr Leben.
Ich war zutiefst beeindruckt vom Mut und der Entschlossenheit der Bewegung. Sie besaß dieselbe Klarheit, wofür es sich zu leben und zu sterben lohnt, die ich seit vielen Jahren an muslimischen und exmuslimischen Feministinnen bewundere, die sich aus religiöser patriarchaler Unterdrückung befreit haben und dafür kämpfen, dass alle Frauen und Mädchen selbstbestimmt leben können.
Zu ihnen zählt Mina Ahadi, die im Herbst 2022 in Leipzig einen Vortrag über reproduktive Selbstbestimmung im Iran halten sollte. Aufgrund ihres Engagements für die Proteste erhielt Ahadi massive Todesdrohungen vom panisch gewordenen Regime: Sie werde den Vortrag nicht überleben. Die Polizei überließ die Verantwortung den Veranstalter*innen, der Gruppe Pro Choice, die den Vortrag schließlich ins Internet verlegte. In der Linken blieb der Vorfall weitgehend undiskutiert – vermutlich aus einem Gefühl der Ohnmacht heraus, plötzlich mit einer enorm repressiven politischen Macht konfrontiert zu sein, die ihre Arme in die eigene Stadt ausstreckt.
Was tun gegen die Ohnmacht? Was braucht es, um sich mit revolutionären Erhebungen anderswo zu solidarisieren – und hilft das überhaupt irgendjemandem? Ich teilte auf Social Media verwackelte Bilder und Videos aus dem Iran, ging zu Kundgebungen mit mehr Fahnen, mehr Leidenschaft, mehr lauten Männern und mehr Kunstblut, als ich es bis dato gekannt hatte; richtete ein VPN ein, um Leuten im Iran freien Internetzugang zu ermöglichen, und versuchte, so viel wie möglich von iranischen und exiliranischen Aktivist*innen mitzukriegen.
Doch bald füllte sich mein Instagram- und Facebook-Feed mit blutigen Bildern und schwarzgerahmten Porträts. Schnell wurde klar, dass das Regime zu keinerlei Zugeständnissen bereit war und aus dem Ausland – auch von der deutschen Regierung – wenig zu befürchten hatte. Sie lassen die Mörder einfach machen, stellte ich fest und befasste mich mit der verschiebbaren Rolle von Frauenrechten in internationalen Beziehungen. Währenddessen verhaftete, folterte, vergewaltigte das Regime tausende Demonstrant*innen; im Dezember 2022 begannen die Hinrichtungen. Die Proteste dauerten fort und gingen erst sehr allmählich, unter dem Eindruck brutalster Repression, zurück.
Ich habe, aus der Ferne, eine feministische Revolte miterlebt, die mich tief bewegt hat, weil sie meine eigenen Fragen und Kämpfe berührt. Auch dieses – vorläufige – Scheitern begleitet seither meine politische Arbeit.
Materialismus als Abgrenzung?
Während die Welt näher rückte, fragte ich mich oft: Welche Rolle spielt heute das Beharren auf einem materialistischen Feminismus? Oben habe ich ausgeführt, dass ich Materialismus nicht mehr in erster Linie als großen Gegenspieler zum Queerfeminismus verstehe. Im Interesse einer streitbaren feministischen Bewegung, die sich über Gemeinsamkeiten und Differenzen verständigen kann, wäre es ganz unproduktiv, die materialistische Feministin als identitäre Selbstauskunft in Stellung zu bringen.
Zudem scheint sich gerade in Social-Media-Kontexten die verkürzte und falsche Queerkritik durchgesetzt zu haben, Materialismus bedeute, Weiblichkeit und Männlichkeit geradlinig auf Biologie zurückzuführen. In Warum Materialismus nicht Transfeindlichkeitbedeutet verteidige ich den materialistischen Feminismus gegen diese Vereinnahmung.
In Das feministische Wir und Über die Gewalt im Geschlechterverhältnis führe ich aus, dass materialistischer Feminismus für mich zu einem großen Teil Subjekttheorie bedeutet. Streit ist ein intersubjektives Geschehen – das macht seine Schwierigkeit und seinen Reiz aus. Im Zusammenhang damit beziehe ich mich in der Tradition feministischer Marxist*innen auf die geschlechtliche Arbeitsteilung als grundlegendes Übel der patriarchalen Gesellschaft, das – verwoben mit den Ideologien Sexismus, Rassismus und Antisemitismus – die Subjekte formt.
Wichtige Erkenntnismethoden sind für mich die feministische Psychoanalyse und der historische Materialismus. Ein weiterer großer Punkt ist das utopische Denken aus der frühen kritischen Theorie Max Horkheimers: Kritische Theorie zielt darauf, den Gegenstand der Kritik, etwa den Kapitalismus, nicht nur gedanklich zu untersuchen, sondern auch abzuschaffen. Materialistische Patriarchatskritik ist also niemals Selbstzweck oder akademisches Glasperlenspiel, sondern strebt danach, das kapitalistische Patriarchat auch in der Realität zu überwinden. Dieser utopische Bezug bringt wiederum den Gedanken der Emanzipation in die Theorie: Emanzipatorisch ist, was aus dem Bestehenden herauswill in einen anderen, nicht mehr frauen- und queerfeindlichen gesellschaftlichen Zustand.
Aus einer materialistischen Perspektive kritisiere ich Intersektionalität und Dekonstruktivismus als queerfeministische Methoden. Ersteres wird hoffentlich in „Ich bin eine stolze jesidische Lesbe und will euch Mut machen“ deutlich, ein Text, den ich über meine Begegnung mit Azadiya H. und ihren Kampf gegen Ehrenmorde geschrieben habe.
Über Dekonstruktivismus schreibt Friederike Beier in ihrem jüngst erschienenen Sammelband Materialistischer Queerfeminismus, mit dem sie beide Theorierichtungen einander näherbringen will, „dass der materialistische Feminismus durch die Methode des historischen Materialismus Geschlecht und Sexualität als konstruiert versteht. Ein materialistischer Feminismus ist somit schon in seiner Entstehung dekonstruktiv und in Ansätzen sogar queertheoretisch, etwa wenn wie bei Wittig der Theoretisierung von lesbischen Lebensweisen eine zentrale Rolle zukommt“ (Beier 2023, S. 10).
Es ist im Sinn feministischen Streitens, auf die gemeinsame konstruktivistische Grundannahme zu verweisen. Dennoch halte ich es für nötig, an der Kritik des queerfeministischen Dekonstruktivismus festzuhalten. Im Anschluss an den Poststrukturalisten Jacques Derrida wird darin Feminismus in erster Linie als Diskursanalyse verstanden. Realität erscheint als Text. Das zeigt sich in der gängigen Wendung, dass Menschen „als etwas gelesen werden“, etwa weiblich, weiß, hetero (obwohl sie in Wirklichkeit vielleicht queer sind oder eine Migrationsgeschichte haben). Die naheliegende Befreiungsmethode wäre also, in den normativen Text einzugreifen und darüber die sprachliche oder sogar die soziale Norm zu dekonstruieren. Das kann z.B. bedeuten, Andere nicht (vorschnell) geschlechtlich einzuordnen, indem man sagt „Ich meine die Frau im gelben Pulli“, sondern zu sagen, wie es mittlerweile in linken Kreisen üblich geworden ist, „die Person im gelben Pulli“. Dadurch werde die Norm gebrochen und – um in der Textmetapher zu bleiben – umgeschrieben: Man übt sich darin, Menschen weniger anhand der binären Gruppen Mann oder Frau, Mädchen oder Junge einzuteilen, sondern aufmerksam für weitere Geschlechtsausdrücke oder einfach andere Persönlichkeitsmerkmale zu sein.
Mittlerweile räume ich der Möglichkeit eines veränderten Umgangs mit Geschlecht im Alltag mehr emanzipatorischen Raum ein als früher. Ich empfinde diese Versuche nicht mehr so stark als einengende Sprechverbote, die meine eigene Wahrnehmung negieren. Vielleicht hängt das damit zusammen, dass viele queerfeministische Gruppen und Institutionen ihre Kritik am normativen Sprachgebrauch heute stärker mit anderen feministischen Handlungsfeldern verbinden. Wenn die Gewalt gegen LGBTI im öffentlichen Raum ansteigt oder der italienische Staat lesbischen Co-Müttern die Elternschaft aberkennt, bleibt nicht mehr so viel Raum, die patriarchale Welt vorrangig als Diskurs zu rezipieren. Der stärker werdende Zwang der Verhältnisse lässt sich in der Textmetaphorik kaum fassen. Dekonstruktion, so mein Eindruck, wird weniger als ausreichende Form der Gegengewalt in Stellung gebracht.
Dennoch möchte ich weiterhin materialistisch eine Spannung zwischen der als konstruiert erkannten Realität und ihrer noch bevorstehenden Abschaffung geltend machen. Die Realität wurde als konstruiert – falsch konstruiert – erkannt und bleibt dennoch vorerst real. Die patriarchale Zweigeschlechtlichkeit und ihre Ausschlüsse lassen sich nur durch eine tiefgreifende Umwälzung der Produktionsverhältnisse und ihrer Reproduktion abschaffen. Zwar bestreiten das weder Beier noch die französischen Materialistinnen der 1970er Jahre, auf die sie sich bezieht. Aber die angebliche Macht der sprachlichen und sozialen Dekonstruktion ist heute ein fester Bestandteil linker Grundannahmen: etwa, wenn Feminist*innen einander unerträgliche sprachliche Gewalt vorwerfen, ohne das mit anderen Formen patriarchaler Gewalt abzugleichen, gegen die man gemeinsam vorgehen müsste. Im ungünstigsten Fall werden physische, psychische, sexuelle und institutionelle Gewalt völlig unterschätzt – je nachdem, wer wie darüber spricht und schreibt.
Dazu kommt, dass der Fokus auf einem diskriminierungsfreien Sprechen und Schreiben in den letzten Jahren zum Angriffspunkt eines Kulturkampfs von rechts geworden ist. Auch das erschwert es mitunter, sich für eine feministisch reflektierte Sprache einzusetzen, deren Wirkung aber nicht völlig zu überschätzen.
Die Kämpfe um sprachliche Deutungshoheit, z.B. wenn es um geschlechtsanzeigende Pronomen geht, sind durchzogen von einem Nebeneinander verschiedener theoretischer Annahmen, die häufig nicht thematisiert werden. So liegt der Praxis, den eigenen Namen mit einem gewünschten Pronomen anzugeben („Anne, sie/ihr“ oder „Leo, kein Pronomen“), ein spezifisch queeres Konzept von Geschlechtsidentität zugrunde, das die Selbstdefinition betont. Ich habe oft gehört, dass es für viele trans oder nichtbinäre Personen eine Erleichterung bedeutet, wenn in Vorstellungsrunden routinemäßig nicht nur der Name, sondern auch ein Pronomen genannt wird. Von cisweiblichen Feministinnen, die ihr Frausein zuvörderst als patriarchale Zumutung verstehen, kann es hingegen als anmaßend empfunden werden, sich als „sie“ ausweisen zu sollen: als hätten sexistische Zwänge nicht alles getan, um meinen Körper, meine Mimik und Gestik und mein Sozialverhalten von frühester Kindheit an als weiblich zu markieren.
Ich halte nichts davon, sich für diese Marker blind zu stellen (sofern nicht andere Marker, etwa das Styling einer Person oder geschlechterpolitische Codes, die sie trägt, Hinweise geben, dass sie sich mit der zugeschriebenen und wahrscheinlich sozialisierten Weiblichkeit nicht identifiziert). Die Einordnung als Frau ist für mich eine gesellschaftliche; sie in die eigenen Hände zu nehmen, wäre – anders vielleicht als für eine trans Frau – kein befreiender Akt. Mich nicht an einer verallgemeinerten Pronomenrunde zu beteiligen und das auch freundlich begründen zu können, ohne die Pronomenwünsche von Gesprächsteilnehmer*innen zu missachten, erfordert die hohe Kunst feministischen Streitens.
Hier befinde ich mich in einer ähnlichen Situation wie vor zehn, zwölf Jahren – wenn ich nämlich darauf bestehen muss, dass es durchaus verschiedene Vorstellungen davon gibt, auf welche Weise man sich am besten gegen geschlechtliche Zwänge zur Wehr setzt. An dieser Stelle könnte eine gemeinsame, respektvolle Erkundung, wie man die Konstruktion von Geschlecht jeweils genau interpretiert und welche eigenen Erfahrungen dabei eine Rolle spielen, hilfreich sein. Um solche Differenzen deutlich zu machen, ist eine analytische Unterscheidung von materialistischen und queertheoretischen Konzepten von Nutzen. Meiner Erfahrung nach sind unverstandene Konflikte auf lange Sicht am destruktivsten: Konflikte, in denen die Differenz und das Unbehagen unverstanden bleiben, in denen man nicht zu fassen kriegt, warum die andere Feminist*in plötzlich so schrecklich ist.
Ich teile Friederike Beiers Anliegen, politische Differenzen nicht unnötig zuzuspitzen und zu Grabenkämpfen um Labels auszuweiten, sondern sich auf Gemeinsamkeiten zu konzentrieren und Bündnisse gegen gemeinsame politische Feinde sowie antikapitalistische Utopien zu schmieden. Dennoch müssen Differenzen ihren Platz in feministischen Räumen haben, müssen sie artikuliert und auf produktive Weise ausgetragen werden können. Ich plädiere dafür, die Differenz – wie am Beispiel der Pronomenrunde beschrieben – am jeweiligen Gegenstand auszudiskutieren, statt sie als Identitätsmarker ins Feld zu führen. Dann würde es schnell heißen: Ich bin für Transrechte, du etwa nicht? Die andere Seite würde antworten: Ich bin für Frauenrechte, du nicht?, und es könnte ein dicker Kreidestrich mitten durch den Raum gezogen werden.
Zugleich müssen die Punkte erkannt und benannt werden, an denen die politische Differenz zu groß wird, um weiter feministisch zusammenzuarbeiten. Das kann offene Transfeindlichkeit sein. Nach dem 7. Oktober 2023, dem Tag des Hamas-Massakers an israelischen Zivilist*innen, lautete der Punkt für mich: Antisemitismus unter Feminist*innen. Sehr, sehr viele queere, antikoloniale und intersektionale Feminist*innen gingen danach mit antisemitischer Israelkritik an die Öffentlichkeit. In Der übliche blinde Fleck habe ich mich damit befasst, dass das kein Zufall war. Dieser Antisemitismus gründet vielmehr in den Grundannahmen der antikolonialen Theoriebildung, die nicht identisch mit queeren Theorien ist, aber große inhaltliche Überschneidungen mit ihnen aufweist. Ein beschämendes Beispiel ist die Leugnung der Vergewaltigungen israelischer Frauen durch Hamas-Kämpfer, die als rassistisches Diskursprodukt beschrieben werden. Die queerfeministische Ikone Judith Butler zweifelte noch im März 2024 an den Gewalttaten, die Sanitäter*innen, Forensiker*innen, Journalist*innen und auch die Täter selbst dokumentiert hatten (Schmid 2024). Auch die palästinensische Leipziger Gruppe Handala postete: „Einfach widerlich, dieser ungebremste koloniale Rassismus! Die braunen Barbaren, natürlich vergewaltigen sie weiße Frauen. Es gibt keine Beweise von Vergewaltigungen durch die Hamas-Widerstandskämpfer“ (zit. n. X-Post von @jamesholdenOG vom 28.6.2024).
Der 7. Oktober hat gezeigt, dass Antisemitismus innerhalb eines dekonstruktivistischen und intersektionalen Feminismus zur Leugnung von Gewalt gegen Frauen führt, wenn sie Jüdinnen sind. Hier stellt sich die Frage nach theoretischer Abgrenzung – und danach, wie es weitergehen kann mit der Suche nach der transnationalen feministischen Bewegung.
Bewegung statt Setzung
Während der Entstehungszeit von Feministisch streiten 2 ist der Drang stärker geworden, über materialistische Absichtserklärungen hinauszugehen und mich an konkreten Gegenständen abzuarbeiten. Das beinhaltet natürlich das Risiko fehlzugehen, misszuverstehen, den Gegenstand nicht voll zu erfassen, ihn nicht mehr unter einen Hut zu bekommen. Die Gegenstände meiner Kritik sind offener und vieldeutiger geworden, haben neue Fäden ausgestreckt und sich mir immer wieder entwunden.
Der Hut, den ich ihnen dennoch aufsetzen kann, ist: Es geht mir um das Streiten als Bewegung – zwischen Standpunkten und zwischen feministischen Subjekten. Eine glasklare politische Agenda ist in vielen Situationen von Vorteil, sie verleiht Geschlossenheit, Stärke und oftmals Anziehungskraft. Aber die Bewegung, die ich suche, ist keine Marschformation. In diesem Band möchte ich – bei allem Bemühen um Klarheit und Verständlichkeit – einer uneindeutigen Theorie das Wort reden, einer Theorie, die riskiert, am Gegenüber und an der Praxis fehlzugehen, sich aber gerade darin offen hält für uneinheitliche Erfahrungen, überraschende Begegnungen und neue Horizonte, die in der Welt und zwischen Feminist*innen entstehen.
Das feministische Wir
… und der Kampf um das Recht auf Abtreibung
Der erste Band von Feministisch streiten beginnt mit einem flammenden Plädoyer für das politische Subjekt Frau. Im Sinne einer streitbaren Auseinandersetzung schlug ich vor, nicht länger die Differenzen zwischen Feminist*innen absolut zu setzen und gegeneinander zu werfen. Ebenso wenig fruchtbar fand ich es, von einem vermeintlich eindeutigen, überzeitlichen Subjekt Frau auszugehen, das überall auf der Welt gleich wäre. Stattdessen plädierte ich dafür, Gleichheit und Differenzen innerhalb des gesellschaftlichen Frauseins zu verhandeln und uns darüber in Beziehung zueinander und zu unseren politischen Anliegen zu setzen (Linkerhand 2018).