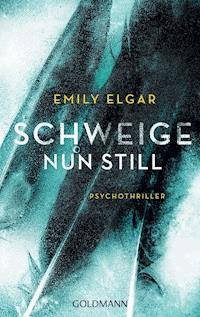7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
In dem Städtchen Ashford kennt jeder Meg und ihre Tochter Grace, und jeder liebt sie. Trotz ihres harten Schicksals sind beide stets für andere da. Dabei ist Grace schwer krank, und Meg rund um die Uhr aufopferungsvoll mit ihrer Pflege beschäftigt. Eines Morgens macht ihre Nachbarin Cara eine Entdeckung, die die ganze Stadt erschüttert: Meg liegt brutal ermordet in ihrem Blut – und von Grace fehlt jede Spur. Wer wäre zu so einer Tat fähig? Ausgerechnet der Journalist Jon, vielleicht der meistgehasste Mann in Ashford, unterstützt Cara auf ihrer Suche nach der Wahrheit. Doch die führt sie an einen tödlichen Abgrund …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 475
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Buch
In dem Städtchen Ashford kennt jeder Meg Nichols und ihre Tochter Grace, und jeder liebt sie. Trotz ihres harten Schicksals sind beide stets für andere da. Dabei ist Grace schwer krank, und Meg rund um die Uhr aufopferungsvoll mit ihrer Pflege beschäftigt. Eines Morgens macht ihre Nachbarin Cara eine Entdeckung, die die ganze Stadt erschüttert: Meg liegt brutal ermordet in ihrem Blut – und von Grace fehlt jede Spur. Wer wäre zu so einer Tat fähig? Ausgerechnet der Journalist Jon, vielleicht der meistgehasste Mann in Ashford, unterstützt Cara auf ihrer Suche nach der Wahrheit. Doch die führt sie an einen tödlichen Abgrund …
Weitere Informationen zu Emily Elgar
sowie zu lieferbaren Titeln der Autorin
finden Sie am Ende des Buches.
Emily Elgar
Finde sie
Roman
Aus dem Englischen
von Karin Diemerling
Die englische Originalausgabe erschien 2020 unter dem Titel »Grace is Gone« bei Sphere, an imprint of Little, Brown Book Group, London.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Deutsche Erstveröffentlichung Februar 2021
Copyright © der Originalausgabe Emily Elgar 2020
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2021
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München
Umschlagmotiv: Dmitry Ageev/Getty Images
Redaktion: Susanne Kiesow
KS · Herstellung: kw
Satz: KompetenzCenter, Mönchengladbach
ISBN: 978-3-641-25703-3V001
www.goldmann-verlag.de
Besuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz
Dieses Buch ist meinen wundervollen Eltern gewidmet –
Edward und Sandy Elgar.
»Danke« ist ein unzulängliches Wort für all die Liebe, die ihr gebt – aber es ist das einzige Wort –, also: Danke.
Prolog
Megan
Grace weiß nichts davon, aber jede Nacht so gegen zwei gehe ich zu ihr. Es fing an, als sie noch ein Kleinkind war, und auch jetzt noch, so viele Jahre später, schleiche ich mich in ihr Zimmer und hebe ihre Decke an, um nachzusehen, ob in ihrer knochigen Brust noch Atem flattert, ob ihr schwaches Herz noch arbeitet. Heute ist eine von diesen Nächten, in denen ich mich bemühe, tapfer zu sein und mich zu beherrschen. Ich starre an die Decke, mache meine Beine schwer.
Bleibt liegen, befehle ich ihnen.
Ich versuche, an etwas anderes zu denken. Überlege, was Grace anziehen soll, wenn wir in zwei Wochen die neue Kinderstation in Taunton besuchen, schließlich könnten wir fotografiert werden. Doch nicht einmal das funktioniert. Ich sehe Grace nicht für die Kamera lächeln, eine hübsche Spange in ihren kurzen, abstehenden Haaren, sondern in ihrem Bett auf der anderen Seite des Flurs, wie sie mit ihrem kleinen Rosenmund nach Luft schnappt, ihre Lippen erst grau, dann blau werden. Ich sehe ihre grünen Augen, so nackt ohne die Brille, angstvoll, verzweifelt, die im Dämmerlicht des Zimmers nach mir suchen, und bevor ich etwas dagegen tun kann, bin ich auch schon aus dem Bett, über den Flur und an ihrer Seite. Sofort taste ich nach ihrer warmen Brust. Sie hebt und senkt sich, langsam und stetig, so wie es sein soll. Das genügt mir aber nicht. Ich beuge mich dicht über sie, dass meine Wange fast ihren Mund streift, und fühle den warmen Hauch, fühle ihr kleines Leben warm und rhythmisch an mein Gesicht pusten. Alles in Ordnung. Erst jetzt kann ich selbst wieder normal atmen.
Ich stecke ihre Hände unter die Decke mit den Gänseblümchen, ihrem Lieblingsmuster, und streichele sacht über ihren Körper, der nicht mehr als ein kleiner Hügel ist. Sie schläft tief und fest heute Nacht. Dr. Parker sagte, dass die Medikamente, die er ihr nach der Operation verschrieben hat, sehr müde machen würden. Kein Grund zur Sorge.
Ich hebe Flopsy mit den abstehenden Ohren vom Boden auf und setze sie oben auf Grace’ Kissen. Die Fenster sind eindeutig verschlossen. Es ist mir einfach zur Gewohnheit geworden, nach ihr zu sehen, ich kann nichts dafür. Die Schwestern meinen, das sei normal, vollkommen natürlich. Sie streicheln meinen Arm und sagen, dass es ihnen genauso gehen würde, nach all dem, was wir durchgemacht haben. Ich schüttele das herzförmige Kissen in ihrem Rollstuhl auf. Sie meinen damit nicht nur Danny. Sie meinen den Tag, als Grace mit Schaum vorm Mund in die Notaufnahme eingeliefert wurde, den Tag, an dem wir schließlich zu der Entscheidung kamen, dass sie nur durch eine Sonde im Magen ausreichend ernährt werden kann, den Tag, an dem er sie mir wegnehmen wollte, so wie damals Danny. An der Tür bleibe ich noch einmal kurz stehen und sehe meiner kleinen Maus beim Schlafen zu. Ich lasse ihre Tür immer offen stehen, damit ich sie rufen höre, falls sie durch irgendetwas aufwacht.
Mein Bett ächzt unter meinem Gewicht, und als ich die Nachttischlampe ausschalte, denke ich, dass die Schwestern und Pfleger keine Ahnung haben, wovon sie reden. Es ist nicht das, was bereits passiert ist, das mich nachts furchtgetrieben in ihr Zimmer eilen lässt. Es ist die tickende Zeitbombe, die ich ständig höre, es sind die kostbaren Momente, die wir noch miteinander haben und die uns immer schneller zwischen den Fingern zerrinnen. Es ist die schreckliche Vorahnung dessen, was kommen wird: dass eines Tages die Tür entriegelt und langsam geöffnet wird, dann diese routinierten, entschlossenen Schritte folgen und ich noch so schnell zu ihr laufen, noch so sehr bitten und flehen und doch letztlich nichts tun kann, um uns beide zu retten.
1
Cara
Ich drücke länger auf die Klingel von Woodgreen Avenue 52, als vermutlich höflich ist. Es klingt dringlich, und das soll es auch, sollen sie ruhig wissen, dass ich es eilig habe. Meine Montagsmittagsschicht im »Ship« beginnt in einer halben Stunde.
Ich stelle mir Grace dort drin vor, wie sie ihr kleines Eulengesicht dem Klingeln zuwendet und dabei viel jünger wirkt als siebzehn, wie sie ihren Rollstuhl mit ihren dünnen Armen irgendwie durch den Flur auf mich zu manövriert, Meg in ihrer gewohnten Kluft aus Hausschuhen, Leggings und überweitem T-Shirt hinterdrein, ein freundlicher, verlässlicher Wachhund: »Komme schon!«
Ungeduldig stupse ich mit dem Bein gegen die Einkaufstasche voller Sommerkleidung – gewaschen, gebügelt und ordentlich zusammengelegt –, die Mum und ihre Freundinnen über Wochen für Meg und Grace gesammelt haben.
Macht schon.
Ich ziehe mein Handy aus der Hintertasche meiner zerrissenen Jeans, sehe auf den Bildschirm, der keine Nachrichten anzeigt, und stecke es wieder ein. Der Anstrich an Meg und Grace Nichols’ Haus ist frisch und riecht in der Junisonne noch penetrant nach Farbe. Natürlich haben sie sich für Rosa entschieden. Mum hat gesagt, dass »The Wishmakers«, die Wohltätigkeitsorganisation, die auch den rollstuhlgerechten Umbau des Hauses finanziert hat, es letzten Monat neu hat streichen lassen. Nebenan blättert die rote Farbe von Mums Tür- und Fensterrahmen ab, schält sich vom Holz wie verbrannte Haut.
Wo bleiben die nur?
Ich klingele noch mal. Sie sind normalerweise immer zu Hause. Vielleicht ist Meg gerade mit Grace im Bad? Oder sie wechselt ihre Magensonde – ich glaube, sie muss jede Woche gewechselt werden. Letztes Weihnachten hat Grace ihren Santa-Claus-Pulli hochgezogen, um mir das frische Loch in ihrem Bauch zu zeigen. Es sah aus wie eine kleine Augenhöhle, nur ohne Augapfel. Irgendwie bodenlos, wie bei einer Puppe, der man die Füllung herausgerupft hat.
»Gruselig, oder?«, sagte sie und sah mich dabei an. Ich zuckte nur die Achseln und wandte mich ab, damit sie nicht merkte, wie mulmig mir war.
Wieder werfe ich einen Blick aufs Handy. Vielleicht sollte ich die Tasche einfach hier vor die Tür stellen? Mit einem Zettel dazu? Aber Mum ist bestimmt sauer, wenn ich die Kleider nicht persönlich übergebe. Sie hat extra gewartet, dass ich sie rüberbringen kann, als würde sie mir damit eine besondere Freude machen. Sie selbst besucht die beiden mehrmals die Woche, und manchmal kommt sie mit feuchten Augen zurück. Sie sagt, Grace frage immer nach mir, ob ich einen Freund habe und so Sachen. Mum will ständig, dass ich zu ihnen rübergehe. Bisher konnte ich vorschieben, dass ich zu viel um die Ohren hätte dieses Jahr, das Abi nachholen, im Pub jobben und mit der Trennung von Chris fertigwerden. Doch vor zwei Tagen war die letzte Prüfung, und mir sind die Ausreden ausgegangen, also stehe ich jetzt hier. Das Problem ist, dass ich in letzter Zeit einfach nicht mehr weiß, worüber ich mit Grace reden soll. Es kommt mir gemein vor, ihr von meinen Plänen zu erzählen – dass ich studieren will, so schnell wie möglich raus aus Cornwall, dass ich für eine lange Indienreise im nächsten Jahr spare –, wenn das Highlight ihrer Woche ein Ausflug zum Strand runter mit ihrer Mutter ist.
Ich drücke die Nase an die geriffelte Milchglastür. Auch wenn der Bungalow für Grace’ Rollstuhl umgebaut wurde, ist sein Grundriss immer noch der gleiche wie bei Mums Haus und den anderen hundert Wohnhäusern der Summervale-Siedlung. Viel kann ich nicht erkennen, durch die Scheibe sieht alles aus wie unter Wasser. Ich taste nach dem Türgriff und drücke ihn herunter. Es ist offen. Als Erstes empfängt mich eine Luft, die warm ist und nach einem Raumspray mieft, von dem ich Nasenjucken bekomme und das »Sommerfrische« heißt. Weiß ich aus Erfahrung, weil Mum das Gleiche kauft.
»Hallo?«, rufe ich in die dumpfe Stille des Hauses hinein.
»Meg? Grace? Ich bin’s, Cara. Ich habe hier ein paar Kleider …« An der Tür zum Wohnzimmer bleibe ich stehen. Alles ist tadellos wie immer. Die beige Couchgarnitur glatt und sauber, die Sessel ordentlich gegenüber dem Sofa angeordnet, als würden die Möbel ihr eigenes Teekränzchen abhalten. Hochglanzfotos von Meg und Grace in herz- und sternförmigen Rahmen blicken vom Kaminsims. Hinter dem Sofa aber fällt mir etwas auf. Etwas ist nicht wie sonst, etwas gehört da nicht hin.
»Grace?« Langsam gehe ich darauf zu, und plötzlich bekomme ich Angst. Grace’ Rollstuhl ist umgekippt, ihr kleiner Plüschhase und das herzförmige Kissen, auf dem sie immer sitzt, sind über das Linoleum in Richtung Küche geschlittert. Der Anblick erschreckt mich, und ich haste um das Sofa herum, sehe die kleine schmale Grace schon verletzt und zerschrammt vor mir, ihre Brille zerbrochen. Aber da ist nichts – oder fast nichts. Nur ihr Tagebuch liegt auf dem Boden, dasselbe, das sie zwischen ihrer Hüfte und dem Stuhl eingeklemmt hatte, als wir uns vor etwa einem Monat zuletzt gesehen haben.
Außer im Bett kenne ich Grace nicht ohne ihren Rollstuhl. Sie sitzt schon so lange darin, mehr als die Hälfte ihres Lebens. Ich hebe das Tagebuch auf. In Megs Schlafzimmer am Ende des Flurs schlägt eine Uhr die halbe Stunde. Ein Wasserhahn tropft. Die Geräusche verändern die Atmosphäre, helfen mir, meine Sprache wiederzufinden.
»Hallo? Meg?«
Ich stecke das Tagebuch vorerst in die Kleidertüte, die ich jetzt abstelle. Dann gehe ich langsam durch den Flur. Mit jedem Schritt wächst meine Furcht. Irgendwo sirrt eine Fliege, das Blut rauscht in meinen Ohren, der Wasserhahn tropft. Plötzlich geht die Tür zur Toilette auf, und ich zucke vor Schreck zusammen, aber es ist nur Cookie, die rote Katze von Grace. Cookie würdigt mich keines Blickes, sondern tapst maunzend durch den Flur, um schließlich in Megs Zimmer zu schlüpfen. Ich folge ihr. Jetzt höre ich ein neues Geräusch, ein Brummen oder Surren. Verzweifelt klammere ich mich an den Gedanken, dass es das Radio sein könnte. Vielleicht haben Meg und Grace mich deswegen nicht gehört?
Doch als ich näher komme, wird mir klar, dass es kein elektrisches Brummen ist. Es klingt tiefer, merkwürdiger … irgendwie organisch. Mein Handrücken streift an der kühlen Wand entlang. Ein billiger Vanilleduft steigt mir in die Nase, süßlich, fast wie nach Fäulnis.
»Hallo?« Ich erkenne meine eigene Stimme nicht wieder, so brüchig und piepsig. Die Angst schnürt mir die Kehle zu. Ich berühre Megs Tür und will sie aufstoßen, als sie schon bei der ersten Berührung nach innen schwingt, wie begierig darauf, ein Geheimnis zu enthüllen.
Die Schmeißfliegen sehe ich als Erstes. Sie kreisen über ihr wie winzige Aasgeier. Meg liegt verdreht in ihrem zerwühlten Bettzeug, reglos und viel zu starr. Ihr Gesicht ist aschgrau, der trübe Blick auf etwas gerichtet, das für lebendige Augen unsichtbar ist, ihr Mund angstverzerrt. Die Stirn wirkt wie eingebrochen, hat keine Form mehr, ist nur noch eine dunkle, breiige Masse. Blutspritzer umgeben strahlenförmig ihren Kopf wie ein Heiligenschein. Ein Bein und ein Arm, voller blauer Flecken, hängen über die Bettkante, und von ihren rosa lackierten Fingernägeln tropft das Blut.
2
Jon
Ich stehe gerade mitten auf einer Weide, blicke auf ein totes Schaf und frage mich zum dreiundfünfzigsten Mal an diesem Tag, wie es so weit mit mir kommen konnte, als mein Handy brummt und eine SMS ankündigt. Der Farmer stößt das blutige Schaf mit dem Fuß an, als wollte er das arme Tier auffordern zu bezeugen, dass es »diese verdammten Zigeuner und ihre verdammten Hunde« waren, die ihm die Speiseröhre aus der Kehle gerissen haben. Ich sage mir, dass das hier meine zweite Chance ist. Dass ich froh sein kann, diesen Job zu haben und damit die Möglichkeit, meinen Sohn Jacob weiterhin zu sehen. Nicht jeder bekommt eine zweite Chance. Während Mr Leeson, der Farmer, sich über sein im Matsch liegendes Schaf beugt, schiele ich rasch auf mein Telefon. Ich hatte auf eine Nachricht von Jacob – Jakey – gehofft, aber der Name auf dem Bildschirm war Ben.
Noch vor einem halben Jahr wäre eine SMS von Ben nichts Bemerkenswertes gewesen. Da hätte ich allerdings auch nicht auf einer sumpfigen Weide gestanden und auf ein totes Schaf gestarrt, weil ich da nämlich noch mit echtem investigativem Journalismus beschäftigt gewesen wäre. Das letzte Mal, dass ich Ben sah, war auch das letzte Mal, dass ich etwas geschrieben habe, das ich mir selbst ausgesucht habe. Er ist ein sympathischer Kerl, freiberuflicher Fotograf, und hat die Fotos zu dem Artikel gemacht, der mich auf Umwegen hierhergeführt hat, zu dieser Weide an diesem nasskalten Tag Anfang Juni, zu Mr Leeson und seinem toten Schaf.
»Also, woll’n Se jetzt mit denen reden oder was?«, fragt der Farmer und zeigt sein geschwärztes Zahnfleisch, das selbst wie ein Ort des Verbrechens aussieht.
Ich schiebe mein Handy zurück in die Hosentasche. »Entschuldigung, Mr Leeson, mit wem soll ich reden?«
»Mit diesen Zigeunern da … diesen Fahrenden oder wie ihr die nennt. Woll’n Se jetzt mit denen reden, oder bleibt das an mir und meiner Schrotflinte hängen?« Er nimmt die Schiebermütze ab und streicht sich mit seiner schmutzigen Hand über die fettigen Haare. Ich habe den Eindruck, dass er auf die zweite Möglichkeit hofft.
»Wie wär’s, wenn ich jetzt erst mal mit meinem Chefredakteur wegen einer möglichen Story rede, und dann sehen wir …«
»Sie ham die ganze verdammte Story hier vor Ihrer Nase.« Wieder tritt er mit seinem schweren Stiefel gegen den Kopf des Schafs. Ich wünschte, er würde damit aufhören. Das Tier ist zwar tot, aber seine Augen stehen noch offen, und der Stiefel ist schmutzig. Es fängt wieder an zu regnen.
»Ich hab gehört, Sie sind aus London«, bemerkt Mr Leeson mit einer mir inzwischen vertrauten Mischung aus Verachtung und Mitleid. Das »arme Sau« klingt unausgesprochen am Ende mit. Ich will jetzt nicht darüber reden. Den Leuten zu erklären, dass ich meiner Frau und meinem Sohn zuliebe hierher nach Cornwall gezogen bin auf der Suche nach einem besseren Leben, kommt mir vor, wie einen Witz zu wiederholen, der längst nicht mehr witzig ist. Ich lasse das Gummiband gegen mein Handgelenk schnappen. Dieses Gummi war ein Vorschlag von Dr. Bunce, der Paartherapeutin, zu der ich zweimal pro Woche mit – und auf Geheiß von – meiner Frau Ruth gehe. Das leichte Klatschen gegen die Haut soll mich von negativen Gedanken abhalten. Natürlich funktioniert das nicht, stattdessen habe ich nur einen neuen Tick, der den ganzen Mist in meinem Kopf begleitet.
»So, ich muss dann mal wieder«, sage ich, ohne auf Mr Leeson einzugehen. Der für Cornwall typische Dauerregen durchnässt schon langsam meinen dünnen, in London gekauften Anorak, und meine Brille beschlägt. Selbst schuld, schließlich stehe ich nur auf dieser gottverlassenen Wiese, weil ich mich nicht getraut habe, Mr Leeson zu sagen, dass ich das verstümmelte Schaf nicht sehen will, das er am Morgen gefunden hat – schon das dritte in diesem Sommer.
Ich bin als Reporter für The Rambler hier, eine Zeitschrift für alles, was mit Cornwall und der freien Natur zu tun hat. Eigentlich sollten wir über die Vorbereitungen des Farmers für die Landwirtschaftsausstellung in Ashford im kommenden Monat sprechen. Ich bin wegen preisverdächtiger, nicht wegen toter Schafe mit Gelee-Augen hergekommen.
Der Schlamm schmatzt unter meinen Converse, als wir über die Weide auf den Hof zugehen. Ich schüttele Mr Leesons schwielige Hand, äußere noch einmal mein Bedauern wegen des Schafs und verspreche, mich bezüglich des Artikels zu melden. Sobald ich im Auto sitze, wische ich meine Brille am Ärmel ab und lese Bens Nachricht.
Jon, Kumpel, lange nicht gesehen. Dachte, du würdest das wissen wollen: Die Polizei hat gerade eine Leiche aus dem Haus der Nichols’ an der Woodgreen Ave getragen. Ein schiefgegangener Einbruch? Krasse Sache. Die Leiche sah zu groß aus für das Mädchen. Ben.
Schon ein ganz normaler Einbruch ist in einer Kleinstadt wie Ashford eine Schlagzeile wert, ein möglicher Mord dagegen etwas Unerhörtes. Ich lese den Text noch einmal.
Von jedem anderen würde sich »zu groß für das Mädchen« brutal anhören, aber ich weiß, Ben wollte mich nur beruhigen, dass es nicht Grace war in dem Leichensack, wofür ich ihm dankbar bin. Trotzdem, meine Fresse, heißt das demnach, dass es Meg ist? Ashfords Liebling, die Supermutter der ganzen Stadt, tot? Ermordet im eigenen Heim?
Ich frage mich, wo man Grace hingebracht hat. Zu den Nachbarn? Auf die Polizeiwache? Wahrscheinlich ist sie stumm vor Schock, sitzt zitternd in ihrem Rollstuhl und drückt diesen Plüschhasen, den sie immer dabeihat, an sich wie ein kleines Mädchen. Ich hoffe nur, dass jemand in der Lage ist, sie zu trösten, dass man den Arzt ruft und dafür sorgt, dass sie sich beruhigt. Ein derart traumatisches Erlebnis kann nicht gut sein für ihr schwaches Herz.
Aus dem Farmhausfenster drüben starrt Mr Leeson stirnrunzelnd zu mir herüber. Seine Lippen bewegen sich, vermutlich sagt er gerade etwas zu Mrs Leeson – vielleicht hat er endlich geschaltet und erzählt ihr, dass er sich an mein Gesicht von der Titelseite des Ashford Echo erinnert –, bevor er vom Fenster wegtritt.
Ich tippe eine Antwort an Ben.Danke fürs Bescheid sagen.
Meine Reifen schlittern im Matsch, als ich vom Hof fahre. Die Hände fest am Lenkrad, halte ich mir vor Augen, warum ich nicht zur Woodgreen Avenue fahren darf. Die Polizei, das Kontaktverbot, die Sorgerechtsvereinbarung. Ich lasse das Gummiband schnappen.
Mit einem Blick auf die Uhr stelle ich fest, dass Ruth und ich in vierzig Minuten eine Sitzung bei Dr. Bunce haben. Ruth hat mich extra heute Morgen per SMS daran erinnert. Während ich über den holperigen Zufahrtsweg der Farm fahre, rechne ich mir aus, dass ich für die fünfzehn Kilometer zu Dr. Bunce’ räucherstäbchenverseuchtem Behandlungszimmer auf der anderen Seite der Stadt um diese Tageszeit höchstens fünfundzwanzig Minuten brauchen würde. Ich schnipse fester. Die Haut an meinem Handgelenk färbt sich pink.
Meine Gedanken kreisen ständig um Bens Nachricht, um Meg und Grace. Könnte es sich wirklich um einen schrecklich schiefgegangenen Einbruch handeln? Irgendwie glaube ich das nicht. Mal abgesehen von Anstand und Menschlichkeit, welcher Idiot würde sich ausgerechnet die beliebteste Familie in Ashford aussuchen? Ein Angriff aus persönlichen Motiven ist jedoch genauso schwer vorstellbar. Meine Gedanken wandern zu Simon, dem Vater von Grace. Als psychisch labil und potenziell gefährlich erachtet, hatte Meg ihn größtenteils von seiner Tochter ferngehalten. Ich könnte wetten, dass alle schon mit dem Finger auf ihn zeigen.
Dann denke ich an das einzige Mal, dass ich mit Meg über Simon gesprochen habe. Das war während des Interviews mit ihr und Grace für den Artikel, der mein Leben ruinieren würde, wovon ich damals natürlich noch nichts wusste. Sie empfingen mich sehr herzlich bei sich zu Hause, obwohl da so eine unterschwellige gereizte Stimmung in der Luft lag, vielleicht die Nachwirkung eines Streits. Mich überkam das Bedürfnis, sofort wieder zu gehen, aber Meg und Grace strahlten mich an und sagten, sie hätten extra Kuchen gebacken. Sie tauschten unauffällige Blicke, woraufhin sie sich entschuldigten und gestanden, dass sie nervös seien. Als sie nebeneinandersaßen, suchte Grace’ kleine Hand immer wieder die ihrer Mutter. Sie beendeten gegenseitig ihre Sätze. Grace sprach mit einer Kleinmädchenstimme, dabei war sie schon eine Jugendliche, und Megs Akzent hatte die volltönenden Vokale von jemandem, der sein ganzes Leben im Südwesten Englands verbracht hat. Meg zeigte mir Fotos von Grace in diversen Krankenhausbetten, Ärztinnen, Ärzte und Pflegepersonal neben ihr wie Spielkameraden. Ziemlich bald merkte ich, dass sie nicht wusste, weshalb die von Wishmakers uns miteinander in Kontakt gebracht hatten – vielleicht hatten sie dort die Absicht des Artikels selbst nicht verstanden –, also musste ich es ihr erklären.
»Nur so interessehalber – was hat man Ihnen gesagt, worum es in dem Artikel gehen wird?«
Meg hatte kurze gelockte braune Haare und ein rundes, unscheinbares Gesicht, zumindest bis sie lächelte. Dann war es, als bekäme man eine Schale mit etwas Warmem, Köstlichem gereicht. Ihre Stirn zog sich in Falten, als sie sich zu erinnern versuchte.
»Maggie sagte, dass Sie darüber schreiben, wie Familien mit schwierigen Situationen umgehen. Dass Sie etwas über die Herausforderungen wissen wollen, vor die uns Grace’ Krankheit stellt.« Leiser fügte sie hinzu: »Und vielleicht auch ein bisschen was über Danny.«
Angesichts ihrer erwartungsvollen Blicke rutschte ich unbehaglich auf meinem Platz herum und wählte meine Worte sorgfältig, weil mir plötzlich bewusst wurde, wie verletzlich die beiden waren.
»Zum Teil, ja. Ich würde gern über beides etwas von Ihnen hören, wenn es Ihnen recht ist. Aber Thema des Artikels ist auch die neue Zweigstelle von ›Väter ohne Grenzen‹ in Plymouth. Daher hätte ich ein paar Fragen zu Grace’ Vater und was sich in Ihrer Beziehung mit ihm ereignete.«
Megs Miene wurde frostig, ihr Blick hart. Grace blickte besorgt zwischen uns hin und her.
»Was wollen Sie über Simon wissen?«, fragte Meg mit verkniffener Miene.
»Sprechen Sie beide noch miteinander?« Ich wusste durch mein Interview mit Simon, dass sie es nicht taten, wollte aber ihre Seite der Geschichte hören.
»Mit dem Mann, der für den Tod meines Sohns verantwortlich ist? Der gewalttätig wurde und meine Tochter zu entführen versuchte? Nein, ich spreche nicht mehr mit ihm.« Ein Schluchzen saß in ihrer Kehle, und sie wurde rot im Gesicht, während die ohnehin schon blasse Grace noch mehr zu erbleichen schien. Die Antwort hatte eine unsichtbare Mauer zwischen uns errichtet – das Thema Simon war eindeutig tabu. Grace starrte mich an, und ich sah, dass Tränen in ihren Augen schwammen. Sie streckte die Hand über den Tisch, die ihre Mum sofort ergriff. Ich entschuldigte mich und bat darum, die Fotos von Grace im Krankenhaus noch einmal sehen zu dürfen, um die Stimmung wieder aufzuhellen.
Als sie etwas später aufstand, um zur Toilette zu gehen, zuckte sie zusammen und rieb sich das Kreuz. Auf meinen fragenden Blick hin schüttelte sie den Kopf, als wäre es nichts weiter. »Alte Rückenverletzung«, sagte sie, »ist schon lange her. Er hat mich die Treppe runtergestoßen.« Dann legte sie Grace die Hand auf die Schulter, wie um zu sagen, dass sie nicht weiter darüber sprechen wolle.
Sobald sie zur Tür hinaus war, beugte sich Grace in ihrem Rollstuhl vor und flüsterte: »Haben Sie ihn gesehen? Haben Sie meinen Dad gesehen?«
Meine Erinnerung daran ist klar und deutlich, als wäre es erst gestern geschehen. Als ich nun auf die Hauptstraße einbiege, weist mich ein Schild darauf hin, wie nahe ich an der Woodgreen Avenue bin, die gerade mal fünf Minuten entfernt ist. Ich könnte an ihrem Haus vorbeifahren und kurz nachsehen. Ich bräuchte ja nicht auszusteigen. Niemand würde meine Anwesenheit bemerken, niemand bräuchte je etwas davon zu erfahren. Und ich könnte immer noch rechtzeitig bei Dr. Bunce sein. Warum also nicht? Danach wäre meine Neugier gestillt.
Scheiß drauf.
Ich biege von der Hauptstraße ab.
Die Summervale-Siedlung ist ein Labyrinth aus in den Neunzigern gebauten Häusern, die sich gleichen wie ein Ei dem anderen, ein fantasieloser Vorort ein paar Kilometer außerhalb von Ashford. Im Stadtkern von Ashford lebt heute nur noch eine Handvoll Einheimischer, denn die meisten haben ihre Häuser schon vor Jahren an reiche Großstädter verkauft, die ein Feriendomizil mit Meerblick wollten. Kann ich ihnen nicht verübeln. Viele von den Einwohnern hier standen nach dem Einbruch des Zinnabbaus in den 1990er Jahren plötzlich ohne Job und schlecht ausgebildet da. Und als die Immobilienmakler ihnen flüsterten, was ihre kleinen Fischerkaten wert waren, haben sie im Nu ihre Siebensachen gepackt und waren bereit, in den neu gebauten Vorort zu ziehen.
Während ich im Schleichtempo auf den Bungalow der Nichols’ zufahre, fasse ich ein paar Vorsätze. Ich werde nicht aussteigen. Ich werde mit niemandem sprechen. Ich bin nur als besorgter Mitbürger hier, nicht als Reporter. Keine Ahnung, ob ein Kontaktverbot auch nach dem Ableben der geschützten Person gilt, aber ich kann mir keinen neuen Ärger leisten.
An das letzte Mal, dass ich hier war – das war vor sechs Monaten –, kann ich mich nicht erinnern. Ich kann mich nicht daran erinnern, weil ich fast eine ganze Flasche Jack Daniels intus hatte, dabei bin ich kein Säufer. Ich erinnere mich nicht, an die Haustür gehämmert, Meg angebrüllt und ihren Vorgarten zerstört zu haben, den ehrenamtliche Helfer von Wishmakers angelegt hatten. Ich erinnere mich nicht, das Wohnzimmerfenster mit einem alten Golfschläger meines Vaters zertrümmert zu haben, und ich erinnere mich nicht, von der Polizei zu Boden gerungen worden zu sein.
Es hat aufgehört zu regnen, als ich vor der Hausnummer 50 halte, nahe genug dran, um zu sehen, was vor sich geht, aber weit genug weg, um nicht erkannt zu werden. Die Polizei hat den Bereich vor Megs und Grace’ Haus abgeriegelt. Zwei uniformierte Beamte wachen regungslos mit verschränkten Armen vor der Tür. Die Vorhänge des großen Wohnzimmerfensters sind zugezogen, aber innen brennt Licht. Einer der Polizisten lächelt ein wenig, erfreut vielleicht, dass endlich mal etwas Aufregendes hier in Ashford passiert, etwas Dramatisches wie in den Fernsehserien. Der Bungalow ist frisch in Rosa gestrichen, und ich stelle schuldbewusst fest, dass der Garten neu bepflanzt wurde. Ein nagelneu aussehender VW-Caddy mit einem Wishmakers-Aufkleber am Heckfenster steht in der Einfahrt. Er scheint speziell für Grace’ Rollstuhl hergerichtet worden zu sein.
Ein paar Nachbarn sind aus ihren Häusern hervorgekommen, doch alle verhalten sich sehr still. Das hier ist das Auge des Hurrikans. Die Männer schütteln den Kopf und legen den Arm um ihre Frauen, die Frauen flüstern hinter vorgehaltener Hand miteinander und betupfen sich die Augen. Jugendliche kauen Nägel und tippen Textnachrichten. Alle halten den Blick auf Nummer 52 gerichtet, als könnten sie begreifen, was hier vor wenigen Stunden passiert ist, wenn sie nur lange genug hinstarren. Noch sind keine Übertragungswagen oder Reporter von den Überregionalen vor Ort. Vermutlich jagen sie sich gerade gegenseitig auf der Autobahn von London hierher, jeder begierig, der Erste zu sein. Wie fanatische Fans auf dem Weg zu einem Popkonzert werden sie sich um die besten Plätze rangeln, um die erste Reihe.
Plötzlich ertönt ein lautes Klatschen am Fenster, und eine feuchte Handfläche drückt sich an die Scheibe. Es ist Ben, seine Kamera im Arm wie ein Baby. Er bückt sich und guckt zum Beifahrerfenster herein, wobei sich seine italienischen Gesichtszüge zu einem breiten, offenen Lächeln verziehen, ehe er die Tür aufmacht.
»Alles klar, Mann?« Wir geben uns die Hand, noch während er einsteigt und die leeren Dosen und Chipspackungen auf dem Boden wegkickt. »Hab ich mir gedacht, dass du vorbeischaust. Ich hab mit mir selbst gewettet, ob du’s schaffst, nicht zu kommen …«
»Schön, dich zu sehen, Ben.« Man kann seinen Redefluss nur stoppen, indem man ihn regelmäßig unterbricht. »Ich bin bloß aus Sorge hier, als Nachbar, nicht beruflich. Ist es … ist es Meg?«
Er nickt bedächtig, für einen Moment betroffen. »Das ist eine Scheißtragödie, Mann. Hier ist was ganz Schlimmes, also ich meine, was echt Schlimmes, passiert. Du weißt doch, dass Remi, eine Freundin von meiner Frau, mit Sam dort drüben liiert ist?« Er deutet mit dem Kopf auf den lächelnden Polizeibeamten. »Also, Sam hat mir erzählt, dass Meg der Schädel eingeschlagen wurde, mit dem gusseisernen Fuß einer Nachttischlampe, in ihrem eigenen Bett. Klingt echt scheißbrutal. Alle reden von ›rasender Wut‹. Jedenfalls hat eine Nachbarin die Leiche gefunden, und zu allem Übel weiß niemand, was mit Grace ist. Alter, ich weiß, das klingt verrückt, aber es sieht so aus, als hätte sie jemand entführt.«
Nein, nein, das kann nicht stimmen. Ben sieht mein Stirnrunzeln, meine Verwirrung.
»Ich weiß, was du denkst. Natürlich war es der Vater – verdammt, wer sonst sollte eine behinderte Siebzehnjährige entführen, stimmt’s? Sam sagt, es wird schon nach ihm gefahndet, aber bisher ohne Erfolg, zuletzt wurde er in Plymouth gesehen …«
Beide drehen wir uns um, als sich vorm Haus etwas tut. Eine in eine Decke gehüllte dunkelhaarige junge Frau, die ich vom Sehen kenne, wird von zwei Polizistinnen langsam aus Nummer 52 geführt. Eine der Beamtinnen hat eine Einkaufstasche über die Schulter gehängt. Die junge Frau ist Cara Dorman aus Nummer 53, dem Haus nebenan. Caras Mum Susan, die eine knallrote Hose trägt und Grace’ rote Katze an sich drückt, folgt ihnen mit unsicheren Schritten. Alle halten die Köpfe gesenkt, blicken auf ihre Füße. Ben packt seine Kamera – »Ich muss los, Kumpel« –, klettert aus dem Auto und fängt an, Fotos zu schießen wie ein Jäger mit seinem Gewehr.
Alle auf der Straße verfolgen die düstere Prozession, die sich langsam am Auto der Nichols’ vorbei auf den Bürgersteig zubewegt. Sie kommen direkt auf mich zu, und einen absurden Augenblick lang fürchte ich, dass man mich wegen Übertretung des Kontaktverbots verhaften wird. Aber die Polizistinnen und Susan blicken weiterhin zu Boden und lassen dabei ihre Köpfe hängen wie traurige, welke Blumen. Nur Cara sieht auf. Sie schaut zu meinem Auto auf der anderen Straßenseite herüber, erkennt mich aber nicht und sieht wieder geradeaus, während sie behutsam über den Ziegelsteinweg ihres Hauses geführt wird.
Als sich die Eingangstür hinter ihnen schließt, spüre ich eine kalte Hand in meiner Brust, ein derart schmerzhaftes Ziehen, dass ich das Lenkrad umklammere. Es ist ein vertrauter Schmerz. Der gleiche wie damals, als bei meinem Sohn Leukämie diagnostiziert wurde, der gleiche, der die ganze Zeit in meiner Brust saß, während Jakey im Krankenhaus war. Seitdem sind zwei Jahre vergangen, und er ist jetzt frei vom Krebs, Gott sei Dank. Seine Haare sind heller blond nachgewachsen, und er spielt viermal die Woche Fußball. Ruth und ich sind es, die sich nicht davon erholt haben. Jakeys Krankheit hat unsere Beziehung belastet, aber es war mein unbedachter Artikel über Meg und Grace, der den Anfang vom Ende bedeutete. Ein Gerichtsverfahren, ein Kontaktverbot und eine schwierige Trennung später bin ich wieder hier. Wieder vor Ort.
Ich reibe mir die Augen unter der Brille, um die Erinnerung an den Anblick von Jakey, wie er bleich und krank in seinem Klinikbett lag, gar nicht erst aufkommen zu lassen. Stattdessen denke ich an Grace und daran, wie sie mir ihre Zusammenstellung an Tabletten gezeigt hat, die sie jeden Tag nehmen musste. Eine blaue für die Muskeln, eine weiße für den Magen und eine rosafarbene, die sie mir unter die Nase hielt.
»Die hier ist die Wichtigste, sie erhält mich am Leben. Ich muss sie zweimal täglich nehmen«, sagte sie mit ihrer singenden Stimme. »Sie macht, dass mein Herz nicht aufhört zu schlagen.«
Grace schluckte die Pille so routiniert wie ein Trinker seinen Wodka. Oh Gott, wo sind diese rosa Tabletten jetzt? Wie lange kann sie ohne sie durchhalten? Ich stelle mir vor, wie ihr Herzschlag schwächer und unregelmäßiger wird, wie ein an Schwung verlierendes Aufziehspielzeug. Schnell reibe ich mir das Gesicht, weil meine Augen feucht geworden sind und ich wieder das Foto von Grace vor mir sehe, das wir für den Artikel verwendet haben. Sie hatte eine Wollmütze auf ihrem Kopf und lächelte so breit, dass ihre Augen hinter den riesigen Brillengläsern fast verschwanden. Während ich versuche, mir ihr Bild und die Tränen aus den Augen zu wischen, höre ich sie wieder. Die hier macht, dass mein Herz nicht aufhört zu schlagen. Und ich weiß, dass sie schnell gefunden werden muss, ehe sie völlig dahinschwindet und nichts mehr von ihr übrig bleibt.
Das Klingeln meines Handys bewahrt mich davor, vollends die Fassung zu verlieren. Ruths Name erscheint auf dem Bildschirm. Ich lasse den Motor an und fahre mit quietschenden Reifen los, sodass ein paar Polizisten herübersehen. Ein Blick auf die Uhr – scheiße, scheiße, scheiße. Es ist 14.52. Ich habe nur noch acht Minuten, um es zu Dr. Bunce zu schaffen, sonst flippt Ruth aus. Stöhnend gehe ich ran, stelle auf Lautsprecher.
»Jon?« Ihre schöne, rauchige Stimme erfüllt den Wagen.
»Oh, hallo Schatz«, sage ich und biege aus der Siedlung auf die Hauptstraße ab, ohne mich richtig umzusehen.
»Du klingst gestresst. Was ist los?«
Man kann ihr nichts vormachen.
»Nein, nein, es ist nur, äh, gerade viel Verkehr hier.«
»Wo bist du denn?« Ich sehe sie vor Dr. Bunce’ Praxis in ihrem eigenen Auto sitzen, vielleicht späht sie gerade die Straße hinunter in der Erwartung, dass ich gleich auftauche. Sie denkt, dass die Sitzungen uns dabei helfen werden, das mit dem gemeinsamen Sorgerecht für Jakey gut hinzukriegen, aber ich hoffe insgeheim, dass sie ihr vor Augen führen, was für ein gutes Paar wir doch sind, und sie zu mir zurückbringen.
»Komme gerade von einem Interview, Liebling. In einer Viertelstunde bin ich da.« Das Navi gibt achtundzwanzig Minuten an.
»Du kommst also zu spät«, sagt sie seufzend, als sei es unvermeidlich, dass ich sie enttäusche, als sei ich das Kreuz, das sie zu tragen hat. Mein Magen krampft sich zusammen.
»Nur ein paar Minuten, und es tut mir leid, aber ich bin unterwegs. Warum fangt ihr nicht schon mal an, ich bin in null Komma nichts da.«
»Weil es eine Paartherapie ist, Jon, und wenn eine Hälfte des Paares keine Lust hat …«
»Ich habe Lust, Ruth, wirklich. Ich bin nur ein paar Minuten zu spät wegen der Arbeit, tut mir echt leid. Guck mal, je länger du mit mir telefonierst, desto weniger Zeit hast du, Dr. Bunce zu erzählen, was für ein blöder Mistkerl ich bin …« Aber ich merke, dass sie mir nicht mehr zuhört, weil sie die Radionachrichten im Hintergrund lauter gestellt hat. Ein paar Worte verstehe ich klar und deutlich: »Leiche«, »Megan Nichols« und »vermisst«.
»Ruth? Ruth?«, rufe ich.
»Okay, bis gleich, Jon«, antwortet sie zerstreut und legt auf, als ich gerade auf die Überholspur schwenke.
Ich bin zwanzig Minuten zu spät, als ich vor Dr. Bunce’ viktorianischem Reihenhaus halte. Mein Handgelenk brennt, ich habe das Gummiband pausenlos schnappen lassen. Die Klingel, die ich drücke, hallt wie eine Erschütterung durchs ganze Haus. Dr. Bunce bewegt sich gern langsam, nicht weil sie alt ist – sie ist erst Mitte fünfzig –, sondern weil sie anscheinend vermitteln will, dass das Leben etwas ist, das man genießen muss wie einen guten Wein. Beeil dich, verdammt noch mal. Als sie endlich aufmacht und ich meine Schuhe auf ihren kalten Mosaikfußboden gestellt habe, bin ich mindestens drei weitere Minuten im Verzug. Ich bringe eine Entschuldigung vor, die sie mit einem sanften Nicken ihres edlen grauhaarigen Hauptes annimmt. Das Therapiezimmer ist sparsam eingerichtet und riecht immer wie frisch gesaugt. Ruth sitzt in einem der beiden Sessel vor Dr. Bunce’ größerem Sessel, die obligatorische Taschentücherbox vor sich. Ihr gewellter blonder Bob ringelt sich hinter ihren Ohren, und das Grübchen in ihrem Kinn ist zu sehen, was bedeutet, dass sie sich schwer bemüht, das Kinn vom Zittern abzuhalten. Sie zieht die Ärmel ihres roten Pullis über die Hände, als ich mich zu einem Kuss auf die Wange zu ihr herunterbeuge und sage: »Es tut mir leid, verzeih, dass ich mich verspätet habe.«
Mit immer noch panisch flatterndem Herzen setze ich mich neben sie, noch nicht auf die Stille des Zimmers eingestellt nach all dem Rasen und Fluchen der letzten zwanzig Minuten. Ruth wirft mir unter tränenbenetzten Wimpern einen Seitenblick zu, ehe sie sich wieder unserer Therapeutin zuwendet, die ihre Hände dachartig aneinandergelegt hat, den Kopf leicht schräg geneigt wie ein nachdenkliches Huhn.
»Ruth, ist es Ihnen recht, wenn ich Jon daran teilhaben lasse, worüber wir vor seiner Ankunft gesprochen haben?«
Ruth nickt. Sie hält ein zusammengeknülltes Papiertaschentuch in der Hand.
»Jon, Ruth sagte, dass sie das Gefühl hat, Ihnen liege nichts an diesen Treffen und infolgedessen auch nichts daran, Ihre Ehe zu retten.« Dr. Bunce spricht, wie sie sich bewegt, langsam und entschieden. Meine Antwort klingt im Vergleich dazu laut und unbeherrscht, als ich mich zu Ruth umdrehe.
»Also komm, ich bitte dich. Das ist das erste Mal, dass ich …«
Ruth runzelt die Stirn, und ihre grünen Augen verdunkeln sich, als sie mir ins Wort fällt. »Es ist das zweite Mal, dass du zu spät kommst, und obendrein hast du mich darüber belogen, wo du warst.«
»Ich habe dich nicht belogen.«
»Du hast gesagt, du würdest arbeiten, ein Interview machen.«
»Ich habe … ich …« Die Hitze steigt mir ins Gesicht.
»Ich habe im Radio gehört, was dieser armen Megan Nichols zugestoßen ist. Du bist zu ihrem Haus gefahren, nicht wahr?«
»Ruth …« Ich werfe Dr. Bunce einen Blick zu, aber sie kommt mir nicht zu Hilfe, sondern sieht mich nur forschend an, ebenfalls auf die Wahrheit aus.
»Ich wusste es, ich wusste es einfach, dass du es nicht schaffen würdest, da wegzubleiben.«
Ich lasse das Gummiband schnappen. Dr. Bunce bemerkt es mit einer hochgezogenen Augenbraue. Aus dem Augenwinkel sehe ich, wie Ruth die Therapeutin mit einem Blick um Unterstützung bittet, ehe sie sich wieder mir zuwendet. Ohne sie anzusehen, versuche ich, es ihr so ruhig wie möglich zu erklären.
»Megan Nichols ist ermordet und ihre behinderte Tochter entführt worden.«
»Eben. Deshalb solltest gerade du ein wenig Demut, ein wenig Anstand zeigen. Und wenn dir das zu viel Mitgefühl abverlangt, dann wenigstens das Kontaktverbot respektieren. Was ist, wenn die Polizei dich gesehen hat?«
»Ich bin aus reiner Besorgnis hingefahren, Ruth, das ist alles. Ich tue es nicht wieder!« Es überrascht mich selbst, dass ich laut geworden bin. Ruth reißt die Augen auf. Ich habe überreagiert und zwinge mich, ruhiger zu sprechen, als ich mich fühle. »Okay, ich hätte vielleicht nicht hinfahren sollen, aber ich kannte sie beide ja ein bisschen und habe auch Simon damals interviewt. Wie du weißt, fand ich von jeher, dass er ungerecht behandelt wurde, und es ist abzusehen, dass das Gleiche wieder passieren …«
»Jon, hör dir doch mal selbst zu!« Ruths Halssehnen treten beim Schreien hervor. Jakey hat mir irgendwann mal zugeflüstert: »Das bedeutet, dass Mummy auf der Palme ist.«
»Der kleine Sohn dieser Frau ist mit vier Jahren ertrunken«, fährt Ruth fort. »Ihre Tochter ist schwer körperbehindert, der Vater ihrer Kinder hat sie die Treppe hinuntergestoßen, als sie schwanger war, und dann versucht, die Tochter zu entführen – und du verteidigst ihn auch noch? Herrgott noch mal!« Wie erschöpft von meiner Dummheit lässt Ruth sich in ihren Sessel zurücksinken und sieht Dr. Bunce an, als wären sie ein Team. Die Therapeutin macht eine beschwichtigende Geste mit den Händen, will die Wogen glätten. Doch ich sehe sie gar nicht richtig, sondern sehe wieder Grace vor mir, wie sie mir lächelnd diese rosa Pille hinhält. Dr. Bunce fragt irgendwas in der Richtung, was mein Abstecher zur Woodgreen Avenue in Bezug auf unsere Beziehung bedeute.
»Es bedeutet, dass Jon mehr daran gelegen ist, seinen Ruf als Journalist zu retten als seine Familie«, folgert Ruth nüchtern und hält den Blick dabei auf die Therapeutin gerichtet, ein Kind, das der Lehrerin vom schlechten Betragen eines anderen erzählt. Ich schüttele den Kopf, bevor sie ausgeredet hat.
»Das ist doch Schwachsinn, kompletter Schwachsinn.«
»Okay, könnten Sie uns sagen, was es für Sie bedeutet, Jon?« Dr. Bunce’ ruhiger Blick legt sich auf mich wie eine Decke.
»Es bedeutet, dass mein Zeitmanagement unter aller Sau ist.«
Nach den letzten beiden Sitzungen hatte Ruth mich nach Hause ins New Barn Cottage eingeladen, ein hübsches Natursteinhaus ein Stück außerhalb von Ashford, das wir gemeinsam umgebaut haben. Wir haben Jakey abgeholt, zusammen zu Abend gegessen, und nachdem ich Jakey ins Bett gebracht hatte, blieben Ruth und ich noch auf und tranken Wein. Letzte Woche haben wir uns geküsst, und es fühlte sich an wie beim ersten Mal, nur noch besser, die Liebe kam flutartig zurückgeströmt. Doch diesmal zucken Ruths Halssehnen immer noch, als wir schweigend die Praxis verlassen. Sobald sie in ihrem Auto sitzt, zerrt sie den Sitzgurt um sich, und ich muss ans Seitenfenster klopfen, damit sie es herunterlässt. Erst da sehe ich, dass sie wieder weint.
»Oh Gott, Ruth, es tut mir leid. Das war wirklich dumm von mir. Ich hätte sofort hierherkommen sollen, aber mach jetzt bitte nicht so eine große Sache draus. Wir sind doch so gut vorangekommen.«
Ihr Blick ist tränenblind. »Ich hatte schon angefangen zu glauben, dass es in den Sitzungen noch um mehr geht als um Jakey, dass sie uns vielleicht helfen können, unsere Ehe wieder ins Lot zu bringen. Aber wenn du dauernd zu spät kommst und das alles nicht ernst nimmt, haben wir uns wohl nichts mehr zu sagen.«
Ich sehe ihr nach, als sie davonfährt. Sie hat natürlich recht, wie immer. Ich muss mich von Summervale und dem ganzen Fall fernhalten. Das ist jetzt der Zeitpunkt, mich darauf zu konzentrieren, mein Familienleben und meine Karriere wieder auf die Reihe zu kriegen. Es ist nicht der Zeitpunkt, nach einem alternativen Ansatz in einem Fall von Mord und Entführung zu suchen. Obwohl kein anderer Reporter wie ich alle drei Beteiligten kennt …
Alle drei Beteiligten.
Habe ich das wirklich gerade gedacht? Mutmaßungen sind so ansteckend und so einfach. Es ist allzu leicht, davon auszugehen, dass Simon etwas mit der Sache zu tun hat. Ich sitze im Auto und schnipse mit dem Elastikband um mein Handgelenk, um nicht an Meg, Grace und Simon zu denken, wo ich doch an Ruth und Jakey denken sollte. Meine Knochen fühlen sich bleischwer an, als ich den Zündschlüssel herumdrehe, ohne gleich loszufahren. Ich will nicht zurück in die Wohnung, die als Zuhause zu bezeichnen ich mich weigere, weiß aber nicht wohin sonst. Der Artikel über das Sommerfest muss immer noch geschrieben werden, er ist morgen fällig. Wenn ich mich zusammenreiße, kann ich ihn in zwei, drei Stunden fertig haben. Und was dann? Ich wünschte, ich hätte einen Freund hier, jemanden, mit dem ich bei einem Bier ein bisschen reden kann, aber all meine richtigen Freunde sind in London zurückgeblieben. Auf der Suche nach jemandem, der in der Nähe von Ashford wohnt und nicht mehr mit Ruth befreundet ist als mit mir, scrolle ich durch meine Kontakte. Becks und Clare sind mit ihr zur Schule gegangen, fallen also flach, und Laurence, der gleich um die Ecke bei mir wohnt, war ihr erster Freund, kommt also erst recht nicht infrage. Außerdem, seit dem Artikel und dem Shitstorm gegen mich wird keiner von ihnen gesteigerten Wert darauf legen, mit mir in der Öffentlichkeit gesehen zu werden. Weshalb nur Dave übrig bleibt.
Eine neue Art von Einsamkeit überfällt mich, als ich auf Daves Nummer starre und feststelle, wie weit es mit mir gekommen ist: Dave ist meine einzige Chance, heute Abend ein freundliches Gesicht zu sehen. Ein Polizist mittleren Alters, den ich nach einem Streit mit Ruth und einem wutschnaubenden Trip zum Pub per Zufall kennengelernt habe. Seitdem habe ich ihn nur noch kontaktiert, wenn ich Insiderinformationen für einen Bericht brauchte. Aber jetzt bin ich verzweifelt, und Dave hat gerade selbst eine bittere Trennung hinter sich und versteht mich vielleicht. Ehe ich es mir anders überlege, schreibe ich ihm eine SMS: »Bierchen heut Abend, Kumpel?« Als ich schließlich losfahre, fühle ich mich mieser als seit Wochen, verlassen und ganz auf mich allein gestellt. Ruth hat gesagt, die Treffen mit Dr. Bunce würden uns helfen, aber in dem Fall hatte sie unrecht. Paartherapie ist wirklich totaler Quatsch.
3
Cara
»Du kannst ruhig weinen, wenn du möchtest, weißt du«, sagt Jane, die Opferschutzbeamtin, als sie die dritte Tasse Tee vor mich hinstellt, nachdem sie die kalt gewordenen beiden ersten in die Spüle gekippt hat. Sie liest die benutzten Taschentücher auf, die Mum auf dem Couchtisch verteilt hat, und wirft sie weg. Ich bekomme den Eindruck, dass Jane gern in Bewegung ist, als wollte sie ihre Gedanken nicht zur Ruhe kommen lassen. Mum neben mir auf dem Sofa drückt meine Hand. Unsere Handflächen fühlen sich feucht an. Sie klammert sich jetzt schon seit über einer Stunde an mir fest.
»Car weint nicht so leicht, stimmt’s, Liebes?« Mum streicht mir mit den Fingerspitzen den Pony aus den Augen. Ihr Gesicht ist fleckig und geschwollen, und ihre Augen sind noch blauer als sonst vom vielen Weinen. Die Wimperntusche läuft ihr in schmutzigen Bächen über die Wangen.
»Sie schlägt nach ihrem Vater, der hat auch nie geweint. Macht aber nichts, ich heule genug für uns beide, nicht wahr, Liebes?« Sie küsst mich auf die Stirn, und ich lasse mich von ihr in die Arme nehmen. Ich verstehe, dass sie jetzt meine Nähe braucht. Dann wird sie auf einmal völlig reglos und starrt ins Leere, als könnte sie sich aus dem Zimmer fortstarren, zurück nach gestern, als ihre Freundin noch am Leben war. Sie atmet schwer, woran ich merke, dass es gleich wieder losgeht.
»Wer … wer ist nur dazu fähig, einem so guten Menschen etwas so Furchtbares anzutun?«, schnauft sie. »Ich kann mir … ich kann …« Ihre Stimme geht in einen hohen Klagelaut über, die Tränen stürzen hervor, spülen hinweg, was auch immer sie sagen wollte. Ich drücke mein Ohr an ihre Brust und lausche ihrem klopfenden Herz, stelle mir vor, wie mit jedem heftigen Schluchzer kleine Stücke davon abbrechen. Jane sieht uns einen Moment zu, bevor ihr Funkgerät knarzt und sie in die Küche hinübereilt, um zu antworten. Sobald wir von meiner Befragung auf der Polizeiwache zurück waren, hat sie die Wohnzimmervorhänge zugezogen, damit wir die Reporterinnen und Fotografen draußen nicht mehr sehen mussten. Aber wir können sie noch hören. Halblaute Stimmen, hin und wieder ein Husten oder ein Lachen, was daran erinnert, dass das ein Montag wie jeder andere für sie ist.
Jane spricht drüben in ihr Funkgerät. »Gut, ich sage es ihnen. Over.« Mein Nacken fühlt sich steif an. Mum lockert ihre Arme um mich, und ich nutze die Gelegenheit, um mich aufzusetzen.
»Detective Chief Inspector Upton und Detective Inspector Brown sind nebenan gleich fertig. Sie kommen dann herüber, um noch ein paar Fragen zu stellen, wenn das okay ist?« Jane sieht uns abwartend an.
Mum drückt noch einmal meine Hand, lässt sie dann los.
»Cara hat ihnen doch schon alles auf der Wache gesagt …«
»Es dauert bestimmt nicht lang. Sie möchten diesmal mit Ihnen beiden sprechen, eher allgemeine Fragen zu Megan und Grace.«
Jane und Mum sehen mich eindringlich an. Das machen sie schon seit Stunden so, als rechneten sie damit, dass ich jeden Augenblick etwas tue, das sie nicht verpassen wollen. Ich nicke, obwohl ich nicht sicher bin, ob ich noch einen Ton herausbringen kann.
»Wenn es dir zu viel wird oder du eine Pause brauchst, sagst du es uns einfach, ja, Cara?« Da ist noch ein dünner Rand von korallenrosa Lippenstift um Mums Mund. Ich nicke wieder, weiß aber, dass sie es laut von mir hören will.
»Ja, okay.« Die Worte kratzen in meinem Hals, und ich stehe schwankend auf, während die beiden mich nicht aus den Augen lassen.
»Toilette«, sage ich. Es gibt eine gleich neben der Küche, aber ich gehe lieber in das Bad am Ende des Flurs. So kann ich mal einen Moment allein sein, ohne die forschenden Blicke, bei denen sich mir alles sträubt. Ehe ich mich davon abhalten kann, schiele ich zu Mums Schlafzimmer hinein, das praktisch das Ebenbild von Megs ist. Tropf, tropf. Ich habe einen Geschmack von Rost, von Blut im Mund. Sehe wieder Megs tote Augen, weit offen, aber blicklos. Schnell stütze ich mich an der kühlen Flurwand ab und drehe mich von Mums Tür weg. Atme tief und langsam, warte darauf, dass mein Herz sich beruhigt, und mache dann einen zweiten Anlauf. Ich trete ein und lasse den Blick über die Wände des Zimmers gleiten. Sie sind mit Erinnerungen tapeziert – Mum ist eine sentimentale Sammlerin, die nichts wegwerfen kann. Ich betrachte ein grässliches Herbstgedicht, das ich mal mit zehn geschrieben habe.
Rote Blätter tanzen bodenwärts
Leise, leicht und ohne Schmerz …
Es ist sogar gerahmt und hängt neben einem Foto von Granny und Granddad, lachend in Liegestühlen am Strand von Ashford. Außerdem gibt es natürlich zahllose Fotos von mir in allen Altersstufen, vom pausbäckigen Baby bis zum ernst blickenden Teenager. Dazu einige billige Aquarelle, die Mum schon ewig hat, und ein paar gerahmte Poster. Ich habe nie verstanden, warum sie sich die Mühe macht, das alles aufzuhängen. Sieht doch niemand außer ihr, wozu dann also. Im Moment jedoch trösten mich diese einfachen Dinge. Sie sind eine Verbindung, die die Welt, bevor ich Megs Leiche fand, mit der von jetzt, nur wenige Stunden später, zusammenhält – das beruhigende »Vorher« mit dem grauenvollen »Nachher«.
Plötzlich bleibt mein Blick an etwas hängen. Neben einem peinlichen »Keep calm and carry on«-Plakat hängt ein Foto von Grace und mir. Ich habe es seit Monaten, vielleicht sogar Jahren nicht mehr richtig betrachtet. Es ist auf der Party von Grace’ dreizehntem Geburtstag entstanden. Der riesige Heliumballon mit der »13«, den ich ihr geschenkt hatte, ist an der Rückenlehne ihres Rollstuhls befestigt, und ich stehe dicht daneben und beuge mich zu ihr herunter, damit unsere Gesichter für die Aufnahme auf einer Höhe sind. Grace hat eine knallblaue Perücke auf und einen Geburtstagsanstecker mit der Aufschrift »Teenager!« an der Brust. Wir lachen beide, aber Grace’ Augen hinter ihrer Brille sind fest auf die Kamera gerichtet, während ich sie von der Seite ansehe, wie um mich davon zu überzeugen, dass sie auch wirklich Spaß hat. Das war noch zu der Zeit, als Meg mir erlaubte, Grace mit an den Strand zu nehmen. Wir kamen immer mit vom Wind geröteten Wangen, eiscremeverklebten Mündern und strahlenden Gesichtern zurück mit dem Gefühl, dass alles in Ordnung war, weil wir uns hatten. Grace liebte den Strand, hasste aber das Wasser, scheute seine Nähe. Einmal fragte ich sie, warum sie sich so davor fürchtete, worauf sie nur »Danny« flüsterte und ich mich hütete, weiter nachzufragen. Es muss kurz danach gewesen sein, dass ich Chris kennenlernte und sich meine Welt nur noch um ihn drehte. Chris zog mich damit auf, dass ich mit einem fünf Jahre jüngeren, behinderten Mädchen befreundet war, und zur gleichen Zeit wurden Grace’ Anfälle immer schlimmer, weshalb es zu riskant wurde, allein mit ihr loszuziehen. So sah ich sie immer seltener, und wenn, dann oft bei einem ihrer vielen Krankenhausaufenthalte, wo sie an grausam aussehenden Maschinen hing und die unausgesprochene Frage in ihren Augen – Wo warst du so lange? – solche Schuldgefühle in mir hervorrief, dass ich erst recht wegblieb.
Es klingelt an der Tür, und ich höre Jane rufen: »Ich mache schon auf!«, als wäre sie hier zu Hause. Rasch gehe ich ins Bad und schließe mich ein.
Die beiden Polizeibeamten kenne ich schon. Sie haben vor ein paar Stunden auf der Wache von Ashford meine Aussage aufgenommen und einen DNA-Abstrich gemacht, während ich Mum heulend in Janes Armen zurückließ. Detective Chief Inspector Upton hat ausgeprägte Gesichtszüge und wirkt wie eine Frau, die zum Spaß Marathons läuft. Detective Inspector Brown sieht neben ihr beinahe verkümmert aus. Ein dünnes Männchen voller Sommersprossen, das Upton wie ein zaghafter Schatten folgt.
Weil ich es früher und später ja doch mit Upton aufnehmen muss, gehe ich zurück in die Küche. Jane räumt eilig Mums Zeitschriften und ungeöffnete Post vom Tisch, und wir setzen uns zu viert daran.
»Danke, dass Sie beide bereit sind, noch einmal mit uns zu sprechen. Sie sind bestimmt sehr erschöpft, aber ich hoffe, es wird nicht allzu lang dauern.« Upton sieht mich beim Reden unverwandt an.
Mum neben mir fährt sich mit ihren langen Fingernägeln durch ihre rostroten Haare und stützt dann die Ellbogen auf den Tisch, beugt sich zu Upton und Brown vor. Sie weint nicht mehr und hat die Wimperntusche und den korallenrosa Lippenstift frisch aufgetragen.
»Oh, wir tun gern alles, wirklich alles, um Ihnen zu helfen, nicht wahr, Car? Haben Sie schon Suchtrupps losgeschickt?«
Upton nickt. »Wir setzen alles daran, Grace zu finden, und die kommenden Stunden sind die entscheidenden, wie Sie sicher wissen. Je mehr Informationen wir haben, desto besser stehen die Chancen. Fällt Ihnen irgendjemand ein, der die Absicht haben könnte, den Nichols’ zu schaden?«
Mum kriegt wieder feuchte Augen und würgt aufschluchzend einen Namen hervor.
»Simon. Er muss es gewesen sein. Er ist wahnsinnig, total gestört, er …« Sie schnieft und schüttelt heftig den Kopf, reißt sich zusammen. »Er hat es schon mal getan, oder? Grace entführt? Und er war auch früher schon gewalttätig. Hat Meg die Treppe runtergestoßen, als sie im achten Monat schwanger war. Deshalb haben die Wehen zu früh eingesetzt. Meg meinte mal zu mir, dass die Ärzte glauben, Grace hätte deswegen so viele Probleme.« »Probleme« sagt sie flüsternd, als wäre es ein schmutziges Wort.
Brown kritzelt etwas auf einen dünnen Notizblock. Upton hält den Blick auf Mum gerichtet und nickt.
»Ja, er ist kein Unbekannter für uns. Miss Nichols hat mehrfach die Polizei verständigt, weil sie sich von ihrem Exmann bedroht fühlte. Uns wurde gesagt, Simon hätte öfter bei ihr angerufen und versucht, Kontakt zu Grace aufzunehmen.«
Mum nickt und blickt von Upton auf Browns Notizblock. »Ehrlich, sie hat ganz oft ihre Telefonnummer geändert, aber irgendwie hat er es immer wieder geschafft, die neue herauszubekommen.«
»Glauben Sie, sie hatte Angst vor ihm?«
Mum nickt so heftig, dass ich fürchte, sie könnte gleich von ihrem Stuhl fallen. »Natürlich hatte sie das. Vor allem natürlich wegen Grace. Stress ist nicht gut für ihr Herz oder ihre Epilepsie. Ich werde das nie vergessen, kurz nachdem sie von Plymouth hierhergezogen waren – die Mädchen haben in Caras Zimmer gespielt, und Meg hat dort gesessen, wo Sie jetzt sitzen und mir alles über Simon erzählt. Da habe ich zum ersten Mal von Danny gehört, ihrem kleinen Sohn, und dass Simon auf ihn aufpassen sollte, aber zu besoffen war, um ihn im Auge zu behalten, als er nah am Wasser gespielt hat, zwei Stunden nördlich von hier, am Strand von Port Raynor. Seine kleine Leiche wurde zwei Tage später angespült.« Mum fängt wieder an zu weinen. Ich tätschele ihr die Schulter, Jane reicht ihr noch ein Taschentuch. Upton rutscht auf ihrem Stuhl herum, als hätte sie keine Zeit für so was.
»Und die Beziehung der beiden endete bald nach dem Tod des gemeinsamen Sohns?«, fragt sie.
»Wie ich Ihnen schon auf der Wache gesagt habe …«, antwortet Mum und tupft mit dem Papiertaschentuch unter ihren Augen herum, prüft es auf Mascaraspuren. »Ich würde das nicht als Beziehung bezeichnen. Simon hat sie misshandelt, Meg war das Opfer.« Sie knüllt das Taschentuch zusammen, fügt dann hinzu: »Hören Sie, sollten Sie jetzt nicht alle dort draußen sein und nach Grace suchen, statt uns immer wieder dieselben Fragen zu stellen?«
Upton hebt entschuldigend die Hand. »Ich weiß, das ist sehr belastend für Sie, Susan, aber ich muss versuchen, mir Klarheit zu verschaffen. Und ich kann Ihnen versichern, dass bereits bestens ausgebildete Suchtrupps unterwegs sind und nach Grace suchen, und zwar rund um die Uhr. Also, können Sie mir noch ein bisschen mehr darüber erzählen, was nach Dannys Tod passiert ist?«
Mum schluckt und wischt sich ein letztes Mal die Nase, bevor sie antwortet.
»Simon begann noch mehr zu trinken nach Dannys Tod, und Meg versuchte immer wieder, sich von ihm zu trennen. Aber er bettelte sie an, zu ihr und Grace zurückkommen zu dürfen, wollte sie nicht in Ruhe lassen. Es hat eine Weile gedauert, aber dann fand sie endlich den Mut, ihn ein für alle Mal zu verlassen, in erster Linie Grace zuliebe, und die beiden kamen hierher, als Grace sieben war, um neu anzufangen. Ehrlich, ich weiß noch, wie ich dachte, das ist die traurigste Geschichte, die ich je gehört habe. Ich konnte es nicht fassen, dass eine einzige Frau so viel durchmachen muss, und jetzt … jetzt, wo das passiert ist, bin ich …« Mum vergräbt ihr Gesicht in einem Taschentuch, vergisst ihr Make-up. Ihre Schultern beben, und Jane stellt ihr ein Glas Wasser hin.
»Bitte lassen Sie sich Zeit, Susan«, sagt Upton. »Ich weiß, das muss sehr schwer für Sie sein.« Sie wendet sich an mich.
»Sie haben Grace nahegestanden, Cara, ist das richtig?«