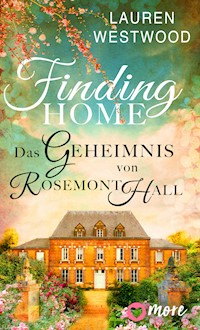9,99 €
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sind die Geheimnisse der Vergangenheit der Schlüssel für die Zukunft?
Nachdem Alex Hart entdeckt, dass ihr Freund heimlich Ehefrau und Kinder hat, stürzt für sie die Welt ein. Sie bricht ihre Doktorarbeit ab und findet eine Stelle als Geschäftsführerin des Herrenhauses „Mallow Court“. Bei der Vorbereitung einer Ausstellung entdeckt Alex ein altes Vogelmedaillon. Nichts ahnend, wohin sie diese Entdeckung führen wird, beschließt sie dem Geheimnis des Schmuckstücks auf den Grund zu gehen und spürt dabei nach und nach die dramatische Geschichte von Mallow Court und seiner Besitzerin auf. Doch diese Suche bringt Alex in ernste Gefahr ...
Unterstützung findet sie bei einem charmanten Uhrenmacher, der ihr nicht nur bei der Reparatur des Medaillons hilft, sondern auch bei der Suche nach den Geheimnissen der Vergangenheit. Doch sind diese Wahrheiten wirklich der Schlüssel zum Glück?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Liebe Leserin, lieber Leser,
Danke, dass Sie sich für einen Titel von »more – Immer mit Liebe« entschieden haben.
Unsere Bücher suchen wir mit sehr viel Liebe, Leidenschaft und Begeisterung aus und hoffen, dass sie Ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubern und Freude im Herzen bringen.
Wir wünschen viel Vergnügen.
Ihr »more – Immer mit Liebe« –Team
Über das Buch
Sind die Geheimnisse der Vergangenheit der Schlüssel für die Zukunft?
Nachdem Alex Hart entdeckt, dass ihr Freund heimlich Ehefrau und Kinder hat, stürzt für sie die Welt ein. Sie bricht ihre Doktorarbeit ab und findet eine Stelle als Geschäftsführerin des Herrenhauses »Mallow Court«. Bei der Vorbereitung einer Ausstellung entdeckt Alex ein altes Vogelmedaillon. Nichts ahnend, wohin sie diese Entdeckung führen wird, beschließt sie dem Geheimnis des Schmuckstücks auf den Grund zu gehen und spürt dabei nach und nach die dramatische Geschichte von Mallow Court und seiner Besitzerin auf. Doch diese Suche bringt Alex in ernste Gefahr …
Unterstützung findet sie bei einem charmanten Uhrenmacher, der ihr nicht nur bei der Reparatur des Medaillons hilft, sondern auch bei der Suche nach den Geheimnissen der Vergangenheit. Doch sind diese Wahrheiten wirklich der Schlüssel zum Glück?
Über Lauren Westwood
Lauren Westwood ist erfolgreiche Romance-Autorin und zudem als Anwältin für eine Firma für erneuerbare Energien tätig. Ursprünglich aus Kalifornien stammend, lebt sie heute mit ihrem mann und ihren drei Töchtern in einem Cottage in Surrey.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
https://www.aufbau-verlage.de/newsletter-uebersicht
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Lauren Westwood
Finding Secrets — Das Medaillon von Mallow Court
Aus dem Englischen übersetzt von Dr. Inka Marter
In Liebe für Eve, Rose und Grace
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Newsletter
Kapitel I
Teil 1
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel II
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel III
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel IV
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Teil 2
Kapitel V
Kapitel 16
Kapitel VI
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel VII
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Teil 3
Kapitel VIII
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Teil 4
Kapitel IX
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel X
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel XI
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel XII
Kapitel 38
Kapitel XIII
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel XIV
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel XV
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Teil 5
Kapitel XVI
Kapitel 52
Kapitel XVII
Kapitel 53
Epilog
Impressum
I
Tagebuch von Hal »Dachs« Dawkins – 1940London, 12. November 1940, 23:30 Uhr
Heute war die bisher schlimmste Nacht. Als ob die Welt untergehen würde, nur dass es nicht schnell vorbei ist, sondern sich lange hinzieht. Meine Ohren pfeifen noch vom Dröhnen der Flugzeuge, dem Heulen der Bomben und den Explosionen, die mir fast den Kopf auseinanderrissen. Und dann die Schreie – die furchtbaren, furchtbaren Schreie.
Wir waren zu einer Häuserreihe in Shoreditch gerufen worden – ich bin bloß ein paar Straßen weiter aufgewachsen. Das große Haus am oberen Ende von Larkspur Gardens hatte einen direkten Treffer abbekommen. Als wir davorhielten und hinaussprangen, hatte ich eine Riesenangst. Konnte sie entkommen?
Auf der Straße lagen mehrere Verwundete, rußgeschwärzt und mit Brandwunden. Der verfluchte Robbo, der Fotograf, war schon da und filmte die Trümmer und das Blutbad. Nachdem wir Verletzte in die Ambulanz geladen hatten, brauste mein Partner los zum Krankenhaus, während ich blieb, um die übrigen Verwundeten zu versorgen.
Die Flugzeuge verschwanden in der Nacht, und ich drohte ihnen mit der Faust. Mein Hals war rau vor Asche, Staub und dem metallischen Geschmack von Blut. Rauch kringelte sich aus dem bombardierten Haus in den angeblichen Himmel empor, zu einem Gott, der nicht existierte.
Aber genau da fielen die ersten Schneeflocken, schwerelos und rein. Unter ein paar Trümmern kroch ein Kind hervor, ein Mädchen. Ihr Gesicht war ganz schwarz, und sie zitterte in ihrem zerrissenen Kleid und dem dünnen Mäntelchen. Sie sah zum Himmel auf, streckte die Zunge heraus und ließ die weißen Kristalle darauf schmelzen.
Als wäre die Welt immer noch schön.
Teil 1
»Am allerwichtigsten ist aber, dass du mit blanken Augen die ganze Welt um dich herum betrachtest, denn die größten Geheimnisse sind immer an solchen Stellen verborgen, wo man es am wenigsten erwartet.«
Roald Dahl
Kapitel 1
Mallow Court, Buckinghamshire Mai 2000
Es ist der perfekte Tag für eine Hochzeit. Die Glyzinie, die sich um die Laube rankt, steht in voller Blüte, und auf den weißen, mit lavendelfarbenen Seidenschleifen handgebundenen Rosen liegt ein Hauch von Tau. Die Sonne scheint, und nur eine leichte Brise zerzaust ein klein wenig die Stuhlschleifen aus Organza. In den Beeten summt es, und ein schillernder Schmetterling schwebt von Blüte zu Blüte. Auf der Weide, auf der Gänseblümchen und Hahnenfuß wachsen, steht inmitten von grasenden Schafen das weiß und silbern gestreifte Zelt.
Und was am allerwichtigsten ist, jedenfalls aus meiner Perspektive: Die schicken mobilen Toilettenhäuschen, die fünfstöckige Torte und der Sushikoch aus Nobu sind alle pünktlich heute Morgen eingetroffen, gefolgt von einer ganzen Wagenladung gekühltem Champagner von Pol Roger. Wie Winston Churchill einmal über sein Lieblingsgetränk sagte: »Nach Siegen verdiene ich ihn. Nach Niederlagen brauche ich ihn.« Und ich werde dafür sorgen, dass es auf ganzer Linie ein Sieg wird. Selbst bei der winzigen Kleinigkeit, die doch schiefgelaufen ist – die Frau des Pfarrers hat gestern kurz angerufen, um mir mitzuteilen, dass er mit Magen-Darm-Grippe im Bett liege –, konnte ich schnell einen Ersatz organisieren.
Es läuft also alles wie geschmiert.
»Scheiße!« Die Braut hält ihre manikürte Hand vor die Flamme, als sie sich die nächste Zigarette anzündet, und wirft das Streichholz in die Pfingstrosen. Dann sieht sie mich giftig an. »Sie haben alles ruiniert.«
Ich bleibe professionell und lasse mir nichts anmerken. In diesem Moment sieht Miss Heath-Churchley dem weichgezeichneten ganzseitigen Foto in Country Life, das Mr Ernest – »Nennen Sie mich Ernie« – Wright-Thursleys Interesse weckte, nicht sehr ähnlich. Als sie auf der Hochzeitsmesse zu uns kam, zeigte sie mir eine laminierte Kopie davon, die sie in ihrer Tote Bag aufbewahrt:
Miss Celestina Heath-Churchley of Albright House, West Sussex. Älteste Tochter von Charles August Heath-Churchley, ausgezeichnet mit dem britischen Ordenskreuz, und Suzanna DuBois Heath-Churchley. Ausbildung an der Chichester Preparatory School und dem Cheltenham Ladies College mit einem Abschluss in Pferdewirtschaft.
Die Frage, wie sie ihre Nachnamen kombinieren würden, hielt mich buchstäblich nachts wach – versuchen Sie mal, fünf Mal schnell hintereinander Churchley-Thursley zu sagen. Und lässt man Heath und Wright dann für immer weg? Man sollte denken, als Geschäftsführerin eines eleganten, für Besucher geöffneten Herrensitzes weiß ich so etwas, aber in diesem Fall bin ich einfach nur sprachlos.
»Der Pfarrer bedauert zutiefst, dass er Magen-Darm-Grippe hat …«, beginne ich zum zigsten Mal mit zunehmender Vergeblichkeit. Ich senke die Stimme. »Zum Glück ist es mir gelungen, so kurzfristig einen Ersatz zu finden. Ihre Zeremonie wird wie geplant stattfinden können.« Ich zwinge mich zu lächeln.
Die bald ehemalige Miss Heath-Churchley – oder »Cee-Cee«, wie ihre Brautjungfern sie nennen – starrt mich wütend an, registriert meine Kunstwildlederjacke, meine indigoblauen Jeans und meine Bikerstiefel. Es ist, als hätte sie einen sechsten Sinn dafür, dass ich nicht nur keine Oberklassenherkunft habe, sondern überhaupt keine Herkunft. Und aus diesem Grund hätte ich normalerweise auch kein Problem damit, ihr zu sagen, wo genau sie sich ihre zweihundert Gäste, ihre Pferdekutsche, ihr Streichquartett, ihren Harfenisten und ihre Band, ihre Low-Carb-Kanapees und ihren Fotografen vom Tattler hinstecken kann. Stattdessen atme ich tief durch und sage mir, dass der Kunde immer recht hat. Denn mit einem vierhundert Jahre alten Haus, das eines der schönsten Beispiele für elisabethanische Architektur im Südosten Englands ist, und der dazugehörigen ruhmreichen Geschichte, den angedichteten Besuchern aus dem Königshaus und den hohen jährlichen Instandhaltungskosten habe ich die Pflicht, den Mund zu halten. Vor allem, da »Daddy« Heath-Churchley einen ziemlichen Batzen Geld bezahlt, um die Hochzeit seiner Tochter in den preisgekrönten Gärten abzuhalten.
»Eine Pfarrerin?« Sie spuckt das Wort praktisch aus. »Wer hat bitte eine Pfarrerin? Konnten Sie keinen richtigen Pfarrer auftreiben?«
»Sie ist ein ordiniertes Mitglied der anglikanischen Kirche.« Ich beiße die Zähne zusammen. »In der Tat ist sie eine ranghohe Geistliche und die Chefin des kranken Pfarrers.«
Das entspricht zwar nicht der Wahrheit, aber das braucht sie ja nicht zu wissen. Offen gestanden ist die Pfarrerin meine Freundin Karen von der Uni, die in Theologie promoviert hat und dann die Priesterweihe empfing, weil sie dadurch viele Männer kennenlernte, wie sie selbst sagte.
»Aber alle werden denken, dass ich lesbisch bin!«, jammert Cee-Cee.
»Ganz bestimmt nicht«, versichere ich ihr. Und wenn man nach den oberpeinlichen Geschichten gehen kann, die die Brautjungfern beim Frühstück erzählt haben, bin ich mir da völlig sicher. Ich ändere meine Taktik: »Und soweit ich weiß, sind Pfarrerinnen ganz groß im Kommen. Madonna und Guy Richie haben auch eine gebucht.«
»Wirklich?« Sofort erhellt sich ihre Miene.
»Oh ja – haben Sie nicht davon gehört?« Ich bemühe mich, die Worte so auszusprechen, dass ich mehr nach Oberschicht klinge.
»Nein.« Sie tritt die Zigarette mit der Spitze ihrer weißen Satin-Manolos aus und schiebt ein paar der Rosenblüten aus Papier über die Kippe. »Und wo ist eigentlich Ernest?«
»Ich habe ihn noch nicht gesehen«, entgegne ich. »Soll ich im Goldenen Vlies anrufen und nachfragen, ob man ihn geweckt hat?«
»Machen Sie das.«
»Und ich glaube, die Pfarrerin würde Sie gern beide vor der Zeremonie treffen. Um sie kennenzulernen.«
»Die ist garantiert eine Lesbe«, sagt sie schmollend.
Am liebsten würde ich laut lachen, aber um Daddys Scheck willen beiße ich mir auf die Zunge und antworte nichts darauf.
»Egal.« Sie winkt schulterzuckend ab. »Ich bade jetzt. Und wehe, es gibt kein heißes Wasser!« Dann dreht sie sich um und geht zum Kutschenhaus, wo sie und ihre Brautjungfern untergebracht sind. »Und sorgen Sie dafür, dass meine Sachen im Hochzeitszimmer liegen, wenn ich fertig bin«, weist sie mich über die Schulter an.
»Aber gewiss doch«, sage ich zu ihrem Rücken, auf den sie offensichtlich Selbstbräuner aufgetragen hat. »Eure Hoheit«, füge ich leise hinzu.
Catherine Fairchild, die Besitzerin von Mallow Court, hatte mich vor der ersten Hochzeitsmesse gewarnt, dass die meisten Bräute am schönsten Tag ihres Lebens wie königliche Hoheiten behandelt werden wollen. Wobei Cee-Cee wahrscheinlich immer so behandelt werden will. Ich selbst kann nicht so viel damit anfangen – ich war nie die Sorte Mädchen, die sich viel aus rosa Rüschenkleidchen und dämlich lächelnden Disneyprinzessinnen machte. Mein sozialistischer Dad war deswegen stolz auf mich gewesen, meine Mutter war allerdings manchmal daran verzweifelt. In gewissen Abständen hat sie immer mal Kostüme zum Feinmachen vom Charity Shop mit nach Hause gebracht, nur um sie später schlammverkrustet und zusammengenknüllt in einer Ecke meines Zimmers zu finden. Ich verkleidete mich lieber als Pirat oder Zauberer oder – wegen meines familiären Hintergrunds – als kommunistische Revolutionärin und nicht als irgendetwas, wofür man sich hübsch anziehen musste.
Es ist also eine Ironie des Schicksals, dass ich nun für einen Herrensitz zuständig bin, in dem hoffentlich zehn bis zwölf Hochzeiten jährlich stattfinden können. Ich plane, »Daddy« Heath-Churchleys Überweisung für ein Upgrade der Gästeunterbringung auszugeben. Und da Cee-Cees Hochzeit die erste ist, die in Mallow Court stattfindet, muss alles reibungslos vonstattengehen. Wenn wir es jetzt schaffen, die Braut zufriedenzustellen, dürften alle künftigen Hochzeiten ein Kinderspiel sein.
Da Cee-Cee gerade in der Badewanne ist, gehe ich das Zelt überprüfen. Dort testen »Mummy« Heath-Churchley, die Trauzeugin der Braut und zwei Brautjungfern den Schokoladenbrunnen und eine Flasche Pol Roger.
»Ist mein Stiefsohn Christopher schon angekommen?«, fragt »Mummy« H-C.
»Nicht, dass ich wüsste«, sage ich. »Ich werde die Augen offen halten.« Nicht, dass ich irgendeine Ahnung hätte, wer er ist – für mich sieht ein adliger Schnösel aus wie der andere.
»Mummy« murmelt ein Dankeschön und macht die nächste Flasche auf.
Ich sehe mich noch einmal im Zelt um – alles glänzt und wirkt sehr edel und teuer. Erleichtert, dass alles in Ordnung ist, kehre ich zum Haupthaus zurück. Nachdem ich mich um die Pfarrerinnen-Krise gekümmert habe, habe ich mir eine Tasse Tee und eine Scheibe Toast verdient. Die kühlen gelben Mauern strahlen in der Morgensonne, in Hunderten kreuz und quer unterteilten Fenstern spiegelt sich das Licht. In der Vergangenheit wäre jemand wie ich allerhöchstens Dienstmädchen in einem solchen Haus gewesen. Aber dank eines sehr guten Mediävistik-Examens in Oxford, einem Doktorvater mit guten Beziehungen und der Tatsache, dass ich zur rechten Zeit am rechten Ort war, leite ich den Laden. Die meiste Zeit ist es eine Freude, hier zu arbeiten.
In weniger als drei Jahren habe ich Mrs Fairchild geholfen, das riesige elisabethanische Herrenhaus, das ihr Vater nach dem Krieg renoviert hatte, in eines der touristischen Hauptziele der an London grenzenden Grafschaften zu verwandeln. Mit den gut konzipierten Führungen, einem Café, einem Souvenirshop mit regionalen Produkten und Craftbeer aus einer kleinen lokalen Brauerei, einem Abenteuerspielplatz, Betriebsausflügen und jetzt den Hochzeiten machen wir langsam Gewinn. Und wenn die Churchley-Thursley-Hochzeit endlich vorbei ist, kann ich mich wieder auf mein Lieblingsprojekt konzentrieren – eine Ausstellung über Kleidung im Lauf der Jahrhunderte, die oben in der langen Galerie präsentiert werden soll.
Ich bin fast an der Küchentür, als plötzlich ein orangefarben-schwarzer Smart um die halbmondförmige Auffahrt saust und auf dem Behindertenparkplatz eine Vollbremsung hinlegt, dass der Kies in den Rittersporn spritzt. Eine Frau in dunklem Hosenanzug und weißer Bluse springt heraus, rotblonde Locken wippen über ihren Schultern.
»Karen!«, sage ich, erleichtert, eine echte Pfarrerin vor Ort zu haben. »Ich bin froh, dass du hier bist.« Ich umarme sie herzlich. »Allerdings …«, flüstere ich ihr ins Ohr, »bin ich nicht sicher, ob die Braut auch so entzückt ist.«
Meine Freundin winkt ab. »Das macht nichts, Alex. Ich habe gestern Abend einen Wahnsinnstypen kennengelernt.«
»Ich dachte, du wolltest ein neues Kapitel aufschlagen.« Ich verziehe das Gesicht. »Was hast du noch gleich gesagt, als du die Priesterweihe empfangen hast? ›Keine beiläufigen und bedeutungslosen Begegnungen mehr‹? Wolltest du dich nicht streng an die Bibel halten?«
»Oh, Alex.« Sie spricht in ihrer tiefen Predigten-Stimme. »Es war weder beiläufig noch bedeutungslos. Es war einfach biblisch – wie Adam und Eva im Garten Eden.«
Ich verdrehe die Augen. »Wahrscheinlich eher wie Sodom und Gomorra.«
»Punkt für dich.«
»Wenigstens wäre die Braut erleichtert zu wissen, dass du nicht lesbisch bist.«
»Was?« Karen hebt die Augenbrauen. »Nein – es war definitiv ein Mann. Ein großer, bärenstarker Kerl. Seinen Namen habe ich nicht mitgekriegt – Eddie oder Denny oder so.« Sie zuckt mit den Achseln.
»Und wo hast du diesen großen, bärenstarken Kerl kennengelernt, dessen Namen du nicht mitgekriegt hast?«
»Natürlich im Dorfpub, dem Goldenen Vlies.« Sie runzelt die Stirn. »Du hast mir doch dort ein Zimmer gebucht. Letzte Nacht. Kurzfristig.«
»Ja – tut mir leid.« Normalerweise hätte ich Karen bei mir übernachten lassen oder sie wenigstens in einem Gästezimmer untergebracht. Aber das Kutschenhaus ist mit Hochzeitsgästen belegt und in meiner Wohnung ist die Dusche kaputt. Die einzige andere Möglichkeit war der Pub im Dorf. Wo auch der Bräutigam und seine Gäste übernachten.
»Kein Problem. Die Nacht war eine Offenbarung. Sagen wir einfach, ein Kollar hat viele Verwendungszwecke.« Sie grinst. »Auch wenn nicht alle von den kirchlichen Texten sanktioniert sind.«
»Karen!« Ich lache. »Du bist unverbesserlich.«
»Ja, vielleicht …« Sie sieht auf die Uhr. »Dann legen wir mal los. Ich sollte Braut und Bräutigam kennenlernen, bevor ich den beiden die Fesseln anlege …« Sie zwinkert mir zu. »Ich meine, sie verheirate.«
»Der Bräutigam ist noch nicht da und die Braut nimmt gerade ein Bad, wie wär’s also mit einer Tasse Tee?« Ich führe sie durch die Tür ins Haus.
»Gibt’s keinen Schampus?« Karen runzelt die Stirn.
»Schon, aber …«
»Ach komm, Alex.« Sie zieht mich am Arm. »Lass uns das Leben ein bisschen genießen.«
Ich lasse mich ein paar Schritte von ihr ziehen, dann bleibe ich eisern stehen. »Wirklich, Karen, es würde keinen guten Eindruck machen, eine Pfarrerin, die ein Gläschen Champagner trinkt … oder zwei. Außerdem habe ich noch ein paar Dinge –«
»He, Sie! Ms – wie war noch mal Ihr Name? Hart?«
Ich drehe mich um und winde mich innerlich bei der affektierten Stimme von Cee-Cee, die mich von der Tür des Kutschenhauses her anschreit. Im überlege, was sie wohl diesmal auszusetzen hat: kein heißes Wasser, eine Spinne im Waschbecken, sie braucht neue Handtücher, das Schaumbad hat den falschen Duft …
»Wo zum Teufel ist Ernie?«, jammert sie. »Sie haben gesagt, dass er in einem schäbigen alten Pub unterkommt. Und jetzt ist er weg.«
»Weg?« Ich hebe die Augenbrauen.
»Ich habe Ant angerufen. Er ist hochgegangen und hat nachgesehen. Er hat gesagt, dass Ernie nicht in seinem Zimmer ist – sein Bett ist unbenutzt.«
»Oh.« Ich schlucke schwer. »Er ist … äh … wahrscheinlich einfach auf dem Weg hierher.«
»Ernie?«, fragt Karen mit großen Augen.
»Ist das die Pfarrerin?« Cee-Cee runzelt die Stirn.
Bevor ich antworten kann, fährt ein großer schwarzer SUV vor, am Steuer sitzt Ant, der Trauzeuge des Bräutigams. Ernie stolpert halb angezogen und völlig zerzaust mit einer leeren Whiskyflasche in der Hand aus der Beifahrertür.
»Schatz …«, lallt er und fällt Cee-Cee praktisch vor die Füße.
»Wo warst du, Liebling?«, schimpft sie mit Kleinmädchenstimme. »Wie ungezogen von dir, mich warten zu lassen. Wir sollen die Pfarrerin treffen.« Sie zieht die Nase kraus. »Sie.«
Cee-Cee sieht Karen an und zeigt auf sie.
Karen sieht Ernie an.
Ernie sieht Karen an. Er gibt einen stotternden Laut von sich.
Cee-Cee sieht Ernie an …
Dann Karen …
… und schließlich mich.
Karen sieht überallhin außer zu mir.
»Äh, nun …«, sagt Karen. »Wir haben uns bereits kennengelernt.«
Cee-Cee schreit.
Kapitel 2
Für die Planung einer großen High-Society-Hochzeit muss man über ein Jahr einkalkulieren. Eine abzublasen, dauert nicht einmal einen Nachmittag. Statt dem Jawort und Kirchenglocken sind Cee-Cees Schreie an der Tagesordnung.
»Nicht schon wieder, du Mistkerl! Wie konntest du bloß?«
Jetzt liegt es an mir, aktiv zu werden: Ich scheuche Karen ins Haus; verbiete dem Fotografen des Tattlers den Zutritt zum Grundstück; schnappe mir einen Besen, als Cee-Cee anfängt, Sektgläser auf der Terrasse zu zerschmettern. Ein paar Gläser kann ich retten und bringe sie den Gästen der Braut, die aus dem Zelt kommen, um sich das Spektakel anzusehen, und schenke allen einen Brandy ein.
»Cee-Cee Schatz, das hat mir doch überhaupt nichts bedeutet – es war nur ein allerletzter Seitensprung. Wie das von dir auf deinem Junggesellinnenabschied mit diesem Bassisten …«
Eine leicht angesäuselte »Mummy« Heath-Churchley wählt diesen Augenblick, um auf den Zug aufzuspringen. »Wie kannst du es wagen?« Sie fuchtelt mit einer halb vollen Flasche vor Ernie herum.
Ich gebe dem Robbie-Williams-Imitator, dem Frontmann der Band, ein Zeichen. Daraufhin hält er ihre Arme fest, bevor sie ihren künftigen Nicht-Schwiegersohn entmannen kann.
»Und was wird Daddy dazu sagen, dass diese Hochzeit schon wieder abgesagt wird?«
Ich schnappe mir ein paar Brautjungfern, die helfen sollen, den Hochzeitsgästen abzusagen. Gerade als ich den Catering-Service anrufen will, ändert »Mummy« Heath-Churchleys Zorn seine Richtung.
»Und wo ist diese Schlampe von einer Pfarrerin? Ich werde dafür sorgen, dass sie … ihre Robe ablegen muss.«
Nicht, dass Karen das wirklich stören würde – jedenfalls nicht im Wortsinn. Aber mir fällt auf, dass ich sie seit dem Moment der Wahrheit nicht gesehen habe, und beschließe, besser nach ihr zu sehen. Ich finde sie im Blauen Salon, wo sie es sich auf dem Sofa gemütlich gemacht hat.
»Es tut mir so leid, Alex!« Sie schluckt Tränen hinunter (und die letzten Reste einer in der Bar stibitzten Flasche Pol Roger).
»Es tut dir leid?!« Ich koche vor Wut. »Wie schade, dass dir bei deiner Offenbarung nicht aufgegangen ist, dass der große, bärenstarke Kerl ausgerechnet der Bräutigam ist! Du weißt genau, wie wichtig das für mich war. Es war unsere erste Hochzeit. Es musste gut laufen. Stattdessen ist es eine totale Katastrophe!«
»Ich hatte keine Ahnung, wer er war – wirklich nicht.« Ich hatte sie noch nie so reumütig gesehen. »Ich sollte hinausgehen und mich persönlich entschuldigen.« Ihre Lippen biegen sich nach oben zu einem kurzen Lächeln. »Glaubst du, es wäre blöd, wenn ich Ernie nach seiner Nummer frage?«
Sie macht Witze – glaube ich. »Du bleibst hier«, befehle ich.
»Ist gut. Hol dir ein Glas – wir können uns ein bisschen unterhalten und uns auf den neuesten Stand bringen, wie du versprochen hast.«
»Was?«
Sie sieht verletzt aus. »Oder hast du mich nur den ganzen Weg hierherkommen lassen, damit ich deine schnöseligen zahlenden Gäste verheirate?«
Jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen. Es stimmt, dass Karen sich mir zuliebe sofort auf den Weg gemacht hat und ich gesagt hatte, wir könnten uns im Pub treffen und uns unterhalten. Aber es hatte dann doch nicht geklappt. Vor der Hochzeit war noch so viel zu tun gewesen, und außerdem hatte Mrs Fairchild mich um ein Gespräch gebeten. Sie hatte einen Brief bekommen, der sie anscheinend beunruhigt hatte, also war ich bis fast zehn Uhr im Haupthaus geblieben. Als ich in meine Wohnung zurückgekommen war, hatte ich Karen auf dem Handy angerufen, aber sie war nicht rangegangen.
»Vielleicht können wir ja heute Abend ein bisschen reden«, sage ich. »Da ich ja offensichtlich nicht hierbleiben muss, bis die Hochzeit vorbei ist.«
Sie schüttelt den Kopf. »Ich habe dir doch am Telefon gesagt, dass ich nicht bleiben kann. Morgen kommt ein venezolanischer Bischof. Es wäre schön gewesen, etwas Zeit mit dir zu haben, aber anscheinend bist du zu beschäftigt.«
»Tut mir wirklich leid«, sage ich und werde wütend. »Tut mir leid, dass ich es nicht in den Pub geschafft habe und du den Bräutigam vögeln musstest. Tut mir leid, dass ich das Geld meiner schnöseligen zahlenden Gäste dafür verplant habe, die Gästetoiletten und den Teppich auf der Treppe zu erneuern, und dass ich wollte, dass alles gut läuft. Und jetzt muss ich Mrs Fairchild gegenübertreten und ihr von diesem furchtbaren Schlamassel erzählen.«
»Mensch, Alex.« Sie ist gekränkt. »Ich hatte ja keine Ahnung, wie wichtig dir so was ist. Ich meine … Gästetoiletten? An der Uni hast du dich auf Das Heilige und das Profane in mittelalterlicher Architektur und Historische Geheimnisse um den Genter Altar konzentriert. Ganz abgesehen von du-weißt-schon-wem. Ich hatte ja keine Ahnung, dass dieser andere Kram nun Vorrang hat.« Sie schüttelt abschätzig den Kopf.
»Das ist lange her«, sage ich.
Sie nickt, und in ihren Augen sehe ich mein letztes Jahr an der Uni. Sie hatte mir beigestanden, als ich an der unglücklichen Liebesaffäre mit Javier, einem argentinischen Dichter, der praktischerweise mein Tutor und unpraktischerweise verheiratet gewesen war, fast zerbrochen wäre.
»Drei Jahre«, sinniert sie. »Wie sich alles verändert.«
»Du hast mir gesagt, dass ich damit abschließen soll«, sage ich und werde noch wütender. »Also habe ich das gemacht!«
»Ach wirklich? Für mich sieht es nämlich so aus, als würdest du dich vor der realen Welt verstecken. Ich wette, du verlässt diesen Ort nie. Hast nie Spaß.«
»Das eine schließt das andere doch nicht aus!«, kontere ich.
Karen und ich hatten noch nie dieselbe Vorstellung von Spaß gehabt. Sobald wir an der Uni zusammengezogen waren, hatte ich entdeckt, dass sie gern auf Partys ging, neben völlig Fremden aufwachte und rohes Ei mit Worcestersauce frühstückte. Ich dagegen lud gern ein paar Freunde ein, um über Bücher und Politik zu diskutieren, spazierte lange allein am Fluss entlang und machte es mir mit einem Krimi und einem Glas Wein im Fenstersitz gemütlich. Wahrscheinlich kamen wir nur so gut miteinander aus, weil wir so verschieden waren.
»Ich liebe es hier«, sage ich und habe das Gefühl, mich verteidigen zu müssen. »Ich bin jetzt viel näher am Leben dran, als ich es je an der Uni war. Und in der realen Welt – ob im Mittelalter oder heutzutage – schlafen Pfarrerinnen nicht in der Nacht vor der Hochzeit mit dem Bräutigam.«
»Dann sollte ich wohl besser gehen.« Ihr natürlicher Enthusiasmus scheint sie zu verlassen. Sie stellt die leere Flasche ab.
»Das solltest du wohl. Da du in diesem Zustand nicht fahren kannst, suche ich jemanden, der dich ins Dorf bringt.«
Sie steht auf und rückt ihr Kollar zurecht. »Hör zu, Alex, es tut mir wirklich leid.« Sie geht zur Tür. »Ich habe mich danebenbenommen. Und fürs Protokoll: Ich hatte wirklich ein neues Kapitel aufgeschlagen. Zur Strafe werde ich eine Predigt schreiben – so in der Richtung Wir sind alle nur Menschen und manchmal fallen wir der Sünde anheim.«
»Ich weiß, dass es dir leidtut, Karen. Und mir auch.« Ich seufze. »Ich hätte mich gestern Abend mit dir treffen sollen. Wir müssen wirklich mal in Ruhe reden. Ich vermisse dich. Es ist einfach … Ich war so beschäftigt.«
»Es ist gut, wenn man viel zu tun hat, Alex. Meistens zumindest. Und du hast an diesem Ort offensichtlich Wunder bewirkt – es ist herrlich hier, alles in tadellosem Zustand und anscheinend ein Selbstläufer …«
»Da irrst du dich …«
Sie hebt die Hand. »Aber willst du das für immer machen? Vielleicht lebst du gern hier, aber bist du wirklich glücklich? Ich bin momentan vielleicht bei Gott in Ungnade gefallen. Man muss allerdings kein Hellseher sein, um zu merken, dass du einsam bist. Du hältst dich beschäftigt, damit du dich mit dem wirklichen Leben nicht auseinandersetzen musst. Sowohl was die schönen Dinge als auch was die Schattenseiten betrifft. Ich meine, wann hast du das letzte Mal Urlaub gemacht?«
Ich senke den Kopf.
»Das habe ich mir gedacht. Komm mich mal für ein Wochenende besuchen. Im Pfarrhaus gibt es ein Gästezimmer. Es mag in Essex sein, aber es ist verdammt viel mehr los als hier.«
»Schon klar.«
»Vergiss nicht: Wer nicht wagt, der nicht gewinnt.« Sie zwinkert mir zu.
»Kann ich mich nicht einfach über das freuen, was ich habe? Ein geregelter Job an einem schönen Ort. Dir wäre das vielleicht nicht genug. Aber mir geht es gut.«
»Wirklich, Alex?« Sie sieht mir tief in die Augen. »Tut es das wirklich?«
»Ja.« Doch sobald ich es das sage, frage ich mich, ob es überhaupt stimmt.
Nachdem Karen weg ist, beschließe ich, diesen furchtbaren Tag hinter mir zu lassen und wieder zur Normalität zurückzukehren. Die Hochzeitsgäste zerstreuen sich langsam, fahren in verschiedenen Limousinen und Taxis ab, und das Reinigungsteam macht sich an die Arbeit. Also nutze ich die Gelegenheit und verschwinde unauffällig in meinem Büro: ein gemütliches kleines Zimmer mit Holztäfelung, einem gemeißelten Steinkamin und einem Fenstersitz mit roten Samtkissen. Ein großer Eichenschreibtisch nimmt fast den gesamten Raum ein. Ich setze mich hin und fahre den Computer hoch. E-Mails müssen gecheckt, Rückrufe getätigt, Rechnungen bezahlt, Termine mit Handwerkern vereinbart werden – was ich alles im Schlaf kann. Obwohl ich zugegebenermaßen doch ein wenig niedergeschlagen bin. Aber das wird sich sicher ändern,
wenn –
»Ähem.«
Eine massige Gestalt in schwarzem Frack und prallem weißen Kummerbund füllt die gesamte Tür aus. Ich erkenne Charles August Heath-Churchley, Vater der Braut.
»Oh«, sage ich erschrocken. »Guten Tag, Sir.«
»Sie –« Seine schlaffen Wangen zittern churchillhaft, als er mit bohrendem Blick auf mich zukommt. »Für wen halten Sie sich?«
Eine aufgeladene Frage, auch wenn er das nicht weiß.
»Wissen Sie, was Sie heute getan haben? Welchen Schaden Sie einer der ältesten und stolzesten Familien Englands zugefügt haben?«
»Ich?« Ich blicke ihn entgeistert an. »Bei allem Respekt, Sir, das ist nicht fair. Sie können mich kaum dafür verantwortlich machen, was die Hochzeitsgesellschaft in ihrer Freizeit anstellt.« Selbst wenn die Ersatzpfarrerin meine beste Freundin ist, füge ich nicht hinzu.
Boshaft äfft er mich nach. »Sie können mich kaum dafür verantwortlich machen? Wer sind Sie, die Putzfrau? Das Mädchen im Souvenirshop? Irgendein kleiner Niemand? Ich dachte, Sie wären hier die Geschäftsführerin. Und in dieser Position sind Sie schließlich für alles verantwortlich.«
Putzfrau? Mädchen im Souvenirshop? Der Mann kann seinen Familienstammbaum wahrscheinlich bis zu den Neandertalern zurückverfolgen – doch das gibt ihm noch lange nicht das Recht, mich zu beleidigen!
»Es tut mir leid, dass der Tag nicht so gelaufen ist wie geplant«, sage ich zähneknirschend. »Aber ich denke, wir sind hier fertig.«
»Oh, wir sind nicht fertig«, schnauzt er mich an. »Noch lange nicht. Ich werde Catherine anrufen – ich werde Sie in hohem Bogen hinauswerfen lassen, da können Sie Gift drauf nehmen.« Er dreht mir den Rücken zu und geht.
»Tun Sie, was Sie nicht lassen können, Sir«, murmele ich leise.
Sobald er weg ist, lege ich den Kopf in die Hände. Ungeachtet meines forschen Auftretens hat mir diese unangenehme Unterredung den Tag ruiniert – wahrscheinlich den ganzen Monat. Catherine – er hat Mrs Fairchild beim Vornamen genannt, als würde er sie kennen. Hier in Mallow Court zu arbeiten war inzwischen sehr viel mehr für mich als nur ein Job. Konnte er genügend Einfluss haben, um mich feuern zu lassen?
Nein, das ist Unsinn. Ich richte mich auf und fahre mir mit den Fingern durchs Haar. Mrs Fairchild ist nicht der Typ, der sich von adligen Clowns ins Bockshorn jagen lässt. Ihr Vater Frank Bolton – der »Schlüpferkönig« – stammte aus der Arbeiterklasse und war ein Selfmademan.
Ich checke meine E-Mails und bringe meinen Terminkalender auf den neuesten Stand – ich bin entschlossen, einfach weiterzumachen, als wäre nichts Unziemliches passiert. Nach dem heutigen Tag werde ich niemanden mehr sehen müssen, der mit den schrecklichen Heath-Churchleys zu tun hat – es sei denn, sie listen Cee-Cee erneut als begehrte Junggesellin in Country Life und ich habe das Pech, im Wartezimmer eines Zahnarztes oder so eine Ausgabe in die Finger zu bekommen.
Und bis dahin – nichts von dem, was »Daddy« Heath-Churchley gesagt hat, tangiert mich auch nur im Geringsten, überhaupt nichts. Ich bin eine unabhängige Frau. Ich brauche keine Wurzeln, keine Familiengeschichte und auch keinen hochtrabenden Namen, um glücklich zu sein.
Putzfrau, Mädchen im Souvenirshop … kleiner Niemand …
Ich pfeife melodielos, um die Worte zu übertönen. Sie sollten mir egal sein, und ich bin mir sicher, dass heute Abend – oder morgen – oder spätestens nächste Woche alles wieder gut ist. Aber in diesem Moment wurde ein lang vergrabener Keim des Selbstzweifels in meinem Hinterkopf freigelegt. Die Sorge, es könnte ein ganzes Leben dauern, um aus dem Nichts eine Identität zu schaffen, und – wie meine unglückliche Begegnung beweist – weniger als zehn Sekunden, um sie in Stücke zu reißen.
Kapitel 3
»Willkommen in Mallow Court«, sage ich mit einem etwas gezwungenen Lächeln. Das Hochzeitsdebakel der Churchley-Thursleys ist eine Woche her, aber ich habe es immer noch nicht ganz verwunden. Auch wenn Mrs Fairchild keine Andeutungen gemacht hat, mich feuern zu wollen, nagt etwas an mir und hört damit nicht auf. Habe ich mich bloß deswegen in die Arbeit gestürzt, um nicht an meine eigene Zukunft denken zu müssen? Ist mein Leben nichts weiter als ein Kartenhaus, das darauf wartet, einzustürzen?
»Ich hoffe, Sie genießen die heutige Führung durch eines der schönsten elisabethanischen Herrenhäuser im Südosten Englands.« Ich stelle mit ein paar Teilnehmern der amerikanischen Reisegruppe Blickkontakt her. »Das Haus wurde 1604 von einem wohlhabenden Wollhändler erbaut, der auch –«
Ein Handy klingelt. Ich unterbreche meinen Vortrag und warte geduldig (nur etwas genervt) auf einen kleinen, kahlköpfigen Mann in einem grünen Bowlinghemd, der in seiner Tasche wühlt, sein Handy findet, es herausholt, mit zusammengekniffenen Augen auf das Display blickt – und, anstatt den Anruf wegzudrücken, laut und mit Südstaatenakzent antwortet: »Hi, Schatz. Wie geht’s den Kindern?«
Ein paar Leute blicken ärgerlich in seine Richtung, und jemand erdreistet sich zu lachen.
Er redet weiter. »Ja, wir sehen uns gerade ein altes Herrenhaus an.«
Ich räuspere mich und werfe ihm einen wütenden Blick zu. Er hebt seine feiste Hand, wie um zu sagen, dass er gleich fertig sei.
Als ich in Mallow Court anfing, habe ich das Skript für die Führungen geschrieben und alle selbst gemacht. Inzwischen gibt es allerdings zwei weitere Vollzeit-Guides. Normalerweise sind die Führungen für mich eine willkommene Abwechslung zu meinen administrativen und organisatorischen Aufgaben, und es macht mir Freude, Menschen zu treffen, die sich für das Haus interessieren. In letzter Zeit fiel es mir allerdings eher schwer, meine Begeisterung aufrechtzuerhalten.
»Bevor ich fortfahre«, sage ich, als ich die anderen in die Bibliothek führe, »möchte ich ein paar Grundregeln klarstellen. Zuerst möchte ich Sie bitten, Ihre Handys auszuschalten …«
Darauf folgt eine gute halbe Minute Murmeln, Rascheln, Wühlen und Piepen.
Der Mann am Telefon legt endlich auf und schließt sich wieder der Gruppe an. »Tut mir leid, Leute.«
Ich ignoriere seine Entschuldigung, während die letzten Handys wieder in Hosen- und Handtaschen wandern. Ein älterer Mann mit einer Red-Sox-Baseballkappe nutzt das Chaos, um sein Kaugummi rauszunehmen und fest unter einen geschnitzten Eichentisch zu kleben.
»Außerdem«, sage ich mit unnatürlich hoher Stimme, »möchte ich Sie daran erinnern, dass das Essen und Trinken im Haus nicht gestattet ist.«
Der alte Mann zeigt grinsend die Lücke in seinen Vorderzähnen und wirft sich das nächste Kaugummi in den Mund. Ich seufze. Neben ihm hebt eine birnenförmige Dame in einem Go ahead, make my day-T-Shirt die Hand.
»Ja?«
»Aber es gibt doch ein Café? Das hat der Busfahrer gesagt. Ich möchte was von dieser Bio-Orangenmarmelade für meine Schwiegertochter kaufen. Und ich will dieses Craftbeer probieren!«
»Natürlich. Die Führung endet am Café und am Souvenirshop. Wenn wir jetzt –«
Eine andere Frau hebt die Hand. »Und wo ist die Damentoilette? Die im Bus hat so gestunken …« Sie tritt von einem Fuß auf den anderen und bemüht sich, verzweifelt auszusehen.
»Einmal hinaus und dann links. Und könnten Sie Ihre Fragen nun bitte erst einmal zurückstellen, damit wir beginnen können? Ich verspreche, im Verlauf der Führung auf alle zu antworten.«
Noch eine Hand schießt nach oben.
»Oder am Ende«, sage ich demonstrativ. »Wie bereits gesagt …«
Kurz handle ich die Daten und Identitäten der blassen Figuren auf den alten Porträts ab. Viele der Leute, die das Haus besuchen, sind an solchen Dingen interessiert, aber man braucht nicht so zu tun, als ob das alle wären. Dann komme ich schnell zum witzigen Teil.
»Vielleicht interessiert es Sie, wem das Haus aktuell gehört – Mrs Catherine Fairchild. Ihr Vater, Frank Bolton, war als der ›Schlüpferkönig‹ bekannt.« Ich lächle, als ein paar Leute miteinander tuscheln. »Seine Firma war in den fünfziger und sechziger Jahren berühmt für britische Damenunterwäsche.«
Nun kichern ein paar Leute. Das ist bei allen Gruppen so, selbst bei den Akademikern.
»Er war der erste Mann in England, der Schlüpfer mit doppelt genähtem Zwickel in Massenproduktion herstellte«, sage ich. »Für diejenigen unter Ihnen, die nicht wissen, was ein Zwickel ist …« Ich hebe schalkhaft die Augenbrauen. »Es ist der funktionale Teil des Schlüpfers.«
Es wird laut gelacht, als diese neue Information verarbeitet wird, und Unterwäsche-Witze werden gerissen.
Jetzt, wo das Eis gebrochen ist, führe ich die Gruppe ins Billardzimmer. Dabei kommt ein großer Mann mit hellbraunem Haar an mir vorbei, den ich vorher nicht bemerkt hatte. Er muss hinten gestanden haben. Er ist viel jünger als der Rest der Gruppe – vielleicht Anfang dreißig. Und er geht nicht einfach vorbei, sondern bleibt stehen und sieht mir in die Augen. Seine sind vom herrlichsten Schokoladenbraun, das ich je gesehen habe. Eine unerwartete Hitze schießt durch meinen Körper.
»Äh«, plappere ich, »wir kommen ins Billardzimmer.« Als wäre das nicht völlig offensichtlich (angesichts des riesigen, mit grünem Tuch bespannten Billardtischs, der so ziemlich das ganze Zimmer ausfüllt).
Ich liefere stammelnd meine Erklärung ab, wie Billard sich von Pool unterscheidet, und die ganze Zeit ist mir bewusst, dass er mich ansieht und mir aufmerksam zuhört. Als ich die Gruppe weiterführen will, hebt er die Hand.
»Ich habe eine Frage zu Frank Bolton«, sagt er. Seine Stimme ist tief, wohlklingend und definitiv nicht amerikanisch.
»Ja?«
»War das Haus schon im Familienbesitz oder hat er es nach dem Krieg gekauft?«
Das ist eine völlig berechtigte Frage, aber ich habe einen kurzen Aussetzer. »Mr Bolton hat das Haus 1944 bei einer Auktion erworben«, sage ich irgendwann. »Es war ziemlich heruntergewirtschaftet, und nach dem Krieg hat er mit den Renovierungen begonnen, um seine frühere Pracht wiederherzustellen.«
»Und woher kam dann das Geld?«
»Nun …« Ich runzle die Stirn. »Wie ich schon gesagt habe – er hat Schlüpfer produziert.«
»Ich meine davor. Woher hatte er das Geld, um sein Unterwäscheimperium zu gründen?«
Ich atme durch, entschlossen, keinen Unsinn zu reden. Das hat noch nie jemand gefragt, und ich habe das Gefühl, dass er mich auf die Probe stellt. »Nach dem Krieg gab es viele Gelegenheiten für ehrgeizige junge Männer«, sage ich. »Frank Bolton war einfacher Herkunft, aber er hat hart gearbeitet und war zielstrebig. Er war ein Selfmademan.«
Ich bin erleichtert, dass meine Antwort glaubwürdig klingt. In Wirklichkeit habe ich keine Ahnung, wie Frank Bolton ursprünglich an das Kapital gekommen ist, um eine Unterwäschefabrik zu kaufen, doch die Amerikaner nicken zustimmend – auf das Konzept eines Selfmademans reagieren sie immer positiv.
Die Gruppe wird sichtlich ungeduldig. Ich fahre mit der Führung fort, komme jedoch nicht richtig rein. Ich verwechsle Daten und vergesse die Namen von früheren Bewohnern des Hauses, wen sie geheiratet und was für Skandale sie ausgelöst haben. Wir gehen ziemlich schnell durch die Räume im Erdgeschoss. Ich ermahne die Besucher freundlich, die empfindlichen Stoffe nicht anzufassen und sich nicht auf die antiken Stühle zu setzen – alles ganz mechanisch. Während der ganzen Zeit muss ich an den Mann denken, der etwas hinter der Gruppe bleibt und sich alles aufmerksam ansieht.
Die Führung endet oben in dem prunkvollen Schlafzimmer, in dem die junge Elisabeth I. Gerüchten zufolge nach einem Besuch bei einem Cousin im Norden auf dem Weg nach Hatfield eine Nacht verbracht hat. Nachdem sich alle das große Himmelbett aus Eichenholz angesehen haben, sammelt sich die Gruppe oben an der Hintertreppe. Ich danke allen und lade sie ein, noch die Küche zu besichtigen und den Souvenirshop und das Café im Erdgeschoss zu besuchen. Zwei Personen fragen mich, ob es einen Aufzug gibt, da sie Knieprobleme haben. Schnell führe ich sie zu einem kleinen Lift, den wir hinter der Täfelung haben einbauen lassen. Sobald sie versorgt sind, gehe ich zurück und sehe mich nach dem großen Mann mit den schokoladenbraunen Augen um. Keine Spur von ihm. Das Adrenalin ebbt ab und wird durch Enttäuschung ersetzt. Trotz all der Fragen hatte ich gehofft, dass die Anziehung, die ich ihm gegenüber empfand, gegenseitig war.
Ich helfe den letzten Leuten die Treppe hinunter, mir wird überschwänglich gedankt, eine Frau fragt, ob ich die Bilder ihrer Enkelkinder sehen will. Die bewundere ich gebührend, dann entschuldige ich mich mit der Begründung, ihrer Landsfrau zeigen zu müssen, wo die Orangenmarmelade steht. Eigentlich hoffe ich, noch einmal den braunäugigen Mann zu sehen. Aber er hat sich regelrecht in Luft aufgelöst.
Kapitel 4
Nach der Führung fühle ich mich merkwürdig aufgewühlt. Der große Mann schien an dem Haus und der Familie so interessiert gewesen zu sein, aber war dann doch nicht geblieben, um noch mehr Fragen zu stellen. Die prickelnde Anziehung, die ich empfunden hatte, beruhte eindeutig nicht auf Gegenseitigkeit. Enttäuscht gehe ich auf die Damentoilette – ein Anbau aus Lehmfachwerk an der Rückseite des Souvenirshops – und betrachte mich im Spiegel.
Ich war immer groß und dünn gewesen, ohne große weibliche Kurven, und obwohl ich ständig übriggebliebenes Gebäck aus dem Café esse, bin ich gertenschlank. Meine Dusche ist Anfang der Woche repariert worden, also bin ich wenigstens sauber, aber mein Haar – kupferfarben und normalerweise zu einem akkuraten kinnlangen Bob frisiert – könnte mal wieder einen Schnitt vertragen. Meine Haut ist blass, ohne jegliche Strahlkraft. Ich sehe älter und weiser aus als meine achtundzwanzig Jahre – aber nicht im positiven Sinn. Als ich mir hier in Mallow Court meine eigene gemütliche kleine Welt geschaffen habe, wie Karen es nennen würde, habe ich mich gehen lassen.
Ich kneife mir in die Wangen, damit sie etwas Farbe bekommen, doch es bleiben nur rote Flecken zurück. Wo ist die scharfsinnige, temperamentvolle Alex, die in der Oberstufe im Debattierclub war und Doppelschichten im Supermarkt geschoben hat, um Geld für die Uni zu sparen? Wo ist die gelehrte Alex mit dem ausgezeichneten Mediävistik-Examen, die sich in Javier, einen argentinischen Dichter, verliebt hat? Wo ist die pragmatische, bodenständige Alex, der immer egal war, ob andere aus wohlhabenderen Familien kamen, schönere Häuser und schickere Autos hatten und auf einen Familienstammbaum blicken konnten, der bis in die Zeit der normannischen Eroberung zurückreicht?
Die Frau, die mich im Spiegel ansieht, ist eine kompetente Geschäftsführerin und verwaltet zuverlässig ein bedeutendes historisches Gebäude. Aber abgesehen davon kenne ich sie nicht mehr wirklich.
Ich beuge mich vor und wische eine Wimper weg, die sich verirrt hat. Meine Augen sind graublau – von der Farbe der winterlichen See, wie Javier immer sagte. Manchmal haben mich Leute gefragt, von welcher Seite der Familie ich diese Farbe geerbt habe. Dad hat braune Augen mit goldenen Sprenkeln und Mums sind blau. Meine Augenfarbe habe ich von keinem der beiden. Ich denke gern, dass ich sie von meiner leiblichen Mutter habe. Ich denke nicht oft an sie – Dad hat nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass ich das Ergebnis einer New Age-Verbindung war. Anders ausgedrückt: Dad hat sie kennengelernt, als er den Grateful Dead hinterherreiste und gegen Atomwaffen protestierte. Und Mum – Carol, Dads Frau, meine Mum, seit ich denken kann – ist die beste Mutter, die ich mir vorstellen kann.
Aber unter der Oberfläche ist eine Unruhe, die ich nicht loswerde. Jeden Tag rühme ich die Vorzüge eines Hauses, das bis in die Zeiten von Elizabeth I. zurückgeht, und kann doch meine eigene Geschichte kaum bis Anfang der siebziger Jahre zurückverfolgen. Fünfzig Prozent meiner Gene stammen von einer Frau, über die ich nichts weiß und die aus einer Familie kommt, über die ich auch nichts weiß. Eine Hälfte von mir ist ein klaffendes Loch, das niemals von den Wurzeln eines Familienstammbaums ausgefüllt werden wird. Sollte ich versuchen, mehr herauszufinden? Werde ich mich dann ganz fühlen?
Ich werde den Gedanken nicht los. Dann verlasse ich die Toilette und gehe durch den Heckenbogen in den Cottage-Garten. Mallow Court ist bekannt für seine jeweils von hohen Hecken umgrenzten Gartenräume. Der Cottage-Garten strotzt vor Farben: weiße Edelwicke, violetter Lauch, rosa Fingerhut, blauer Rittersporn. Durch den Heckenbogen auf der anderen Seite erspähe ich Mrs Fairchild im »weißen Garten«. Sie schneidet Flieder für die Vase im großen Saal.
Ich lächle und winke ihr zu. Ich habe sie nie darum beneidet, in Mallow Court aufgewachsen zu sein. Aber sehr wohl darum, genau zu wissen, wo sie herkommt – aus einer Familie mit einem liebenden Vater, den sie angebetet hat, zwei ungestümen jüngeren Brüdern und einer Mutter, die zwar schon starb, als Catherine Anfang zwanzig war, allem Anschein nach aber einer mustergültigen, aufrechten Hausfrau der fünfziger Jahre entsprach.
Noch einmal schießt mir die Frage des attraktiven Mannes in den Kopf. Wie ist der »Schlüpferkönig« an das Geld gekommen, mit dem er sein Unterwäscheimperium aufgebaut hat? Ich weiß, dass Frank Bolton bescheidene Ostlondoner Wurzeln hat, aber nicht viel mehr. Die meisten Besucher, die zu uns kommen, sind an der Geschichte und Architektur des Hauses, an den spektakulären Gärten oder an der wertvollen Antiquitätensammlung interessiert. Der Rest kann zumindest über die Unterwäsche-Anekdoten lachen. Für die meisten Leute reicht das an Abstammung.
Doch die Frage ist nicht unberechtigt, und wahrscheinlich sollte ich die Antwort darauf kennen. Ich nehme mir vor, Mrs Fairchild zu bitten, mir mehr über ihren Vater zu erzählen. Im Moment verspüre ich allerdings das Bedürfnis, die idyllische Zuflucht Mallow Courts zu verlassen und einen Nachmittag lang die schmutzige Luft der realen Welt zu atmen. Und auch wenn es wahrscheinlich zwecklos ist, werde ich der einzigen Person, die etwas darüber wissen kann, ein paar Fragen über meine eigene undurchsichtige Herkunft stellen.
Ich gehe durch den Souvenirshop wieder hinein. Es riecht nach einer Mischung aus Rosen-Raumduftstäbchen, Kerzen mit Honigaroma, Lavendelschrankpapier und Maiglöckchenparfüm. Obwohl ich den Geruch von alten Büchern vorziehe, verstehe ich, warum der Laden so viel Umsatz macht. Wir haben eine Auswahl von Geschenken für den Gärtner, Lernspiele und Bücher für Kinder, Grußkarten, Schmuck, Hüte, gemusterte Gummistiefel, Geschirrhandtücher und ein schönes Angebot an Topfpflanzen und Saaten – nicht zu vergessen das beliebte Craftbeer, das in der Gegend gebraut wird.
Unsere Angestellte Edith hat gerade einen Kunden abkassiert, als ich näher komme.
»Ich muss etwas erledigen«, sage ich. »Kannst du die Stellung halten?«
»Klar.« Sie lächelt. »Lass dir Zeit.«
»Danke. Gibt es neue Kerzen?«
»Ah.« Sie sieht mich wissend an. »Es geht nach Abbots Langley.«
»Stimmt. Er hat am Sonntag Geburtstag.«
»Wie wäre es mit dieser?« Sie führt mich zu einem Regal mit einer Auswahl von Kerzen in verschiedenen Duftrichtungen. »Wie wär’s mit Grüner Tee, Vanille und Eisenkraut?« Sie gibt mir eine kleine grüne Kerze in einem Votivglas.
Ich schnuppere daran. »Mmmh.« Ich ziehe die Nase kraus. »Die ist perfekt.«
Sie packt sie für mich ein, und ich unterschreibe, damit sie sie auf meine Rechnung setzt (abzüglich zehn Prozent Angestelltenrabatt). Dann verlasse ich den Souvenirshop mit dem Päckchen, springe in meinen Wagen und steuere über ländliche Wege und langsam breiter werdende Straßen zurück in die Zivilisation.
In diesem Fall ist mit Zivilisation die geschäftige Ortschaft Hemel Hempstead in Hertfordshire und ein kleines an der M25 liegendes Dorf namens Abbots Langley gemeint. Ich fädle mich durch die Wohnstraßen und halte vor dem Ivy Cottage, dem Haus, in dem ich aufgewachsen bin. Das gelbe Backsteinhaus mit Kunststofffenstern und einem Wintergarten ist in den sechziger Jahren erbaut worden. Der Vorgarten ist ein Durcheinander aus Topfpflanzen, Kletterefeu und Rosen an klapprigen Gestellen und einem mintgrünen Nissan Figaro mit zwei platten Reifen.
Ich gehe nicht zur Tür, sondern direkt auf einem kleinen Weg um das Haus herum. Nach einer Weile bleibe ich stehen und blinzle – wie immer, sobald ich den Hintergarten erblicke.
Es ist eine Oase der Ruhe – ein spiritueller Garten im balinesischen Stil. Ein gewelltes Dach in einem Eichenrahmen ist am Haus angebaut, die Seiten sind offen. Üppige Palmen, Bambushecken und Solarlaternen begrenzen die unterschiedlichen Räume. Es gibt einen mit Brettern umrahmten spirituellen Garten aus Kies, einen mäandernden Koi-Teich mit zwei identischen gebogenen Brücken darüber, und unter dem Dachanbau ist der Boden mit Gummimulch gepflastert. Hier treffe ich Dad, den Körper einmal in der Mitte geknickt zu einem umgedrehten V in der Position des herabschauenden Hunds.
»Hi, Dad«, sage ich. »Wie geht’s?«
Er lässt die Knie herabsinken und setzt sich auf die Fersen. Er trägt eine eng anliegende Baumwollhose, die an den Knöcheln weiter wird. Sein Oberkörper ist nackt, und man sieht eine Art Landkarte aus missglückten Tattoos – chinesische Zeichen, eine irgendwie fleckige Version der indischen Göttin Shiva, aus deren offenen Armen jetzt Dads Brusthaar sprießt. Er sieht mich einen Moment lang mit seiner undeutbaren Guru-Miene an, dann steht er auf und nimmt einen langen Zug von seiner Zigarette.
»Nichts geht, Alexandra.« Er zwinkert mir zu. »Das Wichtige ist die innere Ruhe, das weißt du doch!« Er breitet die Arme aus, und ich gehe und lasse mich umarmen, genieße das Gefühl seiner versponnenen Verlässlichkeit.
»Hat Buddha denn Selbstgedrehte geraucht, Dad?«, frage ich, als wir uns voneinander lösen. »Ich dachte, du wolltest aufhören.«
Er wedelt ausladend mit der Zigarette. »Viele weise Männer haben über die Jahrhunderte mit Substanzen experimentiert, die ihnen halfen, die Göttlichkeit zu erfahren. Die Schamanen der amerikanischen Ursprungsvölker sind dafür bekannt, bei ihren Ritualen Halluzinogene zu verwenden. Dann sind da die christlichen Religionen – für die Wein ein Symbol der Transsubstantiation ist.« Er grinst trocken. »Und vergiss nicht John Lennon – er ist eine ganz eigene Religion.«
»Keine Sorge, Dad, mach ich nicht.« Man kann unmöglich in einem Haushalt mit Dad aufwachsen und John Lennon vergessen.
Er schiebt die Zigarette in eine Raku-Flasche. »Und wem oder was habe ich das Vergnügen Ihres Besuchs zu verdanken, Eure Hoheit?« Er senkt den Kopf in einer gespielten Verbeugung.
Ich lache. Gerade Dad weiß ganz genau, dass ich keine Prinzessin bin. Als ich klein war, hat er mir statt Märchen Ausschnitte aus Karl Marx, der Bhagavad Gita und dem Guardian vorgelesen. Mum hat das dafür überkompensiert und ist mit mir in jeden Disneyfilm gegangen, der rauskam. Letztlich hat Dads unkonventioneller Stil gewonnen. Als ich alt genug war, um mir eine eigene Meinung zu bilden, fand ich, Cinderella sollte mehr Rückgrat zeigen, sich gegen ihre gemeinen Stiefschwestern wehren und ihnen sagen, dass sie ihre Nachttöpfe gefälligst selbst leeren sollten. Und Schneewittchen hatte zwar Haar so schwarz wie Ebenholz, Haut so weiß wie Schnee und Lippen rot wie Blut, aber war auch dumm wie Brot.
Trotzdem lässt Dad mich nicht in Ruhe, seit ich den Job in Mallow Court angenommen habe. Er denkt, da ich in einem »Tempel der Unterdrücker« für die »Aristokratie«, wie er es nennt, arbeite, bin ich zum Feind übergewechselt. Und neben seiner Arbeit abends im Pub und tagsüber als Yogalehrer ist Dad ein standhafter Unterstützer der Labour Party. Er hasst die aktuellen Parteiführer (»alles verkappte Nazis«) und wartet, dass eine britische Version von Lenin im nördlichen Hinterland auftaucht, wo Dad ursprünglich herstammt. Obwohl alle für Glasnost und Perestroika waren, als ich in die Oberstufe ging, war es für Dad ein trauriger Tag, als die Berliner Mauer fiel und selbst er zugeben musste, dass der Kommunismus – zumindest die sowjetische Variante – sich als historischer Fehlschlag erwiesen hatte.
»Wenn die Revolution kommt, wird dir das Lachen vergehen, Tochter«, sagt er ernst.
»Okay, Dad.« Manchmal ist schwer zu sagen, was er ernst meint und was nicht. »Aber bis es so weit ist, darfst du vielleicht ein Geburtstagsgeschenk annehmen?« Ich halte ihm das kleine Paket hin.
Er wickelt es argwöhnisch aus, als wäre es eine Art kapitalistische Box der Pandora und ihm würde gleich seine Seele entrissen. Er holt die Kerze aus der Schachtel und hält sie sich an die Nase. »Schön.« Er nickt anerkennend. »Eine inspirierende Mischung aus alten Ingredienzen. Ich werde sie später bei meiner neuen PiYo-Stunde anzünden.«
»Super«, sage ich. »Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!«
Er winkt ab. »Geburtstage sind nur eine weitere Drehung des Kreislaufs von Geburt, Tod und Wiedergeburt.«
»Klar, äh … apropos, ich wollte dir ein paar Fragen stellen. Über meine Mutter.«
Er geht wieder auf den Boden in Vasisthasana, den Seitstütz. »Deine Mum ist bei der Arbeit und hat dann einen Zahnarzttermin in Hemel. Um halb vier sollte sie wieder da sein, je nachdem, wie der Verkehr ist. Du kannst dir gern eine Tasse Tee machen und auf sie warten.«
»Nicht Mum«, stelle ich klar. »Meine Mutter – meine richtige Mutter.«
Er sieht mich lange an. »Lass sie das nicht hören, ja? Richtige Mutter.« Er schüttelt den Kopf. »Es würde ihr das Herz brechen.«
»Tut mir leid. Ich meinte leibliche Mutter. Ich weiß, das Mum in wirklich jeder irgendwie bedeutsamen Hinsicht meine Mutter ist.«
Als ich heranwuchs, hatten meine Eltern kein Geheimnis daraus gemacht, dass Mum nicht meine leibliche Mutter war. Aber davon abgesehen wurde ich nicht dazu angehalten, darüber zu reden. Mum war meine Mutter – ist es, und damit hatte sich die Sache.
»Ich will mehr über sie wissen. Sie ist eine Hälfte von dem, was ich bin.«
Dad steht auf – besser gesagt, er kommt in Tadasana, die Berghaltung. Dann zieht er langsam die linke Fußsohle am rechten Bein hoch und hebt die Arme über den Kopf in den Baum. »Wie kommst du ausgerechnet jetzt darauf?«
»Einfach so«, sage ich gereizt. »Habe ich nicht das Recht, etwas über sie zu erfahren?«
Dad sieht mich forschend an. »Ich habe nie ein Geheimnis aus ihr gemacht, oder? Du weißt fast so viel wie ich.«
»Das kann ja wohl nicht stimmen«, sage ich und werde noch gereizter. »Schließlich hast du – du weißt schon …«
»Sie geschwängert?«
»Ich wollte sagen, du hast sie kennengelernt. Genug um, du weißt schon …«
»Sie zu schwängern.«
»Nun … ja.«
Dad schließt die Augen, und ich höre seine tiefe Bauchatmung. »Das waren andere Zeiten«, sagte er. »Damals haben mehr Leute an den Traum geglaubt.«
»Du meinst, alle durften mal?«
»Sie hat daran geglaubt – deine leibliche Mutter.«
»Woran geglaubt?«
Er wechselt das Bein. »Sie hat geglaubt, dass Klassen nichts bedeuten. Sie stammte aus einer reichen Familie, ist in einem schönen Zuhause aufgewachsen, aber sie wollte diese Dinge nicht. Wir haben vielleicht Woodstock und die ersten Vietnam-Proteste versäumt, aber viele von uns glaubten an eine bessere Welt. Eine Welt ohne Hunger und Krieg …«
Ich widerstehe dem Drang, die Augen zu verdrehen.
»Siehst du das?« Er öffnet die Augen und zeigt auf ein paar verblasste Zeichen, die direkt unter seinem Herzen auf seine Brust tätowiert sind. »Das ist der Name, unter dem ich sie kannte: Rainbow. Ich habe es mir auf Sanskrit tätowieren lassen. Ihr Leben war wie ein Regenbogen – kurz, aber wunderschön. Man konnte sie nicht halten oder besitzen. Und das war Teil ihrer Schönheit.«
»Du sagst, sie kam aus einer reichen Familie? Ich glaube, das hast du bis jetzt nicht erwähnt. Was weißt du darüber?«
Kurz verliert er die Konzentration und wackelt auf dem Bein. Seine Bauchmuskeln ziehen sich sichtlich zusammen, als er um Gleichgewicht ringt und den Fuß wieder abstellt. »Tut mir leid. Ich würde dir mehr sagen, wenn ich könnte. Wir waren beide sehr jung.«
»Und wie ist sie gestorben?«
»Das weißt du doch«, sagt er. »Sie war sehr anfällig – immer bei schwacher Gesundheit. Es war kurz nach deiner Geburt. Sie ist eingeschlafen und nicht wieder aufgewacht. Aber das Lächeln auf ihrem Gesicht – es war das Lächeln eines Engels.« Er seufzt. »Danach war nichts mehr dasselbe. Ohne sie wollte ich nicht mehr reisen. Also habe ich dich hergebracht, um sesshaft zu werden. Ich habe deine Mum kennengelernt, sie geheiratet, und der Rest ist Geschichte. Deine Geschichte. Die einzige Familiengeschichte, die wichtig ist.«
»Ich bin mir da nicht so sicher«, sage ich, aber es ist klar, dass ich ihn nicht überzeugen werde.
Er senkt seine aufeinandergelegten Hände in die Gebetshaltung. »Trotzdem.«
»Das ist also alles, was du weißt? Mehr kannst du mir nicht sagen? Du hast nicht einmal ein Foto?«
»Nein. Nur hier oben.« Er tippt sich an den Kopf. »Rainbow war eine helle, flackernde Kerze in einer dunklen Welt. Ihr Licht ist erloschen, aber nicht ohne die Welt zu einem besseren Ort gemacht zu haben.«
»Wie?«
»Nun … da bist du.« Jetzt lächelt er und entwaffnet mich. Ich verstehe, warum die Hälfte der Hausfrauen im Umkreis von Hemel Hempstead und Watford zu seinen Stunden geht und in ihn verknallt ist, trotz seiner – Fehler. Er nimmt ein frisches weißes Handtuch aus einem Korb und trocknet sich den Hals ab. »Du hast ihre Augen«, sagt er. »Ihre wunderschönen Augen von der Farbe von Lichtstrahlen, die durch Sturmwolken brechen.«
Kurz spüre ich, wie mir Tränen in die Augen treten. Ich wende mich ab, blicke auf ein Büschel Ziergras, das sich im Wind beugt.
Dad wirft das Handtuch in einen Wäschekorb und zündet sich noch eine Zigarette an. Der Moment geht vorüber. »Kann ich dich überreden, die Stunde mitzumachen, Alexandra?« Er atmet eine dünne Rauchranke aus und zündet mit der Zigarette die Kerze an, die ich ihm geschenkt habe. »Es könnte dir inneren Frieden bringen.«
»Nein danke, Dad.« Ich hasse Yoga – habe ich immer getan und höre wahrscheinlich nie damit auf. Zum einen erhöht es nicht die Herzfrequenz. Zweitens tut es an merkwürdigen Stellen wie den Hüften, den Füßen oder den Handgelenken weh – zwar nicht gleich, aber ich merke es jedes Mal am nächsten Tag. Und ich finde es auch nicht entspannend – ich meine, es ist Sport. Selbst wenn man die Duftkerzen und die sanften Sitarklänge eine schöne Atmosphäre zaubern, entspanne ich mich dann doch lieber bei einem schönen heißen Bad.
»Okay. Aber es war gut, dass du vorbeigekommen bist.« Dad macht die Zigarette aus, und wir umarmen uns wieder.
»Klar, Dad«, sage ich.
Er sieht seine CD-Sammlung durch und wählt eine mit Panflötenmusik aus, was mir signalisiert, dass ich jetzt gehen soll. Anscheinend weiß mein Vater kaum mehr über meine leibliche Mutter als ich. Traurig, aber wahr. Ich werde heute eindeutig nicht mehr erfahren.
Auf dem Weg zum Auto muss ich mich gegen die Hauswand drücken, um drei Frauen vorbeizulassen – eine Blonde, eine Brünette und eine Grauhaarige. »Hi«, sage ich. Nur die grauhaarige Frau murmelt ein Hallo – die anderen beiden werfen mir bohrende Blicke zu, als wäre ich ein schlechter Einfluss auf ihren Guru oder so was. »Er ist echt gut, oder?«, sage ich. »Mein Beckenboden hat das Training wirklich nötig gehabt.« Ich zwinkere den beiden jüngeren zu und gehe mit einem gespielten o-beinigen Hinken.
Eigentlich hatte ich gar nicht erwartet, viel von Dad zu erfahren, und obwohl ich ein bisschen enttäuscht bin, ist es in vielerlei Hinsicht auch eine Erleichterung, keine bösen Überraschungen aufgedeckt zu haben. Ich hatte wirklich eine glückliche Kindheit und habe nach wie vor ein gutes Verhältnis zu meinen Eltern. Das hat mir immer genügt, und das sollte es auch.
Und bei dem wenigen, was ich über Rainbow weiß, bin ich auch eigentlich nicht erpicht darauf, mehr über sie zu erfahren. Ich bin in den späten 70ern und 80ern aufgewachsen, und Love & Peace war nie so mein Ding. Dads Schrullen hatten mich, wenn überhaupt, in die andere Richtung beeinflusst. Wahrscheinlich wäre ich für eine »helle, flackernde Kerze« wie meine leibliche Mutter, die ihre reiche Familie für eine höhere Berufung verlassen hatte, eine große Enttäuschung gewesen.
Auf der Rückfahrt nach Mallow Court vergleiche ich Dads Weltsicht mit der mittelalterlichen, die ich an der Uni studiert habe. Damals war die Gesellschaft streng geregelt. Frauen, die außerhalb der Ehe ein Kind bekamen, wurden ausgestoßen oder Schlimmeres, und der meiste Besitz gehörte entweder Feudalherren oder der Kirche. Das Wunderbare – was mich überhaupt erst an der Epoche angezogen hatte – war die Architektur. Ich hatte mich in die gotischen Kirchen verliebt – die hohen Buntglasfenster, die entworfen wurden, um das göttliche Licht einzulassen, und Turmspitzen, die am Himmel kratzten. Auch die Religion hatte einen strengen Regelsatz, und dieser Blödsinn von einem Kreislauf von Geburt, Tod und Wiedergeburt kam nicht vor. Wenn man gut war, kam man in den Himmel; wenn man böse war, verrottete man in der Hölle. Ich bin froh, nicht im Mittelalter gelebt zu haben, aber das Einfache hat auch etwas für sich.
Ich fahre durch das Tor von Mallow Court und über den langen, mit Bäumen gesäumten Weg zum Haus. Wenn ich mir vorstelle, es wäre mein Zuhause, habe ich eher ein schlechtes Gewissen, als dass ich das toll finden würde. Ich weiß noch, wie ich den Job angenommen habe – Mum war begeistert gewesen und hatte eine persönliche Führung durch das Haus gewollt. Von Dad hatte ich erwartet, dass er über die »Trickle-Down-Ökonomie« und die »Tyrannei der Oberschicht« schimpfen würde, aber er war nur merkwürdig still gewesen. Alles, was er damals gesagt und seitdem ein paar Mal wiederholt hatte, war: »Dazu habe ich dich nicht erzogen.«
Ich parke hinter dem Kutschenhaus, einem zweistöckigen Fachwerkgebäude, das in eine Unterkunft für Hochzeitsgäste umgebaut wurde – falls wir welche haben, versteht sich. Man kommt zuerst in die Lounge, einen großen, offenen Raum mit Balkendecke und weiß getünchten Wänden. Hinter einer Tür mit dem Schild Privat führt eine schmale Treppe in meine Wohnung im Dachgeschoss hinauf.
Sobald ich die Tür hinter mir geschlossen habe, spüre ich, wie die Anspannung des Tages von mir abfällt. Das größte Zimmer hat eine starke Dachschräge und bekommt nicht viel Tageslicht, aber das ist mir egal. Es ist mein Rückzugsort, und ich liebe ihn.
Ich ziehe meine Boots aus und sinke in die weichen grünen Samtpolster des Sofas. Das Sofa war meine erste Anschaffung, als ich den Job in Mallow Court bekam und wusste, dass ich hier wohnen würde. Der Umbau des Dachgeschosses hat ganze drei Monate gedauert, und während dieser Zeit habe ich in einem Zimmer im Haupthaus gewohnt. Als alles fertig war, hat Mrs Fairchild gefragt, ob ich bleiben wollte – wir hatten uns an das Zusammenleben gewöhnt, und es gefiel uns. Aber ich lehnte ab. Der Teil von mir, der Dads Tochter ist, hätte sich in einem so opulenten Heim nie wohlgefühlt.
Ich lehne mich zurück, blicke durch das Oberlicht und sehe die rosa geränderten Wolken vorüberziehen. An den dreieckigen Wänden an den Enden der Wohnung und der langen Wand unter dem First stehen mit Büchern vollgestopfte Regale. Hinter dem Sofa habe ich einen Tisch – keinen Couchtisch, sondern einen langen hölzernen Büchereitisch mit reich geschnitzten Beinen in Form des Grünen Mannes, den ich in einem Entrümpelungsladen in der Nähe gefunden habe.