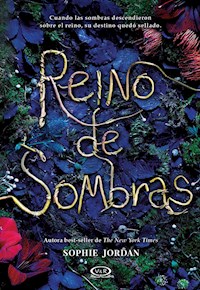Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Loewe
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Firelight
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2013
Miram wurde gefangen genommen, und das ist ganz allein Jacindas Schuld. Zwar gelingt es ihr in einer wahnwitzigen Aktion, Miram zu befreien, doch damit sind die Draki längst nicht sicher. Denn die Drachenjäger sind ihnen dicht auf der Spur. Zugleich drohen die Gefühle des Drakiprinzen Cassian zur Gefahr für die Liebe zwischen Jacinda und Will zu werden. Wenn er nicht bereit ist, Jacinda gehen zu lassen, wird sie für immer an das Rudel gefesselt sein. Und das Leben mit Will, nach dem sie sich schon so lange sehnt, wird niemals möglich sein. Die Flucht vor den Drachenjägern entwickelt sich so zu einer Zerreißprobe für Jacindas Liebe zu Will – und schließlich zu einem dramatischen Kampf um Leben und Tod. Eine außergewöhnliche Romantic Fantasy-Reihe um eine verbotene Liebe. "Leuchtendes Herz" ist der letzte Band der Firelight-Trilogie. Die beiden Vorgängertitel lauten "Brennender Kuss" und "Flammende Träne". Mehr Infos rund ums Buch unter: www.FirelightFans.de
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 358
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Meine Liebe zu dir ist wie eine Reise.
1
Die Luft fühlt sich heiß an in meinen Lungen, während ich mich draußen vor dem Transporter herumtreibe und durch die Scheiben luge. Der dunkle Innenraum erinnert mich sehr an einen anderen Transporter vor gar nicht allzu langer Zeit. Dieser hier ist zwar leer, aber schon bald werde ich darin liegen. Allein. Meine Augen fangen an zu brennen, so intensiv starre ich auf mein künftiges Gefängnis, und ich muss heftig zwinkern. Ich habe es schließlich so gewollt, rufe ich mir in Erinnerung.
»Du weißt, dass du das nicht tun musst«, sagt Will. Er hält meine Hand und streicht sanft mit den Fingern über die Innenseite meines Handgelenks. Das erweckt meinen Puls schlagartig zum Leben und ich bekomme plötzlich wieder Luft. Mit ihm ist immer alles einfacher. Erträglicher.
Sogar das hier.
Ich nicke, obwohl in mir ein regelrechtes Feuer der Angst tobt. Es kostet mich unendlich viel Überwindung, meine Hand aus seiner zu lösen und mich stattdessen an der Wagentür festzuhalten. »Doch, das muss ich.«
»Wir können uns etwas anderes einfallen lassen –«
»Nein. Der Plan wird funktionieren.« Natürlich glaube ich, dass das hier gut gehen wird, schließlich war das Ganze meine Idee. Ich habe sie alle davon überzeugt, entgegen aller Einwände. Will. Cassian. Tamra. Wir sind schon so weit gekommen. Meine Schwester wartet einige Kilometer entfernt von hier in einem Versteck darauf, dass Will und Cassian sie abholen kommen.
Wills Gesichtsausdruck versteinert sich und das lässt ihn auf einmal sehr müde und viel älter aussehen. Aber immer noch so wunderschön, dass es fast wehtut. Ich blinzle und streichle ihm sanft über die Wange und das kantige, stopplige Kinn. »Es wird alles klappen«, versichere ich ihm, »haltet euch einfach an den Plan.«
»Mach da drin ja keinen Blödsinn, hörst du? Spiel nicht die Heldin oder so …«
Ich lege ihm einen Finger an die Lippen und bringe ihn sanft zum Schweigen. Ich genieße es, wie fest und kühl sich sein Mund anfühlt. Sein Blick wird weicher und seine Augen glänzen in ihren schönsten Gold-, Braun- und Grüntönen, wie ein Wald im Herbst. Mir geht das Herz auf – wie immer, wenn er mich auf diese Art ansieht.
Ich atme tief durch und werfe einen Blick hinüber zu Cassian. Es macht mich ein bisschen verlegen, dass er uns zusieht. Dabei tut er das gar nicht: Er starrt nach oben in die Baumwipfel, während er mit der Spitze seines Schuhs den Boden malträtiert. Doch durch das unsichtbare Band zwischen uns spüre ich, was wirklich in ihm vorgeht. Er gibt sein Bestes, um Will und mir nicht zu nah zu treten, aber es kostet ihn sehr viel Willenskraft, uns nicht zu beobachten … Mit aller Macht kämpft er gegen das Missfallen an, das ihn zu übermannen droht.
Ich warte darauf, dass er zu uns herübersieht. Vielleicht will ich sogar, dass er das tut, keine Ahnung. Diese ganze Sache mit dem emotionalen Band zwischen uns ist immer noch neu für mich. Als er endlich hersieht, nicke ich ihm zu. Er erwidert die Geste.
Mit dem Zeigefinger beschreibe ich einen kleinen Kreis in der Luft und sage zu den beiden: »Und jetzt dreht euch um.«
Ein kaum merkliches Lächeln umspielt Wills Mundwinkel, aber er gehorcht ebenso wie Cassian. Als mir beide den Rücken zuwenden, ziehe ich mich aus und konzentriere mich dabei auf jede einzelne Bewegung. Ich löse die Schnürsenkel meiner Schuhe und steige aus meinen Jeans. Dann lege ich meine Kleidung zusammen und staple sie so sorgfältig aufeinander, als hinge mein Leben davon ab. Ich schinde ganz klar Zeit.
Nackt richte ich mich auf und mein Blick fällt auf Wills Rücken. Der glatte graue Stoff seines T-Shirts spannt sich straff über seine starken Schulterblätter. Ich spüre eine leichte Brise und den Kuss der Sonne auf meiner Haut. Jetzt ist der Moment gekommen, in dem ich in den Transporter steige und die Tür hinter mir schließe. Jetzt begeben wir uns in die Höhle des Löwen. Und dort lassen sie mich dann zurück. Ganz allein – auf meinen ausdrücklichen Wunsch hin. Wenn dabei irgendetwas schiefgeht … Ich schüttle den Gedanken ab. Daran darf ich jetzt nicht denken.
Dennoch schnürt sich mir die Kehle zu. Auf einmal sind Moral und Anstand nicht mehr so wichtig. Ich mache einen Schritt auf Will zu und packe ihn an der Schulter, drehe ihn zu mir und drücke ihm einen Kuss auf die Lippen, der sich so intensiv anfühlt wie ein Lebewohl für immer. Ich lege alles in diesen Kuss hinein, all unsere gemeinsamen Erinnerungen. Alles, was wir zusammen durchgemacht haben. Unsere gemeinsame Zeit in Chaparral. Wie seine Familie – seine Jägerfamilie – versucht hat, mir den Garaus zu machen. Wie wir Miram verloren haben. Wie Corbin versucht hat, Will umzubringen …
Er schlingt die Arme um mich. Ich küsse ihn, bis ich das vertraute Brennen spüre, das sich tief in meinem Inneren entzündet und meine Luftröhre hochsteigt. Mit hochrotem Gesicht löse ich mich von Will, keuchend, voller Verlangen.
Und nackt.
Wills Blick schießt nach unten und lässt nicht einen Millimeter aus. Dann sieht er wieder hoch, atmet tief durch und ich kann sehen, dass seine Brust bebt. Meine Wangen brennen nun noch heißer, aber ich bleibe wie angewurzelt stehen. Sengendes Verlangen lodert in seinen Augen und sagt mir, dass ich jetzt gehen muss. Jetzt sofort, sonst werde ich es nie schaffen.
Ich springe in den Transporter und greife nach der Tür, um sie zuzuziehen.
Seine Stimme hält mich zurück. »Warte.«
Fragend spähe ich zu ihm hinaus.
»Du musst dich erst verwandeln.« Er hält die Fesseln hoch.
»Ach ja.« Wie konnte ich das nur vergessen? Wir müssen unbedingt alles richtig machen. Wir müssen sie ködern.
Ich steige wieder aus, stelle mich vor den Transporter und verwandle mich. So emotional aufgewühlt wie ich bin und bei der Hitze und dem Kribbeln, die ich dank Will am ganzen Körper spüre, dauert es nicht lange. In Sekundenschnelle spannt meine Haut und mit einem leisen Rascheln schieben sich meine Flügel hervor und breiten sich aus.
Will sieht mir beeindruckt zu. Sein Blick geht direkt in mein Herz und es bringt mich innerlich zum Schmelzen, dass er auch meine Drakigestalt schön findet. Genau wie beim ersten Mal, als er mich gesehen hat. Er sieht in mir ein wunderschönes Geschöpf, nicht das wilde Tier, auf das seine Familie Jagd macht. Das gibt meinem Ego Auftrieb, den es gerade sehr gut gebrauchen kann. Schließlich muss ich mich gleich den Enkros stellen – den Ungeheuern meiner Kindheit –, die unablässig Jäger auf mich und meine Artgenossen hetzen. Endlich werde ich ihnen ins Gesicht sehen. Ein heftiger, zitternder Atemzug rollt in Wellen durch meinen Körper.
Will fesselt mich schnell, aber sanft, erst an den Händen, dann an den Flügeln. Dabei vermeidet er es, mir in die Augen zu sehen. Es scheint unerträglich für ihn zu sein, mir das antun zu müssen.
Cassian dreht sich zu mir um und ich spüre, dass Zweifel in ihm aufsteigen, als er mich so vor sich sieht, gefesselt wie eine Gefangene.
Will reicht mir die Hand und ist mir beim Einstieg zurück in den Transporter behilflich. Ich versuche, ein Lächeln zustande zu bringen, doch es will mir nicht recht gelingen. Es wirkt schwach und erzwungen. Also lasse ich es sein und sehe ihm stattdessen tief in die Augen. Wir tun das Richtige, sagt mein Blick.
Dann wende ich ihm den Rücken zu, damit er mein Gesicht nicht mehr sehen kann.
Damit ich seines nicht mehr sehen kann und es mir nicht in den Sinn kommt, vielleicht doch noch einen Rückzieher zu machen.
Ich spüre, dass er auf etwas wartet, dass er hinter mir steht und zögert, genau wie ich die Wellen nagender Sorge spüren kann, die von Cassian ausgehen. Aber ich werfe keinen Blick zurück.
Auf keinen von beiden. Das bringe ich nicht fertig. Ich habe Angst, dass ich es mir anders überlege, wenn ich einem der beiden ins Gesicht sehe. Dass ich zusammenbreche wie das kleine Mädchen, das nachts unter der Bettdecke immer zitternd vor Angst den Geschichten gelauscht hat, die Az ihm im Flüsterton erzählt hat. Von den Enkros und den schrecklichen Dingen, die sie allen Drakis antun, die sie in die Finger bekommen. Natürlich ist nichts davon bestätigt, da kein Draki, den sie gefangen haben, jemals lebend nach Hause zurückgekehrt ist, um davon berichten zu können.
Schließlich macht Will die Tür des Transporters hinter mir zu und ich bin darin gefangen. Ich drücke meine zitternden Hände fest gegen das kalte Metall und lasse sie lange dort liegen – in der Hoffnung, ihn irgendwie zu erreichen, ihn irgendwie auf der anderen Seite spüren zu können. Ihn. Nicht Cassian.
Einen Augenblick später höre ich, wie auch die restlichen Türen des Fahrzeugs zufallen und Will und Cassian vorn einsteigen. Dann setzt sich der Wagen ratternd in Bewegung. Ich suche mir einen Sitzplatz auf dem schmutzigen Boden, ziehe die Knie an und mache mich klein. Mein Magen krampft sich zusammen.
Ich atme mehrmals tief durch und warte darauf, dass der Transporter stehen bleibt und sie endlich beginnt: die Schlacht, auf die ich mein Leben lang gewartet habe.
Die holprige Fahrt lässt meinen Mut etwas sinken. Das alles kommt mir so bekannt vor, dass ich mich frage, wie ich nur auf die Idee kommen konnte, das alles freiwillig noch einmal durchmachen zu wollen. Ich bekomme Platzangst. Hier hinten in dem engen Wagen gibt es weder Platz, um sich auszustrecken, noch Luft zum Atmen. Und ich bin gefesselt. Wie in meinen schlimmsten Albträumen. Meine Gedanken kreisen um das letzte Mal, als ich gefangen in einem solchen Transporter gelegen habe. Das letzte Mal …
Das ist schließlich der Grund dafür, dass ich überhaupt hier bin.
Ich atme flach ein und aus und versuche, so gut es geht, ruhig zu bleiben. Ich sage mir, dass ich diesmal alles unter Kontrolle habe. Mit ein paar ruckartigen Kopfbewegungen schüttle ich mir die verhedderten Haarsträhnen aus dem Gesicht und gebe mir Mühe, das Gleichgewicht zu halten, während wir scharf links abbiegen.
Um meine Nerven zu beruhigen, stelle ich in Gedanken eine Liste all der Dinge auf, die diesmal anders sind.
Ich vertraue den Fahrern. Sie halten mir den Rücken frei. Ich weiß, wo wir hinfahren – ich habe unser Ziel bereits gesehen. Und ich habe keine Schmerzen, zumindest keine körperlichen. Auf der anderen Seite bin ich diesmal ganz allein. Miram liegt nicht neben mir.
Miram ist diejenige, für die wir das alles hier tun – diejenige, die wir retten wollen. Wenn ich ehrlich bin, ist sie allerdings nur einer der Gründe, weshalb ich hier bin. Das hier hat mittlerweile eine viel größere Bedeutung für mich bekommen; es ist jetzt eine Suche nach der Wahrheit. Will weiß das. Ich glaube nicht, dass es Tamra klar ist, vielleicht noch nicht einmal Cassian, aber Will weiß, dass es mir jetzt darum geht, Antworten zu finden. Dad zu finden.
Der Wagen wird langsamer und bleibt schließlich stehen. Ich halte den Atem an und feiner Dampf steigt von meinen Lippen und Nasenlöchern auf wie Nebel. Es geschieht nicht mit Absicht, was ich da mache. Ich kann einfach nichts dagegen tun – so bin ich eben: ein Wesen, das Feuer speit. Nun haben meine Gefühle die Kontrolle über mich und das macht es mir besonders schwer, nicht meinen Instinkten nachzugeben.
Angst. Zorn. Zweifel. Habe ich Witze gemacht, als ich Will gesagt habe, dass mein Plan auf jeden Fall funktionieren würde? Habe ich mir vielleicht selbst etwas vorgemacht? All diese Gedanken steigen in mir empor, in einer Flut aus Asche und Kohle, die nur darauf wartet, sich in Feuer und Flammen zu verwandeln.
Von draußen dringen Stimmen an mein Ohr. In wenigen Augenblicken werde ich mich nicht mehr in meinem Blechgefängnis, sondern zusammen mit meinen Artgenossen in der Hand der Enkros befinden. Ganz nach Plan. Angespannt warte ich ab und meine Muskeln vibrieren regelrecht unter meiner Drakihaut. Meine Flügel sträuben sich gegen die Fesseln, aber Will hat ganze Arbeit geleistet: Aus eigener Kraft könnte ich mich nicht davon befreien. Doch das will ich auch gar nicht. Das ist nicht der Plan. Der Plan sieht vor, dass ich glaubhaft die Rolle der Gefangenen spiele.
Einen Augenblick lang muss ich an meine Schwester denken, die ganz allein in einem Motelzimmer darauf wartet, dass die Jungs sie abholen kommen. Sie hat gelächelt, als wir uns voneinander verabschiedet haben, doch in ihren eisblauen Augen stand etwas anderes zu lesen. Sie haben feucht geglitzert und ich bin mir sicher, dass sie, kaum dass wir weg waren, schluchzend zusammengebrochen ist.
Tamra war von Anfang an gegen meine Idee gewesen. Sogar als ich Will und Cassian schon dazu überredet hatte, hat sie sich immer noch gesträubt. Die Fesseln schneiden mir ins Fleisch und drücken mir das Blut ab und ich schiebe die Gedanken an Tamra und meine wachsende Besorgnis entschieden beiseite.
Von Neuem fest entschlossen, starre ich auf die Hintertür des Transporters und warte. Draußen sind nach wie vor Stimmen zu hören, unter denen ich auch die von Will ausmachen kann. Aber vielleicht bilde ich mir das einfach nur ein, weil ich ihn unbedingt hören will. Cassian ist da. Das weiß ich auch, ohne dass er etwas sagt. Ich kann seine Gegenwart spüren. Während ich in der Dunkelheit warte, schlägt mir seine Wut entgegen wie eine Faust, schnell und kraftvoll. Er muss ihnen nun direkt gegenüberstehen. Ein Fauchen entfährt mir, als sein Zorn mit frostigen Fingern nach mir greift und sich unerbittlich in meinem Körper ausbreitet.
Um Cassians eisiger Wut den Kampf anzusagen, suche ich tief in mir nach dem, was ich bin und was mich ausmacht. Hitze steigt in mir hoch und bahnt sich schwelend einen Weg meine Luftröhre hinauf.
Plötzlich scheppert etwas, Metall schlägt gegen Metall. Ich richte den Blick auf die Tür und sehe, wie sie sich öffnet.
Licht flutet in meinen Metallkäfig und ich hebe die gefesselten Hände und halte sie mir vors Gesicht, um meine Augen zu schützen. Durch die schmalen Streifen zwischen meinen Fingern sehe ich Will, der ganz entspannt und ausgeglichen tut und sich nichts anmerken lässt. Zumindest nach außen hin nicht. Ein leichtes Muskelzittern erschüttert seinen Kiefer und zeigt mir, wie angespannt er innerlich ist, auch wenn er gelassen mit der Hand auf mich zeigt und sagt: »Hier ist sie also, Jungs …«
Cassian bleibt mit ein paar anderen Leuten ein paar Meter hinter Will zurück – Männer in Laborkitteln, die mich eingehend mustern. Enkros. Dieser Anblick geht mir durch Mark und Bein. Nichts und niemand auf der Welt hätte mich darauf vorbereiten können.
Cassian. Neben Enkros. Die Ironie dessen ist mir durchaus bewusst.
Ein hysterisches Lachen droht, sich einen Weg aus meiner Kehle zu bahnen.
Ich zwinge mich dazu, mich zu konzentrieren. Der Transporter wird rückwärts durch eine Art Garagentor gefahren. Vor mir erstreckt sich ein langer, schmaler eintönig weißer Flur, an dessen Ende sich eine Stahltür befindet. Hier gibt es keinerlei Möglichkeit, zu entkommen und in den Himmel zu steigen. Doch das habe ich auch gar nicht vor. Zumindest noch nicht.
Einer der Laborkittel macht einen Schritt nach vorn. In der Hand hält er einen Stab mit einer Metallschlinge. Noch bevor ich begreife, was er da macht, legt er die steife Schlinge um meine gefesselten Hände, zieht sie zu und zerrt mich mit einem groben Ruck aus dem Wagen heraus. Ich erhasche nur einen flüchtigen Blick auf die fest entschlossenen Augen des Mannes, deren Blau so blass ist, dass es fast farblos wirkt. Ich stürze aus dem Transporter auf den kalten Boden, lande auf der Schulter und schreie laut auf vor Schmerz – und bin immer noch erstaunt, dass diese in Kitteln steckenden Männer so normal aussehen. Wie Ärzte oder Forscher und gar nicht wie die geheime Bedrohung, die mein Leben so lange überschattet hat.
Erneut rollt Cassians Wut wie eine Woge über mich hinweg. Es läuft mir kalt über den Rücken und ich versuche, dieses Gefühl abzuschütteln. Der Zorn schwächt meine Konzentration und bringt mich dazu, kämpfen und meine ganze Stärke über diese Enkros hereinbrechen lassen zu wollen. Und das geht nicht.
In diesem Moment entfährt Will ein grollendes Geräusch. Als ich aufsehe, treffen sich unsere Blicke. Seine Arme spannen sich an, als er seine Hände zu Fäusten ballt, und er kann sich kaum noch im Zaum halten. Ich schüttle so unauffällig wie möglich den Kopf und hoffe, dass er versteht, dass er sich zurückhalten muss. Dass er nicht eingreifen darf, damit unser Plan aufgeht.
Sie sollten jetzt gehen. Mir ist klar, dass es für sie beide eine Qual sein muss, das hier mit anzusehen, und ich kann das Risiko nicht eingehen, dass einer von ihnen preisgibt, wie sehr ihnen die raue Umgangsweise der Enkros mit mir zu schaffen macht.
»Steh auf! Na mach schon!« Der Kerl reißt an dem Stab und die Fesseln schneiden mir so tief in die Handgelenke, dass ich garantiert beide Hände verliere, wenn ich mich nicht sofort in Bewegung setze.
Wutentbrannt starre ich ihn an und die Gleichgültigkeit in diesen blassblauen Augen erschüttert mich. In ihnen ist nicht das zu lesen, was ich erwartet habe. Kein Gift, keine Bösartigkeit. Weil ihm das alles nicht das kleinste bisschen unangenehm ist. Er ist der Auffassung, dass er das Richtige tut.
Cassians Zorn schlängelt sich weiter durch mich hindurch.
»Seht sie euch an!«, ruft einer der Laborkittel. Ich bin fast versucht, an mir herunterzusehen, um herauszufinden, was er meint.
Mit ein paar schnellen, hektischen Bewegungen wird mir der Mund mit Klebeband verschlossen. Mir bleibt keine Zeit zum Reagieren. Vermutlich hatten sie schon mit genügend Drakis zu tun und wissen, was ich bin. Welche Fähigkeit ich besitze.
Der Laborkittel macht einen Schritt zurück. »Gut. So kann sie niemanden in Brand setzen. Das sollte fürs Erste reichen, bis wir sie untersucht haben.«
Ich stoße einen erstickten Schrei aus. Mein Blick schießt wild hin und her, auf der Suche nach Will. Ich muss ihn einfach noch einmal sehen, nur noch ein Mal, bevor sie mich wegbringen und »untersuchen«.
Wieder reißt man ruckartig an mir herum und ich stehe stolpernd auf. Sie ziehen mich eilig den Flur entlang, an den anderen vorbei. Ein paar von Metallgittern geschützte Glühbirnen strahlen ein gelbes Licht aus, das gnadenlos in meine Augen sticht.
Ich bewege mich Schritt für Schritt vorwärts. Ich kann weder Will noch Cassian sehen.
Doch Cassians Frustration und Angst erreichen mich immer noch. Das knackende Eis seiner Gefühle spült über mich hinweg. Ich drehe meinen Kopf und schaue über die Schulter, um einen letzten Blick auf die beiden zu erhaschen.
Cassian steht wie angewurzelt da und starrt mir nach. Will spricht mit einem der Laborkittel. Sein Blick streift mich kurz, ehe er gleich wieder wegsieht. Er wirkt ungewöhnlich blass und scheuert mit der Hand an der Seite seines Halses herum, als ob es dort etwas wegzureiben gäbe.
Dann erreiche ich das Ende des Flurs. Wir gehen durch die Tür und ich kann Will nicht mehr sehen.
Ich bin allein. Jetzt gibt es nur noch das, was mich dort drinnen erwartet.
Der Aufzug fährt mit mir und den Enkros nach unten. Sie wahren Abstand, pressen sich eng an die Wände und halten ihre Waffen griffbereit.
Es gibt mir Zuversicht, dass ich ihnen offensichtlich sogar mit zugeklebtem Mund gefährlich erscheine. Die Tatsache, dass Will und Cassian nicht mehr bei mir sind, schneidet mir ins Fleisch wie ein Messer. Auch wenn sich mein Herz nach Will sehnt, spüre ich doch die Abwesenheit von Cassian intensiver, als sein kalter Zorn abebbt und mit ihm verschwindet. Und ich verliere nicht nur seine Wut, sondern auch seine Besorgtheit, seine Angst … seine Zweifel. All das löst sich in Luft auf.
Jetzt bin ich ganz allein mit meinen Gefühlen, aber zumindest muss ich mich nun nicht mehr durch das Durcheinander meiner Emotionen wühlen und versuchen, meine eigenen von Cassians zu unterscheiden.
Ich muss nicht erst so tun, als hätte ich Angst, als ich in das Innere des Hauptquartiers geführt werde. Ich bin nicht sicher, was ich erwartet habe … vielleicht ein burgartiges Verlies? Die weißen Wände und die hell leuchtende Decke entsprechen dem jedenfalls ganz und gar nicht. Der geflieste Boden fühlt sich kühl und glatt an unter meinen nackten Füßen, und obwohl ich die Kälte normalerweise gerne mag, zittere ich. Das hier ist kein kühler Waldboden, den weiche Tannennadeln bedecken und der unter meinem Gewicht nachgibt. Dieser sterile Boden unter meinen Füßen ist hart und leblos.
Wir nähern uns einer Tür, die vom Boden bis zur Decke reicht und lautlos aufgleitet.
Der Raum vor uns wird von einem so grellen Licht erhellt, dass ich blinzeln muss. Während sich meine Augen an die Helligkeit gewöhnen, schnürt sich mir die Kehle zu bei dem Anblick, der sich mir da bietet.
Ein langer Tisch – eine Art Überwachungszentrale – steht einer Reihe von Zellen gegenüber, die aus je drei weißen Wänden und einer Plexiglasscheibe bestehen.
Und in jeder Zelle befindet sich ein Draki. Insgesamt sind es vielleicht zehn. In allen Formen, Farben und Größen.
Das ist zu viel für mich und ich kann mich nicht mehr bewegen. Jemand stößt mir so hart in den Rücken, dass ich taumle. Der Laborkittel vor mir ruft etwas und seine Lippen kräuseln sich knurrend, während er an meinen Handgelenken herumreißt und mich just in dem Moment hochzieht, bevor ich auf die Knie falle. Schmerz durchzuckt meine Schulter. Die Plastikfesseln werden noch stärker festgezogen und schnüren mir das Blut ab.
Ich bin wirklich nur ein Tier für sie. Sogar weniger als das. In ihren Augen ist Abscheu zu lesen, aber auch eine Spur von Faszination. Selbst wenn ich für sie nur ein Tier bin, ähnle ich ihnen doch so sehr, dass es ihnen Angst einjagt. Wäre ich ein einfaches Waldtier, würden sie mich netter und zuvorkommender behandeln.
Aber das bin ich nicht.
Für sie bin ich ein unbekanntes Wesen, ein seltsames Geschöpf, das sie als anomale Laune der Natur betrachten, obwohl meine Vorfahren schon viel früher die Erde bevölkert haben als die Menschen.
Mein Herz schlägt wie wild in meiner Brust, als ich in den weitläufigen Raum gestoßen werde. Schnell suche ich mit den Augen die Zellen ab – irgendwo hier muss Miram sein.
Und dann entdecke ich sie. Meine Nasenflügel blähen sich vor Aufregung, als ich sehe, dass sie am Leben ist. Sie liegt zusammengerollt auf der Seite und ihre tarnfarbene, unauffällige Haut steht in Kontrast zu der leuchtenden Haut ihrer Zellennachbarn. Ihre Augen sind geschlossen und ihr strähniges sandfarbenes Haar liegt auf dem Boden wie getrockneter Weizen.
Ich rufe ihr in Drakisprache zu. Trotz des Klebebands über meinem Mund mache ich eine ganze Menge Lärm. Mehrere Drakis heben den Kopf und blicken in meine Richtung.
Miram jedoch reagiert nicht. Sie blinzelt noch nicht einmal.
Ich schreie gegen meinen Knebel an und rufe wieder und wieder ihren Namen.
Ihre Augen flattern und ich glaube, dass sie mich gehört hat. Sie blickt sogar in meine Richtung. Doch nein. Ihre Lider schließen sich erneut. Es scheint ihr alles egal zu sein. Oder vielleicht ist ihr auch gar nicht klar, dass ich es bin. Vielleicht hat man sie unter Drogen gesetzt. Wer weiß, was sie alles mit ihr angestellt haben.
Dann kann ich sie nicht mehr sehen, weil ich in eine leere Zelle geführt werde. Die Plexiglasscheibe gleitet auf und ich werde hineingestoßen. Mehrere Laborkittel folgen mir. Sie piken mich mit einem neuen Stab, der mir einen elektrischen Schlag versetzt.
Ich stürze zu Boden wie ein nasser Sack und ein Schrei bleibt mir im Hals stecken. Rasch lösen sie die Fesseln von meinen Flügeln und Handgelenken, während ich auf dem Boden liege und zucke. Ich kann sehen und spüren, aber ich kann meine Bewegungen nicht kontrollieren. Kurzum, es ist die reinste Hölle. Das Klebeband über meinem Mund nehmen sie mir nicht ab und mir fehlt die Kraft, es mir selbst herunterzureißen.
Alle Enkros bis auf einen verlassen meine Zelle. Der, der zurückbleibt, beobachtet mich mit gelassener Miene. Mein Puls stottert gegen meinen Hals, während ich seine prüfenden Blicke über mich ergehen lasse, wohl wissend, dass ich ihm vollkommen ausgeliefert bin. Er kann mit mir tun, was er will, und ich bin nicht in der Lage, auch nur einen einzigen Finger zu rühren.
Er beugt sich zu mir herunter und streicht mir langsam über den Arm. Bei dieser Berührung dreht es mir den Magen um. Bittere Galle steigt in mir auf.
Hinter ihm kommt ein weiterer Laborkittel zum Vorschein. »Komm schon, Lewis.«
Lewis schüttelt den Kopf und murmelt: »Dieses Exemplar hier hat eine echt hübsche Haut.« Er mustert mich mit kalter Neugier.
»Ja, und Feuer speien kann es auch. Ich würde also schnell die Biege machen, wenn ich du wäre, zumindest so lange, bis wir es gründlich untersucht haben und wissen, wie wir mit dieser Art Drachen umgehen müssen. Erinnerst du dich nicht an die Geschichte von den Jägern, die zuletzt einen Feuerspeier gefangen haben?«
»Glaubst du, das hier ist derselbe?«
»Keine Ahnung. Das ist auch nicht wirklich wichtig. Wichtig ist, dass er ihnen entkommen ist. Unterschätz den hier also nicht. Und jetzt komm schon.« Der Ratschläge erteilende Laborkittel verschwindet.
Lewis beobachtet mich noch eine Weile mit schief gelegtem Kopf. »Ja. Aber jetzt kannst du mir nichts anhaben, stimmt’s? Jetzt bist du harmlos.« Seine Hand gleitet über meinen Bauch. Sanft schlägt er mir auf die Haut, doch dann nimmt er plötzlich ein Stück Haut zwischen Daumen und Zeigefinger, zwickt mich und zwirbelt bösartig mein Fleisch. »Na, wie fühlt es sich an, so hilflos zu sein? Jetzt bist du uns vollkommen ausgeliefert. Es gibt kein Entrinnen. Verstanden?«
Nach einer gefühlten Ewigkeit nickt er zufrieden und lässt von mir ab. »Bis später.« Er geht rückwärts aus der Zelle und die Plexiglasscheibe schiebt sich zwischen uns.
Nun bin ich wieder allein. Ich liege ganz still da und presse meine zitternden Lippen aufeinander. Und versuche mit aller Macht, nicht zu schreien.
2
Zitternd liege ich auf dem Boden und mein Bauch pocht vor Schmerzen an der Stelle, an der dieser Dreckskerl mich verletzt hat. Die Wirkung des Stromstoßes, den sie mir versetzt haben, lässt langsam nach und ich ziehe die Knie eng an die Brust. Mit verschwommenem Blick starre ich zu den Enkros, die sich draußen vor meiner Zelle hin- und herbewegen. Ist mit Dad dasselbe passiert? Ist er auch hier gewesen? Ich habe nicht viel erkennen können, bevor sie mich in die Zelle geschubst haben. Wenn ich laut »Magnus« rufe, antwortet er mir dann vielleicht?
Die geisterhaften Gestalten in den weißen Kitteln schlurfen durch den Raum, vertieft in ihre Aufgaben. Minuten vergehen, bevor ich die Kraft finde, mich wieder zu bewegen. Ich strecke mich langsam und versuche, mich mit den Händen vom Boden abzudrücken. Meine Muskeln zittern vor Anstrengung.
Ich kann eine Stimme ausmachen, ein leises Drakiflüstern, irgendwo rechts von mir. Ich lausche angestrengt über das leise Klicken von Computertasten und die Menschenstimmen hinweg. Zwei Enkros sitzen vor einer langen Reihe von Bildschirmen und lassen ab und an ihren Blick über die Zellen schweifen. Manchmal sehen sie zu mir, manchmal zu den anderen Drakis. Ich wette, dass immer einer von ihnen dasitzt und nichts anderes tut, als uns zu beobachten und auf alles zu achten, was den Kameras in den Ecken vielleicht entgeht. Ich hasse es zu wissen, dass nicht eine einzige meiner Bewegungen unbemerkt bleibt.
Ich fange an, die Worte zusammenzupuzzeln, die durch die Wand zu mir herüberdringen. IchwillnachHauseichwillnachHauseichwillnachHausebitte …
Es ist ein weiblicher Draki und ich frage mich, ob sie ein bisschen verrückt ist. Wer weiß, wie lange sie schon hier ist. Wie lange alle von ihnen schon hier gefangen gehalten werden.
Ich erschauere und rufe mir in Erinnerung, dass ich nur einen einzigen Tag hier überleben muss. Ich kann das durchziehen, ich schaffe das. In nur vierundzwanzig Stunden kommen Will und Cassian und holen mich hier raus. Mein Selbstberuhigungsversuch funktioniert und ich konzentriere mich jetzt wieder voll und ganz auf die Aufgabe, die vor mir liegt.
Ich stehe auf, ignoriere die auf mich gerichteten Augen und die Kamera, die jede einzelne meiner Bewegungen aufzeichnet. Meine Finger bekommen den Rand des Klebebandes über meinem Mund zu fassen und reißen es mit einem Ruck ab. Ich zucke zusammen, taste leicht meine empfindlichen Lippen ab und atme tief durch.
»Miram!«, rufe ich, zunächst etwas heiser, dann mit fester Stimme, und schlage mit der flachen Hand gegen das Glas.
Die Enkros beobachten mich interessiert, aber ich ignoriere sie einfach, weil ich weiß, dass sie nicht verstehen, was ich sage.
»Miram, ich bin’s, Jacinda! Mach dir keine Sorgen, Miram. Ich bin hergekommen, um dich hier rauszuholen.«
Nichts. Nur das Mädchen von nebenan, das unaufhörlich ihr Mantra wiederholt. Ich kann mich nur mit Mühe davon abhalten, sie anzuschreien und ihr zu sagen, dass sie die Klappe halten soll.
»Miram, kannst du mich hören? Bitte sag doch was. Cassian hat mich geschickt. Er ist auch hier, draußen, vor dem Gebäude. Wir sind gekommen, um dich zu retten!«
Nichts. Ich dachte, zumindest der Name ihres Bruders würde sie hellhörig werden lassen, wenn ihr sonst schon alles gleichgültig ist. Deshalb bin ich schließlich überhaupt erst hierhergekommen: damit Cassian uns über seine Verbindung zu mir ausfindig machen kann. Und um Miram zu warnen … um sie auf den Ausbruch vorzubereiten.
Mit diesen Gedanken im Sinn, versuche ich es weiter. Das muss ich einfach.
»Miram«, rufe ich, »du musst mir nicht antworten, aber mach dich bereit, okay? Wir brechen zusammen aus. Innerhalb der nächsten vierundzwanzig Stunden verschwinden wir von hier. Sei bereit dafür, hörst du?«
Aus der Zelle zu meiner Linken dringt Lachen zu mir herüber.
Die diensthabenden Laborkittel scheinen von den knurrenden Lauten fasziniert zu sein. Plötzlich herrscht hektische Betriebsamkeit, während sie die seltsamen Geräusche aufzeichnen. Natürlich. Wahrscheinlich bekommen sie innerhalb dieser Mauern nicht allzu oft ein Lachen zu hören.
Das Geräusch geht mir auf die Nerven. Ich lege meine Hände flach an die Wand, die mich von dem lachenden Draki trennt. »Was ist denn so lustig?«, zische ich.
Doch das Lachen hält einfach weiter an.
Ich halte mir die Ohren zu. »Das reicht jetzt!«
Plötzlich herrscht Stille. Ich nehme die Hände von den Ohren und glaube ein paar Sekunden lang, dass ich keine Antwort bekommen werde. Aber dann sagt plötzlich eine kehlige, männliche Drakistimme: »Dass du denkst, dass du hier jemals wieder lebend rauskommst. Das finde ich höchst amüsant.«
Diese Worte drohen, mir alle Zuversicht zu rauben. Ich wehre mich dagegen und erwidere schnippisch: »Na und? Hast du denn überhaupt keine Hoffnung mehr? Hast du einfach aufgegeben und dein Schicksal hier akzeptiert?«
»Nein, ich habe nicht aufgegeben.« Jetzt klingt er aufgebracht. Immerhin besser als die Drakifrau auf der anderen Seite, die halb verrückt klingt mit ihrem unablässigen Flüstern. »Ich versuche lediglich, hier unten am Leben und bei klarem Verstand zu bleiben. Die Freundin, nach der du rufst – Miram? Sie hat schon längst die Flinte ins Korn geworfen.«
Ich schüttle den Kopf. »Du gibst dich also damit zufrieden, deine Tage hier drinnen zu verbringen?«
»Immerhin lebe ich.«
»Das kann man wohl kaum als ›leben‹ bezeichnen. Wir brechen von hier aus«, schwöre ich ihm. »Du wirst schon sehen.«
Im nächsten Moment erschallt wieder das ohrenbetäubende Lachen. »Also gut. Sollte das wirklich passieren, dann folge ich dir dicht auf den Fersen, verlass dich drauf.«
Ich setze mich zurück auf den kalten Boden und ruhe meine Beine aus, die sich so wacklig anfühlen wie Gelee. Ich nehme den Raum auf der anderen Seite der Plexiglasscheibe in Augenschein – zumindest so viel, wie ich von hier aus erkennen kann: die Überwachungszentrale mit ihren Monitoren und Schaltbrettern, in jeder Ecke mehrere Kameras. Die paar Enkros, die sich in dem Raum aufhalten, unterhalten sich leise. Sie scheinen gerade eine Entscheidung über irgendetwas zu fällen. Einer der Laborkittel sieht auf seine Armbanduhr und gestikuliert in Richtung unserer Zellen. Ein weiterer Laborkittel sieht mich direkt an und schüttelt den Kopf. Er scheint ganz klar anderer Meinung zu sein als die anderen.
Ich lehne mich zur Seite, bis meine Schulter das Plexiglas berührt, und versuche, aus dem gedämpften Stimmengewirr herauszuhören, worüber sie sprechen. Wieder sehen die Laborkittel herüber. Allem Anschein nach hat es etwas mit mir zu tun. Ich muss wachsam sein.
Noch mehr Enkros betreten den Raum und die an der Überwachungszentrale katzbuckeln praktisch vor ihnen.
Ich beobachte alles ganz genau und höre plötzlich die Stimme eines jungen Drakimädchens von ein paar Zellen weiter.
»Wenn sie dich nicht erwischen, dann tut es der Graue.«
Sie klingt wie ein Kind, denke ich und lege den Kopf schief. »Was meinst du damit?«
»Wenn die Enkros dir nicht den Hals umdrehen, dann tut er es.« Sie spricht er so aus, als läge auf der Hand, was sie damit meint. »Der Graue.«
»Und wer soll das sein, der ›Graue‹?«
»Oh, der ist ganz gemein. Er ist schon viel länger hier als alle anderen«, sagt sie verächtlich. »Wahrscheinlich ist er deshalb so ekelhaft. Du musst dich von ihm fernhalten.«
»Was für ein Draki ist er denn?« Ich habe noch nie von einem grauen Draki gehört.
Er muss über irgendeine Gabe verfügen, von der ich nichts weiß. Statt vor Angst erschaudere ich vor Aufregung … darüber, andere Drakis zu treffen und etwas über eine Art zu erfahren, von der ich nicht wusste, dass sie überhaupt existiert. Mit so etwas habe ich gar nicht gerechnet, als ich hierhergekommen bin. Mir sind zu viele andere Gedanken durch den Kopf gegangen.
»Hoff mal lieber, dass du das nie herausfinden musst. Geh ihm einfach aus dem Weg. Versteck dich.«
Ich will gerade fragen, wann ich diesem Draki überhaupt über den Weg laufen sollte – schließlich werden wir in diesen Zellen gefangen gehalten –, als plötzlich eine Sirene losschrillt und ein rotes, blinkendes Licht den Raum durchflutet.
»Was ist los?«, will ich wissen und mein Blick schießt wild umher.
Sogar von meiner Zelle aus kann ich hören, wie die anderen Drakis hastig aufspringen. Irgendwo in meinem Hinterkopf frage ich mich, ob Miram sich wohl auch bewegt hat. Oder liegt sie nach wie vor zusammengekrümmt und reglos auf dem Boden ihrer Zelle?
»Mach dich bereit!«, weist mich der männliche Draki an, der sich vorhin mit mir unterhalten hat.
Ich soll mich bereit machen? Bereit wofür?
Ich habe keine Ahnung, was hier los ist, aber meine Muskeln spannen sich instinktiv an und zeichnen sich deutlich unter meiner Haut ab.
Auf einmal öffnet sich die hintere Seite meiner Zelle. Die Wand dort ist gar keine Wand. Sie versinkt einfach im Boden wie ein Autofenster und gibt den Blick frei auf das satte Grün einer üppigen Vegetation.
Kräftige Windböen sind zu spüren, als mehrere Drakis durch die Luft fliehen und in dem Blätterdickicht verschwinden. In Sekundenbruchteilen sind sie fort, als wären sie nie hier gewesen. Es ist alles so schnell gegangen, dass ich nicht erkennen konnte, ob Miram unter ihnen war oder nicht.
Ganz langsam bewege ich mich vorwärts und frage mich, was mich dort draußen erwartet. Sobald ich die Schwelle meiner Zelle überquert habe, schließt sich die Wand hinter mir. Es gibt kein Zurück mehr.
Ich atme langsam aus und spüre den Boden unter meinen nackten Füßen.
Ich bin ganz allein, es ist weit und breit kein anderer Draki mehr zu sehen. Noch nicht einmal die nutzlose, zu einer Kugel zusammengerollte Miram. Aber ich weiß, dass sie alle irgendwo dort draußen sind, in diesem weitläufigen, künstlichen Wald.
Was haben die Enkros hier mit uns vor? Was wollen sie?
Mit den Augen suche ich das Baumdickicht ab und plötzlich sehe ich sie. Kameras. Überall. Sie sitzen hoch oben in der Krone eines Baums. In dem Astloch eines Baumstamms. Ich bezweifle, dass es auch nur einen Quadratzentimeter dieser Waldattrappe gibt, den sie nicht erfassen.
Unwillkürlich frage ich mich, was sie aufzeichnen sollen. Wie wir uns untereinander verhalten? Soweit ich das erkennen kann, interagiert hier niemand mit niemandem. Alle … halten sich versteckt.
Bei dieser Erkenntnis bleibt mir fast das Herz stehen. Mir fällt die Warnung vor dem grauen Draki wieder ein.
Halte dich von ihm fern …
Geh ihm aus dem Weg …
Versteck dich …
Genau wie alle anderen. Alle außer mir. Plötzlich wird mir klar, dass ich lieber nicht hier herumstehen sollte wie auf dem Präsentierteller. Zu spät, ein Grollen bricht krachend durch die klare, kalte Luft und eine zweite Erkenntnis überkommt mich.
Ich bin nicht allein.
Er ist grau. Genau wie ihn das Drakimädchen beschrieben hat. Ein Schiefergrau, das aussieht wie flüssiger Stahl. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er der wuchtigste Draki ist, den ich je gesehen habe.
Er ist größer als unsere Onyxdrakis zu Hause. Und ganz offensichtlich ist er ziemlich stark. Vielleicht auch noch schnell. Seine Flügel sind ledrig, aber aschfarben, und ragen hoch und spitz hinter seinen massiven Schultern in den Himmel. Ich glaube zwar nicht, dass er sonderlich alt ist, doch seine Augen haben irgendetwas an sich … in diesem zinnfarbenen Blick liegen eine Gerissenheit und eine wilde Drohhaltung, die jahrhundertealt wirken.
Auf einmal wünsche ich mir, ich hätte dem Mädchen vorhin mehr Fragen gestellt und mehr Antworten aus ihm herausgekitzelt.
»Hallo«, sage ich und rühre mich nicht vom Fleck, weil ich nicht recht weiß, was ich tun soll.
Unruhig trommeln meine Finger gegen meine Oberschenkel. Ich habe noch nie einem Draki gegenübergestanden, der nicht zu meinem Rudel gehört hat. Rudel sind seit jeher reizbare, kriegerische Stämme gewesen.
Genau das hat zum letzten Großen Krieg geführt.
In den alten Schriften ist von mehreren Hundert Rudeln die Rede, zu viele, um eine genaue Zahl angeben zu können. Wir haben in der Schule einiges über sie gelernt. Ich habe sogar in den dicken Wälzern unserer Bibliothek etwas über ihre Geschichte gelesen, weil es mich schon immer fasziniert hat, dass es eine Zeit vor den Kriegen gegeben hat, in der alle Rudel eine einzige große, ungeteilte Nation gebildet haben.
Während ich ihn so anstarre, wird mir klar, dass es mich eigentlich nicht so schockieren dürfte, einen Draki einer fremden Art zu treffen. Mir ist von Kindesbeinen an klar gewesen, dass es sie gibt und dass sie irgendwo dort draußen herumlaufen.
Aber es ist eben doch eine große Sache. Mein Körper reagiert instinktiv und bringt jede Faser zum Erzittern, während ich mich darauf vorbereite, mich im Kampf zu verteidigen. Es ist dieselbe Reaktion wie damals, als mich die Jäger verfolgt haben, aber ich hätte nie gedacht, dass ein anderer Draki dieses Gefühl in mir auslösen könnte. Es fühlt sich einfach nicht richtig an, gegen ihn kämpfen zu wollen. Immerhin sind wir Artgenossen.
Natürlich gibt es Störenfriede wie Miram und auch Drakis, die mich ein bisschen einschüchtern, so wie Severin und Corbin. Aber mich mit diesem Draki zu duellieren … das ist etwas ganz anderes.
Auf einmal habe ich das Gefühl, dass mein nächster Schritt über Leben oder Tod entscheidet.
Er erwidert meinen Gruß nicht. Asche und Kohle steigen in meiner Kehle hoch und meine Muskeln spannen sich noch mehr an. Ich mache mich bereit zum Kampf.
Ich stehe ihm direkt gegenüber und fühle mich an einen Gefängnisfilm erinnert, den ich vor langer Zeit gesehen habe und der sich tief in mein Gedächtnis eingegraben hat. Es ist ein komisches Gefühl, wie ein Déjà-vu. Als würde ich plötzlich in dem Film mitspielen. Ich bin die neue Gefängnisinsassin, die im Hof steht und sich dem Schlägertypen entgegenstellt, der das ganze Gefängnis tyrannisiert.
Ich versuche, mich daran zu erinnern, wie der Neuankömmling in dem Film es geschafft hat zu überleben, weil er natürlich der Held ist, der am Ende die Oberhand behält. Genau das habe ich auch vor. Zumindest will ich die nächsten vierundzwanzig Stunden überstehen, bis meine Freunde uns hier rausholen.
»Ich will keine Schwierigkeiten«, sage ich.
Der Draki macht ein seltsames Geräusch, ein kehliges Rasseln, das ich noch von keinem anderen Draki gehört habe. Ich frage mich, ob das eine Art Schlachtruf ist. Ich beobachte, wie sein schuppiges Fleisch zu zittern beginnt und sich wellenartig auf und ab bewegt.
»W… was machst du denn da?«, frage ich und habe nicht die geringste Ahnung, was es sein könnte. Ich weiß nicht, über welche Gabe er verfügt. Egal, welche es ist, sie hat auf jeden Fall alle anderen Drakis in die Flucht getrieben.
Ich mache einen Schritt zurück auf dem feuchten Untergrund, die Augen fest auf ihn gerichtet, aus Angst, ihn aus dem Blick zu lassen.
Auf einmal stellen sich seine Schuppen auf. Jeder Quadratzentimeter seines Körpers ist von scharfkantigen Scheiben übersät, die im rechten Winkel von seinem massiven Körper abstehen. Sie glitzern rasiermesserscharf und ich weiß, dass er mich damit selbst bei der kleinsten Berührung zu Hackfleisch verarbeiten kann.
Der Magen rutscht mir in die Kniekehlen. In Windeseile wird mir klar, warum die anderen sofort geflüchtet sind, als sich die Türen geöffnet haben.
Ich fluche leise, drehe mich blitzartig um und drücke mich in einer einzigen flüssigen Bewegung vom Boden ab. Die anderen hatten vollkommen recht. Ich muss mich so weit wie möglich von diesem Draki entfernen. Und zwar schnell.
Innerhalb von Sekundenbruchteilen tauche ich in den Wald ab und fege durch das Baumgestrüpp. Ich höre, wie der Graue sich hinter mir ebenfalls einen Weg durch das Dickicht bahnt. Ich bin zwar schnell, aber das ist er auch. Los, los, los, los!, treibe ich mich keuchend an.
Die Vorstellung, dass er mich erwischen und mit seinem rasiermesserscharfen Körper gegen meinen krachen könnte, versetzt mich in solche Panik, dass Glut aus meinen Lungen aufsteigt und sich in meinem Mund breitmacht. Und mir ist klar, dass ich keine Wahl habe. Ich muss mich ihm stellen und mich verteidigen.
Mitten im Flug bremse ich ab und mache kehrt. Dabei bewegen sich die großen Segel meiner Flügel majestätisch hinter meinem Rücken – doch gegen seine wirken sie regelrecht mickrig. Seine lösen Windböen aus, die so heftig sind, dass sie das Laub von den Bäumen reißen.
Während er auf mich losgeht, schüre ich die Hitze in mir und sammle sie. Mir ist vollkommen klar, dass es hier mit einem kleinen warnenden Dampfstoß nicht getan ist. Für ihn brauche ich Feuer. Tödliche Flammen.
Als er ganz dicht vor mir schwebt – so dicht, dass ich seine harten, unbarmherzigen Gesichtszüge, die zerfurchte Nase und die aufgeblähten Nasenlöcher sehen kann –, lasse ich die sengende Hitze aus meinem Inneren entweichen.
In einem Strudel wütender, knisternder Flammen bricht sie aus mir hervor.
Der Graue taucht seitlich unter mir weg und entgeht nur knapp der vollen Wucht meiner Feuersbrunst.
Ich blicke nach unten und sehe, dass er sich bereits wieder im Steigflug befindet. Das Glänzen in seinen Augen sagt mir, dass ihm meine Gabe keine Angst einjagt. Irgendwie wirkt er sogar erfreut darüber.
Das erschreckt mich von allem am meisten. Feuer macht ihm also keine Angst? Will er etwa verbrannt werden? Hegt er vielleicht Selbstmordgedanken?
Mir wird plötzlich bewusst, dass ich keine Ahnung habe, wie dieser Draki reagieren wird. Also schieße ich im Sturzflug nach unten, fliege dann ganz dicht am Boden entlang und schaue dabei immer wieder über die Schulter. Und ja, da ist er. Er verfolgt mich unbarmherzig und ist mir bereits dicht auf den Fersen. Diesmal halte ich nicht inne. Im Flug speie ich Feuer über meine Schulter.
Plötzlich schert er hinter mir aus, fest entschlossen, mich zu erwischen. Jede Faser seines massigen Körpers schreit förmlich nach Gefahr und Ungezähmtheit. Er ist ein Drache alten Schlags und scheint keinen Funken Menschlichkeit in sich zu haben. Und er will mir ein Ende bereiten.