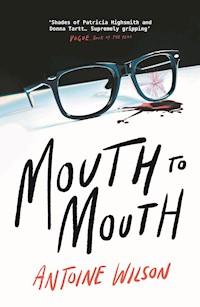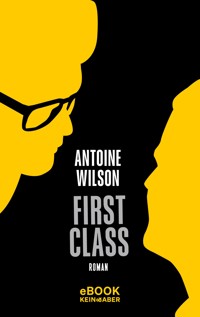
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kein & Aber
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Alles beginnt damit, dass Jeff dem namenlosen Erzähler des Romans in einer Flughafenbar seine Lebensgeschichte vorlegt, und zwar, wie er einen Mann vor dem Ertrinken rettet und sich nach und nach in dessen Leben einnistet. Obwohl der Erzähler an Jeffs Aufrichtigkeit zu zweifeln beginnt, kann auch er sich der fesselnden Geschichte von Täuschung und scheinbar glücklichen Zufällen, in der die Grenzen zwischen Fakt und Fiktion immer wieder verschwimmen, nicht entziehen. Denn Jeffs Aufstieg in der Gesellschaft könnte schillernder nicht sein. Doch zu welchem Preis? Spannend und durchtrieben – Antoine Wilson beleuchtet die ausgeklügelten Wege, auf welche wir andere betrügen, oder uns selbst. Gänsehautmoment beim letzten Satz garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Antoine Wilson · First Class
Digitales Leseexemplar
Erscheint im Mai 2023
SPERRFRIST:
BITTE NICHT VOR DEM
16.05.2023 BESPRECHEN.
HERZLICHEN DANK!
ANTOINE WILSON
FIRSTCLASS
Roman
Aus dem Amerikanischen von Eva Regul
Die Originalausgabe erschien 2022 unter dem Titel Mouth to Mouthbei Avid Reader Press, an Imprint of Simon & Schuster, Inc., New York
Copyright © 2022 by Antoine Wilson
Deutsche Erstausgabe
Alle Rechte vorbehalten
Copyright © 2023 by Kein & Aber AGZürich – Berlin
Covergestaltung: Maurice Ettlin
Satz: Leingärtner, Nabburg
Druck und Bindung: GGPMedia GmbH, Pößneck
ISBN: 978-3-0369-5002-0
Auch als eBook erhältlich
www.keinundaber.ch
Für Chrissy
7
1
Ich wartete am Gate des New Yorker Flughafens JFK, allein, übermüdet vom Nachtflug aus Los Angeles, und sinnierte über den Anblick, der sich mir kurz nach dem Start, kurz vor dem Einschlafen, in der abendlichen Dun-kelheit geboten hatte, ein Anblick, den ich aus einem Flugzeug noch nie zuvor gesehen hatte.
Ich hatte auf der linken Seite am Fenster gesessen, und wir waren, Zufall oder Schicksal, in Richtung Süden übers Meer geflogen, sodass sich mir ein weiter Blick auf die nächtliche Stadt bot: die goldgelb leuchtenden Punkte der Wohnviertel, die rot-weißen Streifen der Highways und dazwischen mysteriöse schwarze Lücken von Gewässern und Parks. Plötzlich ein kleiner Lichtblitz, aber nicht am Boden, sondern in der Luft. Dann noch einer, gefolgt von Strahlen in alle Richtungen, wie eine Blüte, die sich im Zeitraffer öffnet. Ein Feuerwerk. Ich betrachtete die vielen kleinen Explosionen, bis das Flugzeug die Wolkendecke erreichte.
Dabei war es gar kein Feiertag.
Während ich noch darüber nachdachte, wie man einen Anblick, der einen am Boden so vollkommen fesselte, aus einer anderen Perspektive nur als winziges Aufflackern auf riesigem Raum wahrnahm, hörte ich aus dem Lautsprecher einen Namen.
8
»Jeff Cook«, sagte die Stimme. »Bitte begeben Sie sich zum Schalter von Gate 11.«
Ein Allerweltsname, aber ich horchte dennoch auf. Ich hatte mal einen Jeff Cook gekannt, an der UCLA, vor fast zwanzig Jahren. Ich hob den Kopf und sah einen gutausse-henden Mann Mitte vierzig mit großen Schritten auf den Schalter zugehen. Er trug einen eleganten blauen Anzug ohne Krawatte und eine Brille mit transparenter Fassung. Teure Lederslipper. Er nannte der Frau am Schalter seinen Namen und schob ihr Bordkarte und Ausweis hin. Wäh-rend sie auf die Tastatur hämmerte, lehnte er sich leicht auf den Griff seines schicken Hartschalen-Rollköfferchens.
Von meinem Platz in der Nähe des Schalters konnte ich diesen Jeff Cook im Profil betrachten. Ich war schon fast sicher, dass es nicht der Jeff Cook von früher war, und wolltemich gerade abwenden, als er den Kopf in meine Rich-tung drehte. Diese hohen, breiten Wangenknochen und diesen durchdringenden Blick kannte ich.
Er war es tatsächlich. Allerdings hatte Jeff früher beein-druckend lange, wallende dunkle Haare gehabt, nicht so einen kurz geschorenen, grau melierten Schopf wie jetzt. Außerdem hatte er zugenommen, war kompakter gewor-den wie so viele von uns, die nach dem College, als wir uns schon längst als fertige Männer verstanden, noch mal eine ganz andere Figur bekommen hatten.
Damals waren Jeff und ich nicht unbedingt eng befreun-det gewesen, eigentlich kannten wir einander nur flüchtig, aber obwohl er in meiner Vergangenheit nicht mehr als eine Nebenrolle gespielt hatte, erinnerte ich mich sehr deut-lich an ihn.
9
Im ersten Jahr am College war er einfach ein Kommi-litone, der mir aus irgendeinem Grund aufgefallen war, und es ergab sich eine Reihe von Begegnungen, wenn man es denn überhaupt so nennen konnte, am College und an-derswo. Mit seiner wallenden Mähne und seinen markanten Zügen war er kaum zu übersehen, eine Art Vintage-Style-Adonis, der das lässige Selbstvertrauen eines Studenten im höheren Semester ausstrahlte. Man kann nicht mal be-haupten, dass unsere Wege sich kreuzten, er tauchte nur hin und wieder auf, saß am Ecktisch in einem Café, schlen-derte bei einer Demo gegen den Zweiten Golfkrieg um-her oder stand – vollkommen überraschend – im Schein meiner Rücklichter, als ich eines Abends bei einem Freund aus der Einfahrt zurücksetzte. Bei jeder Begegnung mit diesem Mystery Man bekam ich eine Gänsehaut, als wäre er mein wachsamer Schutzengel, und dann packte mich plötzlich die Angst, ich könnte ihn vielleicht nie wieder-sehen.
Gegen Ende jenes ersten Jahres ging ich mit einem Freund Gras kaufen. Er kannte einen Kiffer, der sich ein bisschen mehr besorgt hatte, um seine Kumpel zu versor-gen und nebenbei etwas Kohle zu machen. Wir fuhren zu einer hässlichen Mietskaserne in der Gayley Avenue. Durch die verdreckte Sicherheitsschleuse am Eingang gelangten wir zu einem nach ranzigem Hydrauliköl stinkenden Fahr-stuhl. Im Obergeschoss empfing uns ein leerer, nüchter-ner Flur, aber die Wohnung selbst besaß eine sehr eigene, höhlenartige Atmosphäre, die Fenster waren mit Bettlaken verhängt und die Wände geschmückt mit Postern einer Band, Marillion, von der ich noch nie etwas gehört hatte.
10
Wie bestellt und nicht abgeholt standen wir im Wohnzim-mer herum, während vor uns eine Gruppe bekiffter Ge-stalten auf dem Sofa abhing und uns eher argwöhnisch als freundlich anglotzte. Am Rand des Sofas, genauso stoned wie alle anderen, saß mein langhaariger Schutzengel. Mein Freund bekam das Gras, und vielleicht damit das Ganze nicht zu geschäftsmäßig wirkte, stellte sein Kumpel alle vor. So erfuhr ich den Namen des Mystery Man, einen Namen, der lange nicht so mysteriös war wie er selbst: Jeff.
Im zweiten Studienjahr tauchte er wieder auf, diesmal im Kurs »Kino und sozialer Wandel«. So sah ich ihn nun jeden Dienstag und Donnerstag in der Melnitz Hall, und je vertrauter sein Anblick wurde, desto mehr verblasste die Aura um ihn, bis er einfach ein ganz gewöhnlicher Kom-militone war, der Film ebenfalls nur im Nebenfach hatte und bei den Diskussionen im Seminar genauso ahnungslos war wie ich. Diese Veränderung fand ich bemerkenswert. In den folgenden Jahren musste ich immer daran zurück-denken, wenn ich mit irgendwelchen Promis zu tun hatte, deren VIP-Status mich völlig grundlos, aber doch nach-haltig in Aufregung versetzte.
Die Frau am Schalter beugte sich hinunter und zog etwas aus dem Drucker. Dann reichte sie Jeff seinen Aus-weis und die Bordkarte zurück. Er dankte ihr und verließ den Schalter. Als er an mir vorbeiging, sagte ich seinen Namen.
Er sah mich fragend an. »Ja?«
»UCLA«, sagte ich.
Die Augenbrauen hinter der durchsichtigen Brille schnellten überrascht in die Höhe.
11
»Meine Güte«, sagte er. »Du hast dich überhaupt nicht verändert. Klar, zwanzig Jahre älter oder so, aber du weißt schon, was ich meine.«
Hatte er Mühe, mich einzuordnen? Ich wollte ihm schon meinen Namen nennen, aber er kam mir zuvor.
»Genau der«, sagte ich.
»Namen und Gesichter.« Er tippte sich an die Schläfe. »So was bleibt bei mir hängen.«
Oh Gott, dachte ich, er ist Vertriebler geworden.
Er streckte mir die Hand entgegen.
»Das Filmseminar«, sagte er. »Ich erinnere mich. Das einzige, das ich je belegt habe.«
»War bei mir auch so.«
»Ich wäre fast durchgefallen. Bin im Dunkeln immer eingeschlafen. Die ganze Veranstaltung hat sich angefühlt wie ein Traum.«
»Du hast nicht viel verpasst«, sagte ich. Das stimmte zwar nicht, aber es war eben Small Talk.
Er lächelte und musterte mich einen Moment lang. »Hey, willst du nicht mit in die First Class Lounge kom-men? Ich habe einen zweiten Zugangspass.«
»Und der Flug?«
Er zeigte auf das Display über dem Gate. Unser Flug hatte Verspätung.
Ich saß sowieso schon seit Stunden am Flughafen, da ich das billigste Last-minute-Ticket gekauft hatte, das ich kriegen konnte – Nachtflug von L.A., Zwischenstopp in New York, Flug nach Frankfurt, gefolgt von einer vier-stündigen Zugfahrt nach Berlin –, und die Vorstellung einer First Class Lounge war so verlockend, dass ich dem
12
alten Jeff am liebsten auf der Stelle um den Hals gefallen wäre.
Ich folgte ihm durchs Terminal, und angesichts seines nagelneu aussehenden Rollkoffers und seiner Aktentasche aus weichem Leder wünschte ich, ich hätte etwas Erwach-seneres mitgenommen als meinen altersschwachen Ruck-sack. Das Terminal war nicht brechend voll, aber doch belebt genug, dass wir hintereinander besser vorankamen als nebeneinander. Jeffs Haare waren im Nacken über dem Kragen in einer geraden Linie geschnitten. Alles an ihm wirkte gepflegt und stilvoll. Im College hatte ich ihn nie in besonders ordentlicher Kleidung gesehen, immer nur in zerrissenen Jeans und ausgeleierten T-Shirts, die er auf links trug, damit man den Aufdruck nicht lesen konnte. Ich hatte nie kapiert, ob das ein modisches Statement oder eine Verlegenheitslösung war.
Als ich ihm und dem rhythmischen Klackern seiner Kof-ferrollen vom Gate zum Lounge-Fahrstuhl folgte, sah er sich kein einziges Mal um, ob ich noch hinter ihm war. Bereute er es schon, mich ins Land der Reichen und Schönen ein-geladen zu haben? Hoffentlich hatte ich seine Einladung nicht zu begierig angenommen.
Am Fahrstuhl verhielt er sich aber wieder ganz normal oder zumindest so wie am Gate, er schien sich zu freuen über unser zufälliges Treffen und über die Aussicht, mal wieder Neuigkeiten auszutauschen, obwohl ich eigentlich gar nicht wusste, welche Neuigkeiten das sein sollten.
Er wirkte auf mich wie einer dieser Menschen, die ein-fach nicht gern allein waren. Wenn ich genauer hingesehen hätte oder geahnt hätte, was kommen würde, hätte ich in
13
seinem Blick vielleicht einen Anflug von Verzweiflung ent-deckt. Aber ich weiß es nicht. Vielleicht war da auch nichts, noch nicht.
Am Marmorschalter vor der Lounge nahm ein beflis-sener junger Mann den Zugangspass in Empfang, wies uns hinein und teilte uns mit, dass sie uns Bescheid geben würden, wenn es Zeit fürs Boarding war. Jeff steuerte auf einen niedrigen Tisch mit zwei freien Sesseln am Fenster zu und lud mich ein, Platz zu nehmen, als wäre er mein Gastgeber. Die Sessel waren aus echtem Leder und der Tisch aus echtem Holz. Er bot an, zwei Bier zu holen. Ich sagte ihm, ich hätte seit acht Jahren keinen Alkohol ge-trunken, aber es würde mir nichts ausmachen, wenn er etwas trinken wolle. Er ging zur Bar, seine Taschen ließ er stehen. Selbst hier im exklusiven Allerheiligsten des Flughafens kam mir beim Anblick der unbeaufsichtigten Gepäckstücke der Gedanke an Schmuggelware oder eine Bombe. Schnell verdrängte ich ihn wieder. Das ist seit jeher mein Mantra auf Flugreisen: Nicht nachdenken. Sobald man einen Flughafen betritt, ist man einer kom-plizierten und unergründlichen Maschinerie ausgeliefert, deren einziger Zweck es ist, einen von A nach B zu brin-gen. Einfach nicht nachdenken und es über sich ergehen lassen.
Mit zwei Bierflaschen in der Hand kehrte Jeff zurück. Eine davon stellte er vor mir auf den Tisch und verkün-dete, er habe ein Alkoholfreies bekommen, er wisse zwar nicht, ob ich das trinke, aber er habe gedacht, es sei doch feierlicher – diesen Ausdruck benutzte er tatsächlich –, bei einer Flasche Bier, sei es nun mit oder ohne Alkohol, über
14
Neuigkeiten zu plaudern wie in alten Zeiten. Ich konnte mich nicht daran erinnern, dass wir jemals zusammen et-was getrunken hatten, aber ich ließ es so stehen. Wir stie-ßen an und tranken einen Schluck, dann wanderten un-sere Blicke nach draußen zu den Flugzeugen.
»Das Wunder des Reisens«, bemerkte er. »Man schläft irgendwo ein und wacht auf der anderen Seite der Welt wieder auf.«
»Ich kann im Flugzeug nicht schlafen«, sagte ich.
»Eine Bekannte von mir«, erzählte er, »die Freundin einer Freundin, sozusagen, hat furchtbare Flugangst, aber wegen familiärer Verpflichtungen muss sie viel und oft rei-sen. Fliegt nur im Privatjet, sie ist sehr wohlhabend. Und weißt du, was sie macht? Sie bestellt sich einen Anästhesis-ten nach Hause, der sie in ihrem Bett in Narkose versetzt. Danach fährt er mit ihr zum Flughafen, begleitet sie an ihr Reiseziel, bringt sie dort in ihre Unterkunft, ob Hotel oder eines ihrer eigenen Häuser, und holt sie dann wieder aus der Narkose. Sie schläft wortwörtlich an einem Ort ein und wacht an einem anderen wieder auf.«
»Das sollte mal jemand für uns in der Economy ma-chen«, meinte ich. »Dann würden sie viel mehr Leute in den Flieger kriegen. Wie Sardinen.«
Jeff nippte an seinem Bier.
»Bist du geschäftlich in Frankfurt?«, fragte er mit einem kurzen Blick auf meine ausgelatschten Turnschuhe.
»Berlin«, erwiderte ich. »Da sitzt mein Verleger.«
Ich verschwieg, dass ich auf eigene Kosten reiste, in der Hoffnung, aus der Bezeichnung »Kultautor«, mit der eine Zeitschrift in Deutschland mich tituliert hatte, Kapital zu
15
schlagen. Und dass ich mich außerdem auf eine dringend benötigte Auszeit von Familienpflichten freute, um endlich mal eine Woche lang befreit von Fahrdiensten und Wochen-endeinkäufen zu leben, so, wie Autoren in der Vorstellung ihrer Leserinnen und Leser rund um die Uhr lebten.
»Ich kann mir nicht vorstellen, ein Buch zu schreiben«, meinte Jeff.
»Ich auch nicht.«
Ich sagte das oft, und es war wirklich ernst gemeint, aber alle fassten es immer als Ausdruck falscher Beschei-denheit auf.
Jeff lachte leise. Dann wurde er ernst, und ich rechnete schon mit der Frage, ob er von einem meiner Bücher ge-hört haben müsse. Aber stattdessen wollte er wissen, ob ich jemals in Narkose versetzt worden war.
»In der Highschool habe ich die Mandeln rausgekriegt.«
»Hattest du Angst, nicht wieder aufzuwachen?«
Ich schüttelte den Kopf. »Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Aber inzwischen wäre ich da nicht mehr so entspannt.«
»Du hast Kinder.«
»Zwei.«
»Das verändert alles, oder?«
Er war vor Kurzem operiert worden, nichts Schlimmes, zumindest nichts Lebensbedrohliches, aber er hatte fürch-terliche Angst gehabt, vielleicht nicht wieder aufzuwachen. So was kam ja durchaus vor. Äußerst selten zwar, aber trotz-dem war er den Gedanken nicht losgeworden, wie schreck-lich es für seine Kinder – er hatte ebenfalls zwei – und seine Frau wäre, wenn er nicht mehr aufwachen würde. Die
16
ganze Sache hatte ihn ziemlich aus dem Gleichgewicht gebracht.
»Der Schlaf ist der Bruder des Todes«, sagte ich.
Draußen setzte ein Jumbo zur Landung an, aber er war zu hoch und zu schnell, er würde über die Landebahn hinausschießen, so sah es zumindest für mich aus und für Jeff vielleicht auch, denn er konnte die Augen ebenso we-nig abwenden wie ich, aber dann landete der Jumbo ganz normal, bremste scharf ab und rollte wie jeder andere Flie-ger zum Taxiway. Die ganze Aktivität vor den Fenstern – die herumflitzenden kleinen Autos, die Bodenlotsen, die mit ihren orangen Leuchtstäben die Flugzeuge einwiesen, die Hubwagen der Cateringfirmen, aus denen die warten-den Flieger mit Essen und Getränken beladen wurden, die ausfahrenden Fluggastbrücken, die Gepäckwagen, die mit ihren Anhängern über den Asphalt ratterten –, all das wim-melte unter den grauen Wolken wie auf einem Gemälde von Hieronymus Bosch.
Während ich aus dem Fenster gesehen hatte, war ihm ein Gedanke gekommen.
»Nach meiner Operation«, sagte er, »als ich noch völlig benebelt im Aufwachraum lag, war ich gar nicht so er-leichtert, wie ich erwartet hatte – das kam erst später, als ich meine Familie wiedersah. Stattdessen dachte ich nur daran, dass ich ein Stück Zeit verloren hatte. Wie im Schlaf, nur dass man beim Schlafen genau da aufwacht, wo man auch eingeschlafen ist. Ich hatte das Gefühl, mit mir wäre ohne mein Wissen irgendetwas angestellt worden – was natürlich auch stimmte. Irgendwie fand ich den Gedanken unheimlich, dass ich nicht mehr derselbe Mensch war
17
wie derjenige, der vor der OPeingeschlafen war. Ich hatte etwas verpasst, und ein Teil meines Körpers war heraus-operiert worden. An meinem Bein hatten sie ein vier-eckiges Stück Haut rasiert für so eine Strom ausleitende Elektrode, ansonsten war ich ganz offensichtlich noch ich selbst. Vielleicht war es auch nur eine Nebenwirkung der Medikamente, aber ich wurde das Gefühl nicht los, als Er-satz für mein altes Ich neu auf die Welt gekommen zu sein. Wie gesagt, nach einer Weile ist das Gefühl wieder ver-gangen, angenehm war es trotzdem nicht.«
»Wie eine Nahtoderfahrung?«, fragte ich.
»Witzig, dass du das sagst«, entgegnete Jeff, als hätte er nicht gerade selbst die Unterhaltung in diese Richtung gelenkt. »Ich habe so was mal aus nächster Nähe erlebt. Es war gar nicht lange nach dem College, ein Jahr später un-gefähr. Da habe ich einem Mann das Leben gerettet, völlig ungeplant und unvermutet.«
Ich fragte mich, warum er so betonte, dass es »unge-plant und unvermutet« war, wo man davon doch eigent-lich ausgehen würde.
»Was ist passiert?«, fragte ich.
»Ich hole lieber erst noch ein Bier.«
»Nein, nein«, sagte ich. »Die nächsten übernehme ich.«
»Die Getränke sind kostenlos.«
»Dann kann ich sie wenigstens holen.«
Er ließ sich wieder in seinen Sessel fallen.
Ich stand auf und ging zur Bar, vorbei an all den unter-schiedlichen Reisenden, von Geschäftsleuten bis zu stein-reichen Hipstern, von denen sich viele in fremden Spra-chen unterhielten. Sie waren gar nicht so anders als ihre
Pendants in der unteren Etage, außer dass sie nicht aus-sahen, als würden sie gerade ein Martyrium erleiden. Ich bestellte meine zwei Biere beim mürrischen Barkeeper. Es war noch nicht mal Mittag. Als ich zum Tisch zurück-kehrte und Jeff die Flasche reichte, hob er sie wieder zum Anstoßen.
»Dass wir uns getroffen haben, ist eine glückliche Fü-gung«, sagte er. »Schließlich warst du auch ganz am Anfang dabei.«
19
2
»Am Anfang?«, fragte ich.
»Das Filmseminar«, sagte er, »bei dem Professor aus Nigeria.«
»Äthiopien«, erwiderte ich.
Jeff sah mich zweifelnd an. »Sicher?«
»Wir haben einen nigerianischen Film gesehen, aber der Prof war hundertprozentig aus Äthiopien.«
Jeff schwieg einen Moment.
Dann sagte er: »All die Jahre habe ich gedacht, er wäre aus Nigeria.«
»Ändert die ganze Geschichte.«
Er sah mein Grinsen.
»Okay«, meinte er. »Wir waren also in dem Filmseminar. Du und ich und meine Freundin Genevieve, die immer nur G genannt wurde. Erinnerst du dich an G?«
Tat ich nicht.
»Sie war auch nicht besonders bemerkenswert«, sagte er und lehnte sich zurück wie jemand, der es gewohnt war, dass man ihm zuhörte. »Nicht, dass mir das damals bewusst gewesen wäre. Sie war von fast schon tragischer Spießig-keit. Sie hat Film im Hauptfach studiert, und sie war mit Abstand das größte Talent in ihrem Jahrgang. Ihre Arbeiten waren erstklassig, auf Profi-Niveau, so schien es mir zu-mindest. Aber nicht nur mir. Ihre Professoren schwärmten
20
von allem, was sie machte, redeten vom Masterstudium, prophezeiten ihr eine glänzende Karriere, wenn sie vor harter Arbeit nicht zurückschreckte, und so weiter. Aber dann ging bei der Preisverleihung für die Abschlussfilme der erste Preis an jemand anderen, einen Typen, was schon schlimm genug war, aber zu allem Übel war sein Film auch noch absoluter Mist.«
»Wie ätzend«, sagte ich.
»Ja, ich hatte damit gerechnet, dass G gegen die Ent-scheidung Einspruch erhebt, zumindest hinter verschlos-senen Türen, denn sie hatte einen starken Charakter, sie war ehrgeizig. Aber stattdessen meinte sie, die Juroren hät-ten nur bestätigt, was sie schon immer gewusst hatte – sie besaß vielleicht eine handwerkliche Begabung, aber ihre Arbeiten waren blutleer. Ich hielt das für eine groteske Verzerrung. Ihre Filme waren überhaupt nicht blutleer, sie hatten das Publikum angerührt. Aber sie ließ sich nicht umstimmen. Wenn sie sich einmal festgelegt hatte, konnte man nichts mehr machen. So war sie einfach.
Nach dem Studium ist sie bei einer dieser Talent-Agenturen gelandet – sie wollte die Branche von innen kennenlernen. Es war ein irrsinniger Job mit irrsinnigen Arbeitszeiten, aber sie hat es geliebt. Ich hatte inzwischen bei einem Start-up angefangen, das einen Internet-Stadt-führer programmiert hatte, so eine Art kuratierte Gelbe Seiten, damals wurden die Inhalte der Suchmaschinen ja noch von Redakteuren sortiert und zusammengestellt. Was dazu führte, dass meine Tage unstrukturiert waren und ich viel durch die Gegend gezogen bin, während sie an ihren Schreibtisch und ihr Telefon gefesselt war. Das hat
21
mich irgendwie nervös gemacht, dieses Ungleichgewicht, obwohl ich das damals gar nicht richtig in Worte fassen konnte, aber jedenfalls – erstaunlich, was für eine Dyna-mik so was plötzlich entwickelt –, bei der zweiten Hoch-zeit ihres Vaters hab ich mich mit Champagner volllaufen lassen und ihr einen Heiratsantrag gemacht. Gar nicht so sehr, weil ich verheiratet sein wollte, glaube ich, sondern einfach weil ich Angst hatte, wir würden uns auseinander-leben. Und immerhin, das muss ich ihr zugutehalten, hat sie nicht Nein gesagt. Sie hat nur gelacht und mich geküsst. Aber als wir wieder in Los Angeles waren, stand ihre Ent-scheidung fest. Sie sah keine Zukunft für uns. Und ihrer Meinung nach hatte es dann auch keinen Sinn, die Tren-nung hinauszuzögern. Hat uns beiden das Herz gebro-chen. Ich hatte gedacht, wir könnten den Liebeskummer abwenden, indem wir einfach beschlossen zusammenzu-bleiben, aber wie gesagt, sie hatte eine starke Persönlich-keit.«
»Autsch«, sagte ich.
»Natürlich hatte sie recht.«
»Trotzdem«, sagte ich.
»Ich habe sie geliebt, das heißt, eigentlich habe ich meine Vorstellung von ihr geliebt. Erst eine Weile nach der Tren-nung habe ich verstanden, dass diese Vorstellung von ihr ihr wahres Wesen überlagert hatte.«
Er nahm einen großen Schluck Bier.
»Nach der Trennung war ich todunglücklich, ich hatte kein Geld und keine Freunde. Ich habe in den Canyons gewohnt, wo ich für einen Schauspieler das Haus gehütet habe. Na ja, eigentlich für einen Schauspieler, der für einen
anderen Schauspieler das Haus gehütet hat. In meinem Leben herrschte tote Hose.«
»Kommt mir bekannt vor«, sagte ich.
»Gott, ist das lange her.«
23
3
Eines Morgens, erzählte Jeff, wachte er vom Geräusch der Luft auf, die aus Gs Nase pfiff, aber dann stellte er fest, dass das Pfeifen aus seiner eigenen verstopften Nase kam und er allein war.
Seit der Trennung dachte Jeff oft mit Wehmut an Dinge zurück, an die er früher, als sie noch zusammen gewesen waren, keinen Gedanken verschwendet hatte. So auch an das leise Pfeifen, das G manchmal im Tiefschlaf von sich gab. Mit der Erinnerung an dieses regelmäßige nächtliche Geräusch kehrte eine zärtliche Liebe für sie zurück, wie die Liebe zu einem kleinen, wehrlosen Tier, denn es kündete von einer Verletzlichkeit, die G in wachem Zustand ver-barg, vielleicht weil sie so klein war, gerade mal eins sech-zig, und kaum fünfzig Kilo wog. Ihr Atem, der durch einen winzigen Spalt in den Nebenhöhlen oder der Nasenscheide-wand oder durch die Nase selbst strich, sang ein Lied von Schutzlosigkeit, von einer Kindlichkeit, die sie ihn sonst nur selten sehen ließ. Die Nase, aus der dieses Lied erklang, war wunderbar gewölbt und ein wenig zu groß, was aber von Sommersprossen auf beiden Wangen ausgeglichen wurde (ihm ging erst später auf, dass sie bestimmt oft wie ein Kind behandelt worden war), und diese Nase wurde für ihn zu etwas ganz Besonderem, weil sie Gs zarte Schönheit, zu der sie eigentlich nicht passte, nur umso mehr unterstrich.
24
Er überlegte, ob er wieder ins Bett gehen sollte. In die-sem Bett, im Bett des Schauspielers, hatten G und er sich Babynamen überlegt, alberne Namen, immer im schützen-den Bewusstsein, dass das natürlich vermessen war. In die-sem Bett, in diesem Haus hatten sie erwachsen gespielt, hatten so getan, als hätten sie es selbst eingerichtet und die Kunstwerke an den Wänden auf unfassbar teuren Rei-sen in ferne Länder gekauft. Das Entengemälde auf der Rambla in Barcelona, den Kelim in Istanbul, von einem Mann mit zittrigen Händen. Er gab vor, nicht mehr zu wissen, woher das Geschirr stammte, und sie dachte sich eine passende Geschichte aus. Mit der Erfindung einer glamourösen Vergangenheit hatten sie sich zugleich eine glorreiche Zukunft ausgemalt. Jetzt aber wirkte das alles falsch, in jeder Ecke des Hauses erinnerte ihn etwas an vergangene Situationen und verwehte Träume, und die ehemals heitersten und spielerischsten waren nun die be-drückendsten.
Er musste raus. Er zog sich an, stieg in seinen alten Volvo und fuhr nach Westen in Richtung Santa Monica.
Die Sonne war noch nicht aufgegangen. Von der Steil-küste sah der Strand wie ein dunkelgrauer Streifen aus, das Meer schwarz. Im Dunkeln überquerte er die Fußgänger-brücke über den Pacific Coast Highway, ging von einem Lichtkegel zum nächsten. Der Strandparkplatz war aus-gestorben, nur ein einzelner Radfahrer sauste vorbei und jagte dem goldgelben Strahl der Lampe an seinem Len-ker hinterher. Der Himmel war von einem tiefen Braun-schwarz, niedrige Wolken reflektierten die Lichter der Stadt auf die Erde zurück. In einiger Entfernung erhob sich ein
25
kleiner Hügel auf dem Sand, entweder ein kuschelndes Pärchen oder ein schlafender Obdachloser.
Schon jetzt ließ die Weite des Ozeans seine Probleme kleiner wirken und schuf eine Verbindung zwischen ihm und den elementaren, ewigen Dingen.
Er zog Schuhe und Socken aus, und als er barfuß auf den kalten Sand trat, empfand er ein Gefühl der Freiheit an-gesichts seiner eigenen Bedeutungslosigkeit, ebenso aber – weil er allein war, weil es dunkel war, weil hinter ihm die ganze Stadt schlief – fühlte er sich wie eine Art lokale Gottheit, die unter einem gleichermaßen unsichtbar wie allmächtig machenden Umhang den Blick über ihr Reich schweifen ließ.
Er setzte sich nah ans Meer, auf den trockenen Sand knapp oberhalb der Wasserlinie, und die Kälte zog ihm in den Hosenboden. Der Horizont schnitt die Aussicht ent-zwei, er war das Entfernteste, was man auf dieser Erde se-hen konnte. Jeff stellte sich vor, dort draußen ausgesetzt zu werden, auf halbem Weg nach Japan, und Wasser zu treten, bis die Erschöpfung ihn übermannte. Er wusste damals nicht, dass es bis zu dieser scheinbar unendlich weit entfernten Linie keine zwei Seemeilen waren. Und ge-nauso deutlich verschätzte er sich beim Ausmaß seines Liebeskummers. In der Beziehung mit G hatte er das Ge-fühl gehabt, dass sich etwas entwickelte, dass er sich eine Zukunft aufbaute, und jetzt musste er plötzlich wieder von vorne anfangen. So absurd es ihm später auch erschien – er war nicht mal mehr in der Lage, sich die Intensität die-ses Gefühls in Erinnerung zu rufen –, die Leerstelle, die G in seinem Leben hinterlassen hatte, war beständig und
26
allgegenwärtig, der erste Gedanke nach dem Aufwachen und der letzte vor dem Einschlafen.
Hinter ihm begann es zu schimmern und zu glühen, fiat lux, und langsam traten Meer und Himmel aus dem Nichts hervor. Ein neuer Tag begann. Pelikane flogen dicht über dem Wasser. Weit draußen sah er den schemen-haften Umriss eines Schiffes. In der Nähe zankten sich ein paar Möwen um ein Stück Zellophan. Wellen rollten heran, brachen aber erst am Strand, weit gereiste Wogen eines Sturms, der das Wasser fern von hier auf dem Ozean in Auf-ruhr versetzt hatte, Bewegung und Energie, die von einem Molekül zum nächsten weitergegeben wurde wie ein Staf-felstab, nur um nach diesem langen Weg im Sand zu ver-siegen.
Nur auf der Durchreise, sagte eine Stimme in Jeffs Kopf, Quelle unbekannt, wahrscheinlich ein Autoaufkleber. So was passierte ihm manchmal – aus heiterem Himmel tauchte eine Stimme oder ein Song in seinen Gedanken auf und kommentierte, was gerade geschah, als hätte er nicht nur ein Bewusstsein, sondern mehrere, und als wäre sein Ver-stand eher eine Art Orchesterdirigent als der Urheber seiner eigenen Gedanken.
Aus dem Augenwinkel erspähte er einen dunklen Um-riss auf der Wasseroberfläche. Gerade eben war der noch nicht da gewesen, da war er ziemlich sicher. Ein Büschel Seetang? Nein, ein Schwimmer, der auf den Strand zu-hielt, er schlug mit dem Arm aufs Wasser, dann ließ er sich treiben, als betrachtete er den Meeresboden, wie ein Schnorchler ohne Schnorchel. Aber nein, das war es nicht. Die Gestalt trieb ohne Muskelspannung in der Dünung,
27
und Jeff hatte den Eindruck, dass etwas nicht stimmte. Er stand auf und wartete, dass die Gestalt wieder den Arm hob oder den Kopf zur Seite drehte, um Luft zu holen, aber es geschah nichts. Er wollte einem der Rettungs-schwimmer Bescheid sagen, aber die Wachtürme waren noch geschlossen. Am gesamten Strand war niemand zu sehen außer einer einsamen und viel zu weit entfernten Joggerin.
Noch nie in seinem Leben war er mit einer Situation wie dieser konfrontiert gewesen, in der er mit absoluter Sicherheit erkannte, dass er dieses Problem jetzt ganz al-lein zu lösen hatte. Er wünschte sich, der Gott, an den er nicht glaubte, möge eingreifen oder irgendjemand, der vielleicht wusste, was zu tun war, oder wenigstens jemand, der genauso hilflos und panisch war wie er selbst, damit sie es zumindest gemeinsam angehen konnten. Es war einer dieser schicksalhaften Momente, an die man sich später nicht mit einem erleichterten Lachen, sondern mit einem Schaudern erinnert, denn obwohl ihm klar war, dass er keine Wahl hatte und dass jeder an seiner Stelle dasselbe getan hätte, musste er sich eingestehen, dass es ein Test war. Schließlich hätte er ebenso gut aufgeben, resignieren, ein-fach weggehen können, er hätte leicht so tun können, als hätte er nichts gesehen, er hätte sich aus der Situation weg-denken können, sich einreden können, er wäre nicht da gewesen, wäre einen Moment zu früh gegangen oder zu spät gekommen, und dann wäre er nicht in diese missliche Lage geraten, sondern hätte das Ereignis knapp verpasst, und es hätte sich ungestört und ohne Zeugen so abgespielt, wie die Natur es vorgesehen hatte.
Ich wandte ein, dass man das Eingreifen in eine Situation genauso gut als Schicksal interpretieren konnte, dass der na-türliche Lauf der Dinge alle möglichen Einmischungen be-inhalten konnte, da wir ja selbst ein untrennbarer Bestand-teil der Natur waren.
Darüber dachte er einen Moment nach, setzte zu einer Antwort an – und nahm dann doch nur einen weiteren Schluck Bier.
29
4
Das Wasser war so kalt, fuhr er fort, nachdem er sein Bier geleert und ein neues geholt hatte, dass es ihm den Atem verschlug. Er hatte das Gefühl, nicht genug Luft in die Lunge zu bekommen. Trotzdem hastete er in Unterhose und T-Shirt durchs flache Wasser auf die Gestalt zu, dann schwamm er, und die ganze Zeit sagte er sich, dass es idio-tisch war, dass es dem Mann wahrscheinlich gut ging und er jeden Moment den Kopf heben würde, sodass das Ganze bis an Jeffs Lebensende als peinliche Geschichte über seine Neigung zu voreiligen Schlüssen und überhasteten Aktio-nen in Erinnerung bleiben würde. Gleichzeitig rotierte ein anderer Gedanke in seinem Kopf, ebenso eindringlich und klar, nämlich dass dieser Mann schon längst tot war und hier eine Leiche ans Ufer trieb. Aber hatte er nicht gesehen, wie der Mann den Arm gehoben und ins Wasser getaucht hatte?
Die Kälte schnitt ihm in Hände und Füße, und obwohl er den Kopf oben hielt, schmeckte er bei jedem Schwimm-zug Salzwasser. Als er den dahintreibenden Körper erreicht hatte, zögerte er. Was, wenn der andere sich plötzlich an ihn klammerte und ihn mit letzter Kraft unter Wasser zog, wie Ertrinkende es angeblich taten?
Doch dann fasste Jeff sich ein Herz, packte den Mann an der Schulter und wollte ihn auf den Rücken drehen, aber da er mit den Füßen nicht mehr auf den Grund kam,