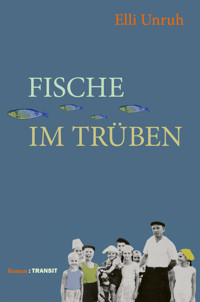
22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Transit
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein sprachlich faszinierendes Debüt, ein intensiver, überraschender Blick auf einen uns weitgehend unbekannten Teil europäischer Geschichte. Elli Unruh erzählt aus dem Leben einer russlanddeutschen Familie, die bis Ende der achtziger Jahre in der Sowjetunion, im südlichen Kasachstan, lebte – Nachfahren von Mennoniten, die einst von Katharina der Großen ins Zarenreich geholt wurden, um dort landwirtschaftliche Kolonien zu betreiben. Man taucht ein in eine faszinierende, ganz und gar andere Welt mit eigenen Lebensweisen, geprägt von familiären und religiösen Traditionen, aber auch von Erfahrungen mit Enteignung, Verfolgung, Deportation und ständiger Überwachung durch die sowjetische Miliz und die »Bevollmächtigten«. Geschrieben in einer klaren, poetischen Sprache, angereichert durch das besondere Deutsch, das die Mennoniten aus Westpreußen mitgebracht hatten. Und das alles vor dem Hintergrund einer wunderschönen, fruchtbaren Landschaft mit riesigen Apfelplantagen, wilden, fischreichen Flüssen und weiten Steppen am Rande des Tian Shan-Gebirges. Ursprünglich gründeten Mennoniten aus Westpreußen Ende des 18. Jahrhunderts auf Einladung der Zarin Katharina der Großen deutsche Kolonien im Russischen Zarenreich, vor allem im Gebiet der heutigen Ukraine, entlang des Flusses Molotschna und auf der Krim. Sie bekamen Land, Autonomie und Religionsfreiheit zugesichert. Bis Ende 1917 blieben die Männer von der Wehrpflicht befreit, da der Dienst an der Waffe gegen ihre religiöse Überzeugung verstoßen hätte. Mit der Februarrevolution endete auch die Erfolgsgeschichte der deutschen Siedler. Im darauffolgenden Bürgerkrieg mussten viele Mennoniten fliehen, verloren Land und Besitz. Unter Stalin endete die Religionsfreiheit, Kirchen und Schulen wurden geschlossen, Gemeinden enteignet und aufgelöst. Später, nach dem deutschen Überfall 1941 auf die Sowjetunion, wurden die Familien »hinter den Ural«, nach Sibirien oder Nordkasachstan deportiert; viele verhungerten, viele wurden als »Verräter« hingerichtet. Die deutsche Sprache wurde verboten. Erst unter Chruschtschow wurden die Deutschen rehabilitiert. Wer überlebt hatte, konnte Sibirien verlassen und sich in Kasachstan oder Kirgisien niederlassen. Dort lebten die Mennoniten mit anderen deutschen Siedlern, mit Russen, Kirgisen oder Tschetschenen zusammen, besuchten die gleichen Schulen und sprachen Russisch – blieben aber weiterhin als »Feinde« stigmatisiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 282
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
© 2025 TRANSIT Buchverlag
Postfach 12 03 07 | 10593 Berlin
www.transit-verlag.de
Layout und Umschlaggestaltung: Gudrun Fröba
Vorsatz @ freepik; Nachsatz: OpenStreetMap
ISBN 978-3-88747-457-7
Elli Unruh
FISCHE IM TRÜBEN
INHALT
ÄPFEL UND ESEL
ZWEI FISCHE AN LAND
ZWEI FISCHE IM NETZ
WAS EIN KIND NICHT ZU SCHÄTZEN WEISS
DER KARTOFFELKÄFER
EIN MORGEN IM HÜHNERSTALL
DER MURAB UND SEIN KUM
VON SCHLEUSEN UND FASCHISTEN
EIN FRIEDHOF IN DER STEPPE
RIESEN, BABA SCHURA
SCHWARZER RABE
MORSEZEICHEN, VOGELMILCH
MAXIM
HEIMREISEN
MIT LEICHTEM GEPÄCK
QUELLEN UND DANK
GLOSSAR
ÄPFEL UND ESEL
ZULETZT IM SOMMER, wenn die Steppe wie das Fell einer Saiga* im tiefen Licht der Sonne steht und im Osten das Tian Shan-Gebirge mit langgestreckten Hängen, Gletscherfirst und wind- und eisgeschärften Kämmen jeden Tag eher in der Dunkelheit versinkt, neigen sich, von Äpfeln beladen, die Äste der Bäume im Gärtchen Almaly** schon fast bis zum Boden. Wenn nicht bald jemand zur Ernte kommt, brechen sie ab, dann war alles umsonst.
Dieser Name – Gärtchen –, er passt wohl nicht ganz. Für fünfhundert Plantagenhektar gibt es aber keinen besseren, keinen schöneren wenigstens, und schön muss er sein. Wie an Schnüren ausgerichtet, stehen die Bäume, hübsch eingehegt und übers Land gereiht. Die friedlichste aller Armeen. Wollte jemand die Plantage im Ganzen betrachten, müsste er hinauf ins Gebirge und hätte von dort doch nicht das gesamte Heer erfasst. Auch abseits von Almaly wachsen Äpfel genug. Da ist keiner, der sie hütet: am Straßenrand, um die Felder, an Zäunen und Mauern. Je näher an den Bergen, stehen die Bäume dicht zu Wäldern gedrängt. Sie tragen unterschiedliche Sorten und gehören doch, ein jeder als Abkömmling, zum asiatischen Wildapfel. Sein Regiment reicht hoch ins Gebirge, die Baumgrenze liegt auf zweitausend Metern. Dort oben gibt es Bäume, die sind dreihundert Jahre alt und dreißig Meter hoch. Kann sein, ein Baum trägt kleine, säuerliche Früchte, beim nächsten sind sie groß, süß und gelb, dann wieder grün und weich, hart und saftig, was man sich nur vorstellen kann. Wie viele? Darüber gibt es Geschichten. Wo fängt man an, die Sterne am Himmel zu zählen? Den Sand am Meer? Die Äpfel in den Wäldern am Fuße des Tian Shan? Rot und gelb schimmern sie am Tag und des Nachts wie polierte Kugeln aus Holz, vom Mondschein weiß bemalt, und setzen fremde Zeichen zwischen Äste und Laub. Man sagt, überhaupt ist der erste Apfel hier gewachsen. Wer weiß, kann es sein? Lag hier einmal das Paradies? So wie im Frühjahr der Duft von Bergblumen über die dichte grüne Steppe weht, scheint es möglich, und im Mai erst, wenn im Weizen der Mohn lodert, kann man sich fast sicher sein. Doch dem Mohnfeuer folgt die Trockenheit und bleibt den ganzen Sommer. Wer Heu machen will, ist bis Anfang Juni besser fertig, sonst setzt die Sonne selbst die Sichel an und macht aus grünen Wiesen ein Jammertal.
Mit dem Kulturapfel und jenen wilden Äpfeln aus dem Gebirge wurde hin und her gezüchtet, bis der Aport zum Vorschein kam. Auf der Plantage wächst nur diese Sorte, mit anderen Sorten darf sich der Aport auf keinen Fall vermischen, denn besser wird ein Apfel nicht. Trockene Hitze schadet ihm nichts, auch nicht vierzig Grad minus und Bodenfrost im Winter. Gespritzt werden muss auch nicht, nicht gegen Mehltau und nicht gegen Schädlinge. Fehlte noch, dass der Aport sich selbst erntet. Die Plantage bringt für gewöhnlich guten Ertrag; in manchen Jahren ist er kaum zu bewältigen, und es liegt wohl an jener allgemein bekannten Sache mit der Erinnerung, dass gerade diese Jahre besonders im Gedächtnis bleiben: Zuletzt denkt man, es sei nie anders gewesen.
Der Boden ist vielleicht nicht so gut wie weiter im Norden, aber noch lange gut genug. Wo kein Apfelbaum steht, wächst was anderes. Was es nicht alles gibt: Melonen, Pfirsiche, Tomaten, Gurken, Mirabellen, Weintrauben, Walnüsse, Kartoffeln, Kräuter, Mais und Gerste und schon spät im Herbst noch süße Schlehen wie sonst nirgends. Die Erde macht keinen Unterschied. Mit dem Wasser ist es eine andere Sache. Im Sommer kommt kein Regen. Also hat man von dort an, wo sich aus Bächen und Stürzen des Gebirges in der Ebene der Tschu zu einem Strom vereint, seinen Lauf begradigt und auf einen betonierten Damm gelegt. Von allen Seiten wird ihm Wasser abgezwackt. Was nach dem Aderlass, den Abflüssen und Kanälen zu Fabriken, Feldern und hinein in die Dörfer von ihm übrig ist, versickert dreißig Kilometer tief Richtung Westen in der Wüste. Dort stauen sich, wie ins Regal gestellt, in mageren Flussarmen unzählbar die Fische. Man muss sie als ob* nur noch aussuchen.
Es ist ein Jahr her, fast schon im Herbst, und Krocha war noch nicht neun Jahre alt, da nahm sein Opa ihn zum Fischen mit hinaus, in die Wüste. Auch Onkel Hein war dabei. Sowie es dunkel wurde, ging es los. Zwei oder wenigstens zwei Stunden, kam es Krocha vor, brummte der grüne Gazik** zuerst von der asphaltierten Straße runter auf Schotter, dort bestimmt eine halbe Stunde, und dann noch viele Kilometer nur über plattgedrückten Sand. Jedes Mal, wenn der Wagen über ein Schlagloch oder ein Hügelchen hopste, schlug Krocha mit dem Hintern auf dem Holzbalken auf. Opa hatte den Balken über die beiden Dreikante ganz hinten auf die Ladefläche gelegt, aber ein Kissen vergessen. Ob Krocha seine Beine ausstreckte oder sich auf dem Balken lang machte, es half nichts. Vorne, neben Onkel Hein, lagen leere Jutesäcke. Aus ihnen hätte Krocha sich ein Polster machen können, doch er war zu aufgeregt, um an Bequemlichkeit zu denken. Zu murren fiel ihm sowieso nicht ein, und obwohl er nicht viel sah, kam auch nicht in Frage, dass er die Augen schloss. Unterm Planendach saß er wie in einer Höhle. Draußen leuchtete die Wüste. Die niedrigen Kronen vom Saxaul*** sahen aus wie zerzauste Haare von versteinerten Opas beim Baden in einem See aus weißer Tünche. Wenn Krocha sich umdrehte und durch die staubige Scheibe auf Opas Kopf sah, konnte er sich gut vorstellen, dass ihm ein Saxaul wuchs, auch aus den Ohren zwei. Onkel Hein trug wie gewöhnlich seine Schildmütze, da wuchs, wenn überhaupt, nur was im Verborgenen.
Zwischen Hügeln und Senken erschien immer aufs Neue der Fluss. Bald wurde er schmal und tiefer, dann wieder flach und breit, verschwand sogar ganz, tauchte erneut auf und ergab sich zuletzt in seichten Tümpeln dem Sand. Dort, endlich, hielt der Gazik an. Nicht an einer besonderen Biegung des Wegs, an einem Stein oder einem Hügel – gerade, als es an der Zeit war, machte Onkel Hein den Motor aus. Weit genug, dass niemand sie sah und niemand folgte, und nah genug, um noch vor Tagesanbruch wieder zuhause zu sein.
Nach allen Seiten nur Wüste und Wüste. Die Männer sprachen nicht, auch Krocha blieb ganz still. Er war noch gar nicht am Wasser und sah schon die prächtigen Fische. Ein wunderbares Meer aus silbernen Locken – nah, als könne man sie einfach mit der Hand herausziehen.
Sie hatten ein Netz aus Seilen dabei, anderthalb auf zwei Meter, zu beiden Seiten auf einen Stock gespannt, und zogen es dort, wo das Wasser ein bisschen tiefer war, senkrecht gegen die Strömung. Hecht kam herauf, auch Tschebak* und Jas**. Die Fische haben sie gleich dort aufgeschlitzt, ausgeweidet und von allen Seiten mit Salz eingerieben. Zwei Säcke mit zwanzig Kilo kamen schnell zusammen.
Als Krocha genug vom Einsalzen hatte, ging er ein Stück weiter ab und warf seine Angel ins Wasser. Was für eine Angel war das – nur ein Hanfstiel, auf anderthalb Meter gekürzt und daran drei Meter kräftiger Faden als Angelschnur. Den Haken hatte er von Onkel Hein. Es dauerte auch nicht lange, da biss was an. Das Mondlicht kräuselte sich auf der schwarzen Oberfläche, zuerst nur wenig, dann wilder. Der Fisch wehrte sich – musste ein guter Brocken sein. Als die Männer merkten, wie Krocha an der Rute riss, kamen sie dazu, flüsterten kluge Sachen, einer klüger als der andere, auch im Übermut vor all der Fülle. Onkel Hein legte ihm eine Hand auf die Schulter. Krocha zog und zerrte nach allen Seiten, ging ein paar Schritte rückwärts, gab noch einmal nach, zog dann mit ganzer Kraft, bis das Wasser einen Riss auftat und ein wahres Ungeheuer ausspuckte. Der Fisch schlug noch mit der Schwanzflosse aufs Wasser, das gab einen Knall wie von einem Flintenschuss. Vielleicht war es nur die Stille der Wüste, die den Knall so laut erscheinen ließ, die Männer sahen sich dennoch, erschrocken fast, nach allen Seiten um. Einmal aus dem Wasser und in der Luft, schoss der Hecht auf Krocha zu, wie gezielt, genau auf sein Gesicht. Krocha duckte sich, wich aus, hopste zur Seite, prallte gegen Onkel Hein. Es ging so schnell, der Hecht erwischte Krocha am Kinn und riss eine Wunde. Ein Faden Blut floss Krocha den Hals herunter. Er beugte sich vor, der Faden tropfte bläuliche Punkte in den weißen Sand. Opa gab ihm ein Taschentuch und Krocha presste es gegen die Wunde. Der Biss war nicht sehr tief und hinterließ doch eine Narbe.
Zuletzt hatten sie fünf Säcke mit je zwanzig Kilo gefüllt.
»Und doch ist es ein gutes Land, ein reiches Land«, murmelte Onkel Hein, als er das Netz zusammenlegte.
Sie verstauten die Säcke auf der Ladefläche. Diesmal dachte Krocha an seine Knochen. Aus den übrigen Säcken baute er sich ein Nest neben die Fische. Dann ging es wieder los.
Wo es ging, fuhr Opa ohne Licht. Onkel Hein schaute immer wieder aufmerksam nach allen Seiten, ob nicht irgendwo die Miliz auftauchte. Krocha war sicher, er könne auch im Liegen wach bleiben, dann dauerte es keine fünf Minuten, bis er eingeschlafen war.
Zu dieser Jahreszeit wird gut kontrolliert. Dass nur niemand was von der Fülle nimmt, von den Feldern oder von der Plantage oder sonst irgendwas. Wenn die Miliz einen erwischt, muss man im besten Fall schmieren. Es kann auch anders kommen. Bei Dimas Vater haben sie vor ein paar Jahren Gerste im Kofferraum gefunden. Sie fragten woher, aber Dimas Vater verriet nichts. Wozu auch? Jeder weiß, dass man übrige Gerste nur bei den Tschetschenen kriegt, und dort fragt die Miliz nicht gern. Als Dimas Vater, mit Gerste im Kofferraum, den Bobik* der Miliz im Rückspiegel auftauchen sah, blieb ihm nichts, als sich zu stellen. Bei ihm im Auto saßen noch zwei andere, »Kollegen«, hat Dima später erzählt, aber die konnten rechtzeitig abhauen. Das ist zum Glück gelungen. Wenn die Miliz auch sie erwischt hätte, wäre das schon organisierte Kriminalität gewesen. Dima sagte das wie ein Advokat, wenigstens klang er sehr gescheit und Krocha war beeindruckt, auch wenn er es nicht zeigte.
Von der Verfolgung hat Dima ihm alles ganz genau erzählt. Sein Vater in der Nacht: Licht ausgemacht und dann Gas gegeben. Die Miliz hinterher, er die Straße runter, hinter einer Kurve noch ein Stück geradeaus, dann scharf abgebogen, immer noch ohne Licht in einen Feldweg rein und unter ein paar Bäume. Der Mond schien ja hell, also ganz in den Schatten, dort Motor aus und leise sein, ganz still und warten.
Als Dima so erzählte, wurde seine Stimme auch leise, bis er nur noch flüsterte: »Die zwei anderen Männer, ihre Sachen unterm Arm, sind aus dem Auto gesprungen, geduckt und schnell schnell zu Fuß durch die Bäume fort.« Bis die Miliz Dimas Vater gefunden hatte, der wartete brav, mit einer Zigarette im Mund – »so«, zeigte Dima, kniff ein Auge und den Mundwinkel darunter zusammen, die Hände auf ein unsichtbares Lenkrad gelegt –, waren die anderen beiden weg. Als hätte die Nacht sie verschluckt. Dann sprach Dima wieder normal.
Sein Vater blieb ein Jahr im Gefängnis, aber ihnen, also Dima, seiner Mama, seiner Oma, seiner Schwester und seinem Bruder, mangelte es in dieser Zeit an nichts und auch das Schwein bekam seine Gerste. Dafür wurde gesorgt.
Dimas Geschichte klang schon übertrieben, aber Krocha glaubt ihm. Er hat die Tätowierung auf dem Oberarm von Dimas Vater mit eigenen Augen gesehen. Dima sagt, sein Papa ist in jenem Jahr im Gefängnis ein bisschen oder wenigstens kurz verrückt geworden, denn später konnte er sich gar nicht mehr erinnern, wie dieses Tattoo überhaupt zustande gekommen war. Ein Würfel, von dem man drei Seiten sieht und auf jeder Seite drei Augen. Was soll das auch bedeuten? Was soll's. Dima ist stolz. Wie auch nicht. Krocha wär's auch.
So oder so. Der Miliz begegnet man besser nicht. Doch von den Fischen die Finger lassen, das geht nicht. Von den Zuckerrüben vielleicht, aber nicht von den Fischen, vom Mais auch nicht und von den Äpfeln auf der Plantage schon gar nicht. So ein Aport, das ist was. Nicht jeder wiegt zwei Kilo, auch nicht jeder fünfte, aber solche gab es schon. Von so einem Apfel wird man satt, durstig bleibt man auch nicht. Der Saft läuft übers Kinn, die Hände und Arme runter und trocknet auf der Haut, vermengt mit rotem Staub, zu braunen Krusten. Sein festes Fleisch leuchtet gelb, beinahe weiß und bricht grob bei jedem Biss in großen Stücken. Auf seiner Schale, dem hellgrünen Grund, weiß gescheckt wie von flüssigem Zucker, brennt die Sonne ihre Strahlen in roten Striemen ein. Wenn man den Aport auch nur berührt, duften schon die Hände. Und erst der Geschmack – man kann süchtig werden! Krocha hat in den vergangenen Wochen zu viele Äpfel gegessen, das steht fest.
Wenn es, wie dieses Jahr, viel zu viele Äpfel gibt, wird jeder, der nichts Besseres zu tun hat, zur Plantage geschickt. Dann finden sich Baubrigaden, Elektriker, Krankenschwestern, Lehrer, Studenten und Schüler ein. Sie klettern in den Ästen herum und stehen auf Bockleitern. Eine Kompanie von schmerzenden Rücken. Die Sonne steht tief und blendet die Augen. Bald werden die Hände steif. Gegen das Licht gleichen die Umrisse der Pflücker komischen, riesigen Vögeln, die mit krummen Klauen goldene Kugeln von den Bäumen holen. Hier hat der Aport seinen einzigen Makel: Einfach vom Baum schütteln kann man ihn nicht. Eine kleine Schramme bloß, dann fault er schon. Ist er einmal reif vom Baum gefallen, bleibt er am besten gleich da liegen. Da wird nichts mehr aus ihm, außer man isst ihn gleich oder kocht am nächsten Tag Marmelade oder setzt einen Calvados an.
Auch beim Transport muss man gut aufpassen. Jeder Apfel wird einzeln verpackt. Das machen für gewöhnlich jene Omas, die zu alt zum Pflücken sind. Mit ihren bunten Kopftüchern stehen sie, wie Perlen zur Kette gereiht, an langen Tischen und wickeln die Äpfel – das geht so schnell, ist kaum zu verstehen – in lilafarbenes Papier, dick wie Karton und legen sie vorsichtig, als wären es rohe Eier, in flache Kisten aus Holz. Wenn die Kisten endlich auf Paletten geschichtet sind, geht es im großen Transporter durch die Sperre, dreißig Kilometer bis zum nächsten Bahnhof und dort in Waggons umgepackt auf die Reise durchs gelbe, verzottelte Nirgendwo. Bis nach Moskau und noch weiter, auch ins Ausland wird der Aport verschickt.
Dort, wo sie mit dem Pflücken nicht nachkommen, wo die Äpfel sich zu hoch und zu gut hinter Blättern verstecken und zum Schluss von selbst herunterfallen, legt sich ein gärender, sumpfiger Teppich über die Wiesen. Ende Herbst kann er drei Handbreit hoch sein. Von ihm kommt so ein süßlich faules Bukett, das weht der Wind aus den Bergen nach allen Seiten. Wer einmal hier, im Grenzgebiet zwischen Kirgisien und Kasachstan, unter Bergen und Äpfeln lebte, der kennt diesen Duft und vergisst ihn nicht. Er bleibt als eine Ahnung im Gedächtnis, die alte Leute Früher nennen und währt als jene Erinnerung, die in der Fremde Heimat heißt.
Fremde und Heimat, das sind nicht Krochas Sachen. In Mihailowka lebt er wie ein Fisch im Wasser, kennt die Häuser und die Straßen wie seine fünf Finger sowie in jede Richtung die nächste große Stadt, wenigstens dem Namen nach. Das reicht. Im Dorf leben wohl zweitausend Menschen. Viele Russen, Kirgisen, Tschetschenen, Inguschen, Kasachen – klar, Griechen, Vietnamesen und nicht wenige Deutsche. Wer gescheit ist und anzupacken versteht, der hat neben dem Gemüsegarten noch einen Stall. Schweine sind gut, eine Kuh noch das Beste. Eine Kuh deckt die Armut zu, sagt man. Hühner hat jeder. Am Tag laufen sie einfach so auf der Straße herum. Wer mit dem Auto fährt, weiß das und macht langsam. Nur wenn die Hühner zu nah an Baba Schuras Garten kommen, wird es gefährlich. Die Latten um ihr Grundstück stehen schief und sind zur Hälfte abgebrochen. Mit Einpflanzen und Jäten kommt sie schon lange nicht mehr nach. Unkraut und alles mögliche Gestrüpp wächst in ihrem Garten, wächst hoch und wild durcheinander. Etliche Hunde haben sich dort zusammengerottet. Hässliche Mischlinge mit räudigem Fell.
Baba Schura hat einen Fehler gemacht, hat die Hunde nicht fortgejagt zur rechten Zeit und sich an sie gewöhnt. Ab und zu wirft sie ein altes Brot ins Gebüsch, damit die Hunde nicht zu viele Hühner reißen. Sie können beißen, aber meistens knurren sie nur böse, egal, wer vorübergeht. Nur – wenn die Sonne untergeht, dann werden sie richtig verrückt. Dann schlagen sie Alarm, als sei es jeden Abend aufs Neue das erste Mal in ihrem Hundeleben, dass es dunkel wird. Ihr Gekläffe steckt die Hofhunde der Nachbarschaft an und schon geht es los – von einem Ende des Dorfes zum anderen –, ein einziges Geheul und Gejaule und die Ketten der Hofhunde rasseln. Kein Wunder, dass sich gleich jemand mit einer Flinte findet, wenn das Rudel einmal einen armen Köter aus dem Gestrüpp verjagt. Der Ausgestoßene wird einfach abgeknallt.
Auf der Hauptstraße kommen zwei, wohl auch drei Autos ohne Probleme aneinander vorbei. Nach beiden Seiten zweigen Wege ab, wie beim Rückgrat eines Fisches. Einige Querstraßen münden wiederum in einer Kreuzung, von diesen Sackgassen geht es über Gras, manchmal Schotter, zwischen den Gärten, auf die Hauptstraße zurück oder in die Steppe. Der Hauptkanal fließt abgesenkt entlang der Hauptstraße und führt, ähnlich dem Lauf der Querstraßen, sein Wasser in schmalen Kanälen nach allen Seiten ab. Am Ende hat so fast jedes Grundstück einen Zufluss. Wo es abschüssig geht, stehen Pappeln und Laubbäume. An anderer Stelle reichen Sträucher und Büsche einem Erwachsenen gerade bis zum Bauch. Vieles wächst wild, ohne erkennbare Ordnung. Mit der Verteilung der Grundstücke ist es das Gleiche. Wie angespültes Treibgut sammeln sich Häuser und Höfe am Weg entlang. Dabei drängt nichts ans andere. Eher das Gegenteil. Einsame Bäume, Banya*, Stall, Klo- und Wohnhaus auf den Grundstücken, auch die asphaltierte Hauptstraße, von tiefen Rissen schon zu Inseln aus Teer zersetzt, driften als ob auseinander. Mag sein, dass dieser Eindruck durch die schneebedeckten Riesen am Horizont noch tiefer wird. Trotz ihrer Weite muss die Steppe dort doch branden. Beständig erinnert solcher Anblick an die eigene Nichtigkeit. Manchen erschreckt sie, dem anderen ist sie gerade recht.
Die Hunde kümmert keine Nichtigkeit, sie stört nur das Dunkel. Aber es hilft nichts; früher oder später werden sie des Bellens müde. Der Himmel, die Berge in der Ferne und auch die Nacht lassen sich nicht verscheuchen. Über Lattenzäune und Lehmwälle, über die Dächer der Häuser, die Wände hinab, spinnen nächtliche Schatten ihre Netze und treiben Insekten, Schwärme von Fliegen ins Licht der Laternen, in geöffnete Fenster und Türen hinein. Dann beginnt das Konzert der Grillen, und Krocha lauscht.
Nach dem Mittagessen hat er sich rumgetrieben, ist am Kanal gewesen mit den Jungs und bei den kaputten Traktoren. Sie haben Mäuse gefangen und von der Zeit ganz vergessen*. Es wollte schon dunkel werden, als Dimas Mama kam. Sie schickte alle nach Hause. Dima bettelte zwar und Krocha stand mit großen Augen daneben, doch im Stillen war er dankbar. Wenn sie nicht gekommen wäre, hätte er am Ende nicht mehr an den Esel gedacht. Er ging nicht heim, machte sich stattdessen auf den Weg in die entgegengesetzte Richtung. Als er die Straße überquerte, an der auch das Kino steht, sah er dort ein paar Männer sich versammeln. Neben ihren Spielkarten hatten sie sicher ein, zwei Flaschen dabei. So eine leere Flasche, einen Rubel gäbe die, das wäre gutes Geld! Krocha musste ihnen unbedingt hinterher. Den Esel würde er später noch kriegen, wo sollte der auch hin? Die Männer gingen nur ein Stück die Straße entlang, dann zum Kanal und dort in der Böschung auf eine Lichtung. Krocha blieb in sicherer Entfernung. Wer hätte sagen können, wie viele Flaschen dort schon lagen? Krocha rechnete: Für den Esel zwei Rubel, dazu das Pfand für die Flaschen, wenn er auch nur zwei fände: vier Rubel. Für sechs Rubel gäbe es schon ein Kilo Bonbons! Die Zigaretten, fünf Glühwürmchen, immer rauf und wieder runter, glommen im Dunkeln. Der Wodka war reihum bestimmt bereits zur Hälfte leer. Die Männer schwatzten und lachten, die Karten schnalzten auf einen flachen Stein. Viel sehen konnte Krocha nicht, das musste auch nicht sein. Er wusste Bescheid. Krocha fühlte die Rubel schon in seiner Hand, sah ihnen zarte Flügel wachsen, Flügel aus Silberpapier. Wie er die Schwälbchen auswickeln würde, hochwerfen und aus der Luft schnappen. Die Schokobären kämen ihm gleich von selbst in den Mund getapst. Er müsste nur den Kopf auf den Tisch legen, die Bonbons neben sich. Er träumte von roten Krebshälsen, dem Klickern ihrer Zuckerpanzer gegen seine Zähne, vom Roten Mohn, Burevestnik*, von Romashka** und Aljonka, und wie herrlich die Bonbons nicht alle heißen, die er für sechs Rubel bekäme. Die Vorfreude trieb ihn die Böschung wieder hinauf, zurück auf seinen Weg in Richtung jener Stelle, die Onkel Hein dem Esel beigebracht hatte.
Vom Dorf sind es auf der asphaltierten Straße vielleicht fünf Kilometer zur Plantage. Wer sich zu Fuß, mit dem Rad oder auf einem Esel auf den Weg macht, schlägt für gewöhnlich einen der parallel verlaufenden Pfade ein, die durch die Steppe führen. Da gibt es im Sommer noch wilde Brombeeren zu pflücken, ein ganzes Stück ist man im Schatten der Pappeln vor der Sonne geschützt. Krocha kennt sich gut aus auf diesen Wegen, wo man sich zur Not verstecken oder schnell abhauen kann. Auf einer niedrigen Mauer, halb zerfallen, von der kein Mensch weiß, wozu sie mal gehörte, lässt es sich gut nach allen Seiten Ausschau halten. Der Esel muss bald ganz in der Nähe aus den Büschen treten. So haben sie es einstudiert, ein paar Mal ist es schon gelungen.
An seiner Mauer angekommen, springt Krocha hoch und macht es sich, so gut es geht, bequem. Nichts zu hören, nichts zu sehen. Der Esel hat wohl selbst getrödelt. Krocha zählt nochmal den Gewinn, den er erwarten kann. Danach wägt er ab, in welchem Verhältnis er von den verschiedenen Bonbons kaufen soll. Fünf Minuten ist er damit gut beschäftigt, dann wird er unruhig. In der Ferne sieht er noch die Reihen der Bäume auf Almaly, im flachen Land davor bewegt sich nichts. Er reibt sich den getrockneten Schweiß von der Stirn und blickt zurück zum Dorf. Nach und nach gehen dort die Lichter an. Krocha springt auf und geht ein paar Schritte herum, prüft seine Umgebung wieder nach allen Seiten, ob sich was bewegt. Nichts. Krocha lehnt an seiner Mauer, kratzt sich den Schädel. Vor drei Tagen hat der Vater ihn kurz geschoren. Ihm ist, als spüre er die Haare wachsen. Als er bei Oma in der Küche saß und der Rasierapparat über seinen Kopf mähte, seine Haare wie Federn nach allen Seiten spickten, hielt er sich an der Tischkante fest. Da lachten wieder alle. Wegen dieser dummen Geschichte. Damals, als Krocha noch im Bauch seiner Mama war und es schien, als wolle er zu früh auf die Welt kommen, hatte sie ihre Hand auf das Hügelchen gelegt und ihm ständig zugeflüstert: »Halt dich nur gut fest!« Also hielt Krocha sich gut fest, blieb ganz bis zuletzt und noch ein bisschen länger, so dass alle schon lachten und zum Bauch sagten: »Lass los, lass schon los!« Das sei der Grund, warum er sich bis heute überall festhält, sagen sie und erzählen die Geschichte jedes Mal.
Es ist eine gute Geschichte, eine, die man sich erzählen kann, aber das versteht Krocha noch nicht. Ihn ärgert sie. Das Festhalten ist nur eine dumme Angewohnheit, wie fast jeder irgendeine dumme Angewohnheit hat. Der eine kaut Nägel oder lutscht den Daumen und Krocha hält sich eben fest. Wenn er nicht aufpasst, passiert es immer wieder, dass seine Hand nach einem Halt sucht, dass er den Stuhl umklammert, auf dem er sitzt oder seine Fäuste sich im Schlaf ins Laken krallen. Aber er passt auf und es wird immer besser, er wird ja auch bald zehn! Doch solang es keiner sieht, ist es egal. Während Krocha sich mit einer Hand den Schädel kratzt, sucht die andere nach einem Vorsprung in der Mauer, als könne er aus dem Stehen irgendwo herunterfallen.
Aus den Sträuchern am Wegesrand vernimmt er endlich ein Geräusch. Dass es nicht der Esel ist, hört Krocha gleich. Er weiß, wie es klingt, wenn eine Schlange durchs trockene Gras kriecht, auf der Suche nach einem warmen Plätzchen. Es dauert nicht lang, da hat Krocha die Bewegung zwischen ein paar Halmen ausgemacht. Er muss gar nicht hinsehen, blind zieht er Nadel und Faden aus dem Bund seiner Hose, rutscht langsam von seinem Platz, schleicht der Schlange mit gebeugten Knien nach, schleicht sich an, beugt sich tiefer und schnappt, sobald er nah genug herangekommen ist, nach ihrem Schwanz. Zwei, drei Handgriffe, dann hat er das zappelnde Tier am Kopf gepackt. Die Schlange windet sich, schlägt aus, schlingt ihren Leib seinen Arm hinauf. Er widersteht ihrer Kraft, darauf kommt es an, drückt das Maul noch fester, drückt ihren harten Kopf fest auf sein Knie. Er setzt die Nadel seitlich an und näht ringsum, nur ein paar Stiche, der Schlange das Maul zu. Nur nah genug mit dem Gesicht, dass er gut sehen kann. Sie ist nicht giftig, aber beißen kann sie schon. Mit zugenähtem Maul ist sie ungefährlich, ein gutes Spielzeug. Krocha hat immer Nadel und Faden dabei. Onkel Hein hat ihm das Schlangennähen beigebracht. Mama hat es gleich darauf verboten. Aber es macht Spaß und geht jedes Mal besser. Krocha steckt die zugenähte Schlange, jetzt ist sie ganz ruhig, in seine Hosentasche und fährt mit Fingerspitzen über die glatte, kühle Haut.
Seit vier Wochen sind die Plantagenäpfel reif. Die Pflücker kommen der Fülle nicht nach. Auch Krocha musste schon. Zum Ende der Ferien wurden alle Schüler zur Plantage geschickt. Sie pflückten die Äpfel und sammelten sie in großen Eimern aus Metall. Essen durften sie auch, aber nur solche vom Boden mit Dellen und die mit Kerben von Vogelschnäbeln. Ihnen wurde gesagt: Mehr, als in eine Hosentasche passen, darf man nicht mitnehmen. Also aßen sie gleich dort, beim Pflücken, in den Pausen unter Bäumen. Die Lehrerin machte es vor. Sie hob einen Apfel vom Boden auf, wischte Erde und Laubreste ab, legte den Daumen auf ein braunes, faulendes Auge und drückte den weichen Brei heraus, wischte noch einmal und biss hinein.
Krocha hat für dieses Jahr genug Äpfel gegessen. Er selbst braucht keine, aber auf dem Markt gibt es im Winter zwei Rubel fürs Kilo. Der Esel ist mit vierzig Kilo beladen – grob geschätzt. Onkel Hein hat zwei Rubel zugesagt, für jedes Mal, wenn Krocha den Esel auf der Straße abfängt und nach Hause bringt. Doch heute wird es nichts. Vielleicht ist der Esel von selbst weitergelaufen, vielleicht hat er sich verirrt. Krocha kann nicht mehr warten. Mama wird sowieso schon schimpfen. Er springt von seiner Mauer und lauscht ein letztes Mal. Dann pfeift er kurz und ruft, nur nicht zu laut, in die Dunkelheit: »Anton! Wo bist du?« Er ruft auf Deutsch, denn Anton ist ein deutscher Esel. Onkel Hein hat nur auf Deutsch zu ihm gesprochen, seit er ihn vor zwei Monaten von der Steppe genommen und in den Stall gebracht hat.
»Wenn sie ihn mit einmal* werden vernehmen wollen, werden sie ihn nicht verstehen«, hat Onkel Hein gesagt, gelacht und Krocha auf den Kopf geklopft. Der Esel gewöhnte sich schnell an den Stall, an die Äpfel, den Weg und die Sprache, obwohl er sein ganzes Leben nur Gras, Müll und russische Zeitung zu fressen bekommen hat.
Krocha zögert noch. Ein letzter Blick ins Dunkel, dann macht er sich auf seinen Weg zurück ins Dorf.
Am Tag schon und noch mehr im Dunkeln gleichen sich die Häuser, das, was man von ihnen hinter den Zäunen sieht. Gerade noch ein Streifen weiß getünchte Mauer, darauf ein Satteldach aus Wellblech. Die Giebel senkrecht mit Brettern beschlagen und blau oder hellgrün gestrichen. Im Garten gibt es ein Klohäuschen und eine Außendusche. Im Sommer kann man sich gut unter freiem Himmel waschen. Die Dusche ist von drei Seiten mit weißen Planen abgehängt. Das Wasser kommt aus einem Trichter auf einem hohen Gestell. Morgens gießt man ein paar Eimer Wasser in den Trichter und abends dreht man ihn auf. Dann kommt, je nachdem, ein paar Minuten lang, herrlich warmes Wasser runter. Für den Winter haben schon viele eine Banya, vielleicht zwei auf zwei Meter, mit einem Abfluss in die Sickergrube am Ende des Grundstücks. Auch das Abwasser aus der Küche und aus dem Klo im Haus, wer schon eins drin hat, fließt dorthin.
Wenn es kein gutes Baumaterial zu kaufen gibt, begnügt man sich mit irgendwelchem Wellblech, brennt Ziegel aus Lehm und Stroh: Saman*, das ist noch das Beste. Einer haut bei alten Schienen die Planken ab, der andere verwendet Schlacke aus der Kohleheizung. Das ist vielleicht nicht so gesund; in der Schlacke kann auch Uran sein, aber was soll's. Im Garten wachsen Wassermelonen, Gurken, Zwiebel, Petersilie und Dill. Im Sommer werden die Fenster mit dunklem Stoff verhangen oder mit Zeitung beklebt, damit die Stube nicht zu sehr aufheizt. Auch wenn die Tür immer geschlossen ist, kommen trotzdem Mücken und Fliegen herein. Sie steigen träge auf, wenn man nach einem Teller greift oder einen Stuhl beiseiteschieben will.
Krocha behält die Fingerspitzen an der Schlangenhaut in seiner Tasche und hält Ausschau, ob kein Hund auftaucht. Überall brennt Licht, nur sein Zuhause liegt ganz im Dunkeln, obwohl das Tor weit offensteht. Kukla knurrt in ihrer Hütte, beruhigt sich aber, als sie ihn erkennt. Langsam rasselt sie an der Kette heran und stößt mit ihrer Schnauze an sein Bein. Krocha schiebt sie fort; die Hündin stolpert zur Seite. Als auf einmal eine Stimme zu vernehmen ist, zucken sie beide, und auch die Schlange in der Hosentasche regt sich. Oben, am Giebel des Hauses, in der Tür zum Dachboden, sitzt eine dunkle Gestalt. Es dauert einen Moment, bis Krocha seine Mama erkennt.
»Wo warst du?«, fragt sie.
Wohl weil sie flüstert, flüstert Krocha auch: »Bei Dimka.«
»Lüg nicht!«
Krocha zögert. Sie darf vom Esel nichts wissen und von den Flaschen auch nicht und von der Schlange ganz sicher nicht.
»Warst du bei Oma?«, fragt Mama.
Dass er nicht dort war, findet sie heraus, also tun, als habe er die Frage nicht gehört: »Ich habe Hunger!« Das freut sie für gewöhnlich. Diesmal nicht.
»Selbst schuld, wenn du nicht zur rechten Zeit nach Hause kommst! Kannst bei Oma essen!« Als sei das nicht komisch genug, flüstert sie noch: »Mama ist weg. Sag ihr das!«
Krocha versteht nichts. Manchmal ist sie so. Wenn er seine Mama nicht versteht, ist es besser, ihr einfach zu gehorchen. Er geht zurück durchs Tor, langsam, falls sie es sich überlegt. Doch sie ruft nicht. Also die Straße runter, bis sie ihn sicher nicht mehr sieht. Krocha sucht im gelben Gras am Wegesrand nach einem Stein. Nimmt schon mal die Schlange aus der Hosentasche; sie windet sich mit steifem Leib. Er findet einen Stein, so groß wie seine Faust. Krocha hockt sich an den Straßenrand, drückt mit einer Hand den zugenähten Kopf der Schlange auf den Boden, hebt mit der anderen den Stein. Er haut der Schlange kräftig auf den Kopf, wartet kurz, dann noch einmal, und sie ist tot.
*Die mit * gekennzeichneten Begriffe oder Namen werden im Glossar erklärt.
ZWEI FISCHE AN LAND
HEDI TANZT NICHT. Natürlich will sie, wie auch nicht? Kaum vernimmt man einen Takt, schon schnellen die Arme hoch – wie die Speichen eines Regenschirms, sobald jemand den Knopf drückt. Die Finger schnippen, ein seltsamer Gleichschritt fährt in die Beine. Wie alt muss man sein, damit das nicht mehr geschieht? Auf der Tanzfläche haben die Arme und Beine, Köpfe, Hände und sogar die Knie von hundert jungen Leuten nur auf den Befehl gewartet. Klar, der eine führt ihn korrekt aus, der andere dann doch gegen den Takt, aber alle machen mit. Hedi will so sehr – sie muss sich anstrengen, um nicht aufzuspringen. Wahrscheinlich muss man taub sein.
Auf der Bühne stehen drei junge Männer. Einer am Schlagzeug, einer an der Gitarre und einer singt. Über ihren Köpfen und rings um den ganzen Platz hängen, durch ein Kabel verbunden, elektrische Laternen. Vor der Bühne hat man zu beiden Seiten je drei Reihen Tische und Bänke aufgestellt. In der Mitte ist genug Platz zum Tanzen. Fast alle Tische sind besetzt. Wahrscheinlich sind sogar mehr als hundert Leute da. Die meisten hatten es nicht weit, sie wohnen in der Stadt. Andere, wie Hedi und Ira, brachte aus verschiedenen Richtungen ein Bus.
Der Platz und die Bühne und alle Lichter, das sieht schön aus. Ira hat recht. Hier gibt es Geld für solche Sachen. Orlowka ist eine »Siedlung städtischen Typs mit besonderer Versorgungslage«*. In der Fabrik, zwei Kilometer außerhalb, wird mit Uran gearbeitet. Deswegen sind die Straßen gut, es gibt einen Bahnhof für die Busse, schöne Blumenbeete und Brunnen im Park mit hübschen Wasserspielen. Es gibt auch Lichterketten und außerdem keine Landkarte, auf der die Stadt verzeichnet ist. Keine normale Karte wenigstens. Zur Sicherheit, denn wie alle Stützpunkte des Militärs müssen auch Orte, die irgendwas mit Rüstungs- und Nuklearsachen zu tun haben, unbedingt geheim bleiben. Es ist Abend, die Uhr geht schon auf neun, der Himmel neigt vom Dunkelblau ins Schwarze.





























