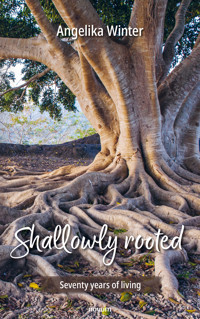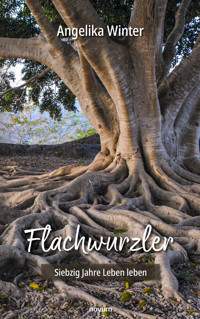
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: novum Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Entscheidungen trifft sie selbst, doch die Autorin hatte keine Wahl - ein Leben in der DDR und nach 42 Jahren alles anders. Ihr ureigener Lebensweg mit ständiger Infragestellung und Befragung des Inneren und äußerem Herumjagen von Ort zu Ort, von Vorhaben zu neuen Vorhaben, immer machen, immer tun – so lebt sie. Das Buch erzählt die Geschichte ihrer Großeltern seit Jahrhundertbeginn, die dreißiger und vierziger Jahre der Familie ihrer Mutter, die Geschichten um ihren Eintritt ins Leben sowie Kindheit, Jugend, Erwachsen-Werden und -Sein mit Kämpfen und Durchhaltevermögen. Sehr spät lernt sie ihren leiblichen Vater kennen und lässt sich von ihm seine Geschichte in beachtlicher Detailfülle aufschreiben, das Leben eines Heranwachsenden in Sachsen vor, während und nach dem Zweiten Weltkrieg.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 778
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie.
Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Funk und Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger, elektronische Datenträger und auszugsweisen Nachdruck, sind vorbehalten.
© 2024 novum publishing
ISBN Printausgabe:978-3-99146-567-6
ISBN e-book:978-3-99146-568-3
Lektorat: Volker Wieckhorst
Umschlagfoto: Siambizkit | Dreamstime.com
Umschlaggestaltung, Layout & Satz: novum publishing gmbh
Innenabbildungen: Angelika Winter
www.novumverlag.com
Widmung
Dieses Buch habe ich wegen mir und für mich geschrieben.
Schlaglichter
Mein eigenes Jahr für Jahr – auf der Weltbühne.Wie viele Zeilen werden in Geschichtsbüchern über die Jahre 1949 bis 1989 und einen kleinen Staat namens DDR stehen?Von heute zurück – als ich mich noch spürte.Wurzelarme Stammbäume.Sieben oder neun Leben hat die Katze.Die innere Stimme und ich.Opfer – Täter – Retter.Wie ich mich unsichtbar machte.Diejenigen, die gegen etwas sind, sind immer lauter als die vielen Sprachlosen.Einsicht in die Gegebenheiten.Vertrauen? Geschenkt, vergiss es!Der bunte Vorhang – Was nie jemand wissen wollte und manches auch nicht sollte, s. Peinlichkeiten!PrägestempelKultivierung der Einsamkeit – Wege zur Erstarrung.… und für den abgerissenen Fetzen Seele gibt es die Auster.Hätte ich je eine Wahl gehabt, ich wäre nicht auf die Welt gekommen.Nun fang doch endlich an! Vier Anläufe sind genug
In mir sitzt ein schwerer schwarzer Klumpen, der sich immer mehr zusammenzieht und immer mehr in sich hineinzieht. Er lähmt mich, endlich das Buch zu sortieren, er lähmt mich, mein Leben weiter zu ordnen und in Ordnern mit Fotos und Erinnerungspapieren einzusortieren. Es ist wie eine Spirale – schreib erst, wenn die Ordner fertig sind, nein, schreib, was du schon hast und arbeite nebenbei oder danach an den Ordnern … Es ist furchtbar. Ich nehme jede Ablenkung wahr und finde zig Ausflüchte, noch nicht anzufangen. Immer fange ich alles an, und irgendwann stoppe ich an einer Stelle – dann zieht es mich in den Sog der Faulheit. Es ist so viel, ich weiß gar nicht, ob ich der ganzen Sache Herr werden werde. Wollen ist das eine, Können das andere, doch Mögliche, jedoch dabei bleiben ein Kreuz. Ich zweifle und behindere mich selbst. Vorwand für Vorwand finde ich und tue nichts.
Mach endlich – Schritt für Schritt. Vielleicht hast du doch etwas zu sagen.
Wie lange will ich schon ein Buch, mein Buch schreiben? Jahrzehntelang. Ich habe immer wieder angefangen, einzelne Kapitel geschrieben, abgeheftet. Wenig systematisch, immer wenn ich glaubte, jetzt unbedingt schreiben zu müssen, schrieb ich, geriet ich in Fahrt, nahm mir die nächsten Schritte vor – und schon kam wieder etwas dazwischen.
Dieses Jahr soll es nun endgültig werden, denn ich vollende mein 70. Lebensjahr. In dieser Zeit hat sich allerhand Leben angesammelt, auch wenn ich es nicht immer als Leben angesehen habe. Ich weiß, dass ich ewig darauf gewartet habe, dass mir jemand sagt, wann das Leben anfängt. Ich war schon Anfang zwanzig, als mir allmählich dämmerte, dass es ja schon mein Leben ist. Irgendwie fühlte ich mich nicht lebenstüchtig, nicht lebensfähig und schon gar nicht in der Lage, mein Leben bewusst gestalten zu können. Ich habe eigentlich nicht gelebt, ich wurde gelebt. Auch wenn es diese Passivform nicht gibt und sie sowohl grammatischer als erst recht semantischer Unsinn ist, so sagt sie doch am besten aus, was Leben für mich bedeutete.
Und warum will ich unbedingt über mein Leben schreiben? Ist es denn so wichtig und interessant, dass es wert ist, beschrieben zu werden? Davon bin ich nun allerdings überzeugt, denn in jedem Leben spiegeln sich die Zeitenläufe wider, und ich bin in einer besonderen Zeit aufgewachsen und in einem besonderen Land, dessen Existenz eines Tages in nicht allzu ferner Zukunft in den Geschichtsbüchern immer weniger Zeilen einnehmen wird. Selbst jetzt, achtundzwanzig Jahre nach Aufgabe seiner Existenz, sind die Informationen darüber schon auf wenige Schlaglichter geschrumpft, aus denen keiner mehr ein farbiges Bild zusammensetzen kann. Irgendwie fühle ich mich als Zeitzeuge. Ich sollte jetzt mein Bild malen, mein Leben beschreiben, auch wenn es eines von Millionen ist, so hat es doch ganz persönliche Blickwinkel, das Einzelne im Gesamten, das Besondere im Allgemeinen. Hinzu kommt: Ich gehöre zu den leisen Millionen, für die dieses Land alles bedeutete, die ohne dieses Land nie zu dem geworden wären, was sie sind, die diesem Land alles zu verdanken haben, die es mochten und mitgestalten wollten, dass es für alle gut sei. Es gelang nicht. Was maßt sich auch ein Kind an, wissen zu wollen, was gut und richtig ist? Die Rufe der Schreihälse, die dagegen waren, werden definitiv in Erinnerung bleiben und das Bild verzerren. Freiheit – das höchste Gut der Menschen, wie wundervoll, wie herrlich, im Namen der Freiheit kann jedes Übel gerechtfertigt werden. Vergiss es, Freiheit ist so schwammig, so gar nicht fassbar, so interpretierbar wie Gut und Böse und Richtig und Falsch, alles Kategorien, von denen ich mich vor langer Zeit schon verabschiedet habe. Ich benutze diese Wörter nicht mehr, weil sie bedeutungslos sind und nur im Munde des Sprechers und im Auge des Betrachters etwas Bestimmtes sind, etwas Konkretes, doch nichts Absolutes. Halt, etwas vorsichtiger könnte ich vielleicht doch sein, denn es gibt sehr Weniges, was so charakterisiert werden könnte. Es kristallisiert sich möglicherweise noch heraus, typisch, allgemeingültig, abstrakt sind es für mich keine absoluten Werte. Ich bin ein abstrakter Denker, ein Skelettdenker, ich will sehen, was unter Haut, Fleisch, Muskeln, Organen der Bewegungsstimulator ist. Was bewirkt was? Wo ist die eigentliche Ursache für Änderungen? Ich denke in Ursache-Wirkung-Feldern, ein anderes Denkmodell steht mir nicht zur Verfügung, obwohl es durchaus so etwas geben soll. Also setze ich mein Erscheinen auf der Welt in die Zusammenhänge der Umgebung. Warum gibt es mich, was führte dazu? Wie war das Umfeld, in das ich hineingeboren wurde und in dem ich aufwuchs? Warum wurde ich so, wie ich geworden bin und nicht anders? Was hatte ich in mir, das diese und keine andere Richtung vorgab? Das ist ein weiterer Grund für mein Bedürfnis, mein Leben aufzuschreiben. Ich möchte mir gern selbst auf die Spur kommen. Ich weiß, wann und wo ich gravierende Fehler gemacht und damit Weichen gestellt habe, die mich in eine völlig andere als gewünschte – nicht etwa geplante oder gewollte – Richtung getrieben haben. Warum habe ich jene Entscheidungen getroffen? Welche Marionetten-Strippen haben an mir gezogen? Warum habe ich keinen Zugang zu mir gefunden? Warum ziehe ich mich in mich zurück? Nun gut, dass ist der zweite Grund, die ganze Seite der Psyche. Manchmal tritt meine innere Stimme in Aktion. Wann sprach sie mit mir, und was folgte daraus? Wann habe ich mit dem Kopf entschieden, wann aus dem Bauch heraus und wann überhaupt nicht?
Möchte ich meinen Kindern und Enkeln meine Lebenserfahrungen und Lebensweisheiten hinterlassen? Ich glaube kaum. Von mir ausgehend habe ich höchst selten gesprochen und erzählt. Am Anfang mehr, später immer weniger, dann habe ich nur noch Fragen beantwortet, meist ziemlich kurz, eher abstrakt. Und Fakten erzählt habe ich höchst selten. Ich fragte mich, ob sie es überhaupt wissen wollten, wie viel davon, ob es sie interessierte oder doch eher nicht, aber vor allem wollte ich keine Kommentare, kein Warum hören. Einen anderen Menschen verstehen zu können, scheint mir schier unmöglich, es sei denn, er verfügt über die Fähigkeit, sich in den anderen hineinversetzen zu können und zu wollen und sich selbst draußen zu lassen. Wer kann das schon.
Also erzähle ich lieber meine Geschichte und Geschichten aus meiner Sicht ohne Erwartung einer Gegenrede. Wen es interessiert, der liest es, wer zwischendurch aufhört, hört auf, ich möchte nichts darüber hören oder lesen. Ich möchte sie nur loswerden.
Aus einer Leserzuschrift entnahm ich folgenden Satz:
„Nein, das sind keine Kleinigkeiten. Sie sprechen mir aus der Seele. Man weiß von keinem Menschen weniger als von den eigenen Eltern oder Kindern.“
Wie oft habe ich mich schon entschlossen: „Jetzt fängst du endlich an, dein Buch zu schreiben!“ Wie viele Anfänge, erste Sätze mit „Aufhorchcharakter“, mit Durchschlagskraft, die das Ventil öffnen und die Gedanken, Erinnerungen, Reflektionen nur so fließen lassen, habe ich entworfen – doch nie habe ich den Stift in die Hand genommen und einfach losgeschrieben. Warum eigentlich nicht? Tausend Ausflüchte vor mir und als objektive Gründe vorgeschobene Vorwände. Andere Dinge waren immer wichtiger. Der Alltag mit seinen wiederkehrenden und sich wiederholenden Kleinigkeiten, der ewige Haushalt, dessen Funktionieren so wichtig ist für das Freiwerden des Kopfes, der jedoch unersättlich frisst, nämlich Zeit, Kraft, Energie, Lust, Freude und einen müden Körper und Geist zurücklässt, der nun wieder die Entschuldigung liefert für den Einschluss der Gedanken in ihrer Hirnschale und den angeblich notwendigen Reifeprozess. Dabei sind Gedanken immer reif, sobald sie sich spüren lassen als formulierte Sätze oder bewegliche Bilder oder ausgelöste Erregungen. Es ist faszinierend, den Urknall eines Gedankens verwundert zu bemerken. Mit einer Plötzlichkeit und Unmittelbarkeit materialisiert er sich im Geiste und lässt sich kaum jemals auf die Quantitätsteilchen und den rührenden, brodelnden Strudel der Bewegung des Ganzen zurückführen, der ihn sprunghaft in die Qualität der Fasslichkeit einer Idee verwandelt hat. Wie schwer lässt er sich festhalten, lässt man ihn gewähren. Er ist klar, schön, eindeutig da, lässt sich hübsche Satzgewänder schneidern, doch soll er sich aufs Papier zwingen lassen, ist er flüchtig, leer, banal, einfach weg.
Meine Buchanfänge? Meine „Durchreißersätze“? Kein einziger fällt mir mehr ein. Nachzugrübeln über Titel nimmt einen auch wahnsinnig in Anspruch, überhaupt scheint es am schwierigsten zu sein, einen Titel zu finden.
Nehme ich einen Namen, worauf unzählige Schreiber zurückgegriffen haben, da sie sich sicherlich mit dem Titel länger herumgeplagt haben als nachher mit dem Aufschreiben der Geschichte, so weiß der Leser sofort: Aha, wieder eine Lebensgeschichte von der Wiege bis zum Grabe, im schlimmsten Falle, doch zumindest mit irgendeiner langen oder kurzen Katastrophe, die die Welt – doch es ist nur die Welt des Menschleins – zum sekundenlangen Stillstand bringt und danach alles ganz anders wird und er gereift oder geläutert oder zerstört den Leser verlässt. Er ist unendlich, der Vorrat an Menschenleben, wovon jedes anders verlaufen ist – und wieder von vielen gleich in seiner Eintönigkeit und Wiederholbarkeit, der Vorrat an Namen, der natürlich eine Aussagekraft haben soll, klangvoll sein soll er auch, Aufmerksamkeit erregen muss er. Gehen die Leute an den Buchauslagen vorbei, fragen sie sich: Wer ist schon Erwin Moorbach/Silke Ehlers? Was geht mich Frieder Richter/Hanna Seebohm an? Trotzdem haben Namenstitel Zugkraft.
Jedenfalls habe ich mich zu keinem Namen entschließen können, denn irgendwie sollte er nicht verraten, ob sich ein Mann oder eine Frau dahinter verbirgt. Warum eigentlich nicht? Weil ich schon die Vorverurteilung höre: „Wieder so ein Weiberroman, entweder romantisch und von der großen Liebe träumend, unerfüllte Gefühlsduselei und tragische Liebe“, oder „eine Emanze hat das zwanghafte Bedürfnis, es der Welt aber mal richtig zu geben!“ Sind Männernamen als Buchtitel genauso häufig verwendet wie Frauennamen? D. h. wurden Männerleben genauso häufig beschrieben wie Frauenleben? Was macht den Unterschied aus? Darüber werde ich demnächst mal nachdenken. Diese Namensüberlegphase hatte ich mit Anfang zwanzig, denn da saß ich mit voller Absicht, festem Willen und einem Kind im Bauch im Lesesaal der Staatsbibliothek Unter den Linden vor einem dicken, leeren Schreibblock und wollte mir all meinen Kummer von der Seele schreiben, bevor mich das Leben fortreißt. Ich habe sieben Stunden vor dem ersten weißen Blatt gesessen, mich nicht von meinem Platz gerührt, aus dem Fenster in den Lichthof gestarrt und mich dem November hingegeben, der mich auch genommen hat. Kein einziges Wort stand auf dem Papier. Mit einem tiefen Seufzer und dem bewussten Abkapseln des bis dahin Gelebten, Erfahrenen, Gefühlten im tiefsten Innern ließ ich mich willenlos und deprimiert vom Leben fortreißen.
Ich verzichtete.
Dann hatte ich einen wunderbaren Titel gefunden, fast zwanzig Jahre später.
„Abrechnung mit 40“ sollte das Buch heißen. Und ich wollte abrechnen, erbarmungslos mit mir und meiner Umwelt. Und was hatte ich nicht alles abzurechnen … Habe ich etwas abgerechnet? Nichts habe ich aufgeschrieben. Ich habe zwar wieder Blöcke bereitgelegt, Platz geschaffen. Orte zum Schreiben gesucht, bis ich wieder in der Staatsbibliothek saß, wo ich viele andere Arbeiten dabeihatte und erledigte, bis ich mir zum Schluss das Bonbon des Aufschreibens der inneren aufreibenden Erlebnisse gönnen wollte. Was habe ich aufgeschrieben? Nichts. Erst muss ich Zeit für mich haben … Ich muss einen ungestörten Ort für mich haben. Ich weiß ja gar nichts vom Schreiben, ich kann doch nicht einfach so blindlings, ungeschult, spontan und unförmig dahinschreiben. Es wird von ich – ich – ich – ich nur so wimmeln, meine unmaßgeblichen Ergüsse werden sich eitel wie der Nabel der Welt schillernd drehen und wenden und glauben, sie wären wichtig. Welche Anmaßung! Bleib bescheiden, es interessiert sowieso niemanden!
Als ich fünfzig war, sollte der Titel lauten „Kreise, Ebenen und Winkel“.
Ich sitze in der Staatsbibliothek Unter den Linden im Lesesaal, blicke nur hin und wieder in den novemberlich gefärbten Lichthof und schreibe mit meiner unverschämt verschmierenden Schrift, was mir in den Sinn kommt. Erstaunlicherweise halte ich den Stift nicht ganz so verkrampft wie einen Meißel, das Blatt Papier bedeckt sich von der ersten Minute an zügig mit ungleichmäßigen Schriftzügen, und ich bin gespannt, wohin mich der Tag bringt. Die heute Morgen noch klar vor mir stehenden Sätze habe ich nicht mehr auffinden können. Wo sie nur sein mögen? Ach, und warum schreibe ich nun plötzlich doch? Erschlagen mich etwa nicht nach wie vor die Buchhandlungen mit ihren Hunderten von Büchern, die ich unbedingt erst noch lesen muss, damit ich vielleicht doch irgendwann einmal etwas von der Welt verstehe? Haben etwa nicht schon mehr als genug Leute die Leserschaft mit ihren Erkenntnissen beglückt? Reichen etwa die Tausende von Büchern in diesen ehrwürdigen Räumen hier und Millionen anderswo in der Welt nicht, mich davon abzuschrecken, ein mickriges Elaborat hinzuzufügen, wo ich doch lieber Wissen in mir sammeln und endlich etwas aus meinem Leben machen sollte?
Ich weiß es nicht.
Ich will jetzt einfach wissen, warum aus mir nichts wurde, warum ich nicht bereit bin, einfach die Fakten meines Lebens zu nennen, weil ich sie selber nicht ertragen kann. Ich versuche manchmal in Gedanken, Sätze zu formulieren, um mich mit den Tatsachen meiner Lebensstationen bekannt zu machen, sie einfach nur zu akzeptieren. Entweder fange ich an zu heulen und zerfließe fast vor Mitleid mit mir, oder mich packt die Wut auf meine Umwelt zu der Zeit, und ich könnte sie heute noch unversöhnlich zum Teufel jagen. Irgendwie trage ich es nach, allein schon im Herumtragen in unversöhnlicher Wut – oder ich fühle mich dermaßen verzweifelt ob meiner Lebensunfähigkeit, Lebensuntüchtigkeit und Hilflosigkeit, mit dem Leben fertig zu werden und irgendetwas aus den vielen Plänen und Ansätzen zu machen, damit ich ruhig, friedlich und friedfertig, selbstbestimmt und zufrieden die Umwelt akzeptierend in Wellen von Spannung und Erholung dahinschwimmen kann und nur noch Quantität vermehrt wird.
Ich will endlich wissen, wissen warum. Ich will nicht alles wissen, ich will den Stein der Weisen nicht finden, ich will nur die Kreise meines kleinen Lebens nachziehen, nacherleben, wie die Kreise größer werden, die verschiedenen Ebenen erkennen, die sich plötzlich wie Abgründe auftun und die Winkel, von denen aus man auf die Dinge blicken kann, wählen und sehen.
Bevor ich eine erste Korrektur und Erweiterung des bereits Geschriebenen vornehme, möchte ich zur Selbstberuhigung, zur Befreiung von alptraumhaften Heimsuchungen bei Tageslicht, deren stereotype Wiederholung in festgestanzten Wort- und Satzfetzen meine Gedanken in einen immer schneller werdenden Strudel trudeln lassen, mir Bösartigkeiten von der Seele schreiben. Seitdem der Stein des Druckes und Stresses, der permanenten Angst, etwas nicht zu schaffen, von mir genommen wurde, gleicht mein Kopf im Inneren etwas, was ich für mich als die geöffnete Büchse der Pandora bezeichne. Da ich nur weiß, dass keiner die Büchse der Pandora je öffnen sollte, da sie nur Unheil birgt, möchte ich meine so schnell wie möglich wieder schließen. Vielleicht gelingt es, indem man Schlimm-Empfundenes hinauslässt? Ich weiß es nicht.
Wenn ich mein Leben in wenigen Sätzen zusammenfassen wollte – mit fünfzig Jahren bot sich die rückblickende Perspektive an –, kam Folgendes heraus:
In meiner Kindheit habe ich leidenschaftlich gern richtige Spiele nach Regeln gespielt, alle möglichen Bücher gelesen, Kindermädchen gemacht – immerhin war ich das bestbezahlte Kindermädchen im Wohnblock mit 0,50 Mark pro Nachmittag. Ich bin gern zur Schule gegangen, die Schule war mein Lebensinhalt, war meine Wohl- und Sicher-Gefühl-Welt. Zu Hause prügelte meine Mutter ihren Lebensfrust an mir und meinem Bruder aus. Mit der Pubertät wurde ich komisch, gehemmt und gehemmter, hilfloser und zurückhaltender, wobei Verschlossenheit bereits zu meinen Kindereigenschaften gehörte. Die Jugendzeit war nicht geprägt von typischen, altersmäßigen Vergnügungen – ich ging zur Schule, lernte, las und zog mich zurück – ganze zweimal war ich tanzen im umtriebigen Alter von 15 bis 19.
Mit 17 war ich in der „Klapsmühle“ – besser klingt natürlich in stationärer neurologischer Behandlung. Während des Studiums befreite ich mich ruckartig von körperlichen Fesseln, nicht ohne auch in extreme Geschichten zu verfallen. Nach dem Studium bekam ich ein Kind, nicht bewusst und gewollt gezeugt, jedoch in vollem Bewusstsein der erfolgten Zeugung. Obwohl ich wusste, dass der Kindesvater und ich nicht zusammenpassten, ich ihn eigentlich auch nicht heiraten wollte, wuchsen die Sachzwänge sich zu einem solchen Wust aus, dass ich mich in die Heirat wider besseren Wissens dreinschickte, da ich als Einzige nicht deren Notwendigkeit und Problemlösung einzusehen gewillt war. Also blieb nur ich auf der Strecke, und alle waren zufrieden. Infolge dieser Verbindung gab ich meine Karriere auf, die mich in gerader Linie zum Doktortitel mit Job auf Lebenszeit und fachlicher Achtung gebracht hätte. Nach dreieinhalb Jahren Ehe beendet ich den Spuk Ehe, den Alptraum Alltags- und Berufsleben, denn jetzt schien mir die Entwicklung meiner Tochter bedroht. Meine Nerven waren lange vorher therapeutisch behandelt worden. Der kommunikative Blender-Ehemann mit Sonnenscheingemüt über jähzorniger Gewaltattitüde störte mein Leben so lange und so gut er konnte, bis ich mir den ihn abprallen lassenden Spezialpanzer angelegt hatte. Die Scheidung war eine Horrorveranstaltung.
Ich heiratete zwei Jahre später wieder, und wir zeugten ein weiteres Jahr später bewusst, gewollt und gewünscht einen Sohn. Mein Mann adoptierte meine Tochter, wir bauten uns unsere Familie, unser Leben und liebten uns ruhig, still, zurückgezogen. Es hätte bis ans Lebensende eine runde Sache werden können, wir passten zusammen. Eine widerliche Krankheit ergriff Besitz von meinem Mann. Nach und nach nahm diese Krankheit Besitz von unserem Leben, bis sie letztendlich alles dominierte. Dreizehn Jahre lang war die Epilepsie unser latenter und akuter Familienleben-Begleiter. Wieder waren es die Kinder, deretwegen ich den Mann aufgab, um sie nicht zu verlieren und ihnen ein normales Leben zu gewähren. Der Opferung war Genüge getan im Interesse der Zukunft der Kinder. Die Scheidung war Minutensache nach vierteljährlicher Therapie beim Psychologen. Sprechen konnte ich mit niemandem darüber, kann ich heute noch nicht. Es klumpt wie Schuld in mir und lässt keine Rechtfertigung zu. Denn ein reichliches halbes Jahr später starb mein kranker Mann. Hätte ich nach dreizehn Jahren nicht auch noch das vierzehnte und letzte ausgehalten? Wer würde mir schon abnehmen, dass er auch hätte hundert werden können, wie mir der Arzt versicherte – und wir alle drei verrückt?
Der Erste war kein Vater, der Zweite war ein Vater mit Zeit für die Interessen der Kinder, bis er zum Dressurakte durchsetzenden Pedanten wurde und die Kinder lieber seine Nähe mieden.
Der Dritte hatte sein mittleres Leben hinter sich, als wir mit 41 und 46 heirateten. Seine drei Kinder waren erwachsen, volljährig, er träumte von zweimaligem Urlaub im Jahr, Gartenwochenenden, kulturellen Unternehmungen in der Freizeit. Mein Sohn war erst zehn Jahre alt. Wir wurden eine Familie, nebeneinander, ich in der Mitte. Mein erwachsenes Mädchen zog in die Freiheit des selbstständigen Lebens. Ich versuchte, dem Mann und dem Sohn das zu geben, was sie brauchten und wünschten – zugleich ging es selten.
Am ersten Hochzeitstag brach die Wende über uns herein. Damit kam das berufliche Aus. Mein Mann schulte voller Energie und Einsatz um und fand nie eine Arbeit, ich fand Arbeit, gab sie auf, probierte andere Jobs, fand eine Arbeitsstelle, die fünf Jahre Arbeit und Lebensunterhalt gewährte. Ich wurde arbeitslos wegen Mangel an Arbeit und suchte wie besessen nach Ausweg und Job, zermürbt von nervlichem Stress. Nach sechs Wochen hatte ich einen artfremden Job über eine Zeitungsannonce, in den ich mit all meiner Verbissenheit einstieg, meinen Kopf vollkrachte mit Dingen, von denen ich vorher keinen blassen Dunst hatte. Ich ertrug die cholerischen Anfälle des Chefs und Gebieters mit zusammengebissenen Zähnen in Erwartung einer Gehaltserhöhung nach einem Jahr. Was ich erhielt, war die Kündigung mangels Arbeit. Ich durfte mich opfern, damit ein paar andere weitermachen konnten. Ein befristetes Teilzeitangebot lehnte ich wegen finanziellen Irrsinns ab. Mein vorheriger Arbeitgeber unterbreitete mir ein Angebot, sodass ich nur ein Vierteljahr Arbeitslosigkeit in Kauf nehmen musste. Mit Perspektive hielt ich das Vierteljahr ganz gut durch, finanziell mit Dispokredit und nervlich mit wenigen bezwingbaren Depressionen.
Da bei mir garantiert das nicht klappt, was klappen könnte, ging das Angebot nicht auf und ich depressiv fast unter. Nein, ich lass mich nicht unterkriegen. Ich bin wie Unkraut, hart und verbissen, Unkraut vergeht nicht, es kommt immer wieder.
Die Perspektive hieß leben von der Hand in den Mund, stundenweise Arbeit auf Honorarbasis, selbst gesucht, Kleinvieh zusammenzählen und Miete bezahlen, Strom etc. und sehen, ob etwas übrig bleibt. Keine Träume mehr haben, keine Pläne schmieden. Leben von heute auf morgen. Nichts wollen, nur sich dreinschicken.
Ich schickte mich drein.
Nun, ist es nicht großartig?
Drei Ehen, doch nie einen Mann, der mich nicht zwingt, den Lebensunterhalt der Familie selbst verdienen zu müssen – zu müssen – zu müssen. Ist gerecht, denn schließlich bin ich im Zeitalter der Segnungen der Gleichberechtigung aufgewachsen. Will ich etwa plötzlich die alte verschmähte Rollenverteilung genießen und es bequem haben oder gar versorgt werden? Das ist anmaßend. Mit keiner Rechtfertigung kann ich mir das anmaßen.
Gleichberechtigtes Leben ging doch gut, volle Berufstätigkeit, Haushalt, zwei Kinder großgezogen bis zum Abitur und Studium, Geld verdient, Wohnen, Ernährung, Kleidung, Urlaub gewährleistet. War ich irgendwann müde und erschöpft? Konnte ich irgendwann alle Viere gerade sein lassen und das nicht tun, was getan werden musste? Hätte ich irgendwann andere Regungen als Funktionstüchtigkeit spüren können, gar Schwäche, Krankheit, Launenhaftigkeit, Sich-gehen-lassen-wollen? Alle diese Fragen werden mit Nein beantwortet. So bin ich ein freundlicher, zurückhaltender Mensch, verbissen, zielgerichtet, pausenlos in der Arbeit, die toll verpackt wird, nicht sehr kommunikationswillig, nicht sehr normal menschlich, nicht Small-talk-fähig, effizient unter großem, lang andauerndem Druck. Was ist von mir übrig? Wo bin ich? Ist von mir noch etwas da? Was wäre ich für ein natürlich menschlicher Mensch geworden, wenn alle meine Anlagen gleiche Chancen gehabt hätten?
Ich mache mich wieder auf in die Vergangenheit. Vielleicht finde ich es heraus. Vielleicht zeigt sich der Beweggrund des roten Fadens meines tendenziell selbstzerstörerischen Lebens.
Ursprünglich dachte ich auch an den Titel für meine Geschichte: „Weshalb aus mir nichts wurde“.
Mach endlich – Schritt für Schritt. Vielleicht hast du doch etwas zu sagen.
Wie viele Zeilen werden im Geschichtsbuch über die Jahre 1949 bis 1989 und einen kleinen Staat namens DDR stehen?
Alle Stimmen zu diesen Jahren, die sich lauthals in den letzten 25 Jahren bemerkbar gemacht haben, hatten etwas zu sagen gegen diesen Staat, diese Enklave in der deutschen Geschichte. Ich möchte die herabmindernden Adjektive nicht aufzählen oder gar wiederholen. Ich war nicht dagegen, nie wäre ich ein Dissident oder Opponent geworden. Ich war froh, in diesem Land aufgewachsen zu sein. Ich hatte die besten Chancen, die sich einem Menschen in seiner Entwicklung bieten können. Ich war als junger Mensch froh, in diesem und keinem anderen Land der Welt geboren worden zu sein, ich hätte mir kein besseres Land vorstellen können. All meine Kraft von Kindesbeinen an wollte ich für die DDR geben, damit es allen Menschen immer besser geht.
Diese vierzig Jahre waren die wichtigsten meines Lebens, sie waren mein erstes langes Leben. Ich gehörte in dieses Leben.
Der Anfang beginnt am Anfang – doch welchem?
2.1 August 1947
Später sollten die Wetterstatistiker berichten, es sei der heißeste Sommer des 20. Jahrhunderts gewesen, jener Sommer des Jahres 1947. In der sächsischen Kleinstadt stach die Sonne bereits in den frühen Morgenstunden unbarmherzig hernieder. Ein junges Mädchen, hochschwanger, zog gesenkten Kopfes einen Handwagen die steile Hauptstraße hinauf. Es ging langsam, nach vorn gebeugt, jedoch in der natürlichen Bewegung behindert durch das runde Bäuchlein, das an ihrer zierlichen Figur buchstäblich wie ein verschluckter Fußball, wie ein wirklicher Fremdkörper aussah.
Die wenigen Leute auf der Straße, deren Aufmerksamkeit die junge Frau allein durch das Poltern und Scheppern des Handwagens auf dem Kopfsteinpflaster der Langen Straße – die ihren Namen übrigens zu Recht trug – erregte, warfen einen kurzen Blick auf sie und dachten sicherlich Ähnliches wie: „Mein Gott, bei dieser Hitze und in dem Zustand …“ Oder: „Selbst noch ein Kind …“ Oder: „Das hat sie nun davon, ja, Strafe muss sein.“ Die Hebamme der Stadt kam schnellen Schrittes mit ihrer Instrumententasche die Straße auf der gegenüberliegenden Seite bergab und dachte bei sich: „Nun wird es sicher nicht mehr lange dauern.“ Das junge Mädchen senkte seinen Kopf blitzschnell noch tiefer und drehte ihn ruckartig zur Seite. Wenn es gekonnt hätte, hätte es sich vor Scham in sich selbst verkrochen. Schweren Herzens, bedrückt zog es das Wägelchen. Die Lange Straße machte jetzt einen kleinen Schwenk nach links, am großen viereckigen Hochbrunnen bog sie rechtwinklig nach links, jetzt wenigstens ein wenig abschüssig, um dann wieder im rechten Winkel nach rechts zu führen, wo sich nun eine sanfte Steigung andeutete. An der Post vorbei, daneben die Stadtparkeinfassung entlang, an den Bahnschranken vorbei, die Geräusche des Bahnhofs hinter sich lassend, zog das dunkelhaarige Mädchen den Handwagen unbeirrt die Hauptstraße entlang bis zum Ortsaugang. Dort bog es nach rechts ab in eine Schrebergartenkolonie, deren großes Eisentor es nur mit Mühe öffnen konnte. Im zweiten Querweg der zweite Garten links war sein Ziel. Auf der linken Hälfte des zweihundert Quadratmeter umfassenden Areals reihte sich eine Reihe Kartoffeln an die andere. Besser, die junge Frau nahm sich nicht die Zeit, sich etwas auszuruhen, denn im Inneren hörte sie die Stimme ihrer Mutter: „Wo das Mensch nur bleibt, wie lange die wieder braucht, die paar Kartoffeln zu holen. Zu nichts nütze, aber ein Kind in die Welt setzen. Und wie wir das Kind großkriegen sollen, interessiert sie nicht …“ Hastig machte sie sich an das Ausbuddeln, hoffentlich war der Mutter die Größe der Kartoffeln recht! Sie warf, schob, legte die „Ardäppel“ in den mitgebrachten, braunen, dickfädrigen, geflickten Sack. Als er halb voll war, wollte sie ihn auf den Wagen heben, doch er war schon zu schwer. Sie zog und zerrte und mühte sich, doch dicker Bauch und Kartoffelsack waren sich wechselseitig im Wege. Endlich hatte sie es geschafft unter Zuhilfenahme der Knie und Schultern. Natürlich waren es noch lange nicht genug Kartoffeln, also buddeln, beugen, aufheben, Oberkörper hochstrecken, Kartoffeln in den Sack legen, noch einmal, noch einmal, weiter, weiter … Die Entfernung zum Handwagen nahm innerhalb jeder Reihe zu. Plötzlich bildete sich eine Lache in der Kartoffelfurche unter ihr, ein stechender Schmerz durchschoss ihre Lenden, der ihr fast den Atem nahm, ihr schwindelte. „Die Fruchtblase ist geplatzt, ich muss zurück.“ Sie griff nach dem Handwagen, band den Sack zu und richtete ihn so auf, dass er nicht umfallen konnte. Sorgfältig verschloss sie die Gartenpforte und zog los. Wellenartig zog sich ihr Körper in Abständen zusammen, ihr gleichmäßig schleppender Gang wurde dadurch unterbrochen. Doch sobald der Schmerz wieder nachließ, biss sie die Zähne zusammen und griff mit konzentrierter Energie nach der Deichsel und setzte ihren Weg zurück fort entlang der sich schier endlos windenden Straße. Die glühende Hitze ließ ihre Lippen aufspringen, der Wehen-Schmerz betäubte ihre Sinne, doch wie aufgezogen strebte sie mit dem rumpelnden Handwagen und dem sich darauf befindlichen Kartoffelsack den zwei, drei, vier Kilometer langen Weg nach Hause zurück. Die Abstände zum Luftholen und Schmerzabfangen wurden immer kürzer, der Gang des Mädchens immer schneller. Die Sonne stand hoch am Himmel, die Stadt schien menschenleer zu sein, nur die zierliche Mädchengestalt in rhythmisch ungleichmäßigen Intervallen schien das einzig belebte Wesen zu sein, und das Gepolter und Geschepper, das Rumpeln des bergab schiebenden und rollenden Gefährts hallte vor dem Häuser-Geviert des Marktplatzes und sprang wie im Zickzack vom Haus zum gegenüberliegenden Haus die ganze Lange Straße hinunter.
Das Mädchen war wie von Sinnen, als es die Messingklinke der Haustür niederdrückte, den Karren mit letzter Kraft hineinbugsierte, den schmalen, langen, abschüssigen, aber wenigstens kühlen Hausflur hinunterlief, die hintere Tür aufriss, die Karre durchzog und im kleinen, viereckigen Hinterhof stehen ließ, dann schrie es laut auf. Die Mutter kam die Treppe des Hinterhauses heruntergelaufen, so schnell sie konnte, sie hatte das Gerumpel im Hausflur überlaut gehört, doch der Schrei hatte sie alarmiert. Sie sah das sich krümmende und windende Mädchen nur kurz an und verstand sofort, dass es höchste Zeit war. „Ich geh die Hebamme holen. Geh hoch und wasch dich ordentlich.“ Weg war die Mutter, die Hintertür schlug mehrmals an, ob des kräftigen Rückpralls.
Das Mädchen schleppte sich zur Treppe, die fünf hohen Steinstufen schaffte es nur auf allen vieren unter Einsatz des ganzen Körpers, bei den elf Holzstufen der Treppe zum ersten Stock konnte es sich am Geländer festhalten und sich hochziehen. Hinter der Eingangstür bückte es sich nach dem Nachttopf, der immer unter der untersten breiten Stufe der Treppe zur Schlafkammer stand. Sie, Dunja, zerrte ihn hinter sich her, als sie mühsam in die Küche kroch. Ein unerträglicher Druck auf Blase und After beherrschte ihren Körper. Sie zog ihren Schlüpfer aus, zerrte das Kleid über den Kopf und hockte sich auf das Nachtgeschirr, die Beine nach vorn gestreckt und abgespreizt, mit den Händen auf dem Fußboden hinter sich den Körper stabilisierend, denn der sich bewegende Bauch vollführte ein Eigenleben und machte ihren Körper zum Abfanghalter. Auf dem Topf sitzend rutschte sie zur Waschbank unter dem Fenster. Sie klappte den Deckel hoch, die darunter befindliche Waschschüssel war leer. In einer Minute des nachlassenden Schmerzes erhob sie sich, griff nach der Wasserkanne und goss Wasser in die Schüssel. Beim Absetzen der Kanne stach der Schmerz wieder zu. Sie krümmte sich, beugte und wand sich und begann, ihren Körper von oben bis unten mit dem Waschlappen, den sie immer wieder in die kleine Waschschüssel tunkte, abzureiben. Eilige Schritte trippelten die Treppe hoch. Die Küchentür wurde aufgerissen, die Hebamme setzte ihre Tasche ab und hatte nach wenigen Schritten Dunja unter den Armen gefasst. „Ja, ja, heute früh wolltest du mich nicht sehen, und jetzt brauchst du mich schon. Wo ist das Bett?“ Die nach Atem ringende Mutter öffnete die Tür zum Nebenzimmer, das eigentlich die „gute Stube“ war, wo statt des großen Tisches in der Mitte ein frisch bezogenes Bett im sonnendurchfluteten Zimmer stand. Hebamme und Mutter legten die wimmernde Dunja aufs Bett und deckten sie mit einem Laken zu. „Einen Moment musst du schon noch warten.“ Die Mutter bereitete der Hebamme frisches Wasser zum Händewaschen, dann setzte sie den großen Kessel auf den eisernen Küchenherd, um Wasser zu kochen. „Bei der Hitze auch noch feuern!“ Die Hebamme griff nach ihrer Instrumententasche und nahm sie mit ins Nebenzimmer. Sie begann die Gebärende zu untersuchen. „Der Muttermund ist schon sehr weit auf. Wir können anfangen.“ Dunja hörte und sah wie durch einen Schleier, sie wälzte sich hin und her und wimmerte leise vor sich hin und atmete hastig, laut, mit angstgeweiteten Augen. „Ruhig, ganz ruhig. Gleichmäßig atmen, tief einatmen, ausatmen. Jetzt Beine anziehen, weiter, Luft anhalten und jetzt pressen, pressen, hecheln und noch einmal.“ Keiner wusste, wie viel Zeit verging. Ein vierzehnjähriger Junge, der gerade noch die Treppe heraufgetobt war, blieb wie angewurzelt in der Küche stehen, als er die ungewohnten Worte und das Stöhnen aus der guten Stube hörte. Die Mutter, die gerade wieder in die Küche kam, um nach dem Wasser zu sehen, bedeutete ihm hastig, wieder zu gehen und in ein, zwei Stunden erst wiederzukommen. Ohne ein Wort stürmte er davon. Aus dem Nebenzimmer waren immer ängstlichere Schreie zu hören, dazwischen die beruhigende Stimme der Hebamme. „Jetzt nimm deine Kraft zusammen und drücke ganz fest, pressen, es guckt schon, und pressen … ja, ja, noch mal und jaaaaa …“ Begleitet von einem lang gezogenen Seufzer. „Warte, ich muss dir erst die Nabelschnur vom Hals ablegen.“ Ein kurzer Klick, die Hebamme packte das Neugeborene bei den Füßen, hielt es hoch, mit dem Kopf nach unten, gab ihm einen leichten Klaps auf den Po. Der erste Babyschrei, zaghaft, eher jammernd, ließ alle sekundenlang erstarren. Dann emsiges Tun, Baby waschen, messen, wiegen, wickeln, anziehen: „Es ist ein Mädchen. 47 cm, 2500 gr, herzlichen Glückwunsch.“ Geschäftig taten die zwei Frauen das, was getan werden musste. Nachdem die Wöchnerin zum Ausruhen vorbereitet und das kleine Wesen in seinem Körbchen am Fußende des Bettes in Sichtweite seiner Mädchenmutter friedlich schlafend lag, schlossen Hebamme und Mutter leise die Tür hinter sich und setzten sich in der Küche an den großen Esstisch. Die Mutter stellte kühlen Johannisbeersaft, selbst gemachten, auf den Tisch, nach der Anstrengung eine Erfrischung. Dann flüsterten sie miteinander. „Und wie soll es weitergehen? Wer ist der Vater? Wird er sie heiraten?“ „Was soll nur werden … Ach, wir werden sie schon durchkriegen.“
2.2 Mein Eintritt ins Leben
Die kleine Angelika – das war ich – hatte also am 28. August 1947 um 10:20 Uhr in der sächsischen Kleinstadt Pulsnitz das Licht der Welt erblickt.
Dunja schlief und wachte, träumte und lag mit offenen Augen inmitten der guten Stube, deren westwärts befindliche Fenster jetzt mehr und mehr Sonnenlicht hereinließen. Sie war erschöpft und ganz ruhig. Ihr Blick wanderte immer wieder zu dem Kinderkörbchen, in dem ein kleines Wesen ganz friedlich schließ. Es atmete gleichmäßig, wobei sich sein Brustkorb hob und senkte. Manchmal bewegte es die Händchen. Als sich die Tür einen Spaltbreit geöffnet hatte, schloss Dunja schnell die Augen. Leise Schritte schlichen zum Körbchen. Die Stimme des dreizehnjährigen Jungen flüsterte: „Nun guck mal, wer hier ist. Guck mal, hier ist dein Onkel. Ich bin dein Onkel Christian. Guck doch mal!“
Natürlich guckte das Baby nicht, doch ein Lächeln huschte über Dunjas Gesicht. Ihr Bruder hatte sich als Onkel zu ihrer Tochter bekannt.
Dunja lag halb wach und gab sich ganz und gar der Stille hin. Sie durfte liegen und ausruhen, und sie lag und spürte ihren ruhig gewordenen Körper, der sich von der Anstrengung erholte. Immer und immer wieder wanderten ihre Augen zum Babykörbchen, in dem das kleine Würmchen wohlig, rosig schlief, sich hin und wieder rekelte und dabei schwer aufseufzend atmete.
Ach, könnte es doch immer so sein … Doch die Zeit vergeht, sie lässt sich durch nichts aufhalten.
Füllen wir die Kleinstadt in Sachsen mit lebendigen Menschen, soweit sie in meiner Geschichte von Bedeutung sind.
2.3 Richard
Als der Vater, Dunjas Vater, nach Hause kam, trotz seiner erst 38 Jahre schwer atmend und mit schlurfendem Gang, was nicht allein Ausdruck seiner Erschöpfung nach körperlich schwerer Arbeit und der entsetzlich brütenden, stehenden Hitze dieses Augusttages war, sagte ihm die Dora, Dunja sei von einem Mädchen entbunden worden, alle gesund und alles gut gegangen. Richard wusch sich den Kohlestaub vom Körper, Dora hatte ihm Wasser in die Waschschüssel gegossen. Er schnaufte und spritzte beim Waschen. Sein magerer Körper ließ alle Rippen erkennen. Die linke Brustseite war durch eine riesige Narbe auf dem Rücken verunstaltet, während vorn die glatten, verheilten Wundränder einer runden Narbe zu sehen waren. An beiden Oberschenkeln waren vorn und hinten ähnliche Narben. Nur wenn er mit Dora allein war, entblößte er seinen Körper. Er wollte nicht über den Scharfschützen auf dem Baum in einer Lichtung vor Stalingrad sprechen, dessen Schießkünsten er die beiden Oberschenkeldurchschüsse und den glatten Lungendurchschuss, der ihm fast das Leben gekostet hätte, zu verdanken hatte. Nur die an der Brust getragene Blechbüchse bremste den Schuss. Diese Geschichte wurde später von Generation zu Generation weitergegeben. Im Lazarett hatte man ihn wiederhergestellt, der Kessel von Stalingrad und damit eine Hölle waren ihm so erspart geblieben. Die Kriegsgefangenschaft in Russland erhielt ihn am Leben, denn leben, leben, leben wollte er und eines Tages nach Hause ins ferne Deutschland zu seiner Frau Dora und den beiden Kindern, Dunja und Christian, zurückkehren. Im Sommer 1947 war er bei einem Schub entlassener Kriegsgefangener dabei. Wochen und Monate waren sie unterwegs, ausgehungert, in zerschlissenen Uniformen, ausgetretenen Stiefeln und ohne jegliche Habe. Er war einer der Heimkehrer, seine Familie, das Land hatte er mehr als vier Jahre nicht mehr gesehen. Die Begrüßung fiel vorsichtig und unbeholfen aus. So hatte er es sich nie ausgemalt in seinen lebenserhaltenden Träumen von zu Hause. Seine Familie wohnte nicht mehr in der Schulstraße, er musste sich durchfragen, um sie zu finden. Sonja, seine siebzehnjährige Tochter, war hochschwanger und schlich nur mit gesenktem Kopf umher. Der dreizehnjährige Christian war ein munteres Bürschchen geworden, dessen Mundwerk nie stillstand, der dauernd mit irgendetwas beschäftigt war. Seine Frau Dora war von Kummer und Sorgen bedrückt und entlud sich in Keifen, Schimpfen und Jammern. Am ersten Abend seiner Heimkehr hatte er, als sich die Familie um den großen rechteckigen Tisch versammelt hatte zum spärlichen Abendessen – Pellkartoffeln mit Quark und Salz –, nach dem Essen seiner Familie verkündet, sie dürften nur heute nach seiner Kriegszeit fragen, er würde nur heute davon sprechen, später würde er nie mehr ein Wort darüber sagen, denn es sei das Furchtbarste, was einem Menschen widerfahren könne, der Krieg. Nie wieder wolle er vom Krieg hören, geschweige denn darüber reden. Dieses Gelöbnis befolgte er bis zu seinem Lebensende. Niemals sprach er vom Krieg. Er wollte leben, musste seine Familie ernähren, seine Frau sollte es ein bisschen leichter haben nach den schweren Jahren allein mit den beiden Kindern. Er wollte satt zu essen haben, er wollte Spaß haben und Lebensfreude genießen. Dass er nun gleich Großvater wurde, wo er doch selbst kaum gelebt hatte … Mit 20 (geboren wurde er am 23. Januar 1909 in Pulsnitz auf der Meißner Seite als Sohn des Fabrikarbeiters Richard Nitz und dessen Frau, eine geborene Katzer, deren Familie immer zu Streichen und Scherzen aufgelegt und damit stadtbekannt war, fünf Kinder hatten sie, zwei Jungen, Georg und Richard, und drei Mädchen, Dora, Hildegard und Gertrud) hatte er eine sieben Jahre ältere Frau (Dora geboren am 17. August 1902) geheiratet, die er geschwängert hatte. Das Kind war zur Hochzeit schon ein Jahr alt – Dunja. Das Leben machte ihm viel Spaß, und das saubere, ruhige Dienstmädchen mit den hellblauen Augen und dem streng frisierten blonden Haar hatte es ihm angetan … Damals hatte Dora nur für Richard Augen und für seine Mandoline, zu deren Klang er hingebungsvoll sang. Dunja war im Sommer 1929 geboren worden – unehelich, mit dem Nachnamen der Mutter. Die Weltwirtschaftskrise brachte auch die Welt in dem sächsischen Städtchen aus den Fugen. Richard verlor seine Arbeit, da sein Vater als aktiver Gewerkschafter für die Kollegen eintrat und der Name Nitz dadurch bei der Betriebsleitung sehr anrüchig war, sodass er sich mit Gelegenheitsjobs durchschlagen und sechs Jahre „stempeln“ gehen musste. Dora musste Heimarbeit annehmen. Die Textilfabriken und Webereien hatten oftmals Kleinaufträge an Heimarbeiterinnen zu vergeben. Hätte Richard nicht manchmal den Spaßmacher, Witze-Erzähler, Zither- und Mandolinenspieler bei Familienfesten und Hochzeiten auf den Dörfern der Umgebung gemacht, was wenigstens etwas zum Essen für die Familie einbrachte, wäre es noch schlimmer gewesen. Eines Tages war sein bester Freund, Frenzel Kurt, in brauner Uniform aufgetaucht und hatte zu ihm gesagt: „Richard, jetzt geht es aufwärts. Adolf macht Deutschland wieder zu etwas, der ist für uns einfache Arbeiter. Du solltest auch zu uns kommen.“ Irgendwie hatten Kurts Worte ihn erschreckt. Machthaber, die für die Armen etwas tun? So etwas hatte es nie gegeben. Er wollte erst einmal abwarten. Allmählich wurde die Schlange vor dem Arbeitsamt kürzer, die Farbe braun tauchte häufiger im Stadtbild auf, das Kleinstadtleben kam in ordentliche und geregelte Bahnen, die Leute gingen eiliger und geschäftiger, die Ströme zu den Werktoren flossen breiter und breiter, die Auftragslage in den Textilfabriken schien zunehmend besser zu werden. Es wurden Gummibänder, Gurte, Bänder, vorwiegend in Grau, gewebt, Bestandteile von Uniformen. 1936 wurde Richard beim Autobahnbau genommen, es gab zwei Mark die Stunde.
Würde es wieder Krieg geben? Es musste wieder Krieg geben. Dunja und Christian gingen zur Schule, Lehrer Frister unterrichtete sie in Zucht und Ordnung, mit Strenge, Gebrüll und dem berüchtigten Rohrstock, den auch er schon mehr als einmal auf seinen Fingerspitzen und dem Hinterteil hatte niederpfeifen spüren. Dunja erwischte es häufiger als den Jungen, Lehrer Frister hatte öfter ausrichten lassen, dass sie genauso viel Unsinn im Kopf habe wie ihr Vater. Immer nur Schabernack und Streiche, Gedanken, wie kann ich jemandem etwas auswischen, sodass dann die Lacher auf meiner Seite sind …
Dann war er eingezogen worden in die Wehrmacht als Soldat. Und jetzt stand er hier in der Küche, frisch gewaschen, mit frischem Unterhemd, und im Nebenzimmer lagen sein Kind und seines Kindes Kind. Er ging hinüber. Ein winziges neues Leben. Lange schaute er auf das Baby.
Dora rief zum Essen. Es gab Suppe, Linsensuppe. Schweigend aßen sie zu dritt, bis Dora sagte: „Richard, nach dem Essen könntest du mit dem Fahrrad nach Lomnitz fahren und Gerold Bescheid sagen.“
Richard holte das Fahrrad aus dem Schuppen und trat langsam in die Pedalen. Die Straße nach Lomnitz schlängelte sich zwölf Kilometer lang bergauf, bergab. Die Sonne stach immer noch vom Himmel. Die Leute arbeiteten auf den Feldern. Richard hielt Ausschau nach Gerold. Aus der Ferne und in der gleißenden Sonne waren die Leute schwer zu unterscheiden. Mager waren sie alle. Endlich erkannte er den Jungen. Er blieb am Feldrand stehen, an sein Fahrrad gelehnt, und wartete einfach, bis der Junge ihn erkennen würde. Oft gesehen hatte sie sich bisher nicht, einmal beim Stubbenschlagen im Wald, das Holz hatten sie dann zu Hause gemeinsam gesägt. Gerold redete viel, er drückte sich immer so fein aus. Vielleicht kam es daher, dass sein Vater etwas Besseres war, immerhin Gutsinspektor in Dittersbach. Die Russen hatten ihn zur Verwaltung des Gutes wieder eingesetzt, jemand musste sich schließlich um die Ernte und das Vieh kümmern, zu essen brauchten ja alle … Deswegen arbeitete Gerold auch in der Landwirtschaft, da gab es Essen, essen war auch anderthalb Jahre nach Kriegsende das Schwierigste.
„Du bist heute Vater einer gesunden Tochter geworden. Beide sind wohlauf.“
Gerold freute sich: „Ich komme am Sonnabend.“
Er ging zurück zur Arbeit auf dem Feld. Bis zum Einbruch der Dunkelheit würden sie gewiss arbeiten. Morgen, Freitag, in aller Herrgottsfrühe, würde es wieder hinaus aufs Feld gehen bis spätabends, aber Sonnabend nur bis Mittag, dann könnte er endlich nach Pulsnitz zu Dunja und dem Baby gehen. Seine Gedanken drehten sich nur noch um Dunja.
2.4 Gerold denkt an Dunja
Wie hatte sie ihm gefallen, als sie eines Tages 1946 an der Tür der Gesindeküche des Ritterguts in Lomnitz stand und der Bauer sagte: „Das ist Dunja, die macht jetzt ihr Pflichtjahr hier.“ Das dunkelhaarige Mädchen mit den riesengroßen grünen Augen und dem vorstehenden Oberkiefer hielt den Kopf gesenkt, die Hände auf dem Rücken verschränkt, schaute sie verschämt auf den Fußboden. Sie wirkte schüchtern und ängstlich. Der Bauer hatte zu ihr gesagt: „Setz dich da hin und iss mit, morgen früh geht’s zeitig raus.“ Der Bauer war gegangen, und sie setzte sich an eine freie Stelle auf der Bank auf die Kante und wartete, bis ihr die Magd einen Teller hinstellte und Suppe, Kohlrübensuppe, auftat. Sie schaute niemanden an, als sie die Suppe widerwillig und mit langen Zähnen langsam aß. „Wer bist du?“ „Ich bin Dunja aus Pulsnitz“, antwortete sie kaum hörbar. „Bist du nicht die Cousine von Pohlischens Annemarie?“ Sie nickte. „So einen komischen Namen hat hier niemand. Klingt so russisch.“ Was hätte sie darauf sagen sollen? Über ihren Namen hatte sich bisher jeder gewundert, sie konnte doch nichts dafür, dass sie Dunja gerufen wurde und nicht Edelgard, was ihr zweiter Vorname war, zwar ganz deutsch, aber langweilig.
Die acht bis zehn jungen Leute aßen ihre Suppe, Brot gab es nicht dazu. Gesprochen wurde wenig, der Arbeitstag auf dem Feld hatte sie müde gemacht. Nachdem die Küche aufgeräumt, das Vieh versorgt war, saßen sie noch ein bisschen auf dem Gutshof unter dem großen Baum herum und quatschten, dann gingen sie nach und nach schlafen. Gerold erinnerte sich an die vielen Wochen, die es gedauert hatte, bis Dunja auftaute. Bei der Arbeit hatte er immer wieder versucht, in ihre Nähe zu kommen, sie zu necken. Allmählich war sie lebhafter geworden, gab schlagfertige Antworten und hatte lustige Ideen. Sie band die Jackenärmel zusammen, vertauschte die Schuhe und noch ausgefallenere Scherze, dabei guckte sie wie ein Unschuldslamm. Sie nahm flink auf und verdrehte alles Mögliche zu einem Ulk. Bald war sie sehr beliebt, ihre Lebenslust wirkte ansteckend und mitreißend. Gerold hatte sich in sie verguckt, obwohl er noch oft mit Gretel abends zum Waldrand ging. Am Wochenende war im Erbgericht Tanz. Die jungen Leute gingen jeden Sonnabend zum Tanz. Auf dieses Ereignis freuten sie sich stets die ganze Woche über, sie träumten vom Tanzen in ganz schicken Klamotten, die sie alle nicht hatten, aber ihre Sachen durch Einfälle verschönerten, vom Tanzprinzen und davon, die Schönsten zu sein. Den ganzen Sonntag und die halbe Woche danach hechelten sie jeden Blick und jede Bewegung und wer mit wem durch. Der Tanz im Erbgericht war der Mittelpunkt ihres Lebens. Gerold fühlte sich nicht so recht wohl beim Tanzen, er stand lieber an der Theke mit ‘nem Bier in der Hand und redete, Zuhörer hatte er immer viele, denn er sprach schnell und in gewählten Worten, wodurch er sich sehr von den Bauernjungen des Dorfes abhob. Die gaben sowieso nur an, wer das meiste verträgt, wie viel sie schon getrunken haben und was sie im Suff angestellt hatten. Am wohlsten fühlten sie sich, wenn sie über jemanden herziehen konnten, der sich bei irgendetwas dumm angestellt hatte, sodass sie ihre überragenden Fähigkeiten glänzen lassen konnten. Gerold verstand sich ausgezeichnet in der Schilderung von Tölpeln, die er dem Gelächter preisgab. Dann erinnerte er sich an den Schrecken, der ihn durchzuckte, als bei der Damenwahl die Mädchen seines Bauern ihn umringten, alle kicherten und Dunja ihn an der Hand fasste und artig sagte: „Darf ich bitten?“ Er wusste überhaupt nicht, was er machen sollte, tanzen war seine schwache Seite. Er mied es. Dunja zog ihn zur Tanzfläche und tanzte mit ihm, plötzlich ging es ganz einfach. Sie zog ihn in den Rhythmus hinein, führte ihn ganz leicht und bedeutete ihm, ihre Schritte mitzumachen. Er kam sich plötzlich gar nicht mehr unbeholfen und dem Tanz ausgeliefert vor, Dunja tanzte ihn. Er empfand das Tanzen sogar als angenehm und bewunderteDunja, wie die tanzen konnte …
Es hatte gefunkt, sie gefielen sich mehr und mehr und verbrachten die freie Zeit miteinander, wann immer es möglich war. Ihre Hände berührten sich beim Garbenbinden, wenn es keiner sah. Gerold trug die von Dunja vollgefüllten Kartoffelkörbe zum Leiterwagen, beim Essen in der großen Gesindeküche sahen sie sich immer länger in die Augen, unter dem Baum auf dem Gutshof rückten sie näher aneinander heran, manchmal gingen sie am Feldrand entlang ein Stück spazieren, ihre Finger verhakelten sich, sie fingen an, sich schüchtern zu küssen.
Im November war Kirmes, das größte Fest auf dem Lande. Die Ernte war eingebracht, der Boden erwartete den Winter. Die Menschen feierten. Es gab zu essen und zu trinken, reichlich, jeder konnte satt werden. Es gab Fleisch und Wurst, sonst eine Seltenheit, wie für festliche Anlässe waren riesige Blechkuchen gebacken worden, Bier stand in Fässern bereit.
Es war eine Ausgelassenheit unter den Leuten, wie sie sonst das ganze Jahr über nicht herrschte. Gerold ließ Dunja nicht mehr los. Sie gingen in die Scheune, im Heu war es weich und unter der Decke warm. Er liebte sie mit allem jugendlichen Ungestüm, und sie erwiderte seine Berührungen, sie fanden sich im Gleichklang der Bewegungen.
Sonja wusste nicht, was mit ihr geschehen war, so hatten sie sich vorher noch nie berührt. Sie waren beide siebzehnjährige Jugendliche, eigentlich noch Kinder, im zweiten Jahr des Friedens nach dem verheerenden Weltkrieg, der die Menschen Tag für Tag ums Überleben hatte bangen lassen, dessen Zeit danach die Angst vor den Bomben genommen hatte, jedoch wieder ein Kampf ums Leben, ums tägliche Sattwerden. Ein Tag um den anderen wurde „abgelebt“, das Dasein bestritten. Gab es Träume? Wovon träumten die Alten? Vielleicht von einem heilen Dach über dem Kopf, einer warmen Stube, satt zu essen? Wovon träumten die Jungen? Nicht von frühmorgens bis spätabends schwer arbeiten zu müssen, sodass man seinen Körper nicht mehr spürt, vom Feiern, Tanzen, Fröhlich-Sein, Lachen und Leben, neuen Schuhen, neuen Kleidern, schicken Hosen …
2.5 Mosaike
Bis hierher sehe ich alles wie einen Farbfilm vor meinen Augen. Bunte Mosaiksteinchen aus Omas kärglichen Berichten, aber gespickt mit reichlich Anweisungen und vor allem Urteilen, was richtig und was falsch ist. Steinchen aus Opas Husten, Blicken, schwerfälligem Atmen und Gehen, Steinchen aus Christians fantasievollen Ideen, Gedankenkombinationen und pausenlosem Beschäftigt-Sein. Steine aus Dunjas verklärenden, wortreichen, ausschweifenden Erzählungen und rechtfertigenden Erklärungen fügten und fügen auch weiter dieses Bild ihrer Wurzeln, das sich vor meinem geistigen Auge abspielt, bevor meine eigene Erinnerung einsetzt. Bis dahin vergeht noch einige Zeit, und das Mosaik wird weiter in Buchstaben gesetzt.
2.6 Dora – Was weiß ich von Oma Doras Anfang?
Dora war das zweite Mädchen, die Mittlere von fünf Kindern, und wurde am 17. August 1902 in Großnaundorf geboren. Ihre Mutter starb, als Dora elf Jahre alt war. Ihre zwei Jahre ältere Schwester Lene und sie mussten die zwei jüngeren Brüder behüten. Ihr Vater August Wenk arbeitete seit Anfang der 1920er auf dem Bau als Maurer in Dresden und sorgte für den Lebensunterhalt der Kinder. Wer sich um diese tagsüber kümmerte, weiß ich nicht. Der Vater war jähzornig, aufbrausend und schlug kräftig zu, wenn die Kinder nicht folgten. Er litt sehr an Ischias. In einer Anwandlung brachte er den Kindern eine Staude Bananen als etwas ganz Besonderes mit. Sie kannten sie nicht, bissen gleich hinein mit Schale, und sie schmeckten ihnen nicht, nie wieder. Was sollten sie auch mit so komischem ausländischem Zeug? Irgendwann hatten die Schmerzen August fast zum Wahnsinn getrieben. Eines Sonntags nach dem Mittagessen, als er auf dem Kanapee in der Küche ruhte, die Kinder friedlich auf dem Boden spielten, schluckte er Arsen, eine große Dosis, und starb. Das Arsen konservierte seine Knochen, sodass in den 50er-Jahren bei der Friedhofsumgestaltung – alte Gräber können nach dreißig Jahren beseitigt werden, wenn kein Familieninteresse am Fortbestehen des Grabes besteht – sein vollständiger Totenschädel zum Vorschein kam.
Als Familienoberhaupt galt der älteste Sohn, der sich in Doberschütz niederließ. Der jüngste Bruder Paul beging auch irgendwann in den 20ern Selbstmord.
Dora ging nach der Dorfschule „in Stellung“. Sie kam in einen Haushalt in Königsbrück, wo sie eine Dienstbotenkammer mit noch einem Mädchen bewohnte, und war Hausangestellte, Mädchen für alles, Kost und Logis frei, einen Samstag im Monat frei, ein paar Mark Verdienst, den sie eisern sparte für die Aussteuer. Heiraten wollte sie, wenn der Passende käme. Sie wartete. Sie ging von Stellung zu Stellung und wurde darüber sechsundzwanzig Jahre alt, ein altes Mädchen. Dann trat der lebenslustige Richard in ihr Leben, der so ganz anders war als sie, lebenslustig, unbeschwert und von ansteckender Fröhlichkeit. Richard hatte auch vier Geschwister, drei fröhliche Schwestern und einen Bruder, der beim Lachen stets Tränen weinte. Den größten Unsinn allerdings heckte ihre Mutter, Nitzens Mutter, eine geborene Kratzer, aus. Sie ließ den Wecker um zehn Uhr abends klingeln, um die Verehrer ihrer Töchter nach Hause zu schicken, sie legte ausgestopfte Figuren vor die Haustüren von Leuten, um diese zu erschrecken. Überhaupt, jemanden zu erschrecken, war der größte aller Späße. Dazu war jedes Mittel recht. Das Spaßmachen ließ sie uralt werden. So weiß ich vom Hörensagen, dass sie vor mir, ihrer Urenkelin, auch noch ihre unnachahmlichen Faxen machte.
2.7 Dora und Richard
Sie waren ein ungleiches Paar, entgegengesetzte Charaktere. Sie heirateten am 13. Juli 1930 in Großnaundorf, da war ihre Tochter Dunja schon ein Jahr alt (wie ich aus dem Familienstammbuch entnehmen konnte, gesagt hatte es keiner). Das sollte gut gehen? Enttäuschte Erwartungen hatten aus Dora eine strenge, bösartige Mutter für Dunja, die Ursache ihrer Lebensfessel gemacht sowie eine keifende, dirigierende, maßregelnde und reglementierende Frau für Richard, die „nur-seine-vergnügungssuchende-Spielernatur“ hasste, aber auch eine liebevolle, hätschelnde Mutter für Christian, den sie viel lieber Waldemar-Ehrenfried genannt hätte, aber Richard hatte seine „Pferdenatur“ durchgesetzt, als er die Geburt des Wunschsohnes anmelden gegangen war, und nicht zuletzt eine pedantisch auf Ordnung und Sauberkeit bedachte Hausfrau im armseligen Hinterhaus, das wie ein halbiertes Haus aussah, denn es hatte nur auf einer Seite ein Dach, dem Hinterhaus, dessen Parterre eine große Waschküche mit Kessel für die Vorderhausbewohner umfasste, Fahrradschuppen und Kaninchenbuchten sowie den Schuppen für Holz und Kohlen der Hinterhausbewohner. Im ersten Stock befand sich die Wohnküche mit zwei Fensterchen zum Innenhof-Geviert, an dessen linker Seite drei Plumpsklos familiengebunden für alle Vorder- und Hinterhausbewohner und die Konsumangestellten, daneben die überdachte Aschegrube, an der Rückwand des Vorderhauses befand sich der Wasserhahn, von dem das Wasser geholt und hochgeschleppt werden musste, denn Wasserleitung gab es nur im Vorderhaus auf den Treppenabsätzen, darüber die rückwärtigen Konsumfenster, dann kamen die knarrende Holztür, Ein- und Ausgangstür zum Hinterhof und ein langer Flur, durch den man auf die Straße gelangte. Rechts bildete ein hoher, brauner Lattenzaun auf einer Steinmauer die Begrenzung zum Nachbarhaus, dem Haus des Fotografen Kahle. Fotoatelier im Parterre, Wohnräume in den beiden darüber liegenden Etagen, das Labor im lang gestreckten Anbau parallel zum Lattenzaun, ein Baum am Haus festgewachsen, eine Birke, das einzige Grün beider Höfe, beim Fotografen gepflastert mit unzähligen kleinen Steinen, vor dem Hinterhaus mit großen Gesteinsquadern, gleichmäßig angeordnet um ein Gulli-Loch in der Hofmitte, abgedeckt mit einem Eisengitter, das zu durchklettern keine Kunst war für Ratten, die ihre Schleichwege vom Sumpfgelände des nahegelegenen Schlossteiches fanden.
Zurück ins Hinterhaus, eine Trennwand zwischen Küche und guter Stube dahinter, beide Räume die gesamte Hausbreite bildend. Aus den zwei Fenstern der guten Stube sah man nach unten auf den Gemüsegarten des Nachbarn, auf die Mauer des Schlosses gegenüber, auf einen den Schlossteich umgebenden Wald sowie Mauerstreifen nach rechts, das Dach eines flachen Gebäudes nach links.
Die steile Holztreppe nach oben führte zur Schlafkammer, so breit wie die beiden Räume darunter, jedoch so schräg, dass auf der Dachseite die beiden Luken nur noch auf dem Bauch liegend erreicht werden konnten. Eine noch steilere Stiege führte zum Dachboden, wo Feuerholz und Zwiebeln gelagert wurden. Das Hinterhaus hatte schon noch geheimnisvollere Ecken, die es später zu erkunden gilt.
Dieses Hinterhaus hatte Dora zugewiesen bekommen, weil Dunja ein Kind bekam und der Platz in der Schulstraße ganz und gar nicht mehr ausreichte für die größer werdende Familie. Das Hinterhaus war Doras Reich, das sie beherrschte und kommandierte. Dora wurde zu einem Zeitpunkt Großmutter, als sie nicht wusste, wie sie die Familie durchbringen sollte. Am liebsten hätte sie Dunja erschlagen, als sie merkte, dass das Mädel schwanger war. Und sie hat zugeschlagen, immer wieder mit dem Siebenriemen, der sowieso griffbereit am Türeingang hing. Sie hat gebrüllt und getobt und gewütet, Dunja im heißen Sitzbad fast verbrüht. Dunjas junger, fruchtbarer Körper hielt den Fötus fest, nährte ihn und ließ ihn gedeihen. Diese Schande, diese unsagbare Schande …
Dunja musste nach Hause und Heimarbeit machen, wie hätte sie sich das überhaupt gedacht? Wie sollte ein Kind ernährt werden in diesen schlechten Zeiten, wo es nicht genug zu essen gab?
2.8 Zurück zum 30. August 1947
Am Sonnabendnachmittag kam Gerold. Er hatte auf dem Wege ein Huhn beim Bauern gestohlen und brachte es nun Dora, damit sie für die Wöchnerin eine kräftige Mahlzeit bereiten könnte.
Er setzte sich vorsichtig bei Dunja auf den Rand des Bettes in der guten Stube und hielt ihre Hand, streichelte ihr Gesicht. Er flüsterte, als traute er sich nicht, laut zu sprechen, aus Furcht, das rosige, schlummernde Baby zu stören.
Es war ein Moment zum Zeitanhalten, ein Moment des Glücks – doch vergeblich. Das Schicksal nahm seinen Lauf …
2.9 Meine Taufe
2.9.1 Fakten und Daten
Abschrift aus dem Kirchenbuch
Taufbuch 1947, Seite 105 Nr. 96
Ort, Tag und Stunde der Geburt
St.-A Pulsnitz Nr. 79/1947//28. August 10 Uhr 20, Pulsnitz, Lange Str. 12
Ort und Tag der Taufe
Pulsnitz, 19. Oktober Kü
Taufname des Kindes
Isolde Angelika 1.K 1.T.
Name, Beruf, Wohnort und Glaubensbekenntnis des ehelichen Vaters
Lt. Mitt. D. Sta.-A. Pu v. 15.01.1948 hat d. Kraftfahrer Ernst Gerold Krause, Wachau *24.01.1929, am 15.10.1947 v.de. A.-Ger. Radeberg (Abt.-Z. 8I 356/47) die Vaterschaft zu nebenbezeichnetem Kind anerkannt
Name und Glaubensbekenntnis der Mutter
Edelgard Dunja Nitz, Heimarbeiterin, Pulsnitz, Lange Str. 12, geb. 26.6.1929 Großnaundorf, ev.-luth.
Somit weiß ich nun durch diese Abschrift aus dem Jahre 2017, dass am 19. Oktober 1947 das Kind, also ich, in der Nikolai-Kirche zu Pulsnitz evangelisch-lutherisch getauft wurde auf den Namen Isolde Angelika. In Sachsen stand immer der zweite Name zuerst und der erste Name, der Rufname, unterstrichen an zweiter Stelle. Das wussten die deutschen Verwaltungsorgane sicher nicht, als sie die neuen Personalausweise erfanden, die Namen der Reihe nach auflisteten und davon ausgingen, der erste Name sei der Rufname. Seitdem kämpfe ich um meinen Namen Angelika, zumal ich Isolde verabscheue und mir keinen Reim darauf machen kann, wer ihn mir warum zugeordnet hat.
2.9.2 Vom Hörensagen und aus GKs-Erzählung
Trotz der strengsten Kontrollen und Bewachung durch die sowjetische Besatzungsmacht, genannt „die Russen“, gab es Tricks, wie der Gutsinspektor Krause, der andere Großvater, zur Taufe seiner Enkelin zum Festmahl beitragen konnte. War eine Kuh trächtig und brachte statt des einen, erwarteten Kälbchens Zwillinge zur Welt, so wurde die Geburt des einen Kalbes gemeldet und registriert. Das zweite wurde im Verborgenen aufgezogen.
Zur Taufe im November 1947 wurde das zweite Kalb geschlachtet und zum feierlichen Anlass als Bratenfestessen aufgetragen. Wie viele Gäste und welche Personen da waren, wo die Feier stattfand, das entzieht sich meiner Kenntnis. Darüber wurde niemals gesprochen.
Allerdings wurde diesmal der Kälbertrick verraten, ein Deutscher denunzierte den Gutsinspektor bei den Russen – schließlich war es allen Deutschen von Kindesbeinen an eingebläut worden, dass die Dinge so zu laufen hatten, wie es der Staat, die Macht, die Machthaber per Gesetz und Erlass vorschrieben, und jede Abweichung müsse der Obrigkeit gemeldet werden, ohne Rücksicht, ob Vater oder Mutter die Vorschriften verletzt hatten. Er wurde nachts von den Russen abgeholt und ins berüchtigte Bautzener Gefängnis, im Volksmund „Das gelbe Elend“ genannt, gebracht. Eine Gerichtsverhandlung fand nie statt. Seine Frau Gertrud durfte ihn nicht besuchen. Die Familie erhielt keine Nachricht. Durch eine Bekannte, die ihren Mann in Bautzen besuchen durfte, erfuhren sie, dass der Gutsinspektor Krause nach einigen Wochen oder wenigen Monaten gestorben war. Den offiziellen Totenschein erhielt seine Frau, ich kenne diesen Großvater nicht.
Meine ersten Erinnerungen
Mein Eintritt ins Leben ereignete sich im August 1947, mein bewusstes Dasein erwachte zwei Jahre später. Meine Erinnerung reicht so weit zurück, nicht eine in Worte gekleidete Erinnerung, sondern Bilder, Stimmen, Farben, Düfte und Gerüche, gespürtes Material von Gegenständen und Gefühle, vor allem traurige. Warum traurige? Sie haben sich eingedrückt, lautes Lachen und Fröhlichkeit kamen erst später hinzu und nicht häufig, eher als Besonderheiten. Ich gucke auf den meisten Fotos sehr ernst. Sehe ich meine Babybilder an, so sieht aus den Augen offene Neugier und Natürlichkeit, spätere Bilder zeigen mich eher ernst und nachdenklich. Wird man schon als Wesen mit besonderen Eigenschaften und Veranlagungen geboren? Heute gilt es als bekannt, dass das heranwachsende Kind im Mutterleib kein leeres Blatt, kein offenes Gefäß ist. Genauso wie es mit genetisch vererbten Anlagen ausgestattet ist, nehme ich an, ist es eine Mischung zu gleichen Teilen des biologischen Vaters und der biologischen Mutter, so ist es dort ebenso ein Prägeraum frei für die Gefühlsweit sowohl während der Zeugung und viel mehr noch während der neun Monate im Mutterleib und dabei wachsend, abhängig von den Gefühlen der Mutter. Mit voller Gewissheit kann ich sagen: Ich bin nicht bewusst mit dem Ziel einer Menschenschöpfung gezeugt worden. Ich war so unerwünscht wie eine Naturkatastrophe, eine menschliche Tragödie. Keiner hat mich gewollt, erwartet, mit Zuversicht begrüßt. Ich bin nicht in eine liebende Familie hineingeboren worden, weiß Gott nicht.
Mit dem Wort Familie habe ich dann auch mein ganzes Leben lang gerungen. Schon frühzeitig in meiner Kindheit kam ich zu dem Schluss, dass sich viele Probleme der Welt lösen ließen, gäbe es nur Wunschkinder.
Hier ist die Geschichte: Sie ist zusammengeklaubt aus Erzählfetzen meiner Mutter, einer Oma, sonstigem Verschweigen bei Verwandten und einer einzigen Erinnerungssequenz.