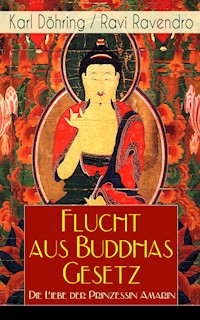
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: e-artnow
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dieses eBook: "Flucht aus Buddhas Gesetz - Die Liebe der Prinzessin Amarin" ist mit einem detaillierten und dynamischen Inhaltsverzeichnis versehen und wurde sorgfältig korrekturgelesen. Aus dem Buch: "Die schönste Zeit meines Lebens verbrachte ich in Siam, wo ich vor dem Kriege lange Regierungsbeamter war. Nach einem Studium in mehreren Fakultäten wurde ich auf mein Gesuch hin nach Bangkok gerufen. Unter der Regierung der Herrscher Chulalongkorn und Vajiravudh baute ich mehrere Palais für den König und für die Prinzen des Königlichen Hauses, und während meines Aufenthaltes in diesem letzten unabhängigen buddhistischen Königreich lernte ich die hohe, verfeinerte Kultur des siamesischen Hofes kennen. Ich versuchte in diesem Roman, etwas von der Schönheit und Eigenart Siams mitzuteilen." Karl Döhring (1879-1941) war ein deutscher Ingenieur, Architekt, Kunsthistoriker, Archäologe, Schriftsteller und Übersetzer, der 1906-1917 in Siam, heute Thailand, arbeitete, sich jedoch ab Mitte der 1920er Jahre vor allem aufs Romaneschreiben verlegte sowie zahlreiche englische Romans ins Deutsche übersetzte. Dabei benutzte er die Pseudonyme Ravi Ravendro, Hans Herdegen, Dr. Hans Barbeck.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 501
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Flucht aus Buddhas Gesetz - Die Liebe der Prinzessin Amarin
Inhaltsverzeichnis
1
Mit weichem, melodischem Rauschen wiegten sich die Äste einer mächtigen Tamarinde im leichten Monsun, und daneben breiteten große Hibiskussträucher mit brennendroten Blüten ihre Zweige schützend wie zu einem Zelt.
Unter dem starken Baum saß ein Buddhamönch in dunkelgelbem Gewand und schaute mit verhaltenem Blick von der Höhe auf den See zu seinen Füßen nieder. Die kristallglatte Fläche strahlte das klare Silberblau des wolkenlosen Himmels um so leuchtender zurück, je näher sich die bewaldeten, düsteren Berge heranschoben. Traumhaft spiegelten sich die schimmernd weißen Klostergebäude mit ihren phantastischen Umrißlinien in den ruhigen Fluten.
Langgestreckte Grenzmauern, von heiligen Semazeichen bekrönt, dehnten sich am Ufer aus, und die schlanken Lotossäulen der weiten Wandelhallen strafften sich, um malerische Dächer mit reichem Ornament zu tragen, in dem sich in tropisch wuchernder Üppigkeit Darstellungen von Elefanten, Schlangenleibern, Dämonen, Drachenköpfen, Göttern und Heroen mit Blumen und Ranken verwoben.
Die Strahlen der späten Nachmittagssonne lagen über der alten Tempelstadt Kandy, und ringsum herrschte friedvolle Ruhe. Nur von der Küste kam eine erfrischende Brise und umspielte zart und kosend den siebenfachen, duftigen, blütenweißen Schirm, unter dem der Oberpriester in innerer Versenkung verharrte. An einer Kette aus starkduftenden, schneeigen Dok-Keo-Blumen war dieses Ehrenzeichen kunstvoll in den Ästen aufgehängt.
Plötzlich drang jedoch ein fremder Ton in die Harmonie dieser Stille; zuerst leise und fern, dann kühn und vorwärtsdrängend surrte der Propeller eines schlanken Flugzeugs, das unaufhaltsam seinem Ziel zustrebte.
Über die feingezeichneten, durchgeistigten Züge des Oberpriesters Somdet Akani legte sich ein Schatten, als ob er von innerer Unruhe gequält würde. Er sah empor und schaute dem Doppeldecker nach, der von Westen kam und langsam nach Osten entschwand.
Ja, von Westen stürmten die neuen Ideen heran, von Westen kamen die Vertreter der weißen Rasse, die mit ihrer technischen Überlegenheit und ihren neuen Erfindungen die Welt zu erobern suchten. Sie hatten keine Achtung vor der Tradition und den inneren organischen Zusammenhängen des Lebens mit den vier Weltrichtungen. Osten war die Gegend des Aufgangs, des neuerwachenden Lebens und der Geburt – im Westen aber verschwanden die Sonne und das Licht, er war das Symbol des Untergangs und des Sterbens. Sollte von Westen das Ende des buddhistischen Zeitalters kommen? War die Weltenwende hereingebrochen? Sollte tatsächlich die vieltausendjährige Kultur des Ostens dem Ansturm des Westens erliegen?
Somdet Akani senkte den Blick wieder und richtete seinen Willen darauf, aufs neue in tiefe Meditation zu versinken. Aber es gelang ihm nicht.
Auf dem Weg, der zu dem Sitz des Oberpriesters führte, erschien ein junger Tempelschüler, der es eilig zu haben schien. Hell leuchtete sein goldgelbes Gewand aus dem Dunkelgrün der Büsche.
Warum eilte der Nen herauf und störte die Ruhe? Sicher war etwas Besonderes geschehen. Somdet Akani hätte es gern gewußt – aber weltliche Neugierde sollte einen erfahrenen Maha aus der Gemeinde der Jünger Buddhas nicht beunruhigen. Wie kam es nur, daß er sich heute durch äußere Einflüsse in seinen religiösen Übungen stören ließ, daß seine Seele zur Sansara, dem Schein- und Trugbild der bunten Welt, niedergedrückt wurde? Sonst schwang sich doch sein Geist, frei von jeder irdischen Fessel, von einer Stufe der Kontemplation zur anderen, bis er die Vollkommenheit und höchste Vollendung des vierten Ihan erreichte...
Der Tempelschüler kam nur langsam näher, da sich der letzte Teil des Weges steil nach oben zog. Schwer atmend stand er jetzt auf der obersten Stufe der steinernen Treppe, die am Ende des Pfades angelegt war. Er schob das Gewand wieder über die rechte Schulter, die sich bei dem mühevollen Anstieg entblößt hatte, dann näherte er sich dem Oberpriester mit bescheiden zu Boden gesenktem Blick. Als er vor ihm stand, sank er mit unnachahmlicher Grazie in die Knie, legte die Hände zusammen, erhob sie zur Stirn und verneigte sich dreimal tief bis zur Erde.
Somdet Akani öffnete die Augen, die er während der Meditation halb geschlossen hatte, neigte leicht den Kopf und erwiderte den Gruß mit gefalteten Händen.
»Der Erhabene möge entschuldigen, daß ich von der Wohnstätte der Mönche heraufkomme zu seinem hohen Sitz unter dem siebenfachen Ehrenschirm und die köstliche Ruhe seiner Meditation störe. Aber ein besonderer Eilbote brachte eben dieses Schreiben aus Bangkok, der Hauptstadt des Königs von Siam, des obersten Buddhafürsten und des Herrn der weißen Elefanten.«
Bei diesen Worten überreichte der Tempelschüler Somdet Akani auf flach vorgestreckten Händen einen Brief, der in ein reichgesticktes, gelbseidenes Tuch eingeschlagen war.
Langsam löste sich die rechte Hand des Oberpriesters aus der durch Tradition geheiligten Meditationsstellung und nahm das Schreiben entgegen. Schon hob sich auch die Linke aus dem Schoß, aber dann hielt Somdet Akani in der Bewegung inne und gab den Brief zurück.
»Nen Vinai, öffne den Umschlag.«
Der Nen setzte sich mit untergeschlagenen Beinen in derselben Haltung wie der Oberpriester auf den Boden nieder. Da Somdet Akani öfter hier weilte, hatten ihm die frommen Laienbrüder des Klosters einen vergoldeten Sitz aus Teakholz errichtet, der mit einer Matte aus Reisstroh bedeckt war. Neben ihm standen eine Silberschale mit mehreren Geräten, eine Teekanne und eine Tasse, aus demselben edlen Metall getrieben. Wie ein Götterbild thronte der Oberpriester vor dem Nen, so daß durch den erhabenen Sitz auch rein äußerlich seine überragende Stellung zum Ausdruck kam.
»Lies das Schreiben vor«, sagte er freundlich.
»An Seine Heiligkeit den erhabenen höchsten Oberpriester des buddhistischen Ordens der Thammajut-Mönche, den Bewahrer und Erhalter der rechten und reinen Lehre Gautama Buddhas, den königlichen Prinzen Akani in Kandy auf der Insel Ceylon.
Gruß und Ehrerbietung zuvor dem Erhabenen von seiner Schwester, der Prinzessin Chanda Rajavong in Bangkok, der Stadt des großen Engels.«
Es folgten die feststehenden, langen Begrüßungsformeln, wie sie unter Persönlichkeiten hohen Ranges in Ostasien und besonders in Siam üblich sind.
Als schließlich der eigentliche Inhalt des Briefes begann, hob Somdet Akani fast unmerklich den Kopf.
»Deine Tochter, Prinzessin Amarin, ist vor einigen Tagen aus Europa hierher zurückgekehrt, nachdem ihre Ausbildung beendet ist. Es traf sich günstig, daß der siamesische Gesandte in Paris, Pia Sri Tamma Sasan, mit seiner Frau in besonderer Mission gerade über Amerika und Japan nach Hause reiste, so daß sich Amarin ihnen anschließen konnte.
Die Prinzessin ist schön geworden und erblüht wie eine goldene Lotosblume im Himapan, sie hat viele Länder gesehen und fremde Sprachen, Künste und Wissenschaften erlernt. Zur Vollendung ihrer Erziehung besucht sie jetzt in Bangkok den ehrwürdigen Abt des Klosters Bovoranivet, der sie in den Lehren des erhabenen Buddha unterweist. In den wenigen vergangenen Wochen hat sie schon große Fortschritte gemacht.
Besondere Freude aber erfüllt mein Herz, daß ich meinem erhabenen Bruder eine wichtige Nachricht von großer Bedeutung mitteilen kann. Der König hat in der letzten Zeit wiederholt mit mir über den Erhabenen gesprochen, und als wir gestern bei dem großen Fest im Tempel des Smaragdbuddhas das Wasser der Treue tranken, sagte er bedeutungsvolle Worte zu mir. Er erklärte, daß sich die alten Mißverständnisse wegen der Pariser Verhandlungen endlich aufgeklärt hätten, und daß der Erhabene nun vollkommen gerechtfertigt wäre...«
Abwehrend hob der Oberpriester die Hand und unterbrach den Tempelschüler, der in gleichmäßig singendem Ton vorlas.
»Es ist gut, Nen Vinai. Geh zur unteren Terrasse und warte dort, bis ich dich rufe.«
Wieder legte der junge Mönch die gefalteten Hände an die Stirn und verneigte sich dreimal so tief, daß er den Boden berührte. Dann machte er noch eine Verbeugung und entfernte sich mit gemessenen Schritten.
Fünf Jahre lang hatte Prinz Akani in stiller Zurückgezogenheit gelebt und sich durch Gebet und Meditation von allen äußeren Einflüssen abgeschlossen. Und nun kam wie ein Ruf aus der Welt des Trugs und Scheins dieser Brief, der die Vergangenheit wieder lebendig machte.
Rückschauend wandte Somdet Akani den Blick nach innen.
Wie sehr hatten die »Mißverständnisse«, die seine Schwester in dem Schreiben erwähnte, vor Jahren sein Leben verbittert!
Auch er hatte, wie alle anderen Prinzen des Königlichen Hauses, eine sorgfältige Erziehung erhalten und war in dem Glanz und der Pracht des Hofes aufgewachsen. Aber schon von früher Jugend an fühlte er sich zu Meditationen und stillen Betrachtungen hingezogen. Er mied die lauten, rauschenden und prunkvollen Feste und widmete schließlich sein Dasein ganz der Buddhareligion. Ähnlich wie Gautama Buddha entsagte auch er der Welt und wurde Mönch im Tempel Bovoranivet, in dem auch andere Angehörige seiner Familie längere oder kürzere Zeit zu frommen Übungen verweilten.
Er fühlte sich glücklich im Schutze des Klosters, und seine glänzende Begabung fiel bald auf. Mit der größten Auszeichnung bestand er alle Prüfungen in der heiligen Palisprache und erwarb schon in jungen Jahren den Titel eines Maha der höchsten Ordnung. Aber erst auf besondere Bitten seines Bruders, des Vaters des jetzigen Königs, verließ er mit sechsundzwanzig Jahren den Orden und trat in den diplomatischen Dienst.
Schon nach kurzer Zeit zeigten sich seine Klugheit und sein Takt auch in weltlichen Dingen, und bald wurde er Botschafter in Paris. Damit stand er auf dem wichtigsten Posten, den Siam damals im Ausland unterhielt. Mit Umsicht, Scharfblick und Geistesgegenwart verhütete er, daß Frankreich und England bei den diplomatischen Verwicklungen sein Vaterland gefährdeten, und nur seiner persönlichen Geschicklichkeit war es zu danken, daß Siam ein selbständiges Königreich blieb.
Aber nachdem er die Hauptgefahr abgewandt hatte, vergaß man seine Verdienste sehr bald. Sein Bruder, der große König Paramin, starb, und ein Neffe des Prinzen Akani kam auf den Thron. Eifersucht und Neid regten sich, andere strebten nach dem begehrenswerten Posten in Paris und stürzten Akani durch Verleumdungen. Vor sechs Jahren rief man ihn aus Frankreich ab und forderte ihn auf, sich in Bangkok vor dem König zu verantworten.
Diese bittere Erfahrung wurde zum Wendepunkt seines Lebens. Müde von all dem Hader und den Intrigen, blieb er auf der Rückreise in Ceylon, nahm wieder das gelbe Gewand, kehrte zu dem Gesetz Buddhas zurück und ging aufs neue ins Kloster.
In der ersten Zeit sehnte er sich oft nach Rechtfertigung, und in seinem Herzen brannte der Wunsch, daß die Wahrheit und seine Unschuld ans Licht kommen möchten. Aber allmählich überwand er den Ehrgeiz und fand Frieden und Ruhe in der Abgeschiedenheit seines Lebens.
Die Oberpriester von Ceylon beurteilten ihn richtig, und er stieg von Stufe zu Stufe. Vor einem halben Jahr war er höchster Oberpriester von Ceylon, dem alten Glaubensland der Buddhareligion, und damit das Haupt der südbuddhistischen Kirche geworden.
Es war nicht außergewöhnlich, daß man einen Siamesen zum höchsten geistlichen Würdenträger Ceylons wählte. Häufig wurden auch Ceylonesen Äbte in siamesischen Hauptklöstern, und es bestand von jeher ein reger Verkehr zwischen der Insel und dem hinterindischen Königreich. Der Überlieferung nach sollen die ersten buddhistischen Missionare aus Ceylon nach Siam gekommen sein.
Nicht wegen seiner königlichen Abstammung, sondern um seiner Persönlichkeit willen hatten die ceylonesischen Oberpriester Somdet Akani zu dieser hohen Stellung berufen.
Und jetzt, nachdem ihn Wunsch und Sehnsucht kaum noch berührten, kam die Rechtfertigung, auf die er früher so schmerzlich gewartet hatte.
Langsam öffnete er die Augen und las weiter.
»Der König erhofft nichts sehnlicher als die Rückkehr des Erhabenen in die Heimat. Er klagte über die Unzuverlässigkeit und Unfähigkeit der höchsten Beamten, und er würde sich freuen, wenn Prinz Akani sein hohes, kirchliches Amt niederlegen und den Posten eines Ministerpräsidenten von Siam annehmen würde. Wenn der Erhabene dies aber nicht mit seinen Pflichten gegen die Buddhareligion vereinbaren könne, möge er doch seinen Wohnsitz nach Bangkok, der Stadt des großen Engels, verlegen. der König würde sich glücklich fühlen, wenn er zu ihm als Oberpriester von Siam und der ganzen südbuddhistischen Kirche die Hände erheben dürfte, und wenn er in wichtigen Fragen den Rat des Erhabenen einholen könnte...«
Somdet Akani war weit vorgeschritten in der Erkenntnis, und das Schicksal hatte ihn gelehrt, daß alle irdischen Ehren und Würden eitel und vergänglich sind. Der Hauch eines schmerzlichen Lächelns glitt über seine ebenmäßig schönen Züge, als der Brief seiner Hand entsank.
Die Sonne zog auf ihrer Bahn weiter zum Westen und neigte sich zum Horizont. Die Zeit der Abendkühle brach an, die leichte Brise von Westen frischte auf und brachte lieblichen Wohlgeruch aus den Gärten von Peradenya.
Als sich Somdet Akani endlich aus seiner vorgebeugten Meditationsstellung aufrichtete, drang die mahnende Stimme der Glocken zu ihm herauf. Unten standen Tempeldiener mit nacktem Oberkörper und sehnigen Armen und schlugen mit schweren, gekrümmten Bambuswurzeln von außen an den Rand der gewaltigen Bronzeglocken, weit ausholend, wuchtig und in langen Abständen. Dann wurden die Schläge immer schneller und nahmen an Kraft ab, bis sie endlich in einem langen Wirbel verebbten.
Zum erstenmal seit langen Jahren kam dieser Ruf zum Abendgebet dem Oberpriester überraschend. Heute fehlte ihm die innere Ruhe, heute konnte er nicht im Haupttempel auf seinem hohen Thron zur Linken des großen, goldenen Buddhabildes die Versammlung der Mönche leiten und mit erhobener Stimme den Chorgesang beginnen...
»Nen Vinai!«
Der Tempelschüler erschien wieder, um das Gebot seines Meisters entgegenzunehmen.
»Geh zum Abt Rajakanat und sage dem Ehrwürdigen, daß er den Vorsitz beim Abendgebet führen möge. Ich habe meine Meditation noch nicht abgeschlossen und bleibe auf dem Berge. Später komme ich zum Kloster hinunter.«
Die Natur atmete auf nach der Sonnenglut des Tropentages, und die Vögel sangen und zwitscherten, während im Tal die gelbgekleideten Gestalten der buddhistischen Priester einzeln und in Paaren aus den Kudis, ihren Wohnungen, über die gepflasterten Straßen der Mönchsstadt zu dem Haupttempel pilgerten. Im Abendwind klangen die Glöckchen an den Kanten der Dächer fein und silbern wie an den Palästen der dreiunddreißig Götter im Dusitahimmel.
Von der Spitze des Berges sah man unten den großen Tempel mit den ausgedehnten Klostergebäuden und den Wohnungen für viele hundert Mönche. Der wohldurchdachte Plan der Bauten mit der strengen Durchführung der Achsen war genau zu erkennen. Wie bei den meisten buddhistischen Tempeln verlief auch hier die Hauptachse von Westen nach Osten, und alles gruppierte sich um das gewaltige Buddhabild aus Bronze, das auf einem Schlangenthron nach Osten schaute. Darüber erhob sich der Haupttempel, der Mittelpunkt der ganzen Anlage.
Die Tempelstadt mit ihren vielen Bauwerken und das Kloster bildeten eine Welt für sich, genau ausgerichtet nach den vier Ecken der Erde. Wenn sich die Sonne erhob, fielen ihre Strahlen durch das große Portal im Osten des Haupttempels und ließen die mächtige Goldstatue des Gautama Buddha in rötlichem Feuer erglühen.
Drei Mauern und Wandelgänge umgaben den Haupttempel, damit ihn die Gläubigen durch dreimaliges Umwandeln zur Rechten ehren konnten. Rechts vom Hauptbuddhabild, im Süden – der Gegend des Lebens –, lag die Wohnstadt der Mönche, im Westen, im Rücken des Buddhabildes – der Gegend des Untergangs und des verlöschenden Lebens –, sah man die Verbrennungsanlage für die Gestorbenen, und links, im Norden – der Gegend des Todes –, erhoben sich zahlreiche spitze, turmartige Grabmäler, in denen die Asche der toten Äbte und Mönche beigesetzt worden war. Dies entsprach genau dem Gang der Sonne, des Jahres und des Lebens.
In ewigem Kreislauf reihte sich Wiedergeburt an Wiedergeburt, bis der einzelne Mensch durch rechten Wandel auf dem achtteiligen Pfad Buddhas das Nirwana erlangte, die Erlösung aus der ewigen Verstrickung der Wiedergeburten.
Der Blick des Oberpriesters fiel auf einen großen, schneeweißen Prachediturm im Westen des Klosters, den die Strahlen der sinkenden Sonne in flammendes Rot hüllten. Diesen schönen Bau hatte Somdet Akani während der letzten Monate nach eigenen Plänen zu Ehren der Buddhareligion errichten lassen, und an diesem Morgen hatte er selbst die Weihe vollzogen. Weit und mächtig luden die Profile des Sockels aus, der die gewölbte Glocke, den Hauptteil des Gebäudes, trug. Hier hatte der Oberpriester mit eigener Hand die kostbaren, echten Buddhareliquien beigesetzt, die die Farbe vertrockneter Pikunblumen hatten und die er auf einer Pilgerfahrt aus den Tempelruinen von Nordindien geholt hatte.
Es war wie eine Ironie des Schicksals, daß ihn gerade an diesem Abend die Rückberufung an die Spitze der siamesischen Regierung erreichte, denn am Morgen hatte er alle seine prächtigen, mit Brillanten geschmückten Orden und Großkreuze und all die leuchtenden Seidenschärpen in einer Nische unter der Glocke des Prachedis eingemauert. Durch diese Handlung hatte er symbolisch zum Ausdruck gebracht, daß er der Welt für immer entsagen wolle.
Hellgrüne Lichter durchzogen in glühendem Farbenspiel das Purpurrot des Abendhimmels. In der kurzen Zeit vor dem Untergang der Sonne wirkte die wundersame Schönheit der Tropennatur wie ein phantastisches Märchenbild. Die Luft erschien durchsichtig und rein, und selbst ferne Orte und Städte rückten näher und zeigten sich dem Blick in eigenartiger Klarheit.
Der Nen mußte unten im Kloster angekommen sein, denn der Chorgesang der Mönche tönte herauf, getragen von der Fläche des Sees – uralte Sanskritworte, die schon vor Hunderten und Tausenden von Jahren die Buddhagemeinde täglich bei Auf- und Untergang der Sonne zum Preise des Vollendeten betete.
Immer berückender dufteten die Blüten, und da und dort tauchte aus dem Dunkel der Büsche und Sträucher das magisch phosphoreszierende Licht eines Glühkäfers auf. Die grauvioletten Schatten wurden tiefer, aber Somdet Akani bemerkte es nicht.
Die feierlichen Gebete der Mönche verhallten, und der leuchtende Tag erstarb. Die Dunkelheit brach herein, und Finsternis löschte die tanzenden Lichter auf den wildverschlungenen Goldornamenten der Tempeldächer aus.
Die große Stille der tropischen Nacht senkte sich über die Erde.
Und es war, als ob Mara, der böse Teufel, der Fürst der Hölle, an Akani heranträte und ihm alle Schätze der Welt und ihre Herrlichkeiten zeigte, wie er einst den erhabenen Gautama Buddha selbst versucht hatte.
Lange hatte der Erhabene als Aszet die Vollendung gesucht. Als Prinz im Palast seines Vaters hatte er sie nicht gefunden, und auch später nicht, als er in die Heimatlosigkeit hinauszog, um als Bettelmönch zu leben. Aber dann erlangte er in einer Nacht unter einem großen Feigenbaum die Erkenntnis von Gut und Böse, von Leben und Tod, von Werden und Vergehen. In jener Nacht wurde ihm der Urgrund aller Dinge klar, der Zusammenhang und die logische Verkettung von Geburt, Leben, Sterben, Tod und Wiedergeburt. Auch das Gesetz von Ursache und Wirkung erkannte er: daß Sehnsucht und Begierden, daß Haften an diesem Dasein nur neues Leiden erweckt, und daß alles Leben nur zum Leiden führt.
Als er sich dann zur höchsten Erkenntnis, dem Weg zur Befreiung vom Leiden, durchrang, wurde er der Buddha, und alle Himmel erdröhnten. Mara aber, der Böse, wußte, daß es mit seiner Herrschaft zu Ende sein würde, wenn der Erhabene die Menschheit durch seine Lehre erlöste. So trat er zu ihm und versuchte ihn.
Und auch Akani glaubte aus dem Dunkel der Nacht Maras betörende Worte zu hören:
»Bist du nicht ein Prinz aus dem Geschlecht der Mahachakri, der Königsfamilie von Siam, die von dem allgewaltigen, strahlenden Gott Wischnu selbst abstammt? Dich hat man in der höchsten Not gerufen, als alle anderen versagten, du hast dein Vaterland vor dem Zusammenbruch und dem Verderben bewahrt. Was wäre heute die Königsfamilie, was wäre ganz Siam ohne dich?«
Tief lagen die Schatten über Baum und Gebüsch, über Berg und Tal, und aus der Finsternis tönten die Stimmen der Tropennacht. Ein hastiges Rascheln, ein halberstickter Schrei – herrschte nicht überall Kampf, galt nicht immer das Recht des Stärkeren? War er, Prinz Akani, nicht der Stärkste von allen, die durch Abstammung ein Recht auf den Thron Siams hatten? Er allein konnte die großen Aufgaben lösen, die das Schicksal seinem Lande gestellt hatte.
Die Einwohner des heutigen Siam waren nur ein kleiner Teil der Thairasse. Viele ihrer Stämme standen unter englischer, französischer und chinesischer Herrschaft. War nicht er von der Vorsehung dazu auserwählt, alle Thaivölker unter dem Zepter einer buddhistischen Dynastie zusammenzubringen?
Was war aus dem Reich des großen siamesischen Königs Pra Ruang geworden, der im dreizehnten Jahrhundert fast alle Thaivölker geeint, dessen Macht sich auf die südliche Hälfte Jünnans und große Teile Sumatras und Javas erstreckt hatten? Schmachteten nicht viele Millionen Laoten unter französischer Herrschaft? Sandten nicht die unterworfenen Laosfürsten aus Französisch-Hinterindien jährlich heimliche Tributgesandtschaften an den König von Siam? Warteten nicht alle Völker im Südosten Asiens auf die Befreiung von den weißen Teufeln?
Mußte der Buddhismus unter der Knechtschaft fremder Staaten verkümmern? Leistete Prinz Akani seiner Religion nicht einen viel wertvolleren Dienst, wenn er wieder in die Welt zurückkehrte und sich eine äußere Machtstellung schuf, um Buddhas Lehre und die Gemeinde seiner Jünger zu schützen? Rechtfertigte das nicht die Flucht aus Buddhas Gesetz?
Mit angehaltenem Atem und ein wenig vorgebeugtem Oberkörper, unbeweglich wie eine Statue, saß der Oberpriester. Seine Hände ruhten im Schoß, die rechte lag flach in der linken. Seine Augenlider waren halb geschlossen, und er hatte den Blick nach innen gewandt.
Erst während der zweiten Nachtwache erhob er sich und stieg mit rüstigen Schritten zu Tal. In der großen Löwenstellung, in der auch schon der Vollendete geruht hatte, ließ er sich auf seinem Lager nieder und stützte den Kopf in die rechte Hand. Eine Lampe, deren Docht mit Kokosöl gespeist wurde, verbreitete nur spärliches Licht in dem einfachen Raum.
Nach hartem Widerstreit seiner Gedanken und Gefühle hatte sich Akani zu dem Entschluß durchgekämpft, auf Ceylon zu bleiben. Seine Lippen brannten, und er tastete nach der Schale kalten Tees, die neben seinem Lager stand. Eine köstlich kühle Nachtbrise wehte zum Fenster herein, milderte die Hitze und verscheuchte die in hohen Tönen summenden Moskitos.
Bei dem flackernden Schein des Lichtes las Akani den langen Brief seiner Tochter Amarin, der dem Schreiben seiner Schwester beigefügt war. Sechs Jahre lang hatte er sie nicht mehr gesehen, und er liebte sie sehr.
Welche Kämpfe und Irrungen mochten ihr in dieser Daseinsform noch bevorstehen? Wie gestaltete sich wohl ihr Schicksal? Würde auch sie das köstliche Nirwana erlangen, geläutert durch die Erkenntnis vom Leiden?
Aber für den Jünger Buddhas gibt es keine Familie. Er ist hinausgezogen aus der Heimat in die Heimatlosigkeit, und er darf selbst seiner nächsten und liebsten Angehörigen im Gebet nur wie aller anderen Menschen und der gesamten leidenden Natur gedenken.
* * *
Als Nen Vinai in der Mitte der dritten Nachtwache leise den Raum betrat, um neues Kokosöl auf die Lampe zu gießen, weilten die Gedanken des Oberpriesters nicht mehr bei Prinzessin Amarin oder der politischen Zukunft seines Landes. Er war den verführerischen Einflüsterungen des Bösen nicht erlegen und hatte sich wieder tief in die erhabene Lehre des Vollendeten versenkt.
Erst im Morgengrauen beendete er seine Meditation und legte das Haupt zu kurzer Ruhe auf die harte, hölzerne Stütze. Eine runde Vertiefung hielt den Kopf auch während des Schlafes, damit er nicht zur Rechten oder zur Linken sinken konnte, sondern stets in der vorgeschriebenen Richtung nach Osten gewandt blieb.
2
»Hallo, Ronnie!«
Im dichten Menschengewühl drehte sich ein junger Mann um, dessen schlanke, sehnige Gestalt sofort den Engländer verriet. Er schüttelte dem Freund aus Cambridge vergnügt die Hand.
»Warwick, alter Junge, warum kommst du denn erst jetzt auf die Rennbahn? Hast mich ja schön warten lassen!«
»Kaufleute in Bangkok haben eben mehr zu tun als so ein reicher, träger Globetrotter wie du, der nur zum Spaß in der Welt herumreist, um sich andere Länder und Leute anzusehen. Sei zufrieden, daß ich dich heute morgen in diesem wildfremden Land vom Dampfer abgeholt und sicher im Dusit-Hotel untergebracht habe!«
Ronnie Maynard schlug Warwick Warbury geräuschvoll auf die Schulter.
»Ja, das hast du fein gemacht, alter Luftbrummer und Kriegskamerad, aber ich würde deshalb den Mund nicht zu weit aufreißen, denn sich selbst zu loben schickt sich nicht. Aber du hast mich wirklich glänzend versorgt, wie eine Amme ihr Baby, das will ich gern anerkennen«, entgegnete er und lächelte den Freund mit seinen offenen blauen Augen strahlend an. Schon auf der Universität hatte er zu dem älteren Kameraden aufgeschaut. »Ich freue mich ja so unbändig, daß ich dich einmal wiedersehe und wie früher mit dir reden kann, Warwick, altes Haus!«
» Pai läo – pai läo – sie sind ab!« ertönten plötzlich laute Rufe aus der Menge.
Das Feld war eben gestartet, und wie elektrisiert folgten die Zuschauer dem Verlauf des Rennens. Aber nirgends herrschte unangenehmes Gedränge, die Leute nahmen Rücksicht aufeinander.
»Wir wollen doch lieber auf die Tribüne gehen, damit wir auch etwas sehen«, schlug Ronnie vor und schaute sich nach der Bahn um. Er nahm Warwicks Arm, und sie stiegen die breite Holztreppe hinauf. Überall bewegten sich festlich geschmückte Menschen unter den farbigen Sonnensegeln.
Warwicks imponierende Gestalt zog viele Blicke auf sich. Seine sonnengebräunten, scharfgeschnittenen Züge sprachen von langem Aufenthalt in den Tropen. Er war nicht schön im landläufigen Sinne des Wortes, aber sein glattrasiertes Gesicht fesselte durch den ruhigen Blick seiner blauen Augen, die sich reizvoll von den schwarzen Haaren abhoben.
»Fast könnte man denken, wir seien in Epsom«, meinte er. »Die Rennbahn ist genau so ellipsenförmig und langweilig. Auch hier Pferde, Schiedsrichter, bunte Jockeis, Waage, Totalisator, Sattelplatz, Buchmacher –«
»Die Menschen machen aber doch einen ganz anderen Eindruck«, unterbrach ihn Ronnie lebhaft, der seine Umgebung neugierig musterte. »Soviel Brillanten, Rubinen und Smaragde, wie heute nachmittag hier getragen werden, gibt es ja kaum in ganz England! Die Leute müssen unheimlich viel Kröten haben! Und wieviel verschiedene Volkstypen man hier beobachten kann – die reinste Arche Noah!«
»Ruhe, Ronnie! Hier versteht fast jeder Englisch, und wir Europäer sind sowieso nicht besonders beliebt. Das Selbstbewußtsein der Asiaten ist in den letzten Jahren bedeutend gestiegen, und sie sind für Kritik doppelt empfindlich geworden. Du mußt dich mehr in acht nehmen.«
Die Menge verfolgte gebannt das Rennen, und alle Blicke waren auf die große Kurve gerichtet, in die das Feld jetzt einbog.
Auch Ronnie hatte sein Glas eingestellt.
»Ramesuen liegt vorn!« rief er aufgeregt.
»Das hat noch nichts zu sagen.«
»Doch – ich habe auf den Gaul hundert Tikals gesetzt! Er muß unbedingt zuerst durchs Ziel gehen.«
Warwick, den das Rennen weniger interessierte, lächelte nur und grüßte dann zur Loge des englischen Gesandten hinüber.
Sir John Brakenhurst dankte. Seine vornehme, etwas hagere Gestalt mit der leicht vorgeneigten Haltung ließ den alten, erfahrenen Diplomaten erkennen.
Reges Treiben herrschte auf der nach englischem Muster angelegten Rennbahn der siamesischen Hauptstadt, deren Einwohnerzahl schon seit einigen Jahren die Millionengrenze überschritten und Peking überflügelt hatte.
Auch der König und die Königin waren erschienen und schauten von einer besonderen Tribüne aus dem Rennen zu. Darüber war in altsiamesischen, prunkvollen Formen eine offene Halle errichtet. Die Sonnenstrahlen spiegelten sich in dem kunstvollen Mosaikwerk und den herrlichen Schnitzereien der übereinandergetürmten Dächer wider, die von schlanken Teakholzsäulen mit Lotoskapitellen getragen wurden. Strahlend hob sich das flammende Gold des königlichen Pavillons von dem tiefblauen Tropenhimmel ab.
Auch die verschiedenen Gesandten der europäischen und exotischen Staaten, der ganze Hof und der siamesische Adel hatten sich zu dem Rennen eingefunden, und es bot sich den Blicken ein farbenprächtiges Bild von brokatdurchwirkten Seidengewändern und kostbaren Juwelen. Man konnte Vertreter fast aller Völker bemerken, die innerhalb der Grenzen Siams wohnten. Die ernsten, schweigsamen Laoten trugen ihre alte Landestracht: schwarzseidene, enganliegende Gewänder mit Goldknöpfen aus Filigranarbeit. Die Birmanen erschienen in ihren typischen Kopftüchern. Auch Peguaner waren zu sehen und schöne Monmädchen mit langem, blumengeschmücktem Haar und heiteren, allzu bereit lachenden Augen.
Brillantengeschmückte Goldknöpfe zierten die enganschließenden Leinenröcke der siamesischen Adeligen, die ihre bauschigen, blauseidenen Panungs in der malerischen Form weiter Pluderhosen geschlungen hatten. Viele Damen der siamesischen Gesellschaft hatten elegante europäische Kleidung angelegt, aber manche trugen auch noch das alte Nationalkostüm und dieselben Panungs wie die Männer.
»Warum haben eigentlich alle Siamesen dunkelblaue Beinkleider?« fragte Ronnie interessiert.
»Weil heute Donnerstag ist«, antwortete Warwick.
»Aber das ist doch kein Grund! Das soll ich mir einreden lassen?«
»Du wirst es gleich verstehen. Der Donnerstag steht unter der Herrschaft des Planeten Jupiter, der nach siamesischer Auffassung dunkelblaue Farbe hat. Deshalb tragen die Leute hierzulande an diesem Tag dunkelblaue Panungs.«
»Fabelhaft!« rief Ronnie begeistert. »Und wie ist es an den anderen Wochentagen?«
»Das erzähle ich dir später einmal genauer, jetzt führt es zu weit. Aber sieh dir einmal die reichen chinesischen Kaufleute dort an, die mit ihren herrlichen Kostümen prunken. Die haben sie den Staatskleidern der höchsten Mandarinen genau nachbilden lassen, und hier in Bangkok, außerhalb der Grenzen des Chinesischen Reiches, können sie diese Gewänder ungestraft tragen.«
In der Menge der Zuschauer befanden sich verhältnismäßig nur wenig Europäer; in ihren schneeweißen Anzügen, Schuhen und den breitrandigen Tropenhüten wollten sie nicht recht in die bunte Farbenpracht der Tropen passen. Außer der besten siamesischen Gesellschaft waren auch Parsenkaufleute und Inder erschienen, die sich in der Hauptstadt des Landes niedergelassen hatten und dort heimisch geworden waren.
Viele Siamesen trugen Uniform. Das Nationalbewußtsein war seit dem Weltkrieg bedeutend gestiegen, das Volk war stolz auf das Heer, die Marine und besonders auf die Luftwaffe.
Zahlenmäßig waren die Chinesen neben den Siamesen an erster Stelle vertreten, aber auch die Japaner fehlten nicht. Früher hatte man die Siamesen geringgeachtet, aber seitdem sich ihr Land als Macht neben den anderen asiatischen Mächten fühlte, gewannen sie immer größeren politischen Einfluß.
»Es ist unglaublich!« Ronnie hielt nervös das Glas und packte seinen Freund mit der anderen Hand am Arm. »Ramesuen hält nicht durch!«
Die Reiter kamen jetzt von der anderen Seite her in Sicht, und unter den ersten fiel ein feuerroter Jockei auf einem schwarzen Pferd auf.
»Hanuman!« schrien einzelne, dann schwollen die Rufe immer lauter an.
Die Pferde fegten vor der Tribüne vorbei und passierten das Ziel.
»Hanuman! Hanuman hat gewonnen!« ertönte es begeistert von allen Seiten.
»Verdammt, und ich hatte doch auf Ramesuen gesetzt!« brummte Ronnie ärgerlich.
Alles strömte nun zum Totalisator. Warwick ging mit Ronnie zur Waage, wo die Pferde einzeln vorbeikamen, zuerst der von der Menge umjubelte Hanuman.
»Schade, daß du mich nicht eher gefragt hast, Ronnie. Du hättest natürlich wissen müssen, daß Hanuman aus dem königlichen Marstall kommt. Gegen den darf doch kein anderes Pferd gewinnen.«
»Also eine ganz gemeine Schiebung!« erklärte Ronnie empört.
»Ruhe, sei doch nicht so unvorsichtig! Und sprich nicht so laut. Wir sind hier in einem absolut regierten Land. Eine Schiebung kannst du das außerdem nicht nennen. Wenn ein Pferd aus dem königlichen Marstall an einem Rennen teilnimmt, wagt eben niemand, ein besseres und schnelleres aufzustellen. Die Leute sind hier monarchistisch-loyal.«
Indische Buchmacher zahlten die Gewinne aus, die diesmal sehr niedrig ausfielen, da in Siam nur Ausländer gegen ein Pferd des Königs wetten.
Am Totalisator drängten sich Vertreter aller Nationalitäten: reiche Chinesen in violettseidenen Anzügen und großen, breiten Panamahüten, persische Kaufleute in Gehrock oder schwarzem Kaftan, Malaien von der südlichen Halbinsel mit edelsteingesckmückten Dolchen im Gürtel, und Inder mit ihren Frauen, die in auffallend bunte Seide gekleidet waren und reichen Brillantschmuck trugen.
Dazwischen blitzten die feuerroten, goldgestickten Uniformen der Gardekapelle auf, die in der Pause konzertierte und die neuesten amerikanischen und englischen Schlager spielte. Die Musiker waren mit den dazu nötigen Instrumenten und allen Arten von Saxophonen ausgerüstet.
»Weißt du, wer von unseren Bekannten aus Cambridge noch hier ist?« fragte Warwick. »Dort hinten in der Loge des Königs steht Prinz Surja.«
»Donnerwetter, das ist er wirklich! War eigentlich früher ein ganz netter Kerl. Kommst du oft mit ihm zusammen?«
»Nein. Das ist hier anders als in England. Er hat übrigens gute Karriere gemacht – zur Zeit führt er das Kommando über die Torpedobootflottille, außerdem untersteht ihm das Marineflugwesen.«
»Ich muß ihm sofort die braune Männerpranke schütteln«, sagte Ronnie freudig. »Wir wollen gleich zu ihm gehen.«
»Ich möchte nicht zur Hofloge«, wehrte Warwick ab. »Ich muß noch einige andere Bekannte sprechen.«
»In die Hofloge selbst gehe ich auch nicht, ich lasse ihn herausbitten. Wir können uns ja nachher bei dem Musikpavillon wiedertreffen.«
»Nimm dich aber in acht mit ihm – er ist ein eifriger Vorkämpfer für den Zusammenschluß aller asiatischen Staaten unter Japans Führung, und er haßt die Europäer«, warnte Warwick leise.
Ronnie Maynard nahm die Ermahnung aber nicht besonders ernst, denn seiner Meinung nach war sein Freund immer zu vorsichtig und zu skeptisch.
Als er in seinem hochmodernen, etwas auffälligen Anzug davoneilte, schaute ihm Warwick lächelnd nach. Schon in England war Ronnie dafür bekannt gewesen, daß er seine Freunde häufig zur Unzeit überfiel und gewöhnlich dort erschien, wo man ihn am wenigsten erwartete. Was für ein Gesicht würde Prinz Surja wohl machen, wenn Ronnie plötzlich vor ihm auftauchte?
Warbury richtete sich zu seiner vollen Größe auf und sah sich auf den weiten Tribünen um. Er blickte oft mit verengten Augen, wenn er in die Ferne sah, wie Leute, die häufig der blendenden Tropensonne ausgesetzt sind.
Plötzlich bemerkte er den englischen Gesandten, der auf ihn zukam und ihn freundlich begrüßte.
Sir John Brakenhurst trug einen rohseidenen Anzug von dunkler Tönung. Sein Tropenhut war mit demselben Stoff überzogen und geschmackvoll mit einem dazu passenden braunen Band garniert. Trotz eines fast dreißigjährigen Tropendienstes hatte er sich vorzüglich gehalten, und man sah ihm seine fünfzig Jahre nicht an. Ein starkes, etwas vorspringendes Kinn betonte die energischen Züge seines glattrasierten Gesichts, und sein Auftreten verriet den vornehmen Weltmann.
»Ich kann Ihnen gratulieren, mein lieber Warbury, die siamesische Regierung hat die Konzession für Ihre Reisplantagen bewilligt.«
»Auf Ihren Rat hin konnten wir die Sache ja auch glänzend vorbereiten. Sie sind ein Menschenkenner, Sir John. Kleine Geschenke – zur rechten Zeit, am rechten Platz!«
»Ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, daß man in solchen Fällen durch Großzügigkeit zum Ziel kommt. Und das Geschenk an den Prinzen Murapong wird wohl nicht zu unbedeutend ausgefallen sein«, entgegnete Sir John. Ein humorvoll ironisches Lächeln spielte um seinen Mund, und in seinen Augenwinkeln zeigten sich viele Lachfältchen. »Aber für die Firma Breyford sind das natürlich nur Kleinigkeiten.«
Aus vielen Gründen war der Gesandte Warwick besonders gewogen. Er schätzte in ihm einen der besten Vertreter der englischen Nation auf diesem vorgeschobenen Posten, und er achtete ihn, weil sich Warwick im Weltkrieg als verwegener Kampfflieger ausgezeichnet hatte. Abgesehen davon, war Warbury ein vorzüglicher Sportsmann, mit dem man ausreiten, Polo und Golf spielen konnte. Auch über siamesische Verhältnisse war er sehr gut unterrichtet und hatte Sir John schon manche wichtige Nachricht zukommen lassen.
»Ihre Stellung bei Breyford wird sich ja jetzt wohl bald ändern, wenn ich recht gehört habe?«
Warwick lachte nur, und nach einigen liebenswürdigen Worten verabschiedete sich der Gesandte wieder von ihm.
Gleich darauf fühlte Warwick, daß ihn jemand am Arm packte, und als er sich umwandte, sah er Ronnie in Gesellschaft des Prinzen Surja vor sich. Er begrüßte den Siamesen mehr höflich-formell als herzlich.
Der Prinz war kleiner als Ronnie. Seine etwas weichen, regelmäßigen Züge machten einen sympathischen Eindruck, und unter seinen Landsleuten galt er als Schönheit. Wenn er den Mund öffnete, blitzten seine weißen Zähne herausfordernd zwischen den braunroten, bogenförmig geschwungenen Lippen. Die Uniform bedingte eine militärische Haltung, aber seine Bewegungen wirkten abgerundet und gleitend. Seine dunklen Augen hatten einen leicht melancholischen Ausdruck, doch leuchteten sie manchmal in der Erregung leidenschaftlich auf.
»Mir scheint, daß erst ich nach Siam kommen muß, um die alten Kameraden von Cambridge wieder einmal zusammenzubringen!« erklärte Ronnie gönnerhaft.
Surja und Warwick lachten über seinen Eifer; beide kannten ihn gut genug.
»Ronnie Maynard hat mir eben erzählt, daß er ein Tagebuch über seine Weltreise herausgeben will. Wer hätte früher gedacht, daß er einmal unter die Schriftsteller gehen würde!« sagte der Prinz.
»Ihr Siamesen müßt euch ordentlich anstrengen, damit ihr gut abschneidet. Ich habe eine seltene Beobachtungsgabe, und man fürchtet meine scharfe Feder. Oh, ich kann Zustände geißeln!« erwiderte Ronnie überzeugt.
»Nun, dann wollen wir uns dementsprechend in acht nehmen«, entgegnete Surja verbindlich. Aber er warf ihm einen lauernden Blick zu, der Warwick nicht entging. »Siam wird ausgerechnet auf dich gewartet haben«, bemerkte Warwick belustigt, um Ronnies überhebliche Worte etwas abzudämpfen.
»Das hoffe ich. Ein Land wie Siam muß erst entdeckt werden, ich meine, richtig entdeckt werden von einem Mann, der Bücher schreibt, ein unbestechlicher Beobachter ist und ein umfassendes, weitschauendes Urteil hat«, erwiderte Ronnie, ohne den leisen Spott seines Freundes zu fühlen.
»Damit meinst du wohl dich selbst?«
»Natürlich! Übrigens gibt es unter den Siamesinnen Mädels von außerordentlicher Schönheit. Zu Anfang wollten Sie mir allerdings gar nicht gefallen«, versicherte Ronnie und sah sich wohlwollend um.
Surja warf unmerklich den Kopf zurück, und seine feurigen Augen blitzten warnend unter den kühngeschwungenen, schwarzen Brauen. Das anmaßende Wesen des jungen Engländers kränkte sein Nationalgefühl, und Ronnies letzte Äußerung konnte er nicht unerwidert lassen.
»Es gibt auf der ganzen Erde schöne Frauen – warum sollten denn die Siamesinnen eine Ausnahme machen?« fragte er kühl.
In diesem Augenblick kamen einige Mitglieder des Hofes vorüber, und Ronnie vergaß zu antworten. Neben einer würdigen älteren Dame in mattblauem, silberdurchwirktem Panung ging eine jüngere, die allgemein auffiel. Ihre Erscheinung hatte nichts Europäisches, und doch mußte jeder Europäer ihren rassigen siamesischen Typus als schön und harmonisch empfinden.
Mehrere junge Dienerinnen folgten den beiden. Sie waren in denselben Farben gekleidet wie ihre Herrinnen, und auch sie trugen reichen Schmuck.
Warwick wunderte sich, daß er dieses schöne junge Mädchen noch nicht gesehen hatte, da er doch die höhere siamesische Gesellschaft kannte. Er wußte nur, daß die ältere Dame die Prinzessin Chanda Rajavong war, eine Tante des Königs. Fragend blickte er auf Surja, als ob er von ihm eine Erklärung erwartete.
»Wer war denn dieses entzückende Kind?« erkundigte sich Ronnie hastig. »Bei einer Schönheitskonkurrenz würde ich ihr als Preisrichter alle meine Stimmen geben.«
»Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Amarin, die Tochter des Prinzen Akani. Sie ist erst kürzlich aus Paris zurückgekehrt«, erwiderte Surja steif und von oben herab.
Das letzte Rennen war beendet. Die drei schlossen sich dem Strom der Menge an und wandten sich dem Ausgang zu. Vor dem Hauptportal hielt ein großer Rolls Royce, dahinter ein anderer Wagen. Beide hatten dunkelblaue Farbe und trugen dasselbe feine Silbermonogramm an den Türen. Chauffeure und Diener hatten dunkelblaue Samtuniform mit Silberstickerei, im Ton genau zu den Wagen abgestimmt.
Prinzessin Amarin stieg mit ihrer Tante in das vordere Auto, während die Dienerinnen in dem zweiten Platz nahmen.
Unwillkürlich sah Warwick zu ihr hinüber. Ihre Gestalt und ihr Gesicht wirkten ungewöhnlich fremdartig und reizvoll, und ihre märchenhaft tiefen Augen hatten einen rätselhaften Ausdruck.
Als der Wagen anfuhr, sah sich Amarin um, und die Blicke der beiden trafen sich in kurzem Verweilen.
Es war Warwick, als ob dieses Mädchen plötzlich eine schlummernde Sehnsucht, ein Verlangen nach ungeahnten Wundern in ihm weckte. Traumverloren schaute er ihr nach.
Surja bemerkte es und verabschiedete sich kurz.
Ronnie blieb ihm den Gegengruß schuldig, weil er nur Augen für die junge Prinzessin hatte.
3
Die Menschen, die auf dem Rennplatz zusammengeströmt waren, drängten dem Ausgang zu, und die Polizei hatte Mühe, die Ordnung aufrechtzuerhalten. Aber im Fernen Osten ist eine Menge leichter zu lenken als in Europa. Ein Polizeioffizier hob von einem erhöhten Stand aus plötzlich die Hand und gab ein kurzes Kommando. Darauf bildete sich wie durch einen Zauberschlag eine breite Gasse.
Der König und die Königin verließen den Rennplatz, aber niemand drängte sich neugierig vor. Geduldig und ehrfürchtig warteten die Leute, verneigten sich tief und legten wie betend die Hände zusammen, als die Palastwachen in prunkvoller alter Tracht vorausschritten und das Herannahen des Herrscherpaares ankündigten.
Der König war verhältnismäßig klein. Er trug einen leichten, weißen Leinenrock und einen dunkelblauen Seidenpanung, Schwarzseidene Strümpfe, schwarze Halbschuhe und einen Panamahut. Nicht das geringste Abzeichen seiner hohen Würde war an ihm persönlich zu entdecken, aber hinter ihm gingen Hofbeamte in reichgestickten Uniformen, und einer von ihnen trug den großen, blauseidenen Königsschirm.
»Wozu braucht denn der König einen Schirm?« wollte Ronnie wissen.
»In den Tropen ist es nicht nur angenehm, sondern auch ehrenvoll, unter einem Schirm zu wandeln, und je mehr Absätze dieser hat, desto größere Ehre kommt seinem Besitzer zu. Die Anzahl dieser Stufen muß aber immer ungerade sein.«
»Hat er auch einen blauen Schirm, weil heute Donnerstag ist?«
»Nein. Ich sagte dir doch schon, daß Blau die Farbe des Planeten Jupiter ist, und Jupiter war doch der König unter den Göttern. Also ist seine Farbe auch die des Königs.«
Als die Hofwagen abgefahren waren, wurde die Sperre am Ausgang aufgehoben.
Warwick sah sich nach Marbin, seinem Chauffeur, um und hob die Hand, um sich bemerkbar zu machen. Der Malaie verstand es auch, trotz des starken Verkehrs im richtigen Augenblick vorzufahren. Gewandt steuerte er den offenen Lincoln durch das Gedränge und hielt kurz vor der Stelle, an der Warwick und Ronnie warteten. Dann sprang er behende vom Führersitz und öffnete die Tür.
Warwick nahm am Steuer Platz, und Ronnie setzte sich neben ihn, während sich Marbin hinter den beiden niederließ.
Geschickt brachten die Polizisten vor dem Ausgang des Rennplatzes Ordnung in das Gewimmel der Wagen, aber trotzdem bedurfte es Warwicks voller Umsicht, um in dem Gewühl einen Weg zu finden.
»Glänzende Autostraßen«, meinte Ronnie anerkennend, als sie endlich in die breite Windmill Road einbogen und unter stattlichen Teakbäumen dahinfuhren. »Bin ganz erstaunt über den fortschrittlich modernen Straßenbau in Bangkok. Ich dachte, ihr hättet hier nur armselige Wege für Büffelkarren.«
»Ganz so schlimm ist es doch nicht. Früher waren die Straßen allerdings auch in der Nähe der Hauptstadt entsetzlich schlecht, aber als sich der Vater des jetzigen Königs für den Autosport zu interessieren begann, änderte sich das sehr schnell.«
»Zu schlimm! In diesem absolut regierten Land dreht sich natürlich alles nur um die geheiligte Person des Königs, und an das Wohl des Volkes denkt kein Mensch. Höchste Zeit, daß diese unmöglichen Zustände gegeißelt werden! Ihr Kaufleute könnt das natürlich nicht tun, denn ihr wollt Geld verdienen und müßt deshalb überall Rücksichten nehmen und den Mund halten. Dazu gehört eben ein freier, unabhängiger Schriftsteller, wie ich es bin.«
»Ich weiß wirklich nicht, warum du den Mund aufreißt und was du geißeln willst. Die Straßen in der Hauptstadt und der nächsten Umgebung sind wunderbar gepflegt und stehen der Allgemeinheit zur freien Verfügung. Bei der Ausdehnung dieser Millionenstadt ist das eine Annehmlichkeit, die du nicht unterschätzen darfst. Wie du siehst, fahren zur Zeit der Abendkühle ja auch alle Leute spazieren.«
»Gut und schön. Aber ihr habt keine Landstraßen! Ihr könnt wohl mit euren Autos in der Nähe der Hauptstadt herumkutschieren, aber damit ist es auch aus!«
»So darfst du die Sache nicht auffassen, Ronnie. Gewiß, in Südsiam gibt es keine Landstraßen wie in anderen Ländern, aber dafür haben wir ein ausgedehntes Kanalnetz. Das ist eben durch die Natur der Landschaft bedingt. Die große Menamebene ist durch den Fluß angeschwemmt und vollkommen flach. Kilometerweit erhebt sich der Boden kaum vier bis fünf Meter über den Meeresspiegel. Wenn wir hier Fahrstraßen bauen wollten, müßten sie so gut fundiert sein und so hoch liegen, daß sie nicht überschwemmt werden könnten. Dadurch würden sich aber die Wasserverhältnisse in der Menamebene ändern, und der Reisbau würde darunter leiden.«
Ronnie hörte erstaunt zu.
»Kanäle sind schon das einzig Richtige für Südsiam«, fuhr Warwick fort. »Große Lasten lassen sich auf dem Wasser in Booten viel leichter fortbewegen als auf Landstraßen. Bei der Reisernte stehen außerdem alle Felder unter Wasser, und man kann mit dem Boot überall bequem hinkommen.«
»Das ist ja die verkehrte Welt«, meinte Ronnie lachend, gab sich aber zufrieden.
Bei einer Wegkreuzung stockte der Verkehr. Ein großer, uralter Bo-Baum stand etwas abseits der Straße und reckte seine starken Äste zum Himmel empor. Der dicke, breite Stamm und auch die Zweige waren mit roten Tüchern behangen, und viele Leute machten sich eifrig an dem Baum zu schaffen. Manche standen, manche saßen, aber Ronnie konnte nicht erkennen, was Sie machten.
»Was tun die denn? Beten Sie etwa den Baum an?« fragte er neugierig.
»Nein, Sie wollen in der Lotterie spielen und holen sich hier Rat. Dies ist ein heiliger Feigenbaum, wie sie vielfach auch in den Tempelhöfen stehen. Die graubraune Rinde ist von vielen verschlungenen Adern durchzogen, und die Leute reiben so lange daran, bis sie Zahlen oder Buchstaben in der Maserung zu erkennen glauben.«
Ronnie hatte das Notizbuch aus der Tasche genommen und schrieb schnell, während Warwick weitersprach.
»Diese Zahlen setzen sie dann in der Chinesenlotterie, und wenn sie gewinnen, bringen sie aus Dankbarkeit dem Baum Spenden dar. Manchmal zünden sie auch Kerzen davor an, oder sie hängen Blumengewinde und Kränze in die Äste, oder auch rote und weiße Tücher. All die vielen Goldflitter und Puppen, die du in den Zweigen siehst, sind Opfergaben.«
»Also wird auch dieses arme Volk von der Spielleidenschaft verdorben?« ereiferte sich Ronnie. »Tut denn die Regierung nichts dagegen?«
»Sie ist sehr fortschrittlich, aber Siam ist ein merkwürdiges Land«, entgegnete Warwick nachdenklich. »Du findest hier finsterstes Mittelalter und modernste Einrichtungen dicht nebeneinander. Kein Land des Ostens – mit Ausnahme von Japan – besitzt zum Beispiel ein so vorzüglich ausgebildetes Flugwesen; auch ist das ganze Land von einem Netz von Wetternachrichten- und Meldestationen für den Luftdienst überzogen, die ausgezeichnet arbeiten. Und doch ließ sich Surja, dem auch dieser Dienstzweig untersteht, vom Hals bis zu den Fußgelenken mit magischen Ornamenten tätowieren, um hieb- und schußfest zu werden. Und dabei hat der Mann in Cambridge seine Examina glänzend bestanden und denkt in anderen Dingen ebenso modern wie wir.«
»Nicht möglich! Das ist ja interessanter Stoff für mein Buch!«
»Ich weiß nicht, ob es ratsam ist, eine so hochgestellte Persönlichkeit wie den Prinzen in deinem Buch bloßzustellen. Aber ich kann dir etwas anderes erzählen. Neulich kam zu unserem Gesandtschaftsarzt ein siamesischer Marineoffizier, der eine Schußwunde in der Hand hatte. Der Doktor verband ihn und erkundigte sich dabei, auf welche Weise er die Verwundung erhalten hätte. Der betreffende Offizier ist bei der englischen Marine ausgebildet worden, also schließlich kein Dummkopf.
Zuerst wollte der Mann nicht mit der Sprache heraus, aber schließlich erzählte er doch, daß er sich von einem Beschwörer durch einen Zauber hatte unverwundbar machen lassen. Er hatte ihm dafür achtzig Tikals gezahlt – das sind sechs bis sieben Pfund nach unserem Geld und für einen Siamesen eine beträchtliche Summe. Hocherfreut nahm er, als er zu Haus angekommen war, seinen Browning aus der Schublade, um eine Probe zu machen, und schoß sich durch die Hand. Das Geschoß schlug natürlich glatt durch Fleisch und Knochen.«
»Hoffentlich ist er jetzt von dem Wahnsinn geheilt?« erwiderte Ronnie erregt.
»Die Sache kam dem Marineminister zu Ohren, der sehr aufgeklärt ist und den weitverbreiteten Aberglauben ausrotten möchte. Er ließ den Zauberer und den verwundeten Offizier kommen und wollte den Beschwörer bestrafen.«
»Sicher hat er den Betrüger ins Gefängnis gesteckt!«
»O nein.«
»Aber warum denn nicht?«
»Der Mann sagte ganz einfach, dieser Zauber wäre vor Jahrhunderten, ja vor Jahrtausenden entstanden, und damals hätte es noch keine Browningpistolen gegeben. Für alle anderen Waffen genügte er. Nach Ansicht der Eingeborenen hatte er sich damit gerechtfertigt und konnte nicht bestraft werden.«
Ronnie lachte.
»Hat der Offizier nachher auch noch eine Probe mit einem Dolch gemacht?«
Warwick schüttelte den Kopf und fuhr langsamer, da er dauernd grüßen mußte. Er nannte seinem Freund auch die Namen der Diplomaten und der großen Kaufleute, die an ihnen vorüberkamen. Ronnie hörte aber nur halb hin, denn ihn interessierten viel mehr die schönen Siamesinnen und die Monmädchen, die in einfachen Rikschas ihre abendliche Spazierfahrt machten. Flinke, sehnige Chinesenkulis zogen die leichten Gefährte. Mit erstaunlicher Geschicklichkeit bahnten Sie sich einen Weg durch den dichten Verkehr und schlängelten sich wie Aale zwischen den schnellfahrenden Autos durch.
»Sag mal, Warwick, hast du eigentlich eine braune Frau?« fragte Ronnie plötzlich.
»Wie kommst du denn darauf? Hier in Bangkok haben manche Leute, wenn sie nicht auf europäische Art verheiratet sind, eine Mia, das heißt eine eingeborene Frau. Aber über solche Privatangelegenheiten spricht man selbstverständlich nicht, und man mischt sich auf keinen Fall ein.«
»Ist deine Mia hübsch?«
»Ich sagte dir doch eben, daß man nicht über diese Dinge spricht. Wenn du es aber unbedingt wissen mußt – ich habe keine Mia.«
»Warum denn nicht? Wenn doch die anderen eine haben? Es muß sich eigentlich hier in Siam sehr nett mit einer Mia leben. Ich habe schon auf dem Dampfer gehört, daß sie sehr unterhaltsam sein sollen. Mir kannst du es doch ruhig beichten. Du hast bestimmt eine kleine, hübsche Siamesin, wenn du es auch jetzt abstreitest.«
»Aber nein, ich habe wirklich keine. Außerdem habe ich mich auf meinem letzten Urlaub verlobt.«
Ronnie Sah den Freund verblüfft an.
»Davon weiß ich ja überhaupt nichts! Mit wem denn? Kenne ich Sie auch?«
»Das müßtest du doch erraten – Evelyn Breyford.«
Ronnie verstummte plötzlich, und es dauerte einige Zeit, bis er sich wieder gefaßt hatte.
»Ich gratuliere dir aufrichtig«, sagte er dann feierlich und resigniert.
Warwick erwiderte nichts darauf, und beide schwiegen eine Weile.
Ronnie hatte seine eigenen Gedanken. Er bedauerte sich und fühlte tiefes Mitleid mit sich selbst. Nun wußte er, warum Evelyn seinen eigenen Antrag abgelehnt hatte. Sie liebte einen anderen! – Und ausgerechnet Warwick Warbury, sein bester Freund, war dieser glückliche andere!
Ronnie hatte die beiden nur für gute Sportkameraden gehalten. Allerdings hatte er sich im stillen immer darüber gewundert, daß Evelyn sich so sehr für den Flugsport begeisterte. Nun löste sich dieses Rätsel.
Sie fuhren unter großen, mächtigen Salabäumen dahin, deren weiße Blütenpracht den grünen Blättern fast keinen Raum gönnte, und ein zarter Duft umfing sie. Durch eine breite Wasserfläche von ihnen getrennt, erhob sich zu ihrer rechten Seite der Tempel der Lotosteiche. Feierlich klangen die Glocken des Klosters, die die Mönche zum Gebet riefen. Die Stunde der Abendkühle war herbeigekommen, und alles atmete erleichtert auf nach der Tropenhitze des Tages. Hell glänzten die prachtvoll geschwungenen Dächer der Tempelbauten mit ihren schönverzierten Schlangen- und Drachengiebeln, und in weiter Ferne grüßte der Goldene Berg, der höchste Tempelturm der Hauptstadt. Er war nach dem Weltberg Meru benannt und sollte andeuten, daß Bangkok den Mittelpunkt der Welt bedeutet.
Warwick erklärte all das seinem Freund, und Ronnie, der sich mit größter Begeisterung allen neuen Eindrücken hingab, tröstete sich bald wieder.
»Ein seltsames Volk«, sagte er etwas sprunghaft, als einige Mönche in malerischen, gelbseidenen Gewändern vorübergingen, die sie nach Art einer Toga umgeschlagen hatten. »Ich verstehe nicht, daß hier so viele Männer ins Kloster gehen, wenn es eine Unmenge von schönen Frauen gibt. Es ist nicht zu begreifen, daß ein vernünftiger Mann sein ganzes Leben als buddhistischer Priester vertrauern mag! Ich wäre jedenfalls nicht dafür zu haben.«
»Du machst dir falsche Vorstellungen. Die meisten Siamesen gehen nur vor ihrer Verheiratung einige Jahre ins Kloster, um sich für das Leben vorzubereiten. Man ist nicht wie bei uns für immer durch das Mönchsgelübde gebunden, man kann jeden Tag wieder aus dem Orden ausscheiden.«
»Das ist allerdings etwas anderes. Alle Achtung, die Leute sind wirklich schlau!«
»So darfst du es nun auch wieder nicht beurteilen«, entgegnete Warwick ernst. »Zuerst ist es mir auch sonderbar vorgekommen, wenn ein Angestellter unserer Firma auf vier Wochen Mönch wurde und ins Kloster ging. Aber als ich dann länger im Land war, sah ich ein, daß der Buddhismus in der Beziehung den Bedürfnissen des Volkes entgegenkommt. Wir könnten nur froh sein, wenn es in Europa ähnlich wäre. Wie viele Mönche und Nonnen würden gern wieder ins Leben zurückkehren, wenn sie sich nicht durch strenge Eide gebunden fühlten! Aber es gibt natürlich auch in Siam Mönche, die ihr ganzes Leben lang im Kloster bleiben und sich dort glücklich fühlen.«
Ronnie überlegte einen Augenblick.
»Wie ist es denn nun bei verheirateten Leuten? Können die etwa auch ins Kloster gehen, und was wird in dem Fall aus der Ehe?«
»Ja, Sie können auch auf längere oder kürzere Zeit das gelbe Gewand nehmen, wenn Sie wollen. Die Ehe wird dadurch geschieden. Später kann Sie wieder aufleben, aber es ist nicht unbedingt nötig.«
»Großartig! Da haben es die Siamesen aber leicht, sich aus unangenehmen Fesseln zu lösen!«
»Ja, es kommt aber selten vor«, erklärte Warwick, »hier sind die Lebensbedingungen noch so günstig. Kinder werden in Siam noch nicht als Last, sondern als Zuwachs an Vermögen, Macht oder Reichtum angesehen.«
Die Fahrt in der Abendkühle war wunderbar erfrischend. Ronnie nahm seinen Tropenhut ab, und der Wind spielte mit seinen strohblonden Haaren. Die Brise trug den süßen Duft der Maliblüten vom Dusitpark herüber.
Plötzlich fühlte Warwick wieder Ronnies Hand auf seinem Arm.
»Hattest du denn wenigstens früher eine Mia? Das möchte ich doch zu gern wissen.«
»Du bist wirklich ein aufdringlicher Mensch und ein schrecklicher Plagegeist!«
»Aber Warwich, sage es mir doch!«
»Ja, ich hatte früher eine Mia.«
»War es eine schöne – au!«
Ronnie empfand plötzlich einen Schmerz an der Schulter, als ob ihn ein Stein getroffen hätte, aber es rollte nur ein großer Nashornkäfer in seinen Schoß, der bei der schnellen Fahrt des Wagens mit ihm zusammengestoßen war.
»Siamesinnen sind viel zu Stolz, um mit einem Europäer zusammenzuleben. Aber es gibt ja so viele Mädchen aus anderen Volksstämmen hier. Wenn ein siamesischer König früher einen Krieg gewann, führte er einen Teil der Feinde in die Gefangenschaft und siedelte sie mit ihren Familien in der Nähe seiner Hauptstadt an, als bleibendes Denkmal seines Sieges. So haben wir rings um Bangkok eine ganze Anzahl fremder Völker, unter anderen auch die Mon in Paklat. Die Monmädchen stellen einen großen Teil der Mias. Im Volksmund nennt man deshalb auch die Gegend von Paklat ›das Land der Liebe‹.«
Warwick fuhr über eine Brücke und bog links in die Sapatumstraße ein.
»Übrigens ist meine Verlobung mit Evelyn noch nicht veröffentlicht, also sprich bitte nicht darüber. Es soll vorläufig nicht bekanntwerden.«
»Die Türme des Schweigens, in denen die Parsen ihre Toten den Geiern aussetzen, sind Plapperpappeln gegen meine versiegelten Lippen«, erklärte Ronnie mit feierlichem Pathos.
Warwick lächelte.
An der Brückenrampe kam ihnen das große Luxusauto des reichen Kiam Hoa Heng entgegen, in dem mehrere Frauen und Kinder saßen. Der dicke Chinese grüßte Warwick ehrerbietig. Die Straße war an dieser Stelle durch einen großen Schotterhaufen eingeengt.
»Dieser Kerl scheint auch ein feistes Trüffelschwein aus der Herde Epikurs zu sein«, bemerkte Ronnie.
Im selben Augenblick überholte ein großer, dunkelblauer Rolls Royce den Chinesen.
»Verspare dir solche Stilblüten lieber für dein –«
Plötzlich sah sich Warwick in der engen Durchfahrt dem anderen Wagen gegenüber, der mit großer Geschwindigkeit auf ihn zukam.
»Oha!« brüllte Ronnie und sprang kurz entschlossen in großem Bogen in den Straßengraben.
Der Chauffeur hatte dasselbe mit richtigem Instinkt schon eine halbe Sekunde früher getan.
Bremsen kreischten, Scheiben klirrten, platzende Pneus knallten wie Revolverschüsse ...
Ronnie landete etwas unsanft auf dem feuchten Boden, aber Marbin war gleich darauf an seiner Seite und half ihm auf die Beine. Ronnie betastete sich vorsichtig und war froh, daß er außer einigen Abschürfungen keine Verletzungen erhalten hatte.
Als er sich verwundert umsah, entdeckte er Warwichs Wagen auf der anderen Seite des Schotterberges. Das Auto war umgeschlagen und schien schwer beschädigt zu sein. Warwick selbst lag jenseits des Straßengrabens mitten unter den dichten, braunroten Stauden leuchtend roter Wasserlilien. Dahinter lief eine Gartenmauer entlang, und wenige Schritte davon entfernt erhob sich ein großes, prächtiges Parktor.
Unweigerlich wäre es zu einem furchtbaren Zusammenstoß mit dem dunkelblauen Rolls Royce der beiden Prinzessinnen gekommen, wenn Warwick nicht im letzten Augenblick den Wagen herumgerissen hätte und kurz entschlossen in den hohen Schotterhaufen hineingefahren wäre.
»So ein sträflicher Leichtsinn von dem Siamesen! Ich habe alles genau gesehen. Der Kerl allein hatte Schuld!«
Ronnie Schimpfte und humpelte zu Warwick hinüber.
Der Rolls Royce hatte ebenfalls in der vornehmen Villenstraße angehalten. Prinzessin Chanda und Amarin stiegen hastig aus und eilten auf Warwick zu, der reglos am Boden lag.
Ronnie und der Chauffeur knieten neben ihm nieder. Blut strömte über Warwicks Gesicht, Schnittwunden klafften an den Händen und am Kopf, und die Stirnader war durchschnitten.
»Ist er schwer verletzt?« fragte Amarin entsetzt.
Ronnie drehte sich um und sah die beiden Prinzessinnen neben sich, die sich ängstlich vorbeugten. Hinter ihnen stand ihr Chauffeur und starrte mit glasigen Augen auf Warwick nieder.
»Hoffentlich hat er keine inneren Verletzungen«, erwiderte Ronnie besorgt.
»Hier kann er unter keinen Umständen liegenbleiben«, sagte Prinzessin Chanda. »Hole Decken, Krabu«, befahl sie dann ihrem Chauffeur und warf ihm einen bösen Blick zu.
»Krabu wird in letzter Zeit immer nachlässiger. Ich habe ihn im Verdacht, daß er Opium raucht«, sagte Me Kam, Amarins Amme, die zu der älteren Prinzessin trat. Sie war seit langer Zeit mit dem Chauffeur verfeindet und benützte jede Gelegenheit, um ihn bloßzustellen.
Ronnie stand wieder auf. Er sah etwas schmutzig und zerzaust aus, aber er riß sich zusammen.
»Mein Name ist Ronnie Maynard – Mr. Warburys Freund«, stellte er sich den Damen vor.
Amarin nannte leise ihren Namen und den ihrer Tante.
Der siamesische Chauffeur brachte eine blaue, silbergestickte Plüschdecke, zögerte aber, sie auf den feuchten Boden auszubreiten.
Prinzessin Chanda nahm sie ihm ab.
»Mr. Maynard, helfen Sie doch bitte, Ihren Freund auf die Decke zu legen. Er muß sofort drüben ins Haus gebracht werden, die Chauffeure können ihn dorthin tragen.«
Zahlreiche Wagen hatten angehalten, verschiedene Leute stiegen aus und betrachteten die Gruppe neugierig. Einige Europäer traten näher und boten ihre Hilfe an. Inzwischen wurde Warwick von den Chauffeuren nach dem Gartentor getragen. Ronnie ging nebenher und hielt bedrückt und niedergeschlagen die Hand seines Freundes in der seinen.
Auf einen Wink der Prinzessin Chanda kletterte Krabu über den Zaun und riegelte die beiden Flügel von innen auf.
»Man kann aber doch nicht einfach in ein fremdes Grundstück eindringen?« fragte Ronnie betroffen.
»Das ist kein fremdes Grundstück – das Haus gehört dem Vater der Prinzessin Amarin«, wies ihn die Amme Me Kam vorwurfsvoll zurecht. »Es steht nur leer, weil Prinz Akani zur Zeit in Ceylon lebt.«
Chanda ging schnell zum Hause voraus, das eine Reihe hoher, starkstämmiger Saketbäume von der Straße aus wie eine Kulisse gegen Sicht schützte. Sie waren aber so geschickt angeordnet, daß sie die Seitenfronten nicht gegen den erfrischenden Monsunwind absperrten.
Die Prinzessin ließ eine Couch auf die Veranda bringen, und sie legten Warwick darauf nieder. Ronnie wollte sich wieder über ihn beugen, aber Me Kam schob ihn energisch beiseite und untersuchte mit sachkundiger Hand die Verletzungen. Sie hatte Übung und Erfahrung in der Wundbehandlung, wenn ihr Wissen auch reichlich mit Aberglauben durchsetzt war.
Mit Hilfe der anderen Dienerinnen verband sie Warwick und legte heimlich einen mit Segens- und Zaubersprüchen beschriebenen Palmblattstreifen, den sie aus ihrem Brusttuch zog, zwischen die Leinen. Sie war fest davon überzeugt, daß der Zauber mehr helfen würde als alle Arznei.
Prinzessin Chanda ließ sofort an einen englischen Arzt und an das englische Hospital telefonieren, während Amarin stumm in einem Sessel saß und unverwandt auf Warwicks bleiches Gesicht blickte. Die schwarzen Locken waren mit Blut verklebt und hingen wirr in seine Stirn. Sie schauderte zusammen. Daß von all den vielen Tausenden in Bangkok gerade dieser eine Mann durch ihren Wagen verunglücken mußte! Während der Spazierfahrt hatte sie dauernd an ihn denken müssen. Seine männlich schönen Züge kamen ihr so vertraut vor, als ob sie ihn seit langem kennen müßte.
»Dr. Hayes ist nicht zu Hause«, meldete der Chauffeur Marbin, der zu einer der nebenan liegenden Villen geeilt war und von dort aus telefoniert hatte.
»Dann muß Dr. Pois gerufen werden«, erwiderte Prinzessin Chanda.
»Ich habe bereits versucht ihn zu erreichen – ebenso noch drei andere europäische Ärzte. Aber Sie Sind um diese Zeit alle unterwegs, um Krankenbesuche zu machen.«
»Vielleicht kann Pra Nivet helfen«, sagte Amarin hastig. »Er ist doch unser alter Hausarzt.«
»Du hast recht – aber er hat kein Telefon. Am besten fahre ich selbst hin und hole ihn«, entgegnete Prinzessin Chanda kurz entschlossen.
»Kann Krabu das nicht besorgen^«
»Nein, der darf nach diesem Unfall heute kein Auto mehr steuern. Ich nehme den Chauffeur von Mr. Warbury. Aber der weiß nicht, wo Pra Nivet wohnt, deshalb will ich selbst mitfahren. Ich werde auch gleich dafür sorgen, daß Pra Nivet alles Nötige mitbringt.«
Rasch erhob sie sich und winkte Marbin. Die Dienerinnen und Me Kam blieben zurück.
Prinzessin Amarin wollte sich erheben, aber im selben Augenblick fühlte sie, daß jemand ihre Waden streichelte. Sie wandte sich um und sah, daß die Amme vor ihr kniete.
»Der schöne Farang Angkrit (Engländer) hat seinen Wagen geopfert und ist in den Steinhaufen gefahren, sonst wäre ein großes Unheil geschehen, und wir wären alle schwer verunglückt oder tot. Wir wollen alles tun, Herrin, daß er gerettet wird und am Leben bleibt.«
Amarin sah sie erschrocken an.
»Ist er denn so schwer verletzt?«
»Die Wunden bluten weiter, aber ich weiß ein Mittel. Wir müssen einen Zauber machen, der wird ihm helfen.«
Die junge Prinzessin schüttelte abwehrend den Kopf.
»Doch, wir müssen es tun, sonst wird er zu schwach, und wenn Pra Nivet kommt, ist es zu spät. Ich habe Ma Di schon fortgeschickt – sie hat Wachslichter, Blumenketten und Weihrauchstäbchen geholt.«
Amarin war unentschlossen und wußte nicht, was sie dazu sagen sollte.
»Aber ihr könnt doch nicht seine Wunden besprechen! Sein Freund ist hier – er wird darüber lachen.«
»Ach, Herrin, auf den kommt es nicht an. Mit dem werde ich schon fertig.«





























