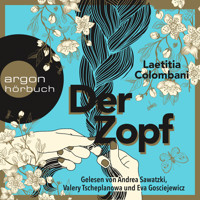Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Paul Zsolnay Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Hubert von Goiserns literarisches Debüt: Ein musikalischer Roman über Liebe, Sehnsucht und das flüchtige Glück.
Maria ist verschwunden. Seit Monaten hat Herwig, mit dem sie seit fast dreißig Jahren verheiratet ist, nichts von ihr gehört. Dass sie ihren Job gekündigt und seinen Volvo mitgenommen hat, lässt zumindest hoffen, dass sie noch am Leben ist. Doch was ist passiert, mit ihrer Ehe, ihrer Liebe, ihrem gemeinsamen Leben? Hubert Achleitner schickt seine Protagonisten auf eine abenteuerliche Reise, die sie von den österreichischen Bergen quer durch Europa bis nach Griechenland führt. Und die für beide doch in erster Linie eine hochemotionale Reise in ihr Inneres bedeutet. Ein weiser und sehr musikalischer Roman über Liebe und Sehnsucht, das Schicksal und das flüchtige Glück … „flüchtig wie die angezupften Töne der Bouzouki waren die Begegnungen mit diesen Menschen. Dennoch hinterließ jeder von ihnen eine Melodie in meinem Herzen, die weiterschwingt.“
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 383
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Hubert von Goiserns literarisches Debüt: Ein musikalischer Roman über Liebe, Sehnsucht und das flüchtige Glück.Maria ist verschwunden. Seit Monaten hat Herwig, mit dem sie seit fast dreißig Jahren verheiratet ist, nichts von ihr gehört. Dass sie ihren Job gekündigt und seinen Volvo mitgenommen hat, lässt zumindest hoffen, dass sie noch am Leben ist. Doch was ist passiert, mit ihrer Ehe, ihrer Liebe, ihrem gemeinsamen Leben? Hubert Achleitner schickt seine Protagonisten auf eine abenteuerliche Reise, die sie von den österreichischen Bergen quer durch Europa bis nach Griechenland führt. Und die für beide doch in erster Linie eine hochemotionale Reise in ihr Inneres bedeutet. Ein weiser und sehr musikalischer Roman über Liebe und Sehnsucht, das Schicksal und das flüchtige Glück … »Flüchtig wie die angezupften Töne der Bouzouki waren die Begegnungen mit diesen Menschen. Dennoch hinterließ jeder von ihnen eine Melodie in meinem Herzen, die weiterschwingt.«
Hubert Achleitner
flüchtig
Roman
Paul Zsolnay Verlag
Nicht wir gehen durch die Geschichte, sondern die Geschichte geht durch uns.
Dies ist die Geschichte von Eva Maria Magdalena Neuhauser. Die meisten nennen sie einfach Maria, deshalb tu ich das auch. Ich komme auch darin vor, aber es ist nicht meine Geschichte. Es sind die Erinnerungen an einen Sommer, den ich mit dieser außergewöhnlichen Frau zusammen verbringen durfte. Die Namen in dieser Geschichte habe ich frei erfunden, auch den für mich. Ich heiße in diesem Buch Lisa.
Darüber hinaus gebe ich die Dinge genau so wieder, wie sie geschehen oder, da, wo ich nicht dabei war, wie sie mir berichtet worden sind, das meiste von Maria selbst.
Kapitel 1
Maria und ich haben uns gegenseitig auf der Straße aufgelesen. Vom rein äußeren Gesichtspunkt aus betrachtet hat sie mich mitgenommen: Ich war die Anhalterin, die an der Straße stand. Ich bin in ihr Auto eingestiegen. Aber es gab auch eine innere Reise, und da war es umgekehrt. Wir sind uns in den drei Monaten, die wir zusammen verbracht haben, sehr nahegekommen; haben fast alles miteinander geteilt, das Lager, das Essen und einmal sogar einen Mann. Sie war der großzügigste Mensch, den ich kennengelernt habe. Großzügig war sie auch mit ihrer Vergangenheit. Sie hat mich an ihrer Lebensgeschichte teilhaben lassen. Vielleicht hing es auch damit zusammen, dass ich sie im Augenblick ihres Loslassens von allem getroffen habe. Das soll aber weder ihren Edelmut schmälern, noch soll es heißen, sie wäre an nichts gebunden oder gar bindungsunfähig gewesen. Der Brief an Herwig zeugt vom Gegenteil. Sie hat zwar mit den Worten geschlossen, er möge die Freiheit finden, sie loszulassen. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass sie das wirklich will, aber so hat sie es geschrieben.
So manches, von dem ich berichten werde, habe ich dem Brief entnommen, den ich wenige Wochen nach dem Jahreswechsel im Briefkasten fand. Er war an mich adressiert, aber an Herwig gerichtet. Herwig ist der Mann, an dessen Seite Maria fünfunddreißig Jahre ihres Lebens verbracht hatte. Maria erlaubte mir, ja sie bat mich auf einer beigelegten Notiz darum, den Brief zu lesen, damit ich von den Abenteuern erfahre, die sie nach unserer Trennung erlebt hatte.
Wie ich merkte, sparte Maria einiges aus, von dem sie wohl glaubte, es würde Herwig verletzen. Ich weiß nicht, ob das notwendig war, und frage mich natürlich, ob sie auch mir etwas vorenthalten hat.
Ich habe den Brief mehrmals gelesen. Maria hatte mich beauftragt, ihn weiterzuschicken, und ich wollte nicht, dass mir etwas entging. Am Ende habe ich mir, obwohl es ein wenig unanständig schien, eine Kopie gemacht. Am nächsten Tag, als ich die Blätter in ein neues Kuvert steckte, musste ich feststellen, dass Herwig Bergers Adresse nirgendwo im Brief aufschien. Maria musste sie vergessen haben, oder sie war aus dem Kuvert gefallen.
Ich durchsuchte im Internet das österreichische Telefonbuch und hatte Glück, denn es gab nur zwei Berger mit dem Vornamen Herwig. Die erste Nummer war ein Festnetztelefon mit Anrufbeantworter. Eine Computerstimme bat um Hinterlassung einer Nachricht. Ich legte, ohne etwas zu sagen, auf und wählte die zweite. Eine andere Stimme, derselbe Text.
Es war schon sechzehn Uhr, und über der Stadt begann sich trübe Dunkelheit auszubreiten. Ich stand auf, um Licht zu machen. Als ich die Vorhänge zuzog, gingen gerade die Straßenlaternen an. Ein angriffiger Wind war aufgekommen und fegte eine Staubwolke vor sich her. Schneeregen war vorausgesagt. Dunkle Wolken hatten es eilig, den Himmel zu erobern. Noch war es aber nicht so weit. Ich war gerade dabei, zu überlegen, ob es sinnvoll gewesen wäre, etwas auf die Sprachbox zu sprechen, da klingelte es. Ich ging zum Tisch, wo ich mein Telefon abgelegt hatte. Der Anruf kam aus Österreich. Es war eine der zuletzt gewählten Nummern.
»Berger«, tönte es melodiös aus dem Lautsprecher des Telefons. »Haben Sie eben bei mir angerufen?«
Der rasche Rückruf überrumpelte mich. Ich hatte mir noch gar nicht zurechtgelegt, was ich sagen wollte. »Ja, äh, guten Tag.«
»Wer spricht da?«
»Lisa, ich heiße Lisa.«
»Und worum geht es?«
»Ich … ich bin eine Freundin von Maria. Sind Sie der Mann von Maria Neuhauser?«
Einen Augenblick war es still, dann kam eine tonlose Stimme, der alle Melodie entwichen war: »Wer spricht da noch einmal bitte?«
»Ich bin eine Freundin von Maria. Ich habe hier einen Brief von ihr. Für ihren Mann Herwig Berger. Sie hat mich beauftragt, ihn weiterzuleiten, allerdings vergessen, mir die Adresse dazuzuschreiben. Im Telefonbuch habe ich zwei mit demselben Namen gefunden. Ich möchte nicht, dass der Brief an den Falschen gerät. Darf ich Sie fragen, was Sie von Beruf sind und wie der volle Name Ihrer Frau lautet?«
»Von wo rufen Sie an? Ist das eine deutsche Nummer?«
»Bitte beantworten Sie zuerst meine Frage.«
»Ich unterrichte. Meine Frau heißt Eva Maria Magdalena Neuhauser und ist seit über einem halben Jahr vermisst. Wenn Sie wissen, wo sie ist, sagen Sie es mir bitte.«
»Ich weiß es leider nicht.« Das war keine Lüge. Ich wusste es wirklich nicht.
»Von wo rufen Sie an?«
»Ist das wichtig?«
»Nein, Sie haben recht. Es ist nicht wichtig. Wichtig ist nur, ob Maria noch am Leben ist. Ist sie noch am Leben?«
Kapitel 2
Maria war von Kindheit an gesegnet mit einem schon fast animalischen Pragmatismus. Reden war nicht ihr Ding. Praktisches Handeln zog sie langem Grübeln vor. Diskussionen waren ihr eine Qual. Vernunft war in ihren Augen eine theoretische Größe und Kategorie. Sie war ergebnis-, nicht vernunftorientiert. Maria war in den Augen der meisten kein hübsches Mädchen. Ihre Schönheit lag verborgen unter einer kratzbürstigen Wildheit, die kein Gefallenwollen kannte.
Das Unbändige machte sich vor allem im Winter bemerkbar. Man hätte glauben können, dass der dramatische Lebensauftakt und der Schock des ersten Atemzuges in der Eiseskälte ihrer Geburtsstunde bei Maria einen Grausen vor Kälte und Schnee ausgelöst haben müssten, aber das Gegenteil war der Fall. Sie liebte die Kälte, sie liebte das Eis, und sie liebte den Schnee. Sie liebte es, auf spiegelglatten Flächen talwärts zu rasen. Es verging kein Jahr, in dem nicht ein Schlitten oder ein Schi zu Bruch ging. Und viele Jahre später, als sie ihr erstes Auto erstand, einen grasgrünen, acht Jahre alten Ford Escort mit Hinterradantrieb, liebte sie es, auf den Schneefahrbahnen durch die Kurven zu driften und auf den Parkplätzen Pirouetten zu drehen. Sie war und blieb ein Winterkind.
Weil ihr die Kälte nichts ausmachte, bekam sie von ihrem Vater, der ihr zum Einschlafen gerne vogelwilde Indianergeschichten erzählte, den Spitznamen Eskimo. Das war für Maria innerhalb der Familie kein Problem. Es sprach sich jedoch bis in den Kindergarten herum, wo es eines Tages zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung kam. Nachdem sie mehrmals darauf bestanden hatte, bei einem ihrer richtigen Vornamen genannt zu werden — sie stellte es allen frei, bei welchem —, einer der Buben jedoch nicht damit aufhörte, sie weiterhin Eskimo zu nennen, stürzte sie sich auf ihn, und es begann eine wilde Prügelei, die damit endete, dass sie ihrem Gegner ein Büschel Haare ausriss, diese wie eine Trophäe schwenkte und dabei schrie, sie würde alle skalpieren, die sie weiterhin Eskimo nannten. Damit war die Sache gegessen.
Die ersten zehn Jahre ihres Lebens verbrachte Eva Maria Magdalena Neuhauser in einem beschaulichen Dorf am oberen Ende eines vom Gletscher gespeisten Bergsees. Gegen Süden verhinderten abweisende, meist senkrechte Felswände ein Entkommen. Es bedurfte eines mehrstündigen, steilen Aufstiegs, um das Plateau zu erreichen, und noch eines ganzen Tagesmarschs, um es zu überqueren und die nächste Siedlung zu erreichen. In Richtung Norden verwehrten steile, bewaldete Flanken den Blick auf das untere Ende des Sees. Eine schmale, wegen Steinschlag- und Lawinengefahr im Winter oft gesperrte Straße war die einzige Nabelschnur zur Welt da draußen. Abgesehen von einer sommerlichen Schiffsverbindung.
Wie ein Fjord lag er da, der See. Seine schwarzgrünen Wasser lockten selbst an heißen Sommertagen nur wenige abgehärtete Einheimische zum Schwimmen. Der Ort markierte für alle, die sich hierher verirrten, das Ende der Welt. Für die hier Aufgewachsenen bedeutete er den Anfang.
So war es zumindest bis vor kurzem. Dann kam der Touristen-Tsunami, der Kolonnen von Reisebussen und scheinbar nie versiegende Völkerschaften fremder Menschen aus aller Damen und Herren Länder, vor allem aber aus dem fernen Osten in den Talschluss spülte. Es fehlten nur die Kreuzfahrtschiffe. Aber zum Glück war es eben doch kein Fjord.
Die Besucher waren wie ein Befall. Man muss jetzt nicht gleich an Läuse denken. Es reicht auch das Bild von Schmetterlingen. Ein großer Schwarm bunter Schmetterlinge, der jeden Tag das Dorf befällt. Jahrein, jahraus. Den Gastwirten gefiel das natürlich, jedenfalls den meisten. In der Biologie ist der Wirt ein Organismus, der einen als Gast bezeichneten artfremden Organismus mit Ressourcen versorgt. Wenn es zum beiderseitigen Vorteil ist, nennt man das eine Symbiose. Wenn die Wirt-Gast-Beziehung zu Ungunsten des Wirtes geht, wird der Gast zum Parasiten. Ab einer gewissen Anzahl werden auch bunte Schmetterlinge zu Schädlingen. Inzwischen lässt man die Bevölkerung durch den Abtransport der Ausscheidungen homöopathisch am Aufschwung teilhaben.
Damals, wie gesagt, war alles noch abgelegen, versunken, versponnen, verträumt und geheimnisvoll. Nur wenige Reisende verirrten sich hierher, und auch das nur in den Sommermonaten.
Georg Neuhauser, Marias Vater, arbeitete für die örtliche Seilbahn, die im Sommer Ausflügler und im Winter einheimische Schifahrer hinauf auf den Berg brachte. Marias Mutter hieß Mathilde und hatte eine Anstellung im an die Bergstation angebauten Hotel. Dort oben, jenseits der Baumgrenze und mit grandiosem Blick auf das Ende der Welt einerseits und ihren vergletscherten, sonnenbeschienenen Anfang andererseits, fanden Georgs und Mathildes Herzen zueinander — und in Folge bald auch ihr genetisches Erbgut.
Maria kam im tiefsten Winter auf die Welt. Ihre Eltern waren an jenem Tag die Einzigen oben am Berg. Man schrieb den 5. Jänner 1962, der Abend vor dem Fest der Heiligen Drei Könige. Georg hatte Dienst als Maschinist, und Mathilde wollte in ihrem Zustand an seiner Seite sein.
Es war eine Woche vor dem Geburtstermin. Draußen hatte es minus fünf Grad, und die Schneeflocken tanzten romantisch vom Himmel. Gegen Mitternacht pfiff bereits der Wind und rüttelte an den Fensterscheiben, obwohl sie von den Verwehungen schon fast zugewachsen waren. Da spürte Mathilde die erste Wehe. Georg lag schlafend neben ihr im Bett. Sie wollte ihn schon wecken, da verebbten die Schmerzen wieder. Vielleicht war es ja nur eine Verspannung. Sie wartete. Die nächste Welle ließ nicht lange auf sich warten. Mathilde begann stoßweise zu atmen, und Georg wurde von selber wach. Als er die Situation erfasste, war es mit seiner sonstigen Gelassenheit und Zuversicht vorbei. Er telefonierte gleich mit dem Betriebsleiter im Tal und bestand darauf, seine Frau mit einer Sonderfahrt hinunterzubringen, damit ein Arzt ihr beistehen könne. Entgegen Mathildes Flehen, sie jetzt bitte nicht alleinzulassen, schleppte er zuerst eine Matratze in die vereiste Gondel und verfrachtete sie dann, eingepackt in zwei Daunenjacken und unter einem Berg von Decken, in die mit Eiskristallen überzogene, klirrend kalte Blechkabine. Er verriegelte von außen die Tür, rannte zum Steuerstand, setzte die Maschine in Bewegung und löste die Festhalteklammer. Die Gondel glitt zwischen den Felsen in die Tiefe und war nach wenigen Sekunden aus dem Lichtkegel des Scheinwerfers im dichten Schneetreiben verschwunden. Georgs Augen flogen prüfend über die Instrumente. Stromspannung, Zugseilgeschwindigkeit, Tragseilvibrationen, alles war im erlaubten Bereich, nur der Windmesser machte ihm Sorgen. Bei manchen Böen schnellte er auf über achtzig Kilometer pro Stunde. Das Thermometer zeigte hier oben inzwischen minus siebzehn Grad. Weiter unten war es sicher nicht so schlimm.
Mit einem Male verstummte das dröhnende Surren hinter dem Steuerstand, und das große Umlenkrad, über welches das Zugseil lief, stand mit einem heftigen dumpfen Schlag still. Der Sturm heulte ungebrochen weiter, aber das Singen der Seile änderte die Frequenz, und beide Stahltrosse, das Zug- wie auch das Tragseil, begannen mit großer Amplitude wild auf und ab zu tanzen und schnalzten, begleitet von bedrohlichen Klängen, die an Glockenschläge erinnerten, gegen die Führungsschienen. Ein Blick auf die Instrumente sagte Georg, dass in der Gondel kurz vor der ersten Stütze eine Notbremsung ausgelöst worden war.
Genau so war es. Während der Talfahrt hatte der Sturm die Kabine in eine immer extremere Schräglage gedrückt, sodass sie, beinahe waagrecht am Seil hängend, gegen die Mittelstrebe der nächsten Stütze gekracht wäre, hätte Mathilde nicht geistesgegenwärtig den Notknopf gedrückt.
Und dort oben, hoch über den Felsen schaukelnd, vom Sturm gerüttelt, als würde ein Dämon sie in den Abgrund schleudern wollen, begleitet vom vielstimmigen Geheul des Sturms und mit jenem Gebet in ihrem bangen Herzen, das Mathilde von ihrer Großmutter als Kind gelernt hatte, wenn sie Trost und Zuspruch gebraucht und gesucht hatte, nämlich mit der Bitte um den Beistand der heiligen Gottesmutter Maria, brachte sie ihr Kind zur Welt und nannte es aus Dankbarkeit an die weibliche Heilige Dreifaltigkeit: Eva Maria Magdalena.
Als Maria ins Schulalter kam, siedelten die Neuhausers ins Tal, und als sie zehn Jahre alt und mit der Volksschule fertig war, zog die Familie in die nahe, ehemalig kaiserliche Kurstadt, wo es eine Mittelschule gab. Ihr Vater hatte dort eine Anstellung bei den Bundesforsten gefunden, und Marias Mutter kümmerte sich nun statt um Schifahrer und Bergsteiger um Kind, Mann und Garten.
Gerne hätten sie Maria auch auf die Universität geschickt und studieren lassen, Wirtschaft oder Jus. Sie war gut im Lernen, tat sich mit Zahlen leicht. Das Geld hätte auch irgendwie gereicht, aber Maria wollte nicht in die Stadt ziehen. Man entschied sich also dazu, das Mädchen in die gerade neu errichtete Handelsakademie zu schicken. Sie lag in Gehweite, und von allen Klassenzimmern aus hatte man einen großartigen Blick auf den Talschluss.
Kapitel 3
In Marias letztem Schuljahr, als sie in die Maturaklasse der HAK kam, begann Herwig Berger, der kurz vor dem Abschluss seines Lehramtsstudiums stand, in den unteren Klassen dieser Schule Geografie und Wirtschaftskunde sowie Musikerziehung zu unterrichten. Gleich in der ersten Stunde gab es ein Missverständnis, das seinen Namen in der Schule und bald auch darüber hinaus nachhaltig beeinflussen sollte. »Ich bin euer Geografie- und Musiklehrer, und ihr seid meine erste Klasse. Mein Name ist Berger«, stellte er sich vor und fügte hinzu: »Aber nennt mich bitte Herwig.« Die Kinder, aufgewachsen mit einem anerzogenen Respekt vor Autoritätspersonen, hörten, was zu hören erlaubt war, und nannten ihn ab da »Herr Wig« oder, wenn sie unter sich waren, einfach nur »der Wig«. Und dieser Name blieb ihm: Bald nannte ihn jeder nur noch Wig, ja, er begann sogar sich selbst mit dem Kurznamen vorzustellen.
Am Ende des ersten Semesters kam noch ein Spitzname dazu, den er nicht mehr loswerden sollte. Nach einem leidenschaftlichen Vortrag in der Musikstunde, in dem er seine Begeisterung für Mozarts Da-Ponte-Opern auf die Schüler zu übertragen suchte, nannte man ihn »Don Giovanni«. Dass ihn noch nie jemand in weiblicher Begleitung gesehen hatte, tat dem keinen Abbruch, es trug im Gegenteil zur Mystifizierung seiner Person bei.
Maria hatte nur einmal Gelegenheit, ihn im Unterricht zu erleben. Er war für eine Kollegin eingesprungen und supplierte eine Musikstunde, die Maria in Erinnerung blieb. Denn er spielte ihnen nahezu endlos Jodlerschleifen vor und erzählte dann, dass es sich dabei um die Gesänge westafrikanischer Pygmäen handle, die sie bei der Jagd im Dschungel einsetzten.
Maria fand gleich nach der Matura eine Stelle bei einer Bank. Wig nahm immer wieder einmal am Schalter ihre Dienste in Anspruch, ohne jedoch erkennbare Notiz von ihr zu nehmen.
Zwei Jahre sollten vergehen, bis die Sterne günstig standen. Bei den Festspielen in Salzburg liefen sie sich im Foyer praktisch in die Arme. Maria im Dirndlkleid ins Programmheft vertieft, Wig in Jeans und schwarzem Rollkragen damit beschäftigt, sich im Gehen eine Zigarette zu drehen. »Die charmante Hüterin meiner Ersparnisse.« Maria blickte auf, und als sie ihn erkannte, erwiderte sie amüsiert: »Na so was, Don Giovanni verirrt sich in die ›Zauberflöte‹?« Wig lachte. »Wenn man das Glück hat, die Gruberova einmal erleben zu dürfen, wie sie Mozarts königliche Koloraturen in den Sternenhimmel meißelt, darf man sich das nicht entgehen lassen. Aber ich muss zugeben, meine Großmutter arbeitet hier im Haus, und so komme ich manchmal in den Genuss einer Regiekarte. Andernfalls wäre ich wahrscheinlich nicht hier. Für den gleichen Preis kann man zehn Freunde zu einem Konzert von Queen einladen, inklusive Zugfahrt und Bier. Und Sie? Ich wusste gar nicht, dass Sie eine Opernliebhaberin sind.« Maria lachte und wurde leicht verlegen. »Na ja, nicht wirklich. Aber vielleicht werde ich ja noch eine. Ich bin bei einer Kundenbefragung angeblich zur freundlichsten Mitarbeiterin gewählt worden. Die Festspielkarte ist ein Ablenkungsmanöver. ›Zauberflöte‹ statt Gehaltserhöhung.«
»Die Wahl zur freundlichsten Mitarbeiterin macht Sie nicht stolz?«
»Nein. Weil es nicht stimmt. Da gibt es andere, denen diese Auszeichnung gebührt hätte. Liebenswürdigkeit ist nicht meine Stärke. In der Hinsicht bin ich ganz die Tochter meiner Mutter. Sie hat mir beigebracht, jeder Art von Freundlichkeit mit Misstrauen zu begegnen. Keine Geschenke geben und keine Geschenke annehmen. Sie ist der Meinung, jedes Geschenk hat ein Preisschild. Auch wenn es abgekratzt worden ist.«
»Warum haben Sie in dem Fall das Geschenk dann doch angenommen?«
»Vielleicht weil ich nicht immer das tue, was meine Mutter sagt, und weil ich neugierig bin. Aber Queen in der Stadthalle wäre mir auch lieber gewesen. In eine Oper zu gehen ist immer ein wenig wie ein Hochamt in der Kirche besuchen.«
»Wie meinen Sie das?«
»Der Aufwand, der Anspruch auf Erleuchtung, und es ist in beiden Fällen nicht förderlich, zu viel über den Text nachzudenken.«
»Vielleicht sollte ich wieder einmal in die Kirche gehen!«
»Ja, tun Sie das. Ein Hochamt in der Franziskanerkirche oder im Dom kann auch was. Musik, Gesang, Weihrauch, Kerzenlicht, das Beten … Sie dürfen, wie gesagt, nur nicht zu viel auf den Text hören, sonst reißt bei den Lesungen oder allerspätestens bei der Predigt der Faden.«
Im Anschluss an die Vorstellung lud Wig Maria noch zu einem Glas Wein ein. Sie lehnte zuerst ab, da sie, wie sie meinte, sonst den letzten Zug nach Hause versäumen würde. Am Ende ließ sie sich aber doch noch zu einem Streifzug durch die Gassen der Altstadt überreden. Die von der Sonne aufgeheizten Häuser gaben der Nacht die Wärme zurück. Aus dem Gurgeln und Plätschern der Brunnen sprudelte Mozarts Geist und füllte die Welt mit seinen beseelten Melodien. Sie tranken das eine oder andere Glas Wein auf die Musen und Zwischenwelten, glitten leichtzüngig vom Sie zum Du, und als sie über den Domplatz auf das Parkhaus zugingen, wurde die Statue der Gottesmutter schweigende Zeugin ihres ersten Kusses, den sie sich im Schutz der Arkaden der Franziskanergasse gaben. Die Fahrt nach Hause in Wigs moosgrünem Mini Cooper dauerte viel zu kurz, kürzer, als ihnen beiden recht war. Das Kassettenradio spielte Lieder, die sie noch nie zuvor gehört hatte. Eine Männerstimme besang den Tod Marilyn Monroes, der sie mit einem weißen Zeppelin in den Himmel entführte, wo ihr der Atem Gottes nun den Nagellack trocknete. Auf die Frage, wer das sei, drückte Wig ihr statt einer Antwort eine Kassettenhülle in die Hand.
»André Heller? Ich habe von ihm gehört. Meine Mutter hat immer das Radio laut aufgedreht, wenn sein Lied ›A Zigeuner mecht i sein‹ gespielt wurde. Ich wusste gar nicht, dass er gestorben ist.«
»Wie kommst du auf die Idee, er wäre gestorben?«
»So steht es doch auf der Kassette: ›Das war André Heller‹, und das Bild schaut auch irgendwie aus wie ein Grabmal.«
»Nein, nein er ist schon noch am Leben. Er ist halt in Wien sozialisiert, dort gehört der Tod zum Überleben. Vor kurzem hat er eine neue Platte veröffentlicht. Aber diese hier ist seine beste, finde ich jedenfalls.«
Sie bogen gerade in die Straße ein, in der Maria wohnte, als ein neues Lied begann. Unisono-Streicher ließen aus der Stille kommend eine einzige Note anschwellen, ein Klavier legte sich drunter und fügte einen schläfrigen Puls hinzu. Es war eine einfache Phrase, bestehend aus nur drei Tönen, aber sie ließen die Geigen abheben und zur schwebenden Dominante werden, bis die Stimme einsetzte: »Wenn’s regnet, dann wachsen die Regenbögen, wenn’s schneit, dann wachsen die Stern’, bei Sonne, da wachsen die Schmetterlinge, und immer, immer hab’ ich dich gern …«, bald beschwörend, bald besänftigend, als würde er ein Kind in den Schlaf singen wollen, dann wieder betörend und drängend, in Verliebtheit die ganze Welt umarmend. »Du, du, du bist mein einziges Wort, du, du, du heißt alles!«, besang André Heller die Liebe.
In dieser Nacht verlor nicht nur Maria ihre Unschuld. Auch Wig war noch nie mit einer Frau ins Bett gegangen, geschweige denn hatte er einer die Unschuld genommen. Er wünschte sich, nichts getrunken zu haben, aber der Alkohol half ihnen, sich fallenzulassen und ganz ihrem Körper hinzugeben. Sie küssten und streichelten einander eine halbe Ewigkeit, nein, viele Ewigkeiten lang, dann überwanden sie die Scheu vor der Nacktheit und begannen sich nach und nach gegenseitig die Kleider abzustreifen. Maria entdeckte die drängende Lust eines Liebhabers und noch mehr ihre eigene Lust, alles an ihm zu erkunden. Wig ergoss sich in ihre Hand und Maria nicht nur einmal in die seine, ohne dass er es merkte. So verging Stunde um Stunde im Sinnesrausch, bis sie erschöpft einschliefen.
Erst als sie langsam erwachten, ein paar Vögel hatten bereits angefangen ihre Stimmen zu erheben, um mit ihrem Gesang die Sonne hervorzulocken, konnte Maria es geschehen lassen, dass Wig, der wie sie noch im Halbschlaf war, in sie eindrang.
Der Schmerz zerschnitt beiden wie eine Stichflamme das Wonnegefühl und holte sie rücksichtslos aus der Zwischenwelt auf die Erde zurück. Wig spürte, wie seine Vorhaut riss und sich im selben Moment Marias vorher so anschmiegsamer Körper versteifte. Ihre Fingernägel gruben sich Halt suchend in seine Schultern. Sie hielten beide den Atem an und lagen aus Angst vor jeder weiteren Bewegung für eine Weile reglos aufeinander. Ein Pulsieren ging durch ihre Körpermitte. Sie waren eins geworden. Bis Maria ihn mit einer sanften, aber bestimmten Bewegung von sich herunterstieß. Aus den einzelnen Vogelstimmen war ein Konzert geworden, das erste Sonnenlicht warf die gezahnten Schatten vom Blattwerk einer Eberesche auf die weißen Vorhänge. Sie hielten sich eng umschlungen, spürten den Herzschlag des anderen, ließen ihre Atemzüge in Einklang kommen und fielen erneut in einen glückdurchfluteten, traumlosen Schlaf.
Als sie erwachten, waren ihre Schmerzen noch nicht verklungen, sie wurden jedoch überstrahlt von Glücksgefühlen und der Erleichterung, es endlich getan zu haben. Sie waren beide für sich gewiss, in dieser Angelegenheit die Letzten ihrer Jahrgänge gewesen zu sein.
Trotzdem hatten sie für eine Weile genug vom Sex. Der Schmerz im Moment des Eindringens hatte Spuren hinterlassen. Die unsanfte Landung trübte die Erinnerung an das vorangegangene Fluggefühl.
Drei Jahrzehnte später, Wig war gerade voll Vorfreude unterwegs im Volvo zu einem Wochenende mit seiner Freundin Nora, als das Autoradio, eingestellt auf seinen Lieblingssender Freies Radio Salzkammergut, einen Blues spielte, der die Geschichte seines Liebeslebens, von jener Nacht bis in die Gegenwart, beschrieb. Vom ersten Mal, wo es alles war, nur kein Genuss, bis zu jenem unstillbaren Verlangen, das ihn nun auch im Griff hatte und um das alle seine Gedanken kreisten.
Aus der erlebten Intimität wuchs in Wig bald eine drängende Sehnsucht nach mehr. Mehr Nähe, mehr Sex, auf jeden Fall mehr Zeit mit Maria. Nach Wochen des Schmachtens und vergeblichen Auflauerns schrieb er ihr einen Brief. Beim Versuch zu antworten stieß Maria an die Grenzen der Sprache. Poesie wäre vonnöten gewesen, aber Schreiben war schon immer ihre Achillesferse gewesen. Wig im Gegensatz dazu hatte einige Übung darin. Weil es immer schon leichter gewesen war, einem Mädchen einen Brief zu schreiben, als mit ihm ins Gespräch zu kommen, hatte er während der Pubertät an fast alle Schönheiten seiner Altersgruppe bekennende, brennende Liebesbriefe verfasst. Maria indes war nach drei Versuchen überzeugt, nur wirre Sätze zu Papier gebracht zu haben, und steckte die Blätter kurzerhand in den Ofen statt in ein Kuvert. Bald stellte sich auch heraus, dass sie keinen gemeinsamen Bekanntenkreis hatten, innerhalb dessen man sich hätte über den Weg laufen können. So verging ein ganzer Monat, bis der Zufall seinen nächsten Auftritt hatte.
Es war zum Siebziger von Wigs Großmutter. Seiner Doppel-Oma, wie er sie liebevoll nannte. Denn Theresa Berger war einerseits die leibliche Mutter seiner Mutter Agnes, gleichzeitig aber auch die Pflegemutter seines Vaters Lothar.
Wie zu allen runden Geburtstagen Theresas hatten die Eltern von Wig auch in diesem Jahr einen gemeinsamen Geburtstagsausflug organisiert. Und wie immer zu solchen Anlässen waren auch Hääna und Bob mit dem Flugzeug aus Vermont angereist. Hääna war Wigs Tante, die um drei Jahre jüngere Schwester von Agnes, und hieß eigentlich Hanna. Diese Aussprache hatte ihr Mann Bob, ein ehemaliger Besatzungssoldat, jedoch nie ernsthaft in Betracht gezogen, obwohl man ihn regelmäßig darauf hinwies, sein Hääna klänge wie das einheimische Wort für Chicken. Aber niemand war ihm deswegen böse, am wenigsten Hanna. Bob war eine Frohnatur und fand es jedes Mal »amazing to be back«. Er brachte seine Bewunderung für die Lakes, die Mountains, die Schnitzels und Strudels und Cakes so oft zum Ausdruck, dass es ihm bis auf seine Hääna niemand mehr glaubte. Während der Fahrt mit dem Raddampfer über den Wolfgangsee bedauerte er immer wieder, dass seine Hääna kein Dörndl und er keine Leidrhausn trug, und die Fahrt mit der Zahnradbahn auf den Schafberg fand er einfach nur »awesome, just like a trip through Disneyland«.
Nachdem sie bei der Bergstation angekommen waren, stieg die Geburtstagsgesellschaft die letzten Meter dem Gipfelkreuz entgegen, als just zur selben Zeit, von der anderen Seite des Berges kommend, zwei Bergsteigerinnen durch die sehr treffend so benannte Himmelspforte das luftige Ziel erreichten. Wig traute seinen Augen nicht. Es war Maria in Begleitung einer älteren Frau. Hatte sie ihn wirklich nicht gesehen? Oder wollte sie ihn nicht gesehen haben? Er rief ihren Namen. Beide Frauen drehten sich verblüfft um. Marias Begleiterin fand als Erste die Sprache: »Der junge Mann scheint dich zu kennen?« Wig eilte zu ihr und streckte Maria seine Hand entgegen. Jetzt löste sich auch bei ihr die Zunge. Sie nahm etwas verlegen seine Hand. »Servus, Herwig.« Sie wandte sich zu der Frau an ihrer Seite und sagte: »Mama, das ist Herwig Berger, wir haben uns bei der ›Zauberflöte‹ kennengelernt.« Inzwischen war Herwigs Familie nachgekommen, und es kam zu etwas steifen gegenseitigen Vorstellungen. Herwigs Großmutter warf Maria einen aufmerksamen Blick zu. »Herwig war von dem Opernabend ganz begeistert. Er sprach von einer Jahrhundertvorstellung. Fanden Sie das denn auch?«
Maria errötete, konnte aber ihr Lächeln nicht verbergen. »Es war meine erste ›Zauberflöte‹. Ich habe noch keinen Vergleich. Aber ja, es war ein wirklich sehr schöner Abend.«
Es blieb ihre einzige »Zauberflöte«. Wig jedoch nicht ihr einziger Mann. Er wusste lange nicht, welche Rolle sie in seinem Leben spielen wollte oder er in ihrem einnehmen durfte. Maria wusste es auch nicht. Sie war zwanzig, Wig fünfundzwanzig, als sie sich kennenlernten. Er hätte sie am liebsten gleich geheiratet. Sie behielt sich lange vor, unnahbar, ja unerreichbar zu sein. Sie fing an, die Pille zu nehmen, und wenn ihr ein Mann gefiel, ließ sie sich gerne verführen. Ihre Abenteuer hielten sich dennoch in Grenzen. Die meisten Männer, die ihr gefielen, bemerkten es entweder gar nicht oder waren zu unbeholfen. Sie nahm auch nie jemanden mit zu sich nach Hause. Sie wollte ausgeführt, entführt und verführt werden. Nur bei Wig war es anders. Wig war der Einzige, dem Maria erlaubte, ihre Wohnung zu betreten. Hätte er das damals gewusst, wäre diese Zeit wahrscheinlich leichter für ihn gewesen.
Überhaupt war damals vieles schwierig. Allein mit Maria in Kontakt zu treten. Mobiltelefone waren zwar schon erfunden, aber nur etwas für eine Handvoll begüterter Freaks, denen es nichts ausmachte, einen fünfzehn Kilo schweren Koffer mit sich herumzuschleppen. Maria hatte zu Hause nicht einmal einen Festnetzanschluss, und der Apparat in der Bank war für ihn natürlich tabu. So blieb Wig also nur das Briefeschreiben. Auch wenn er inzwischen wusste, dass sie nie zurückschreiben würde. Manchmal rief sie jedoch bei ihm an. Immer von einer Telefonzelle und immer mitten in der Nacht. Nicht um zu plaudern, sondern stets mit der eindeutigen Botschaft, jetzt mit ihm schlafen zu wollen. Er war sich nie sicher, ob es Bitte oder Aufforderung war. Es hätte auch keinen Unterschied gemacht. Er war ihr erlegen und ergeben. Für Wig war es die große Liebe. Für Maria war es der beste Sex. Das war mindestens ebenso viel wert.
Die Adventzeit kam, und alle warteten auf Schnee. Die Kurstadt versank in einem Kältesee. Die Sonne ging, wenn es ihr überhaupt gelang, die Wolken zu durchbrechen, erst in der zweiten Unterrichtsstunde auf, und am Ende des Schultages, noch bevor die letzte Stunde zu Ende war, lag schon wieder Nacht über dem Tal. Bei Schülern und Lehrpersonal ließ die Konzentration nach, und Maria war wieder einmal untergetaucht.
Kurz vor Weihnachten fiel endlich der erste Schnee. Das ersehnte Weiß brachte Licht in die Gemüter. Am Tag vor dem Heiligen Abend fand Wig eine Nachricht von Maria auf seinem Anrufbeantworter. Ob er Schi fahre, und wenn ja, ob er Lust hätte, am Stephanitag mit ihr auf den Karstein zu fahren?
Während Wig noch überlegte, wie er Maria eine Antwort zukommen lassen könnte, klingelte das Telefon.
»Und, wie sieht’s aus? Bist du dabei?«
Er war dabei. Gleich nachdem sie aufgelegt hatte, holte er seine Schiausrüstung aus dem Keller und montierte noch am selben Abend die Dachträger auf seinen Mini Cooper.
Wig war kein sehr guter, aber ein passabler Schifahrer, er fuhr am liebsten in langen Bögen und hatte gerne alles unter Kontrolle. Die ersten Schwünge waren noch ungewohnt und steif. Bald aber kam das Gefühl für das Gleichgewicht und den Schwerpunkt zurück. Mit dem wachsenden Vertrauen in das Zusammenspiel seiner Sinne und beflügelt von Marias Gegenwart bekam Wig auf einmal Lust auf Geschwindigkeit. Es waren perfekte Bedingungen und nur wenige Leute auf der Piste. Also ließ er es krachen. Doch wie schnell er auch fuhr, Maria tanzte ohne ersichtliche Anstrengung neben ihm her und schwang stets vor ihm ab. Bei jeder Gelegenheit, die sich bot, bog sie von der Piste ab in den Tiefschnee. Er probierte es auch. Doch schon bevor er den ersten Schwung ansetzen konnte, verschnitt es ihn, und er riss einen fürchterlichen Stern. Am Ende des Tages war er glücklich, aber so erschöpft, dass er Maria das Steuer des Mini überließ und nach wenigen Kilometern Fahrt am Beifahrersitz einschlief.
Ein Jahr später nahm Maria ihn mit auf eine mehrtägige Schitour in die Berge, wo sie aufgewachsen war. Sie zeigte ihm die Seilbahn und die Stütze, wo sie zur Welt gekommen war. Sie zeigte ihm die Almhütte ihrer Großeltern, die tief verschneit in einer windgeschützten Senke des Plateaus lag. Sie mussten sich erst einen Schacht durch den Schnee graben, bis sie an die Tür kamen. Wig lernte von ihr, wie man im Ofen Feuer macht, wenn der Kamin nicht zog. Sie brachte ihm das Tiefschneefahren bei. Sie zeigte ihm, wie man mit der richtigen und gleichmäßigen Gewichtsverlagerung, allein mithilfe der Schwerkraft und der Fliehkräfte, durchs Leben schweben konnte. Sie zeigte ihm, wo die schönsten unverspurten Hänge lagen, unter welchen Bedingungen und zu welcher Tageszeit sie sicher befahren werden konnten. Mit anderen Worten, sie zeigte ihm ihre Welt. Und Wig? Wig war verzaubert von ihr. Er bewunderte Maria für ihre Furchtlosigkeit, ihre Geschicklichkeit, ihre Energie und ihre Ausdauer.
Das hatte leider einen Nebeneffekt. Es beschlich ihn ein Gefühl von Unterlegenheit und Ausgeliefertsein. Letzteres sollte sich noch verstärken, als es am dritten Tag zu schneien begann.
Zuerst löste sich im stetig dichter werdenden Schneefall die verschneite Bergkulisse mit all ihren felsigen Graten auf. Dann verschwanden nach und nach auch die letzten Orientierungspunkte — die trutzigen Zirben, knorrige, zeitlose Zeugnisse der Überlebenskunst. Mehr Skulpturen denn Bäume. Mehr Geschaffenes als Geborenes. Mehr Kunst als Natur. Zurück blieb weiße, makellose Zweidimensionalität. Es war, als hätte Gott auf den Reset-Knopf gedrückt und seine ganze Schöpfung rückgängig gemacht, als hätte er mit einem großen Tuch alles weggewischt.
Nur ihre kleine Hütte schien er ausgespart zu haben. Maria kletterte durch das Fenster hinaus, um den Kamin und die Tür freizuschaufeln. Als sie fertig war, schnallte sie sich die Schier an und erklärte, die zur Neige gehenden Lebensmittel aufstocken zu wollen. Wig solle inzwischen den Ofen anheizen und das Feuer hüten, sie würde in drei Stunden wieder da sein. Er wäre lieber mitgekommen, aber er wollte sich keine Blöße geben, also ergab er sich seinem Schicksal. Er hatte keinen Schimmer, woran oder wie Maria sich orientiert hatte, und es dauerte auch nicht drei, sondern fünf Stunden, aber sie fand tatsächlich wieder zurück. Wigs Erleichterung war groß, aber von da an fühlte er sich unterlegen. Die Beziehung war aus dem Gleichgewicht. Während er seiner Bewunderung immer wieder Ausdruck verlieh, für ihre Kompetenzen in Sachen Orientierung, Geschicklichkeit oder physischer Stärke, fand sie ihm gegenüber nie Lob für irgendetwas. In ihrer Familie hatte es das auch nicht gegeben, weder Lob noch Tadel. Sie war ohne Strafen aufgewachsen, aber auch ohne Belohnungen.
Maria schien zwar nicht unverwundbar, aber schmerzbefreit und, wenn schon nicht alles, so doch sich selbst immer im Griff zu haben. Ihre Nähe entspannte ihn und gab ihm Sicherheit. Auch nach einem Jahr fand er alles an ihr wunderbar. Umgekehrt fragte er sich aber, was sie an ihm hatte. Außer, dass sie gerne mit ihm ins Bett ging. Er hätte sie das gerne gefragt, aber die Angst vor der Antwort hielt ihn davon ab. Was, wenn sie es gar nicht wusste? Vielleicht war er nur das kleinere Übel. Und das auch nur so lange, bis sie ein noch kleineres gefunden hatte.
Hätte Wig sie gefragt und Maria auch Worte für ihre Gefühle gefunden, wäre er überrascht gewesen. Maria hatte nämlich den Eindruck, all ihre Fähigkeiten wären im Grunde zu nichts zu gebrauchen. Es sei denn, sie hätte den Beruf der Sportlerin ergriffen. Etwas, das ihrem Verständnis nach jedoch an Sinnlosigkeit nicht zu überbieten gewesen wäre. Am Ende eines Wettkampfes standen viele Verliererinnen einer einzigen Siegerin gegenüber. Nur ein krankes Gemüt konnte sich darüber freuen. In einer archaischen Gesellschaft wäre sie wahrscheinlich eine große Jägerin gewesen, eine, die ein ganzes Dorf mit Fleisch versorgt hätte. Aber heutzutage? Sie hätte viel lieber Wigs Gabe gehabt, Kindern die Geheimnisse des Lebens zu vermitteln.
Im fünften Sommer ihrer Beziehung wurde Maria schwanger. Es geschah während ihrer zweiten Griechenlandreise. Maria hatte die Pille abgesetzt. Einerseits weil sie ständig zugenommen hatte und sich nicht mehr wohl in ihrem Körper fühlte, andererseits weil sie seit einem Jahr keine Lust mehr auf Abenteuer mit anderen Männern hatte und nur noch Wig an sich heranließ. Sie wollten an den fruchtbaren Tagen besonders vorsichtig sein.
Doch Marias Körper hielt sich nicht an Regeln. Befreit von den regelmäßigen hormonellen Morgengaben, setzte das Ei nicht dann zum Sprung an, wenn es das hätte tun sollen, sondern nach eigenem Gutdünken, und so war es nur eine Frage der Zeit, bis es klingelte.
Es war im Urlaub. Früh am Morgen. Maria stand bis zu den Knien im Meer. Sie spürte den sandigen Boden zwischen ihren Zehen und die Wellen in den Kniekehlen. Sie war fünfundzwanzig und fühlte sich wie eine zur Blüte gereifte Knospe. Bei dem Gedanken musste sie lachen. Aber sich als Blüte zu fühlen war ein schöner Gedanke, und sie nahm ihn mit, als sie sich mit ihrem ganzen Körper nach hinten ins Wasser gleiten ließ und mit langsamen Tempi der aufgehenden Sonne zutrieb. Strömungswirbel streichelten ihre Schamlippen. Weit draußen machte sie tote Frau, füllte mit tiefen Atemzügen ihre Brust und legte den Kopf in den Nacken. Sie spürte ihr Haar sich in den Wellen wiegen und die Bewegung auf ihre Kopfhaut weitergeben. Mit jedem Ausatmen sanken Becken und Beine langsam nach unten. Einatmen, Rücken durchstrecken, ihren Busen und ihre ganze Weiblichkeit dem Himmel darbieten. Luft anhalten, ausatmen, und wieder von vorne. Eins werden mit dem Meer und dem Himmel. Loslassen. Wärme breitete sich ihren Schenkeln entlang aus und verlor sich wieder. Da spürte sie, dass etwas anders war, etwas hatte sich verändert.
Vielleicht war es auch das mediterrane Klima oder der Vollmond? Kaum zurück vom Urlaub, wurde Maria klar, dass etwas im Busch war. Sie gab Wig sofort bekannt, abtreiben zu wollen. Er beschwor sie, diesen Schritt nicht zu tun. Sie könnten heiraten. Wenn sie nicht zu Hause bleiben wolle, würde er sich ein Sabbatical nehmen und den Hausmann machen. Wig bekam seinen Wunsch erfüllt. Die Hochzeit wurde ohne viel Feierlichkeit und ohne den Segen der Kirche, aus der Herwig schon als junger Mann ausgetreten war, auf dem Standesamt geschlossen. Maria war fünfundzwanzig, Wig dreißig. Ihr Leben war auf Schiene. Dachten sie.
Sie übernahmen die geräumige Wohnung seiner Eltern. Diese bezogen ihrerseits ein nur unwesentlich kleineres, dafür aber kaiserlich-königlichen Geist atmendes Quartier im Dienstbotentrakt der einstigen habsburgischen Sommerresidenz. Agnes hatte dort vor einem Jahr den Verwaltungsposten übernommen.
Trotz des aussichtsreichen Nistplatzes und der hoffnungsvollen Umstände rollte die Glückskugel vom Tisch. In der fünfzehnten Schwangerschaftswoche ging das Kind ab. Als es geschah, dachte niemand, am allerwenigsten Maria selbst, dass sich dieses Ereignis zu einer Katastrophe auswachsen könnte. Doch die ungeplante und für lange Zeit unerwünschte Frucht hatte in Marias Körper eine Sehnsucht geweckt. Schon vor dem Auftreten der Krämpfe, die das Ende einleiteten, war sich Maria sicher geworden, das Kind austragen zu wollen. Ab da wollte sie ein Kind. Die geflüchtete Seele hatte eine Leere hinterlassen.
Herwig wusste zuerst nicht, wie ihm geschah. Nach dem Abortus wollte Maria in Ruhe gelassen werden. Sie müsse erst abwarten, bis sich ihr Zyklus normalisiert hatte. Als es dann so weit war, konnte sie gar nicht genug bekommen, vor allem nicht an den Tagen, wo sie ihren Eisprung zu haben glaubte. Es war Vögeln so, wie es sich der Papst vorstellte, lustloser Befruchtungsvollzug. Das ging drei Jahre so dahin, ohne dass die Hoffnung zu Hoffnung wurde. Bis eine Untersuchung ergab, dass Maria keine Kinder bekommen könne. Nachdem sich herausgestellt hatte, dass ihr Körper nicht dazu fähig war, Wig, sich selbst und der Welt ein Kind zu schenken, zerbrach etwas in ihr. Sie verlor den Glauben an sich und den Glauben an das Leben überhaupt. Wigs Vorstellung, nun wieder zu lustbetonter Vereinigung zurückkehren zu können, erwies sich als Illusion. Bei Maria versiegte nun jeglicher Wunsch nach körperlicher Nähe, und erotische Prohibition trat in Kraft.
Der Mensch kann jedoch auf Dauer nicht ohne Erregungszustand und Sinnesreiz leben, also sucht er sich den Kick auf Abwegen. Maria entschied sich für die Ausschüttung körpereigener Substanzen, um sich wegzubeamen, und Wig griff zum Alkohol, um den Weltschmerz auf Distanz zu halten.
Maria nahm sich ihres Körpers an, als gelte es, ihn zu bestrafen, weil er sie im Stich gelassen hatte, als es drauf angekommen war. Sie begann ihn zu quälen und Prüfungen auszusetzen. Sie fing an, wie besessen Rad zu fahren und auf den Bergen herumzuklettern. Wenn niemand bereit war, mit ihr zu gehen, ging sie eben allein. Sie kaufte einen Gleitschirm, ließ sich einmal von einem Bekannten kurz unterweisen, wie es geht, und sprang, ohne zu zögern, das Schicksal und alle Schutzengel herausfordernd, in jeden Abgrund, aus dem ihr ein Wind entgegenblies.
Wenn das Wetter gar nichts zuließ, strampelte sie mit geschlossenen Augen und Musik aus einem Walkman in den Ohrstöpseln im Flur auf einem Ergometer durch karge Landschaften. Sie radelte am liebsten durch eine menschenleere Wüste. Zu Musik, die nach Sand und Hitze schmeckte. ZZ Top waren perfekt dafür geeignet, oder Canned Heat. Beide Kassetten hatte sie von ihrer Mutter geschenkt bekommen.
Wig reichten anfangs ein, zwei Gläser Rotwein. Es dauerte aber nicht lange, da war er bei einer ganzen Flasche. Es half ihm, der Realität zu entfliehen. Mithilfe des Alkohols konnte er die unerträgliche Schwere des häuslichen Seins wie eine ausgebrannte Trägerrakete absprengen. Um am nächsten Morgen erneut und umso heftiger von der Schwermut zu Boden gedrückt zu werden.
Einmal dachte er laut darüber nach, dass man doch auch ein Kind adoptieren könne. Sie ließ ihn alleine nachdenken und wechselte einfach das Thema. Die unerquicklichen Tage wurden häufiger und heftiger. Marias Bewegungsdrang wurde immer haltloser und wuchs sich zur Besessenheit aus. Wigs Sorgen ließen sich nicht mehr ertränken. Er gab das Trinken auf und versuchte mit kleineren und größeren Aufmerksamkeiten einen Fuß in die Tür zu ihrer Seele zu bekommen, kaufte Blumen, besorgte Konzertkarten, buchte einen Schiurlaub am Arlberg und überraschte sie mit einer Wochenendreise nach Barcelona. Alles Sachen, worüber sie früher gesprochen, wovon sie geträumt hatte. Aber es änderte nichts an der Gesamtwetterlage. Die blieb angespannt, mit Neigung zu lokalen Gewittern, die sich sporadisch über Wigs Haupt entluden. Zum Beispiel, wenn er davon sprach, noch einmal von vorne beginnen zu wollen. Sich von allem Dinghaften zu trennen. Die Wohnung aufzulösen. Alles zu verkaufen und ihre Habe auf einen Koffer zu reduzieren. Den Job zu kündigen. Einen VW-Bus zu kaufen und der aufgehenden Sonne entgegenzurollen. Schauen, was kommt. Der Welt und ihrem Leben noch eine Chance geben.
Diese Art von Text regte Maria maßlos auf. »Dann geh doch. Rede nicht dauernd davon. Tu es einfach.«
»Ich will dich aber mitnehmen.«
»Ach, Wig, du nervst mich mit deiner Opferbereitschaft.«
Die Jahre, ja die Jahrzehnte vergingen zäh und doch wie nichts. Wig hielt an der Schulroutine fest, wie ein im Wasser treibender Schiffbrüchiger sich an eine Holzplanke klammert. Der Stundenplan war seine Schwimmweste, das Klassenzimmer seine Arche, die Kinder Geschöpfe, die es vor der Sintflut des Schwachsinns zu retten galt. Er goss seine ganze Leidenschaft in den Unterricht. All seine Hoffnung auf ein besseres Morgen setzte er in die heranwachsenden Mädchen und Buben.
Anfang Dezember gab Marias Walkman seinen Geist auf, und Wig schenkte ihr zu Weihnachten einen neuen, digitalen Musikplayer. Nicht diesen MP3-Scheiß, wie er extra betonte, sondern einen, der in der Lage war, Musik unkomprimiert wiederzugeben, so wie sie aufgenommen worden war. Er hatte auch gleich Musik draufgeladen, von der er dachte, sie würde ihr gefallen.
Rasch hatte sie alles, was sie nicht mochte, herausgelöscht. Das ganze Country-Gesülze zum Beispiel. Auch Jazzmusik ging gar nicht. Jazz fand sie entweder akademisch fade oder freigeistig anstrengend. Die Beach Boys hatte sie zuerst begnadigt, dann aber der klebrigen Süße ihres Chorgesangs wegen ebenso entsorgt. Dieses ineinander verwobene Zeug war nichts für sie. Das war gerade so, wie wenn mehrere Leute gleichzeitig sprächen. Wig hatte einst versucht, ihr zu erklären, was eine Fuge ist. Seitdem hatte sie einen weiteren Begriff für etwas, das sie nicht mochte. Aber das Gerät war eines der wenigen Dinge, die sie noch miteinander verbanden.
Jedes Mal, bevor sie in den Sattel des Ergometers stieg, drückte sie auf Zufallsgenerator. Der Kopf wurde von der Musik in Beschlag genommen, klinkte sich aus und überließ das Denken ihren Beinen. Und das Herz tat sein Bestes, um mitzuhalten.
Als die Pummerin in Wien ein neues Jahrtausend einläutete, schürte dieses Ereignis, das genau genommen überhaupt keines war, bei Wig die Hoffnung, die Dinge würden sich jetzt ändern.
Wig war am Ende der Fahnenstange angekommen, und zwar an ihrem unteren Ende. Er steckte fest. Um ihn herum war es pechschwarz. In seiner Hilflosigkeit erinnerte er sich an ein Laster seiner Studienzeit, das ihm damals Gelassenheit beschert hatte. Er begann wieder zu kiffen.
Und siehe da — halleluja, es wurde besser. Es entspannte seine Abende, jedenfalls, solange Maria nichts davon mitbekam. Wenn sie es merkte, folgten ätzende Bemerkungen, so lange, bis er das Weite von ihr und die Nähe anderer Menschen suchte. Er kam mit allen gut aus, war ein geschätzter Kollege, den man um Rat fragen, bei dem man sich ausschimpfen und über andere beschweren konnte. Wig war loyal gegenüber allen, die ihn ins Vertrauen zogen. Aber es gab niemanden, dem er sich anvertrauen konnte oder wollte. Ein weiterer Sommer ging vorüber. Mit dem ersten Frost kamen auch die ersten verschnupften Kinder. Er steckte sich an, der Schnupfen wurde zu einer Erkältung, die Erkältung zur Grippe, er musste ein paar Tage das Bett hüten. Kaum war er wieder in der Schule, bekam er Rückenschmerzen. Diese gingen nahtlos über in Zahnweh. Ein Backenzahn explodierte geradezu und musste ihm gezogen werden. Alles wurde zu Willensübungen. Sein Leben bestand nur noch aus Reflexen. Sein Gesichtsausdruck wurde maskenhaft. Wie in Trance glitt er durch die Tage und Wochen. Ein ganzes Semester zog vorbei an ihm, als würde ein Film vor ihm ablaufen, ein weiteres versickerte spurlos. Der monotone Rhythmus der Schuljahre bildete den immergleichen Grundton. Das Leben war zu etwas Zweidimensionalem geworden, in dem sogar das Atmen schwerfiel.
Das sei wahrscheinlich eine Alterserscheinung, meinte Wolfgang. Ein Kollege, der gerade einmal dreißig Lenze zählte und zu wissen glaubte, wie es sich anfühlen müsste, wenn Mann oder Frau ein Lebensalter von sechzig Jahren erreicht hatte. Aber da täuschte er sich. Ja, Wig würde in einem knappen halben Jahr seinen Sechziger feiern. Er haderte jedoch nicht damit. Im Gegensatz zu seiner um fünf Jahre jüngeren Frau, die jede freie Stunde damit verbrachte, allein oder mit ihren Freundinnen durch die Berge zu hecheln, und bei schlechtem Wetter am Hometrainer leere Kilometer abstrampelte, um sich jung und fit zu halten.
Die Zufriedenheit bezüglich seines Alters kam vom Kiffen, das behauptete jedenfalls sein Freund Konrad. »Nimm einen Zug vom THC, dann tut das Alter nicht mehr weh.« Aber nachdem Konrad es war, der ihn mit dem Kraut versorgte und auch davon lebte, unterstellte ihm Wig, nur Werbung in eigener Sache zu machen. Sein Konsum der toxischen Pflanze war außerdem überschaubar. Jedenfalls bis vor kurzem.