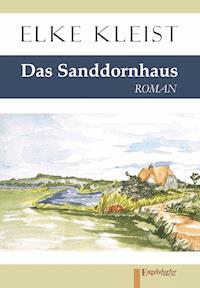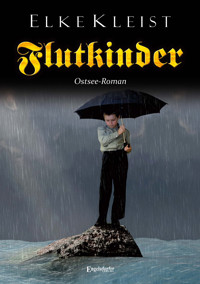
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Engelsdorfer Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das Leben steckt voller Rätsel. Gerade als Nell den Entschluss fasst, ihr Leben neu zu ordnen, erreicht sie die überraschende Nachricht, dass sie die Erbin eines Hauses in Prerow ist. Was mochte Elisabeth Bollnow, die sie kaum kannte, wohl dazu bewogen haben, ausgerechnet ihr das Haus zu vermachen? Und was hatte die alte Dame mit ihrer Großmutter zu tun, die lange vor ihrer Geburt gestorben war? Obwohl Nell ihre Großmutter nie kennengelernt hatte, fühlt sie sich schon ihr ganzes Leben lang wie ein Teil von ihr, als würde ein unsichtbares Band sie zusammenhalten. Aber wie kann das sein? Und was hat es mit dem Bild auf sich, das die kleine Marie 1878 von ihrer Großmutter gemalt hatte und auf dem Nell sich selbst wieder zu erkennen glaubt? Fragen über Fragen. Mehr und mehr taucht sie in die Vergangenheit ein und kommt einem dramatischen Familiengeheimnis und einer lange zurückliegenden großen Liebe auf die Spur, die sie zutiefst berührt, aber gleichzeitig auch verschreckt. Welche Rolle spielt ihr Nachbar Christian dabei? Es knistert gewaltig zwischen ihnen, aber darf das überhaupt sein? Als dann der Fund alter menschlicher Knochen im Prerow-Strom auch noch schreckliche Verbrechen enthüllt, die in der Sturmflutnacht von 1872 ihren Anfang fanden und eng mit Nells und Christians Familiengeschichte verbunden sind, wird alles noch viel rätselhafter. Wer ist wer? Nichts ist, wie es scheint.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 632
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Elke Kleist
FLUTKINDER
Ostsee-Roman
Engelsdorfer Verlag Leipzig 2023
Die Autorin
Elke Kleist, 1956 geboren, lebt seit ihrer Kindheit in Prerow. Sie hat zwei sehr erwachsene Kinder und vier wundervolle Enkel.
26 Jahre lang betrieb sie gemeinsam mit ihrem Mann das Restaurant „Klönsnack“ in Prerow.
Bisher sind von ihr eine Sammlung von Kurzgeschichten und die Romane „Charmefaktor Hering“, „Mit dem Nordost nach Südwest“ und „Das Sanddornhaus“ erschienen.
Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.de abrufbar.
Copyright (2023) Engelsdorfer Verlag Leipzig
Alle Rechte bei der Autorin
Titelbild © Photobank [Adobe Stock]
Hergestellt in Leipzig, Germany (EU)
www.engelsdorfer-verlag.de
INHALT
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Das möchte ich noch loswerden!
KAPITEL 1
1872
Das Unheil kündigte sich in leuchtendem Orange an.
Der Himmel schien zu brennen, doch dann ballten sich schwarze Wolken mehr und mehr zu einer bedrohlichen Wand zusammen und tauchten das kupferrote Licht in tiefes Dunkel. Ein sicheres Vorzeichen, dass es Sturm geben würde. Einen mächtigen Sturm.
Thillmann Lange starrte auf das tobende Meer hinaus. Mit Besorgnis hatte er den seit Wochen anhaltenden starken Westwind beobachtet. Er sollte recht behalten. Inzwischen war daraus ein Sturm mit enormer Gewalt geworden, der nun über Prerow hinweg fegte, erbarmungslos an den Bäumen zerrte, die Häuser durchschüttelte und alles, was nicht fest verstaut war, mit sich riss. Er drückte enorme Wassermassen mit voller Wucht in den Ostteil der Ostsee. Der Weststrand verlor Meter für Meter an das Meer. Es strömte immer weiter in den Darßer Urwald hinein, entwurzelte mit ungeheurer Kraft Windflüchter und verschlang das Land, gerade so, als wollte es alles, was sich ihm in den Weg stellte in die Tiefe ziehen. Währenddessen zog sich das Wasser an der Nordküste immer weiter zurück und hinterließ einen Strand ungeahnter Breite. Ein unheimliches Bild, das nichts Gutes verhieß. Das hatte Thillmann Lange so noch nie erlebt.
Fröstelnd schlug er den Kragen seiner schweren, dunkelblauen Jacke hoch und vergrub die Hände tief in ihren Taschen. Er kehrte dem Strand mit einem unheimlichen Gefühl den Rücken, gerade so, als könnte jeden Augenblick etwas von dort über ihn herfallen. Wie ein imaginärer Feind, der vorzugsweise aus dem Hinterhalt angriff.
Hinter den Dünen, in dem schmalen Küstenwäldchen, verlor der Wind ein wenig an Kraft, legte dafür aber auf der Holzbrücke, die Thillmann Lange über den Strom zurück ins Dorf führte, umso stärker zu. Es kochte und brodelte unter ihm, der Schlund zur Unterwelt schien sich zu öffnen. Thillmann Lange hatte Mühe, sich auf den Beinen zu halten. Die lauernde Gefahr legte sich wie ein Ring aus Eis um seinen Körper.
Er war hier aufgewachsen. Wind, Wellen und Schiffe gehörten zu seinem Leben und es war nur logisch, dass er, wie schon sein Vater, Großvater und Urgroßvater zur See fuhr. Wie fast alle Jungs von hier. Aber während die Söhne der armen Leute als Kajütenjungen oder Leichtmatrosen die Weltmeere befuhren, mehr war für sie nicht drin, ging er als Sohn eines Kapitäns nach ersten Erfahrungen auf See als Schiffsjunge und Matrose sofort auf die Navigations- und Steuermannsschule und legte mit nicht maldreißig Jahren an der Seefahrtsschule Wustrow ebenfalls sein Kapitänspatent ab. Er wollte nie etwas anderes. Das Meer war sein Leben. Er kannte keine Angst, hatte den Stürmen immer lachend ins Auge gesehen.
Aber das hier, das war etwas anderes.
Es war November und seine „Seemöwe“ lag schon im sicheren Hafen in Stralsund. Doch er dachte an die, die noch auf dem Heimweg waren und gegen die zunehmend winterlichen Stürme ankämpfen mussten. Die See kannte kein Erbarmen und er wusste, nicht alle würden es schaffen. Es blieben immer welche draußen, fanden ihr Grab tief unten auf dem Grund des Meeres.
Er warf einen letzten Blick in den grauen Himmel, ehe er den Hafen hinter sich ließ. Er musste nach seiner Frau sehen. Sie stand kurz vor der Niederkunft.
Sie klagte nie, aber er konnte nicht übersehen, wie müde und erschöpft sie schon am Morgen war und wie schwer es ihr fiel, ihre Arbeiten zu bewältigen. Tiefe Falten hatten sich im Laufe der Jahre in ihr ernstes, einst so schönes Gesicht gegraben. Nur manchmal sah er sie versonnen lächeln, wenn sie zärtlich über ihren Bauch strich und leise eine Melodie für das Baby summte.
Vielleicht schenkte sie ihm nach sechs Töchtern endlich den lang ersehnten Sohn.
Sie hatten nicht mehr daran zu glauben gewagt, dass ihnen das Glück eines weiteren Kindes noch einmal zuteilwerden würde. Sie waren schließlich beide nicht mehr die Jüngsten. Zwei ihrer Töchter waren bereits verheiratet, zwei versprochen und die beiden anderen konnten es kaum erwarten, den Großen nachzueifern. Aber der Herrgott hatte es gut mit ihnen gemeint.
Lange liebte seine Töchter und war ihnen immer ein guter Vater gewesen, wie er auch ein guter Ehemann war. Er war ein ruhiger und besonnener Mann, auf See wie zu Hause. Er hatte es als Kapitän zu beachtlichem Wohlstand gebracht, kaum etwas konnte ihn aus der Ruhe bringen. Aber der Gedanke, endlich einen Sohn zu bekommen, dieser langjährige Wunsch, verzehrte ihn und wuchs zu einer verzweifelten Leidenschaft heran, die ihn nicht mehr losließ. Mit einem Sohn würde noch einmal ein ganz neues Leben beginnen. Es würde erst einen wahren Sinn bekommen. Ein Sohn, in den er all seine Erwartungen setzte, der in seine Fußstapfen treten würde, sich wie er den Gefahren des Meeres stellen und die Seemannsehre der Familie Lange in die nächste Generation weitertragen würde.
Diesmal musste es ein Sohn werden.
Nicht weit entfernt, am Krabbenort, lauschte auch Erna Lembke in ihrer altersschwachen Kate dem Heulen des Windes, dem Ächzen des Gebälks und dem unheilvollen Klappern der Fensterläden. Würde das Haus diesen Gewalten widerstehen können?
Oder holten sie jetzt alle ihre Sünden ein?
Sie dachte an ihren Mann, den der Sturm ihr zwei Jahre zuvor nahm und sie mit vier kleinen Söhnen allein zurückließ. Der Sturm hatte nicht danach gefragt, wie sie die Kinder allein satt bekommen, ihnen eine warme Stube schaffen und das alte Haus instand halten sollte. Er hatte auch nicht nach den vielen einsamen Stunden gefragt, in denen sie Kälte umfing und kein starker Arm ihr Geborgenheit gab. Er hatte ihren Mann einfach in die Tiefen des Meeres gerissen.
Sie war stark. Sie musste es sein. Und nur ein einziges Mal war sie schwach geworden. Ließ sich fallen. Vertraute. Nun saß sie hier mit einem weiteren Kind unter dem Herzen, das jeden Tag hinausdrängen konnte. Ein Kind der Sünde. Noch ein hungriges Maul mehr, das zu stopfen sein würde. Und doch, was konnte dieses kleine Wesen in ihrem Bauch dafür. Sie liebte dieses Kind jetzt schon und wer weiß, vielleicht schenkte ihr der Herrgott diesmal ein Mädchen?
Der Vater des Kindes war ein hübscher Kerl, der durch die Lande zog, mal hier, mal dort arbeitete und, wie sich schnell herausstellte, nie lange an einem Ort blieb. Groß, stark, mit rotblonder Mähne, wie ein verwegener Wikinger. Mit süßen Versprechen hatte er sie eingewickelt, sich in ihr Bett geschlichen und dann aus dem Staub gemacht. Ein Kind? Nein, so hatte er sich das nicht vorgestellt, das sollte sie mal schön allein ausbaden.
Und wieder fragte niemand, wie es ihr ging. Die wohlhabenden Frauen des Dorfes blickten verächtlich auf sie herab, ihresgleichen mit spöttischer Häme. Selten begegneten ihr Mitleid und Hilfsbereitschaft, außer beim alten Krüger, der in seinem Laden wieder und wieder bereit war anzuschreiben. Aber irgendwann würde auch er sein Geld einfordern. Geld, das sie nicht hatte, obwohl sie sieben Tage die Woche, oft zehn Stunden und mehr schuftete. Sie hatte für die reichen Scharmbergs, Langes und Niemanns geputzt und gewaschen bis, ja bis ihre Schwangerschaft unübersehbar war und die Herrschaften eine solch unehrenhafte Frau nicht länger in ihren Häusern duldeten.
Also schleppt sie Brennholz aus dem Wald, karrte Dung auf die Äcker und half beim Heu einfahren. Manchmal nahmen sie die Fischer mit auf die See hinaus. Aber die zunehmende Leibesfülle setzte ihr zu und sie musste viel zu früh viel zu harte Arbeit auf die schmalen Schultern ihrer noch viel zu kleinen Jungs abwälzen.
Wieder war es Krüger, der ihr half, sie ein paar Stunden in seinem Laden arbeiten ließ, um wenigstens einen Teil ihrer Schulden begleichen zu können und ihr darüber hinaus gestatte, den einen oder anderen Happen mitzunehmen.
Wären da nicht noch die alte Kuh und der kleine Acker hinter ihrer verfallenen Kate, sie hätte wohl längst mit ihren Kindern ins Armenhaus gemusst.
Und nun noch so ein kleiner Mensch ohne Zukunft.
Sorgenvoll schweifte ihr Blick durch das Fenster, hinaus in die dunkle, stürmische Nacht.
Tief gebeugt stapfte Thillmann Lange gegen den Wind an. Am Dorfkrug machte er Halt. Für ein Glas Rum sollte noch Zeit sein. Der Sturm riss ihm fast die Tür aus der Hand und er musste sich ordentlich ins Zeug legen, um sie hinter sich wieder zu schließen.
Der Schiffer Lukas Scharmberg, die Fischer Tietz und Hensel und noch ein paar Männer saßen um einen runden Tisch herum, blickten auf und nickten ihm stumm zu.
Thillmann Lange rieb seine kalten Hände. Er überlegte kurz, ob er sich zu den Männern setzen sollte, entschied dann aber doch, nur ein schnelles Glas im Stehen zu nehmen.
„Die ‚Windbraut‘ ist auch noch draußen“, sinnierte einer der Männer, während er gedankenversunken in sein Glas stierte.
„Ist ein gutes Schiff“, brummte sein Gegenüber.
„Kohnert ist ein erfahrener Kapitän.“ Lukas Scharmberg lehnte sich entspannt zurück und steckte seine Pfeife in den Mund. Dabei öffnete er ihn weit, als hätte er Sorge, ihn sonst zu verfehlen. „Der weiß, wie er den Sturm zu nehmen hat.“
„Trotzdem, wenn er schlau ist, bleibt er in Wismar bis der Spuk vorbei ist.“
„Ich sage euch, der nimmt es mit jedem auf, auch mit Rasmus.“
„Wenn ihn das mal nicht teuer zu stehen kommt. Mit Rasmus legt man sich besser nicht an.“ Der alte Mann, der das sagte, wiegte bekümmert den Kopf. „Die Meeresgeister kennen kein Erbarmen.“
Thillmann gab dem Dorfschulzen ein Zeichen, ihm einen Rum einzuschenken.
„Wenn ihr schlau seid“, sagte er, an die Männer gewandt, „geht ihr nach Hause und bringt eure Frauen und Kinder in Sicherheit.“ Er hob sein Glas und prostete ihnen zu.
„Hast wohl auch Angst vor Rasmus?“, frotzelte einer der Männer. „Wirst langsam zu alt für die Schifffahrt? Komm her, setzt dich her und trink noch einen mit uns.“
Thillmann schüttelte den Kopf. „Nein, lass mal. Ich sage euch, da kommt noch was. Das ist noch nicht alles. Wenn der Wind auf Ost dreht, dann holt uns alle der Rasmus.“ Er stellte sein Glas ab und legte ein paar Münzen auf den Tisch. Grüßend hob er die Hand an die Mütze und wandte sich dem Ausgang zu.
„Ja, ja, lauf du mal nach Hause und ordne deinen Weibern die Röcke“, rief ihm Lukas Scharmberg höhnisch hinterher und ließ sein Glas polternd auf den Tisch knallen. „He Schulze, noch eine Runde!“
Scharmbergs Worte durchfuhren Thillmann wie ein Dolchstoß. Immer wieder musste er den Hohn der Männer ertragen, dass es bei ihm nur zu einem Sack voll Weiber reichte, während deren Söhne längst mit zur See fuhren.
Ein Sohn! Endlich ein Sohn! Das würde den Spöttern ein für alle Male die Mäuler stopfen.
Missgestimmt entschied er die erneute Erniedrigung zu überhören und verließ das Gasthaus wortlos.
Der Sturm hatte inzwischen noch mehr zugelegt und er hatte Mühe, sich auf den Beinen zu halten. Die Bäume bogen sich unter der Last des Windes, unfähig sich ihm zu widersetzen. Äste fielen krachend zu Boden. Es war dunkel geworden und man konnte nur noch das flackernde Licht der Petroleumlampen in den Häusern sehen. Ohne dieses tröstliche Licht hätte wohl schon so manch einen der Glaube verlassen, unbeschadet durch diese Nacht zu kommen.
Thillmann Lange brauchte sich darum kaum Sorgen machen. Sein Großvater hatte damals das Grundstück auf dem Berg erworben und das Haus gebaut, in dem er und seine Familie heute lebten. Es war ein gutes Haus, massiv gemauert und mit einem stabilen Steindach. Schmucke Fensterläden schützten die Scheiben und drinnen sorgten prachtvolle Kachelöfen für wohlige Wärme.
Vor der Haustür kam ihm seine Jüngste schon entgegengelaufen.
„Papa, Papa, da bist du ja“, ihre Stimme überschlug sich fast vor Aufregung, „die Hebamme war da und hat gemeint, du sollst die Mutter gleich morgen ins Pfarrhaus bringen. Wenn der Sturm noch stärker wird, könnte sie womöglich nicht rechtzeitig bei ihr sein, wenn es losgeht. Außerdem muss sie der Erna, der aus dem Krabbenort, auch beistehen. Da hat sie lieber beide zusammen und …“
„Nun mal langsam, Minning“, unterbrach Thillmann Lange seine Tochter und schob sie ins Haus. Was für ein gutes Gefühl, in ein warmes und behagliches Heim zu kommen und Kälte und Sturm einfach draußen lassen zu können.
Seine Frau stand in der Küche und trocknete sich die Hände an einem Leinentuch ab.
Thillmann Lange setzte sich an den großen Esstisch. „So, so, die Piepersche war hier. Es geht also bald los?“, fragte er mit einem leichten Beben in der Stimme.
Nach sechs Kindern sah man einer Niederkunft nicht mehr so aufgeregt entgegen. Wenn da nicht jedes Mal die Hoffnung wäre, endlich mit einem Sohn gesegnet zu werden.
Wilhelmine nickte zögerlich. „Sie meint, das Kind würde nicht mehr lange auf sich warten lassen. Sie schien besorgt.“
Thillmann sah sie erschrocken an. „Es geht dir doch gut? Und unserem Kind auch?“
„Die Piepersche sagt, dass sich schon alles richten würde.“ Unsicher schaute sie zu ihrem Mann hinüber. „Und dass meine Mutter ganz sicher helfen könnte.“
Thillmann Langes Faust donnerte auf den Tisch. „Ich will nichts von ihr hören, Weib!“
Diese Frau kam ihm nicht über die Schwelle. Dieses unheimliche Weibsbild.
Damals, als sie jung waren, hatte er noch darüber gelacht, aber mit der Zeit bereitete sie ihm mehr und mehr Unbehagen. Kräutergebräu, Handauflegen und nächtliche Besuche auf dem Friedhof bei Vollmond, nein, nein, mit so was wollte er nichts zu tun haben. Basta! Früher hatte man Weiber wie sie als Hexen auf dem Scheiterhaufen verbrannt.
Wilhelmine drehte sich traurig zur Seite. Es hatte keinen Sinn, ihr Mann würde seine Meinung nie ändern. Ihre Mutter hatte eine Gabe, den Menschen dort zu helfen, wo Doktor Wispel es nicht mehr vermochte. Wäre es nach dem alten Arzt gegangen, hätte sie selbst schon lange das Bett nicht mehr verlassen dürfen, weil das Kind viel zu früh nach unten drückte. Aber wer hätte sich dann um ihren Mann und die Mädchen kümmern sollen? Ihre Mutter wusste immer um ein heilendes Mittel. Sicher, manchmal geschahen recht wunderliche Dinge, aber eine Hexe war sie deswegen noch lange nicht.
Doch seinem Ehemann widersprach man nicht. Und von ihren Besuchen bei der Mutter durfte er sowieso nichts wissen.
Sie stütze mit den Händen ihren schmerzenden Rücken. „Bei Erna Lembke ist es auch so weit. Der alte Krüger bringt sie morgen ins Pfarrhaus. Bei ihr zu Hause ist es zu …“, sie suchte nach dem richtigen Wort, „nun, die Piepersche meinte, im Pfarrhaus wäre es sicherer und sie könnte so auch besser nach ihr sehen, weil der Sturm so ungeheuerlich tobt und sie womöglich nicht zu ihr durchkommt.“
Thillmann Lange runzelte unzufrieden die Stirn. „Das ist ungebührlich, dass eine angesehene Kapitänsfrau und eine Tagelöhnerin nebeneinander niederkommen.“
„Dieser Sturm fordert uns allen etwas ab“, versuchte Wilhelmine ihren Mann zu besänftigen, „und sich zu helfen, egal welchen Standes wir sind, ist gottgefällig.“
„Nun denn, dann soll es so sein. Aber unser Kind und der Bastard von der
Lembke unter einem Dach, gutheißen kann ich das nicht.“
Wilhelmine strich ihm über den Arm und rief die Töchter zur Ordnung, die lautstark stritten. „Ab an eure Stickarbeiten. Los, los!“
Kichernd huschten sie hinüber in die anliegende Stube. Wenn die Mutter derart streng sprach, tat man besser wie geheißen.
Wilhelmine lächelte milde, doch dann straffte sie sich. „Grete! Grete!“
Ein dünnes Mädchen, höchstens 13 Jahre alt, kam dienstbeflissen angeflitzt.
„Gnädige Frau?“
Wilhelmine musterte sie skeptisch. Würde dieses halbe Kind, dass kaum älter war als ihre jüngste Tochter, mit all den Aufgaben fertig werden, die während ihrer Abwesenheit zu erledigen waren?
„Pack mir meine Sachen zusammen. Ich werde morgen ins Pfarrhaus gehen bis zur Niederkunft.“ Sie überlegte kurz. „Ich denke zwar, dass das ganz unnötig ist, aber ich will mich beugen. Du wirst dich inzwischen darum kümmern, dass es dem gnädigen Herrn und unseren Töchtern an nichts fehlt.“
„Aber gewiss doch, gnädige Frau.“ Das Mädchen knickste brav und verschwand im Nebenzimmer.
„Du wirst ein Auge auf sie haben müssen.“ Wilhelmine sank erschöpft auf den Stuhl am anderen Ende des Tisches.
„Bring du mir nur einen gesunden Sohn nach Hause. Hier wird schon alles seinen rechten Gang gehen. Und jetzt lass uns essen.“
Über Nacht hatte der Sturm plötzlich nachgelassen. Eine unheimliche, lähmende Stille kroch über das Land.
Überraschung und Erleichterung zog durch die Häuser. Die Menschen atmeten auf und meinten, sie hätten das Unheil überstanden.
Doch dann traf ein, was Thillmann Lange befürchtet hatte. Der Wind frischte wieder auf, drehte auf Nordost und schwoll zu einem noch gewaltigeren Orkan heran als der, der vorher wütete. Er wirbelte den Sand auf und trieb ihn in beißenden Wolken über das Land, riss Sträucher aus dem Boden, entwurzelte Bäume, jagte Regen, Schnee und Hagel vor sich her und drückte das aufgestaute Wasser der Ostsee mit unbändiger Kraft gegen die Dünen und in den Strom.
Erna Lembke zeterte und wehrte sich, aber der alte Krüger ließ nicht nach.
„Erna, du kannst nicht hierbleiben“, polterte er ungehalten. „Das Wasser ist schon gestiegen. Willst du am Ende mit deinen Jungs hier absaufen? Und das Kleine gleich mit?“
„Ich gehe ja mit“, gab sie allmählich mit weinerlicher Stimme nach, „aber wo soll’n meine Jungs denn hin? Ich kann sie doch da nicht mit hinnehmen.“
„Die kommen mit zu uns. Meine Frau hat schon eine Ecke für sie hergerichtet, wo sie schlafen können.“
Erna sackte in sich zusammen. „Ich kann’s doch nicht zahlen.“
Krüger wischte ihren Einwand mit einer Hand weg. „Papperlapapp! Da mach dir mal keine Sorgen nicht. Schickst mir im Frühjahr deine Jungs. Hab genug zu tun auf dem Feld. Jetzt aber hurtig, pack dein Bündel und rauf auf den Wagen, bevor dein jämmerlicher Katen über uns zusammenbricht.“
Das Haus schwankte und knarrte wie zur Bestätigung bedrohlich, als eine weitere starke Sturmbö an ihm rüttelte und unter mächtigem Getöse einen der Fensterläden abriss und wie ein Geschoss durch die Luft jagte.
Trotzdem wollte Erna sich noch nicht geschlagen geben. „Es wird doch wohl nicht so schlimm werden“, unternahm sie einen letzten jämmerlichen Versuch Krüger umzustimmen.
Aber der ließ nicht mit sich reden. „Ich sage dir, Rasmus holt sich jeden, der nicht rechtzeitig wegkommt.“
In dicke Decken gehüllt saßen sie eng beieinander auf Krügers Leiterwagen. Regen und Hagel peitschte ihnen in die Gesichter und die Pferde hatten Mühe, gegen den Sturm anzukommen.
Von allen Seiten kamen sie, auf Fuhrwerken, mit Bollerwagen und zu Fuß, um sich vor dem drohenden Wasser in Sicherheit zu bringen. Mit vor Nässe triefenden Sachen scharrten sie sich um die kleinen Feuer im Pfarrhof, denn für alle war einfach kein Platz im Haus. In der Scheune teilte die Frau vom Schulzen heiße Pellkartoffeln aus und gab den Müttern etwas Milch für die Kleinsten.
Selbst im Angesicht der drohenden Katastrophe würdigten die anderen Frauen Erna kaum eines Blickes. Als hätte sie eine ansteckende Krankheit wendeten sie sich demonstrativ von ihr ab.
Erna kochte vor Wut. Was bildeten diese Weiber sich ein. Nicht eine von ihnen hatte auch nur den blassesten Schimmer davon, wie es war, wenn die Kinder sich vor Hunger und Kälte in den Schlaf weinten, weil es wieder mal nicht für alle reichte und wie es war,sich ganz allein durchschlagen zu müssen. Die konnten ihr alle den Buckel runterrutschen, diese ach so ehrhaften Damen. Die hochnäsige Borchers da drüben, die bald jeden Tag Prügel von ihrem Mann einheimste, so dass sie grün und blau durch Prerow lief und sich trotzdem aufführte, als hätte sie die beste Partie von allen gemacht. Erna hatte nie Schläge von ihrem Mann bekommen. Er war ein guter Mann, Gott habe ihn selig. Oder die Grube und die Müller, die in ihren kostbaren Pelzen herumstolzierten und Gott weiß was vornehm taten. Aber Erna hatte sie mit eigenen Augen gesehen, wie sie bei Nacht und Nebel im Haus der alten Hebamme verschwanden, um beseitigen zu lassen, was sie sich bei irgendwelchen Techtelmechteln eingefangen hatten, während ihre Männer Monate lang auf See ihr Leben riskierten.
Wem hatte die alte Hebamme nicht schon alles aus der Not geholfen und sich dafür gut entlohnen lassen. Aber sie öffnete auch denen ihre Tür, die nichts hatten. Sie kannte das Elend der gepeinigten Frauen nur zu gut.
Für Erna war das nicht in Frage gekommen. Kinder waren ein Gottesgeschenk, ob willkommen oder nicht. Sie würde auch dieses kleine Bündel groß bekommen.
Früh um vier Uhr brachen Dünen und Deiche und das Meer stülpte sich wie ein riesiger, schwarzer Krake über den Bodden und brachte ihn zum Überlaufen. Der Sturm peitschte das Wasser vor sich her, gurgelnd und brausend füllte es die tiefer gelegenen Dorfwiesen, Wege und Grundstücke. Gierig stürzte es sich auf alles, was sich ihm in den Weg stellte, spülte den Lehm aus den Fachwerken heraus, zersplitterte Fensterglas und drang in die Häuser ein. In den Stuben schwammen Tische und Stühle herum, kostbares Porzellan und einfachstes Tongeschirr wurden von den Regalen gerissen und zerbarsten gleichermaßen in tausend Scherben.
Eiskalt umschloss das strömende Wasser die Körper derer, die sich nicht rechtzeitig auf ihre Hausböden retten konnten und riss etliche von ihnen gewaltsam mit sich in den Tod.
„Das Wasser kommt! Das Wasser kommt!“ Ein Mann kam auf den Pfarrhof gerannt und wedelte wild mit den Armen. „Der Krabbenort ist schon überflutet und der halbe Ort. Hat einer Lampes und Kretzmers gesehen? Sind die hier? Wir konnten sie nirgends finden.“ Grauen schwang in seiner Stimme mit.
Entsetzt blickten die Leute in die Runde und schüttelten die Köpfe, einige brachen weinend zusammen und schlugen verzweifelt die Hände vor’s Gesicht.
„Wir müssen hier weg!“ schrien andere, von Panik getrieben.
„Nein, bleibt hier! Das wäre euer sicherer Tod!“
Die Menschen wussten nicht, was sie tun sollten. Sie rannten ruhelos hin und her, jammerten, schickten laute Gebete gen Himmel oder verfielen in lähmende Apathie, unfähig, auch nur einen Finger zu rühren.
In dieser Nacht konnte und wollte niemand schlafen. Die Angst um das eigene Leben, das ihrer Familien und ihre Besitztümer, seien sie noch so klein, hielt alle wach.
„Der Krabbenort unter Wasser? Oh mein Gott, das Haus“, flüsterte Erna erschrocken. „Was soll nun bloß aus uns werden? Wo soll ich jetzt mit meinen Kindern bleiben? Lieber Gott, bin ich nicht schon genug gestraft, kennst du gar kein Erbarmen?“
Doch dann wurde ihr erst richtig bewusst, was der Mann gesagt hatte. „Der halbe Ort? Meine Kinder! Herr im Himmel, sie sind beim alten Krüger!“
Der Mann, der eben die niederschmetternde Nachricht gebracht hatte, war schon wieder auf dem Weg zurück ins Dorf, um denen zu helfen, für die die Hilfe noch nicht zu spät kam.
„Der Laden vom Krüger liegt auf einem Reff, da kommt das Wasser nicht hoch, gute Frau. Deine Kinder sind da sicher“, rief er ihr zu und war, ehe Erna ihn noch etwas fragen konnte, um die Ecke verschwunden.
„Lieber Gott, ich danke dir!“ Erleichtert drückte Erna ihre Hände fest an ihr Herz.
Im selben Moment ließ sie ein stechender Schmerz, als würde ihr jemand ein Messer in den Bauch stoßen, fast in die Knie gehen. Sie konnte sich gerade noch an einer Wand festhalten. Es ging los. Ausgerechnet jetzt. Wo war die Piepersche?
Erna zwang sich tief ein- und auszuatmen. Was sollte schon passieren, versuchte sie sich zu beruhigen, war schließlich nicht ihr erstes Kind. Sie wusste doch, wie so was ablief. Sie schleppte sich in gebückter Haltung zum Haus, um die Qual abzumildern. Aber die nächste Wehe rollte bereits heran und schien ihren Leib auseinanderreißen zu wollen. Das ging zu schnell! Sie musste einen Platz finden. Sie konnte ihr Kind doch nicht hier im Hof zur Welt bringen.
Plötzlich waren zwei Männer zur Stelle und packten sie bei den Armen. Unter dem Kommando der Hebamme Pieper brachten sie sie in eine winzige Schlafkammer, wo eine Stalllaterne für spärliches Licht sorgte. Aber es war ruhig und saubere, weiße Tücher lagen bereit.
Die alte Hebamme wusch sich die Hände in der bereitgestellten Waschschüssel, schrubbte die Nägel und zog dann die weißen, leinenen Sachen über ihr grobes Wollkleid.
„Leg dich da hin“, rief sie Erna über die Schulter hinweg zu. „Woll `n doch mal sehen, was dein Kleines macht.“
Mit erfahrenen Händen tastete sie Ernas Bauch ab und nickte zufrieden mit dem Kopf. „Hast noch Zeit.“
Die Tür zur Kammer öffnete sich einen Spalt und ein dünnes, blasses Mädchen steckte ihren Kopf herein. Hastig flüsterte sie der Hebamme etwas zu und verschwand genauso schnell wieder, wie sie gekommen war.
„Ich muss nach dem Kapitän seine Frau sehen“, sagte die Alte, ohne sich noch einmal zu Erna umzudrehen. „Musst laut rufen, wenn’s bei dir los geht.“
Erna schaute ihr mutlos hinterher. So eine Kapitänsfrau hatte natürlich Vorrang. Was galt schon das Kind einer Tagelöhnerin, wie sie eine war. Eine wie sie war unter Null.
„Das Kind liegt falsch. Ich werd’s drehen müssen.“ Die Hebamme sah Wilhelmine Langes schmerzverzerrtes Gesicht. „Nu gucken’s mal nicht so düster, ist noch keins dringeblieben.“
Sie drehte Wilhelmine den Rücken zu, um sie ihre Sorge nicht sehen zu lassen. Das sah gar nicht gut aus. Das würde verdammt schwer werden, noch dazu, wo die Frau nicht mehr die jüngste war. Hoffentlich hatte sie noch genug Kraft das durchzustehen.
„Trulla, mach Wasser heiß“, wies sie das Mädchen an, das ihr zur Seite stand, „viel heißes Wasser brauch ich!“
Wilhelmine Lange versuchte mühsam sich ein wenig aufzurichten. „Piepersche, konntest du sehen, ob es ein Junge ist?“, fragte sie mit schwacher Stimme.
Die Hebamme blickte erstaunt auf. Was war in dieses Weibsbild gefahren? Ein Kind, das falsch lag, konnte leicht den Tod von Mutter und Kind bedeuten. Was spielte es da für eine Rolle, ob es ein Junge oder ein Mädchen war?
Doch dann ging ihr ein Licht auf. Draußen, vor der Tür, lief Thillmann Lange wie besessen auf und ab. Nur mit Mühe hatte sie ihn davon abhalten können, sich mit in die Kammer hinein zu drängeln. So weit kam das noch, ein Mannsbild bei der Niederkunft mit dabei.
Der Herr Kapitän, dachte sie grimmig, setzt seiner armen Frau zu. Sechs Töchter und kein Sohn, das nagt an seinem Mannesstolz. Verärgert schüttelte sie den Kopf. Diese Kerls sollten mal Kinder kriegen. Das wollte sie erleben. Den ganzen Darß würden die zusammen brüllen.
„Das können S’ noch nicht sehen“, grummelte sie und schrubbte ihre Hände noch einmal gründlich, „da müssen S’ schon warten, bis das Kind sein Hinterteil rausstreckt.“
Dann schaute sie Wilhelmine Lange mitfühlend an. „Hier, nehmen S’ das. Ist gegen die Schmerzen. Dann merken S’ nicht so viel.“ Sie nickte der Kapitänsfrau aufmunternd zu.
Wilhelmine Lange griff nach der Hand der Hebamme. „Piepersche, denkst du, der Herrgott wird mir beistehen?“
Sieh mal einer an, dachte die alte Hebamme, nichts übrig von der stolzen gnädigen Frau. Am Ende sind sie doch alle gleich.
Sie tätschelte der verängstigten Frau den Kopf. „Machen S’ sich mal keine Sorgen. Bei dem Jungen von Johanna Schuster, letztes Jahr, war’s genauso, und gucken S’ ihn sich heute an. Ein Prachtkerl. Hier, nehmen S’ von den Tropfen.“
Wilhelmine musterte das kleine braune Fläschchen ängstlich.
Die Hebamme zwinkerte ihr vertraulich zu. „Können S’ ruhig schlucken. Sind von ihrer Mutter. Zehn Tropfen. Nicht mehr.“
Wilhelmine drückte die kleine Flasche an sich. Nun würde alles gut werden. Sie blickte zur Tür. Dass nur Thillmann nichts davon mitbekam.
Vorsichtig, um ja nichts zu verschütten, nahm sie die Flasche an den Mund. Waren das jetzt zehn? Oder noch nicht? Vielleicht noch einen.
Die Wirkung setzte schnell ein und Wilhelmine fühlte sich auf einmal leicht und schwerelos. Sie schwebte einem Licht entgegen. Kein Sturm, kein Wasser konnten ihr jetzt noch etwas anhaben.
Wie aus weiter Ferne drang die aufgeregte Stimme der Hebamme zu ihr durch, verschwommene Bilder tanzten vor ihren Augen und irgendetwas schien ihren Körper auseinanderreißen zu wollen. Warum quälte die Piepersche sie so? Warum ließ man sie nicht in Ruhe? Warum ließ man sie nicht in das Licht?
Als das Kind seinen ersten kläglichen Schrei von sich gab, war sie schon in einen tiefen Schlaf gefallen. Ein Schlaf der vollkommenen Erschöpfung und Erlösung.
Kaum hatte die Hebamme Mutter und Kind versorgt, setzten auch bei Erna die letzten Wehen ein.
Die Piepersche kniete vor ihr. „Los Erna, noch einmal pressen. Ja, so ist es gut. Warte, noch nicht, warte, warte und jetzt, noch einmal, pressen!“
Erna schnaufte, fluchte und brüllte vor Schmerzen, um im nächsten Moment versöhnliche Gebete gen Himmel zu schicken.
„Ich seh `s schon, da ist das Köpfchen. Los Erna, noch mal pressen! Press, Press!“
Im selben Moment, in dem Ernas Kind ihren schützenden Leib verließ, erschütterte ein Beben das Pfarrhaus. Direkt über Ernas Kopf ragte durch ein schier riesiges Loch im Dach ein gewaltiger Ast. Der eisige Sturm schoss in die kleine Kammer, wirbelte herum und ließ augenblicklich die Luft gefrieren und Hagelkörner auf sie herab prasseln.
Erna schrie erschrocken auf, aber die Hebamme behielt einen kühlen Kopf. Mit einem schnellen Schnitt trennte sie die Nabelschnur durch, raffte eins der sauberen Tücher und wickelte das Kind darin ein, um es vor der Kälte zu schützen und drückte es an sich.
„Sie holen dich gleich hier raus“, rief sie, schon an der Tür, und verließ eilig mit dem Baby die Kammer, ohne weiter auf Erna zu achten, die hilflos die Hände nach ihrem Kind ausstreckte.
Der Raum nebenan, in dem Wilhelmine immer noch in tiefem Schlaf lag, war unbeschädigt geblieben.
„Glotz nich, lauf los, Trulla! Sie sollen die Erna da drüben wegholen. Der Baum ist genau über ihr rein“, befahl die Hebamme dem Mädchen, das bei Wilhelmine Wache hielt.
Dann kümmerte sie sich um Ernas Kind und legte es neben Wilhelmines Säugling in eine große Holzwiege.
Trulla kam zurück. „Die Frau vom Schulzen und ein paar andere haben die Erna schon umgebettet.“
Die alte Hebamme nickte zufrieden. „Dann ist’s ja gut.“
„Soll ich der Erna jetzt ihr Kind bringen?“ Trulla stand bereits an der Wiege, bereit, nach dem kleinen Bündel zu greifen.
„Nein, du bleibst hier und passt mir gut auf die gnädige Frau auf. Ich schau erst mal nach Erna, ob alles recht ist, bevor ich das Kleine in die Kälte hinaustrage“, wies die Hebamme sie an. „Und dass du mir keinen einen hier reinlässt. „
Sie machte sich auf den Weg zu Erna.
Thillmann Lange war die ganze Zeit, von Ängsten, Hoffnung und Ungeduld getrieben, vor der Kammertür auf und abgelaufen. Er hatte den Kampf, den seine Frau auszufechten hatte mit angehört und konnte doch nur hilflos abwarten. Die Sorge um sie nahm ihm fast den Atem. Er dachte weder an die Mädchen zu Hause noch an den Sturm und das Wasser, oder an die Männer, die jetzt draußen auf See waren. Nicht einmal der Sohn war wichtig, den er sich doch so sehnlichst wünschte. Einzig Wilhelmine galt seine Sorge.
Er hatte sich damals auf den ersten Blick in sie verliebt und sie gegen den ausdrücklichen Willen seines Vaters geheiratet, was zu einem Jahre andauernden Bruch zwischen ihnen führte. Erst auf dem Sterbebett hatten Vater und Sohn ihren Frieden miteinander gemacht.
Wilhelmine sollte die Tochter einer Hexe sein? Damals hatte er alles Gerede und die Gerüchte um Wilhelmines Mutter als Unfug abgetan. Wer glaubte denn so was. Aber irgendwann war auch ihm die Alte immer unheimlicher geworden und er fürchtete um den guten Ruf seiner Familie. Er verbot seiner Frau jeglichen Umgang mit ihrer Mutter. Er wollte die Hexe nicht in ihrem Leben haben.
Wilhelmine war ihm immer eine getreue Frau und den Kindern eine gute Mutter gewesen. Und Gott sei Dank hatten weder sie noch eine seiner Töchter die Neigungen der verrückten Großmutter geerbt. Na, das hätte er auch zu unterbinden gewusst.
Es übermannte ihn ein Schwall von Zärtlichkeit für seine Frau, ein Gefühl, dass ihn in der Jugend fast um den Verstand gebracht hatte und dass er längst verschollen glaubte. Unbändige Angst packte ihn. Sollte er sie jetzt etwa verlieren?
Ob er wollte oder nicht, er hatte seinen Posten vor der Tür dann doch verlassen müssen. Die Ereignisse überschlugen sich, der ganze Pfarrhof war in Aufruhr und stand mittlerweile auch unter Wasser, das glücklicher weise nicht bis ans Haus heran reichte. Es galt, den vielen Verletzten zu helfen und schnell die entstandenen Schäden am Gebäude wenigstens notdürftig zu beheben, um den Leuten Schutz zu gewähren. Da wurde jede Hand gebraucht. Auch seine.
Die alte Hebamme stellte beruhigt fest, dass man für Erna einen sicheren Platz gefunden hatte und untersuchte sie. „Gut. Sehr gut. Alles raus. Wirst schnell wieder auf die Beine kommen.“
„Piepersche, wo ist mein Kind?“ Erna zerrte sie am Arm. „Wo ist mein Kind? Ist alles in Ordnung mit meinem Kind?“
Die Hebamme drückte Erna zurück auf das Lager. „Is allens dran. Trulla bringt’s dir gleich, dein Kind. Ruh’ dich erst mal aus.“
„Piepersche, was ist es?“ Erna schaute die Hebamme flehend an.
Die lächelte listig. „Wirst ja gleich sehen.“
Sie ließ Erna allein zurück und machte sich auf die Suche nach Thillmann Lange, der ihr schon entgegen gelaufen kam.
Er brachte kein Wort heraus, während er ihr zuhörte. Seine Kehle war wie zugeschnürt. Aber in seinen Augen standen all die Ängste und Hoffnungen, die ihn seit Stunden umtrieben.
Endlich fand er seine Stimme wieder. „Ein Mädchen also“, sagte er tonlos, aber es schien gerade so gar keine Bedeutung für ihn zu haben. Er packte die Hebamme am Kragen. „Aber was ist mit meiner Wilhelmine? Es geht ihr doch gut?“ Nackte Angst spiegelte sich in seinem Gesicht wider.
Ärgerlich schüttelte die Hebamme seine Hände ab. „Die lütte Dirn hat sie fast umgebracht.“ Sie tippte ihm wütend mit dem Zeigefinger gegen die Brust. „Konnten Se nicht die Finger von ihr lassen? In ihrem Alter! Mussten Se ihr das noch mal antun?“
In Thillmann Langes Augen schwammen Tränen. „Piepersche, sie wird doch wieder?“
„Das liegt allein in Gottes Hand.“ Die Hebamme zuckte mit den Schultern. Sie konnte hier nicht mehr tun.
Thillmann Lange wollte sich an ihr vorbeidrängen. Er musste zu Wilhelmine! Er musste seiner Frau doch beistehen. „Piepersche, lass mich durch. Ich muss zu ihr.“
Die Alte zögerte. Das Einzige, was seiner Frau jetzt helfen konnte, war Ruhe.
„Dann soll’s sein. Aber tun Se sie nich aufwecken. Sie muss schlafen, Ihre Frau“, stimmte sie letztendlich zu. Sie würde ihn sowieso nicht aufhalten können.
Da schoss ihr ein Gedanke durch den Kopf. Was wäre, wenn …, nachdenklich schielte sie zu Thillmann Lange hinüber, der neben ihr lief, gebeugt von der Last auf seiner Seele.
Sie versperrte ihm vor der Kammertür mit ihrem fülligen Körper den Weg.
„Hörn’s mir zu, Thillmann Lange“, sie kniff die Augen zu Schlitzen zusammen, „ich frag’s nur einmal und hab hinterher nie nich was gesagt.“ Argwöhnisch schaute sie sich um und warf einen Blick um die Ecke, um sicher zu gehen, dass niemand sie belauschte. „Sie hab’n wieder en Dirn und die Erna wieder en Jung’n.“ Verschlagen nickte sie mit dem Kopf.
Thillmann Lange schaute sie verständnislos an. Was redete die Alte so seltsam daher? Ja, er hatte wieder eine Tochter. Aber was ging ihn Ernas Balg an? Er wollte zu Wilhelmine. Und zwar schnell. Nichts sonst.
Die Hebamme blinzelte verschwörerisch. „Aber Sie woll’n doch ’n Jungen. Oder irre ich mich?“ Ihr Blick bohrte sich in seinen.
Er kapierte immer noch nicht. Hatte die Alte den Verstand verloren?
„Thillmann Lange“, sie stieß ihn grob vor die Brust, „es könnt Ihr Sohn sein. Überlegen S’ sich, bevor die Erna ihr Kind holt.“ Musste sie etwa noch deutlicher werden?
Erst jetzt erfasste Thillmann Lange den Sinn ihrer Worte. Er ballte die Hände zu Fäusten. „Bis du vollkommen von Sinnen, Weib?“, stieß er zornig aus. „Wie kannst du nur!“ Er packte sie bei den Schultern und schüttelte sie heftig. „Du alte Hexe, du!“
Doch plötzlich lockerte er seinen Griff, ließ sie los und schaute sie ungläubig an. „Du meinst, du würdest …?“
Erschrocken hielt er inne. Nein, er musste die Alte falsch verstanden haben. Aber was, wenn nicht? Was, wenn sie tatsächlich zu etwas so Ungeheuerlichem fähig wäre?
„Du denkst, dass …, aber weiß Erna denn nicht …“, mit offenem Mund starrte er sie an.
Die Alte lächelte verschlagen. Der Wurm war am Haken.
„Die Erna weiß noch von nichts nich. Der Baum hätt sie fast erschlagen und ich musst das Kind raus bringen bevor sie’s sehen konnt. Keiner nich weiß was.“
„Und das Mädchen?“
„Trulla?“ Die Piepersche winkte ab. „Ach die“, wiegelte sie abfällig ab, „die kann doch kaum ’nen Hund von ’ner Katze unterscheiden. Der werd’ ich schon das Maul stopfen.“
Thillmann Lange raufte sich die Haare. „Ernas Bastard soll mein Sohn werden?“
Er wusste nicht, ob er die Alte für diesen unheimlichen Vorschlag hassen oder bewundern sollte.
Aber der Keim war gelegt. In seinem Kopf tobte ein Wirbelsturm der Gefühle.
„Du willst die Kinder einfach austauschen?“ Richtig glauben konnte er das immer noch nicht.
„Einfach, einfach! Nichts is einfach nich!“, schnaubte die Hebamme. „Das kost Sie schon ’ne Stange Geld.“ Sie zuckte unschuldig mit den Schultern, was so gar nicht zu ihrem berechnenden Blick passte. „Schließlich muss ich den Rest meines Lebens schwer an dieser Last tragen“, flötete sie vornehm mit spitzen Lippen.
Thillmann Lange presste die Faust vor den Mund. Was für eine Versuchung! Ein Wort von ihm und er hätte einen Sohn. Endlich einen Sohn! Was machte es schon, dass er nicht sein Blut hätte. Niemand wüsste davon. Er würde ihn erziehen, prägen, einen echten Lange aus ihm machen.
Die Männer da draußen, die voll Hohn nur darauf warteten, dass er wieder mit einer Tochter herauskäme, er konnte ihren Lästergesang förmlich hören. „Na, wieder ’ne Büchse? Da musst du wohl noch mal ran. Haha, wenn du nicht den Mumm zum achten Weiberrock hast, wirst du nie ’nen Stammhalter kriegen.“
Hätte er nun den Sohn, würden sie für alle Zeit an ihrem Spott ersticken.
Und war es nicht auch Wilhelmines größter Wunsch, ihm endlich einen Sohn zu schenken?
Die Piepersche hüstelte ungeduldig.
„Aber die Frauen“, nach Luft ringend griff er sich an den Hals, „werden die das nicht merken?“ Seine Stimme klang heiser und zitterte. Hieß es nicht, dass Mütter da einen ganz besonderen Sinn hatten, ihre Kinder regelrecht riechen könnten?
Die Hebamme schüttelte den Kopf. „Nie nich, solang sie ihr eigenes Kind noch nich am Busen hatten.“
Sein Widerstand schmolz dahin. Er sah sich mit seinem kleinen Sohn am Strand laufen und die Möwen jagen, mit ihm zusammen den Seemännern hinterher winken und ihn eines Tages stolz an Deck seines eigenen Schiffes stehen.
In dem Moment kam Erna wankend um die Ecke. „Piepersche, ich will mein Kind!“
Die Hebamme warf Thillmann Lange einen letzten fragenden Blick zu.
KAPITEL 2
Nell blickte argwöhnisch auf den Brief in ihrer Hand. Ein offizielles Schreiben. Was wollten die denn schon wieder von ihr? Sie mochte solche Post nicht. Meist verbargen sich dahinter der Hinweis auf irgendein Vergehen, Versäumnis oder die Aufforderung, diese oder jene Angaben zu machen und Papiere, Genehmigungen oder sonst etwas nachzureichen. Möglichst vorgestern und gern gleich verbunden mit einem beiliegenden Zahlschein. Alle hielten ihre Hände auf. Und wie viele Hände die hatten!
Sie schaute genauer hin. Vom Amtsgericht? Das konnte nichts Gutes sein. Ärgerlich stopfte sie den Brief in ihre Tasche. Den Stapel Werbesendung, mit dem sie tagtäglich überschüttet wurde, entsorgte sie gleich im Papierkorb und stieg die Treppe zu ihrer kleinen Wohnung im dritten Stock hinauf.
In einem dieser anonymen Wohnblöcke zu wohnen, in denen kaum jemand seinen Nachbarn kannte, war weiß Gott nicht ihre erste Wahl gewesen. Aber sie lag günstig, war erschwinglich und vor allem sofort frei.
Nell erinnerte sich noch genau, als sie zum ersten Mal durch diesen Flur die Treppe hinauf ging. Es roch nach nacktem Beton, ein paar Schmierereien verunzierten die Wände und das knirschende Geräusch ihrer Schritte, das der Sand auf dem Boden hinterließ, hallte durch das Treppenhaus. Bis zum letzten Moment hatte sie sich der kindlichen Illusion hingegeben, hinter der eher dünnhäutigen Wohnungstür könnte sich das Paradies verbergen. Tat es nicht. Die Wohnung war noch winziger als beschrieben. Sie glich einem Karton. Einem Schuhkarton. Einem für Kinderschuhe. Mit Deckel.
Aber es war ein Neuanfang. Ihr Neuanfang!
Am liebsten wäre Nell gleich ganz aus Stralsund weggezogen. Einen völlig neuen Beginn wagen. Raus aus der Stadt. Raus aus ihrem alten Leben. Und vor allem weg von ihm! Weit weg! Es war Zeit, endlich ihren Träumen zu folgen. An einem anderen Ort. In Prerow.
Aber eine geeignete und vor allem bezahlbare Wohnung in Prerow zu finden war ein nahezu hoffnungsloses Unterfangen. Ferienwohnungen waren für die Vermieter einfach so viel lukrativer, als sich für deutlich weniger Geld mit Dauermietern herumzuschlagen.
Also hatte Nell sich ihre neue Wohnung in Stralsund schön geguckt, sie nach und nach zu einem gemütlichen Zuhause, zu ihrem Rückzugsort gemacht und sich eingeredet, dass es ja auch viel besser wäre, nicht so weit zur Arbeit fahren zu müssen. Prerow blieb ihr Zufluchtsort, wann immer es die Zeit erlaubte.
Nach zwei Jahren, die sie nun hier wohnte, nahm sie das Treppenhaus gar nicht mehr wahr, durchquerte es fast traumwandlerisch. Hinein in ihr Reich. In das sie niemanden hineinließ, den sie nicht ausdrücklich eingeladen hatte. Nie wieder wollte sie sich in eine Abhängigkeit begeben, über sich bestimmen oder sich einsperren lassen. Diese Wohnung, so klein sie war, gehörte nur ihr allein.
Sie gab die Suche nach einer Wohnung in Prerow aber nicht auf. Sie hielt den Draht zum Makler am Glühen und verbrachte manche weinselige Nacht in Prerow auf dem Sofa ihrer Freundin Sonja. Die Wohnungssituation in dem Ostseebad spitzte sich allerdings mehr und mehr zu, so dass ihre Zuversicht auf eine harte Probe gestellt wurde. Viele junge Leute kehrten Prerow notgedrungen längst den Rücken zu und zogen nach Barth oder Umgebung, wo Wohnraum noch vorhanden und erschwinglich war. Manche von ihnen kamen im Sommer zum Arbeiten auf den Darß. Doch wer wollte schon auf Dauer mit einem Saisonjob leben, von dem er gerade noch sich selbst, aber niemals eine Familie unterhalten konnte. So zog es immer mehr von ihnen in andere Regionen, die ihnen bessere Perspektiven zu bieten hatten. Zurück blieben die Alten. Der Bau von Ferienwohnungen und -häusern ging derweil unvermindert weiter und die Zahl der Urlauber nahm stetig zu. Leider wuchsen Fahrradwege und Gaststättenplätze nicht in selbem Maße mit und es wurde zeitweise eng in Prerow.
Die meiste Zeit verbrachte Nell in Stralsund bei ihren Patienten und bekam von dem, was sich in Prerow abspielte, nur wenig mit. Die Urlauberströme, die Stralsund besuchten, kamen, um das Meeresmuseum, das großartige Ozeaneum und den Hafen zu sehen und verirrten sich nicht in die Neubaugebiete.
Kurz nach der Wende, hatte Sonja ihr einmal erzählt, als es erst wenige Gaststätten im Ort gab, waren Bestechungsgelder, um so an die begehrten Plätze im Restaurant ihres Vertrauens heranzukommen, gang und gäbe. Diese Verhältnisse könnten sie bald wieder einholen. Zurück zu den Wurzeln, leider eher zu den hinterwäldlerischen. Und man stelle sich vor, hatte Sonja mit gespielter Entrüstung berichtet, es gab in Prerow sogar eine Gaststätte, die in der Anfangszeit zwei verschiedene Speisekarten hatte. Eine für die Gäste aus dem Osten, eine für die aus dem Westen. Mit unterschiedlichen Preisen natürlich. Damals war es nicht schwer zu erkennen, woher die Gäste kamen. Wehe dem Ossi, der da schon wie ein Wessi aussah. Aber lange hatte das ja sowieso nicht funktioniert.
Nell war oben angekommen, vorbei an dem Gulaschgeruch aus Müllers Wohnung in der ersten und dem Zigarrenqualm vom alten Meier in der zweiten Etage.
Genug gemeckert. Jetzt war Feierabend. Erst mal Kaffee!
Sie öffnete ihre Wohnungstür und ließ sie geräuschvoll hinter sich ins Schloss fallen, wie es im Haus Sitte war. Anscheinend glaubte jeder, dass es für alle anderen wichtig war zu wissen, dass man zu Hause war. Wie oft hatte sie in der ersten Zeit ihre Mitbewohner dafür verflucht und wie schnell hatte sie sich angepasst. Sie streifte die Schuhe von ihren Füßen und schlüpfte in warme Socken.
Auf dem Weg in die Küche warf sie einen kurzen Blick in den Spiegel an der Wand und fuhr sich durch die wilden, roten Locken. Im schummerigen Licht des Flures schien ihr das junge Mädchen von früher entgegenzublicken. Es war doch eine Gnade, dass die Augen mit dem Alter schwächer wurden. Sie ermöglichten es sich so zu sehen, wie man einmal war. Nicht zuletzt deswegen liebte Nell auch das gnädige Licht ihrer IKEA-Lampe. Sofort stieg ihre Laune.
Aber die Zeit konnte man nicht betrügen, sie hinterließ ihre Spuren, ob man sie nun wahrhaben wollte oder nicht. Spätestens das Tageslicht offenbarte die tatsächlich gelebten Jahre. Nur an ihrem Haar schienen sie spurlos vorbeizugehen. Immer noch leuchtend rot. Eine einzige weiße Haarsträhne, die einfach nicht zu bändigen war, sprang ihr immer wieder vor die Augen, als wollte sie sie so an ihr tatsächliches Alter erinnern. Doch im Grunde fühlte sie sich immer noch wie damals, nur eben 35 Jahre älter.
Nell pustete die widerspenstige Strähne aus dem Gesicht und ging in ihre Küche. Drei Schritte vorwärts, einen zur Seite, das war ihre Küche. Sie schaltete den Kaffeeautomaten an. Eigentlich war das Ding viel zu klotzig für den winzigen Raum, aber nichts ging über einen guten Kaffee. Das glucksende Geräusch der Maschine löste jedes Mal Glücksgefühle bei ihr aus. Entspannt lehnte sie sich an den Küchenschrank und schaute versonnen zu, wie sich ihre Lieblingstasse füllte.
Der Brief fiel ihr wieder ein. Schlagartig verschlechterte sich ihre Stimmung erneut. Türmten sich mit diesem Schreiben weitere bürokratische Anforderungen vor ihr auf? Ein Antrag auf den Antrag eines Antragsformulars? Aber nein, doch nicht vom Amtsgericht. Sie kramte den Brief aus den Tiefen ihrer Tasche. Zerknittert und von einem angefangenen Schokoriegel gezeichnet, legte sie ihn vor sich auf den Tisch. Kritisch beäugte sie ihn, als könnte sie durch den beschmutzten Umschlag hindurchsehen, versuchte ihn etwas glatt zu streichen und schob ihn dann von sich. Sie würde ihn später öffnen. Nicht jetzt. Das Amtsgericht musste warten. Wenigstens eine Tasse Kaffee lang.
Sie streckte den Rücken. Nach über zwanzig Jahren, die sie im Krankenhaus mit psychisch kranken Menschen arbeitete, spürte sie ihre Kräfte schwinden. Sie brauchte eine Veränderung. Sie musste da raus! Sie fühlte sich körperlich und nervlich ausgelaugt, konnte den Patienten nicht mehr das geben, was sie brauchten, weil sie es einfach nicht mehr schaffte. Sie war auf dem besten Weg, selbst zur Patientin zu werden. Die Balance zwischen Mitgefühl mit ihren Patienten einerseits und dem so nötigen emotionalen Abstand andererseits, eben um wirklich helfen zu können, gelang ihr immer weniger. Sie ertappt sich dabei, manch vorgebrachtes Problem eines Patienten gedanklich zu bagatellisieren, um beim nächsten vor Betroffenheit in Tränen auszubrechen. Sie kam aus dem ständigen Erschöpfungszustand nicht mehr heraus. Sie schlief schlecht. Jede Nacht galoppierten die Probleme ihrer Patienten durch ihre Träume, so dass sie, durchgeschwitzt und vollkommen kaputt, in jeden neuen Tag startete. Anfangs dachte sie, es läge am Montag. Da war es immer besonders schlimm. Aber es lag nicht am Montag, es lag am Job. Sie brauchte unbedingt eine Auszeit.
Sie liebte ihren Beruf. Für seelisch angeknackste Menschen da zu sein, ihnen zurück ins Leben zu helfen, war ihre Erfüllung. Das würde sie auch gern weiterhin tun, aber ohne den Krankenhausstress, der geprägt war von ständiger Personalnot und Zeitdruck, der kaum Platz für die Sorgen der Patienten ließ. Gerade jetzt sollten noch mehr Stellen abgebaut werden. Zu verstehen war das alles nicht.
Die Anzahl der Patienten in den therapeutischen Gesprächsrunden wurde immer größer. In den kurzen Zwiegesprächen, die diese Zusammenkünfte hergaben, konnte sie manchmal Schwingungen spüren, die sie berührten und die ihr oft weit mehr sagten, als tatsächlich ausgesprochen wurde. Doch diese Impulse lösten sich im Beisein der anderen Patienten jedes Mal zu schnell auf, als dass sie sie wirklich zu greifen bekam.
Künftig wollte sie den Menschen helfen, bevor sie abstürzten, bevor sie in dieses tiefe Loch fielen, aus dem ihnen dann nur noch starke Medikamente oder ein stationärer Aufenthalt heraushelfen konnten.
Eine alte Ärztin, die im Laufe der Jahre zu einer mütterlichen Freundin für Nell geworden war und die allein eine Stadtvilla bewohnte und dort praktizierte, hatte ihr angeboten, bei ihr mitzuarbeiten, wann immer sie so weit wäre. Nell hätte eine Gabe, den Menschen auf eine ganz besondere Art zu helfen, hatte sie gesagt. Sie hätte heilende Hände.
Nell hatte die Frau insgeheim belächelt. Hände! Handauflegen! Wer glaubte schon an solchen Hokuspokus. Man half niemandem mit irgendwelchem Zauber, sondern mit Wissen und Einfühlungsvermögen.
Sie brauchte jetzt erst einmal etwas Abstand, um in Ruhe ihre Möglichkeiten zu sondieren. Bis dahin sollte sie vielleicht mal etwas ganz anders machen? Sie könnte als Verkäuferin arbeiten oder kellnern? Vielleicht brauchte Sonja noch Unterstützung in ihrem Café? Sie musste nichts überstürzen, sie hatte genug gespart, um eine Weile zu überbrücken.
Sie nahm den Kaffeebecher zwischen ihre Hände und setzte sich im Wohnzimmer, das kaum größer war als die Küche, in ihren Lieblingssessel am Fenster. Der war, genau wie die Kaffeemaschine, eigentlich viel zu groß, aber er war ihr Zuhause. Zärtlich strich sie über die abgewetzte Armlehne. Er war ein Erbstück ihrer Großmutter. Sie hätte ihn ja längst neu beziehen lassen können, aber dann wäre er nicht mehr derselbe. Genau auf diesem Stoff hatten auch die Hände ihrer Oma gelegen und es fühlte sich für Nell an, als könnte sie so die Hände ihrer Großmutter spüren.
Nell hatte ihre Großmutter nicht mehr kennengelernt. Sie war viel zu früh gestorben. Lediglich aus den spärlichen Andeutungen ihrer Mutter hatte sie immer versucht sie sich vorzustellen. Das einzige Foto, eine vergilbte Schwarzweißaufnahme, das sie irgendwann in einer alten Kiste entdeckt hatte, zeigte zwei lachende Frauen, von denen die eine langes lockiges Haar hatte. Nell hätte wetten mögen, dass es rot war. Die Ähnlichkeit zwischen ihr und dieser Frau war unverkennbar. Das konnte kein Zufall sein. Sie hatten etwas gemeinsam!
Das Foto verschwand, aber das Bild blieb in ihrem Kopf.
Nell musste ihre Großmutter nicht kennen, um zu wissen, dass es da etwas gab zwischen ihnen, etwas Unsichtbares, etwas, das über Generationen reichte. Ihr Herz sagte es ihr. Umso sicherer war sie, dass auch sie eines Tages in Prerow leben würde. Genau wie ihre Oma.
Ihre Mutter war schon als ganz junge Frau aus Prerow weggegangen. Geflüchtet. Aber warum? Wovor? Was war so Schlimmes passiert, dass sich die beiden nicht wieder vertragen konnten? Nell hatte es nie erfahren. Nur so viel, dass ihre Mutter Prerow hasste und erst nach Omas Tod noch einmal zurückgekommen war, um deren wenige Habseligkeiten zu verhökern. Einzig den Sessel hatte sie behalten. Warum gerade den, hatte sich Nell nie erschlossen. Es hatte sie auch nicht viel Mühe gekostet, ihn der Mutter abzuschwatzen. Sie hatte ihre Mutter immer und immer wieder gelöchert, gebeten, gebettelt, ihr doch von früher zu erzählen, aber außer gelegentlicher Vorwürfe, sie sei genau wie ihre Oma, war kaum etwas aus ihr herauszubekommen.
Dementsprechend verstört hatte ihre Mutter dann auch reagiert, als Nell ihr irgendwann verkündete, sie würde ganz sicher irgendwann nach Prerow ziehen.
Vielleicht war es gerade dieses geheimnisvolle Getue ihrer Mutter und die Tatsache, dass sie, Nell, angeblich wie ihre Oma war, die ihre Neugier umso mehr weckte und mit ihrer Großmutter noch enger verband, sie zum Idol ihres Lebens erhob. Sie war wie ihre Oma! Was als kindlicher Starrsinn und Opposition begann, entwickelte sich zu einem tiefen Gefühl und der Gewissheit, dass es etwas ganz Besonderes mit ihrer Großmutter auf sich gehabt haben musste.
Das Telefon riss sie aus ihren Gedanken.
„Hallo, Mama!“
„He, Kleines. Ich wollte nur mal hören, wie es dir geht.“
Nell schüttelte verwundert den Kopf. Hatte ihre Mutter gemerkt, dass sie gerade an sie dachte? Es war nicht das erste Mal, dass derjenige, der Nell gerade beschäftigte, sich genau in dem Augenblick bei ihr meldete. Gedankenübertragung? Bioströme? Passierte so etwas anderen auch? Sie würde Sonja fragen, ob sie so etwas auch schon erlebt hatte. Aber die würde sie wahrscheinlich wieder auslachen und ihr sagen, dass es so etwas nur bei rothaarigen Frauen gäbe. Aber nur bei denen mit einer weißen Haarsträhne.
„Ich habe im Krankenhaus angerufen, aber da sagte man mir, dass du schon weg wärst.“
„Ich hatte Frühschicht.“
Nell war eigentlich gerade nicht zum Reden aufgelegt. Nach einem anstrengenden Tag wollte sie ihre Ruhe haben. Sie mochte es schon gar nicht, wenn ihre Mutter sie im Krankenhaus anrief. Nichts Privates auf Arbeit. Aber ihre Mutter lebte schon immer auf der Sonnenseite des Lebens. Schatten wollte sie nicht sehen. Dass ihre Tochter Medizin studieren wollte, hatte sie schon vehement abgelehnt, als es dann die Psychologie wurde, verfiel sie förmlich in Panik. Sie war regelrecht hysterisch geworden, verbot es ihr, drohte mit Enterbung und versuchte mit aller Macht es ihr auszureden. Aber Nell wusste, dass sie genau das und nichts anderes machen wollte.
Sie liebte ihre Mutter. Aber sie hatten beide vollkommen andere Vorstellungen davon, wie ihr Leben ablaufen sollte. Da waren Reibereien vorprogrammiert. Nell konnte sich an kein Treffen, kein Gespräch mit ihrer Mutter erinnern, dass nicht im Streit geendet hätte.
„Was ist los, Kleines, du klingst erschöpft.“
Kleines. Jetzt musste Nell doch lächeln. Einen winzigen Moment fühlte sie sich in ihre Kindheit zurückversetzt, als ihre Mutter sie in den Arm genommen und vor der ganzen Welt beschützt hatte. Probleme zwischen ihnen kamen erst, als Nell begann ihren eigenen Weg zu gehen. Einen Weg, der eben nicht der war, den ihre Mutter für sie gedacht hatte.
Wer war sie heute für ihre Mutter? Immer noch das Kind, das ihren Schutz brauchte? Oder doch eher die Tochter, die nicht nach ihrer Pfeife tanzen wollte und nach wie vor gelenkt werden sollte.
Nell war plötzlich todmüde und sehnte sich nach einer Schulter, an die sie anlehnen konnte. Jemand, der sie tröstete, ihr beistand und endlich mal wieder streichelte, ohne Vorhaltungen und ohne die ewige Diskussion, dieses und jenes anders machen zu sollen. Sie war es so leid, mit allem allein klarkommen, immer stark sein zu müssen. Sie wollte schwach sein dürfen und sich fallen lassen. Aber die meiste Zeit war niemand da.
„Ich bin einfach nur müde“, sagte sie leise. „Ich kann nicht mehr richtig schlafen, ich kann meinen Patienten nicht mehr zuhören und der Rücken tut mir weh“, fügte sie kläglich hinzu.
„Brauchst du Hilfe, Kleines? Soll ich kommen?“
Das war es. Genau dafür liebte Nell ihre Mutter. Was auch immer zwischen ihnen stand, wenn sie sich brauchten, zählte nichts anderes. Dann waren sie füreinander da.
Ihre Mutter hatte Deutschland, in dem sechs Monate Winter und sechs Monate kein Sommer herrschten, wie sie zu gern immer wieder betonte, seit langem den Rücken gekehrt.
Nell wusste, ein Wort und ihre Mutter würde sich sofort auf den Weg machen. Sie würde in Lissabon in den nächsten Flieger steigen und ihr zur Hilfe eilen. Dass ihre Anwesenheit hier für Nell mehr Stress als Hilfe bedeutete, war eine andere Sache.
Schon schlich sich wieder dieser Gedanke in Nells Kopf. Was hat die Liebe zwischen ihrer Mutter und Oma zerstören können? Konnte ihnen beiden das eines Tages auch passieren?
Nell schnaubte laut in ihr Taschentuch. „Das ist ganz lieb von dir. Aber nein, lass mal gut sein. Ist schon okay. Ist ja nicht mehr für lange.“
„Was soll das heißen?“
Schwang da Hoffnung in der Stimme ihrer Mutter mit? Dass sich die Tochter vielleicht doch noch besann und sich beruflich umorientierte? Oder endlich zu ihr nach Portugal zog? Oder gar einen gutsituierten Mann gefunden hatte? Themen, mit denen ihre Mutter sie nur zu gern in nahezu jedem Telefonat aufs Neue überhäufte. Nell konnte die Fragezeichen förmlich spüren.
„Ich werde kündigen. Das heißt, nein, das ist so nicht richtig“, begann sie, ehe sie einen Schluck aus ihrer Kaffeetasse nahm. „Im Zuge einer neuen Personalabbauwelle werde ich das Angebot annehmen, gegen eine recht großzügige Abfindung freiwillig zu gehen.“
„Was für eine Welle?“
„Das jetzt schon unterbesetzte Personal ist dem Krankenhausbetreiber noch zu viel. Also wird weiter abgebaut.“ Nells sarkastischer Ton triefte förmlich durch die Leitung. „Und das alles auf dem Rücken derer, die bleiben und nun noch mehr arbeiten müssen. Und der Patienten natürlich“, redete sie sich in Rage.
Einen Augenblick war Ruhe am anderen Ende der Leitung. Das war ein Thema, das bei ihrer Mutter so gar nicht auf fruchtbaren Boden fiel.
„Wie hoch ist die Abfindung? Reicht sie zum Leben? So alt bist du ja noch nicht? Und du hast ja auch niemanden …“
„Der für mich sorgt, ich weiß“, unterbrach Nell sie. „Mach dir keine Sorgen, ich komme klar. Außerdem habe ich schon neue Pläne.“ Letzteres entsprach leider nur halb der Wahrheit.
„Du hättest mit Doktor Hofer zusammenbleiben sollen“, warf ihre Mutter zerstreut ein.
„Mama, der war verheiratet. Außerdem ist das inzwischen zwei Jahre her.“
„Na und, du hast es gut bei ihm gehabt. Eine traumhafte Wohnung, eine Menge Geld und du brauchtest dich um nichts kümmern.“
„Bitte hör auf damit.“
„Du klingst wie jemand, der gekriegt hat, was er wollte und nun nicht mehr will, was er gekriegt hat“, fuhr ihre Mutter in beleidigtem Ton fort.
„Du weißt, dass es die Hölle war.“
„Aber eine gut bezahlte.“
„Lebst du in der Hölle?“, fuhr Nell ihre Mutter genervt an.
Sie dachte an ihren Stiefvater. Er hatte nach dem Tod ihres Vaters sehr schnell dessen Platz eingenommen. Schließlich müsse das Leben doch weitergehen, hatte ihre Mutter gesagt und sich im Wohlstand des neuen Mannes eingerichtet. Er war ein guter Mann. Für Nells Geschmack ein wenig zu gut. Ihre Mutter lebte seither in einem goldenen Käfig. Ein Käfig, in den Nell sich bei Doktor Hofer ebenso begeben hatte. Nur dass es zu ihrem goldenen Käfig keinen Schlüssel gab.
Nell war ihr Leben lang mit zielsicherer Trefferquote an die falschen Männer geraten. Aber was hieß schon falsch? Eben nicht die richtigen für sie. Sie hatte eine ausgeprägte Schwäche für unerreichbare Kandidaten. Je mehr ein Mann sie auf Abstand hielt, umso reizvoller war er für sie. Das konnte auf Dauer nicht gut gehen. Später wurde ihr klar, dass sie wohl weniger nach Liebe als nach dem Kampf gesucht hatte. Den um Anerkennung, dass gerade der Mann sie toll finden sollte und anhimmelte, der am wenigsten zu haben war. Ein Kampf, den sie nicht gewinnen konnte. Am Ende blieben nur Enttäuschung, verletzter Stolz und Traurigkeit. Aber das Schmerzlichste war das Gefühl, wieder einmal versagt zu haben.
Ihre Freundin Sonja rückte ihr letztendlich den Kopf zurecht. Wenn ein Mann dich behandelt, als habe er kein Interesse an dir, sagte sie, dann hat er keins. Basta!
Dann kam Harald Hofer. Zum ersten Mal bemühte sich ein Mann um sie, ließ sich nicht abweisen und umwarb sie hartnäckig und ausdauernd. Eine ganz neue Erfahrung für sie, nicht mehr kämpfen zu müssen. Und es auch nicht länger zu wollen.
Sie ließ ihn zappeln. Zu lange waren echte Nähe und eine funktionierende Partnerschaft nur eine Illusion geblieben. Doch er weckte in ihr die Hoffnung, der Himmel könnte sich über ihr öffnen und erstrahlen.
Er sah umwerfend gut aus und die jungen Schwestern im Krankenhaus waren verrückt nach ihm. Er schien der Inbegriff von Vollkommenheit.
Aus einer schönen Schale allein kann man nicht essen, hatte eine alte Patientin ihre Lebenserfahrung einmal während einer Therapiesitzung zusammengefasst. Nell hatte daraufhin nach den Rissen in seiner Schale gesucht, aber keine gefunden. Doch sie brauchte Zeit. Zu viele Zweifel und Enttäuschungen mussten erst aus dem Weg geräumt werden.
Er gab ihr diese Zeit, blieb aber immer in ihrer Nähe. Er wollte sie. Er wollte keine von diesen jungen, hübschen Dingern, die ihn pausenlos anhimmelten, sondern sie. Er eroberte sie schließlich mit Intelligenz, Charme und sehr viel Einfühlungsvermögen.
Eine wunderbare Zeit begann, ihr Leben begann zu leuchten und alles, was vorher war, wurde bedeutungslos. Sie lebte seine Träume und glaubte, dass es auch ihre waren.