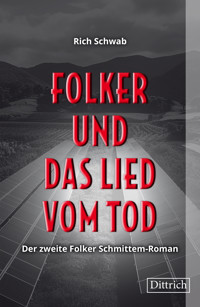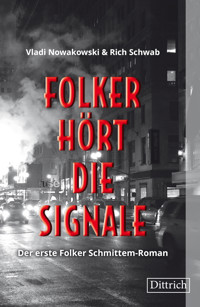
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Dittrich Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Köln: Irgendwas ist ja immer. Im ungewöhnlich warmen Frühjahr 2019 sorgt Schuggermän für den Schnee, das türkische Schutzgeld-Business hat ein deutsches Problem, ein Trupp Nazis will das Trinkwasser vergiften, und den zuständigen Mann beim Verfassungsschutz plagt ausgerechnet jetzt eine tiefe Sinnkrise. Der Musiker Folker wird mitten in eine Geschichte um Gift, Koks, Erpressung und verdeckte Ermittler hineingezogen. Das Dumme ist: Folker hat nur einen Schlag. Und zwar bei Frauen. Ohne Taifun, Jupp, Sansibar und die anderen kommt er da nie wieder heil raus. Ihm selbst bleibt am Ende nur eine Waffe …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 466
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vladi Nowakowski & Rich Schwab
Folker hörtdie Signale
Der erste Folker Schmittem-Roman
© Dittrich Verlag ist ein Imprint
der Velbrück GmbH, Weilerswist-Metternich 2023
Printed in Germany
ISBN 978-3-910732-01-8
Satz: Gaja Busch, Berlin
Coverdesign: Helmi Schwarz-Seibt, Leverkusen
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Inhalt
1 Mittwoch, 13. März 2019
2 Montag, 18. März
3 Dienstag, 19. März
4 Mittwoch, 20. März
5 Donnerstag, 21. März
6 Freitag, 22. März
7 Samstag, 23. März
8 Sonntag, 24. März
9 Montag, 25. März
10 Dienstag, 26. März
11 Mittwoch, 27. März
12 Donnerstag, 28. März
13 Montag, 01. April
14 Dienstag, 02. April
15 Donnerstag, 04. April
16 Freitag, 05. April
17 Samstag, 06. April
18 Dienstag, 09. April
19 Mittwoch, 10. April
20 Donnerstag, 11. April
21 Freitag, 12. April
22 Samstag, 13. April
23 Montag, 15. April
24 Dienstag, 16. April
25 Mittwoch, 17. April
26 Donnerstag, 18. April
27 Freitag, 19. April
28 Samstag, 20. April
29 Mittwoch, 24. April
EPILOG
Dank
GLOSSAR
Die Autoren
LINKS
Schreiben ist einfach.Man muss nur die falschen Wörter weglassen.
Mark Twain
Wir sind die Brüderder romantischen Verlierer.
Uli Hundt
Dat Wasser vun Kölle es joot.
Bläck Fööss
1
Mittwoch, 13. März 2019
DIE KRAADEBERJER
»Wenn ich Beweis mit Eszett tippe, ist das hier aber rot unterstrichen!«
Von Jaworskis Stirn fiel ein Schweißtropfen auf die Tastatur des Laptops. »Ist dann wohl falsch.« Für Jürgen Jaworski war der Spruch ›die Gedanken sind frei‹ negativ behaftet: Seine Gedanken waren so dermaßen frei, dass es sich meist nicht lohnte, sie zu verfolgen.
»Dann ist in deinem Gerät wohl die neue rotgrünversiffte Rechtschreibung installiert«, dröhnte Heiner Hoffmann und schlug mit der flachen Hand auf den hellbraun gekachelten Wohnzimmertisch. Jaworskis wochenlang mühsam gebasteltes Modell einer Ju 52 hob kurz ab und verlor bei der Landung ein winziges graues Plastikrad. Er reagierte mit einem ergebenen Lächeln, sagte aber kein Wort. »›Ich weiß‹ wird mit Eszett geschrieben, weiß ich genau. ›Beweiß‹ dann ja wohl auch, du Arsch!«. Hoffmann kratzte sich unter seinem olivgrünen T-Shirt den Bauch, lehnte sich auf dem Sofa zurück und nahm einen Schluck aus seiner Bierpulle.
»Wir nehmen auf jeden Fall die jute alte Reschtschreibung«, pflichtete Willi Kopp, genannt ›Koppnuss‹, ihm eilig bei. »Die ordentlische. Denn dafür stehn wir ja ein. Für Rescht un’ Ordnung.« Er hämmerte sich mit der rechten Faust auf die linke Brust und stieß einen mächtigen Rülpser aus.
Karl-Heinz Küppers kämpfte sich aus seinem Sessel hoch und nahm Haltung an. »Kameraden! Wir sind im Widerstand! Was soll dieser faule Zauber um falsche oder richtige Buchstaben?«
»Genau«, schrie Hoffmann.
»Rischtisch so, mit uns nisch!«, brüllte Kopp und ließ den nächsten Kronkorken ploppen.
»Siiieg …«, röhrte Küppers. Weiter kam er nicht, denn in diesem Augenblick hörten sie ein zaghaftes Klopfen an der Wohnungstür.
»Herr Jaworski«, quengelte die Stimme einer alten Frau hinter der Tür. »Es ist schon nach elf. Können Sie und ihre Freunde nicht endlich mal Ruhe geben?« Kurze Pause. »Sonst muss ich wirklich die Polizei rufen.«
Die Widerstandskämpfer erstarrten mitten in der Bewegung: Küppers mit seinem hochgestreckten rechten Arm, Kopp mit der Bierflasche an den Lippen, Hoffmann, der von der Couch hochgesprungen war, in seltsam gebückter Haltung mit offenem Mund, als zwinge ihn ein Anfall von Diarrhöe auf eine imaginäre Kloschüssel. Eine im Improvisationstheater als »Freeze« bekannte Technik. Obwohl die vier Nazis in Jaworskis Wohnzimmer soeben eine perfekte Performance dieser Kunst darboten, ging ihnen das völlig am Arsch vorbei. Der ging nämlich gerade auf Grundeis.
»Scheiße!«, flüsterte Jaworski und wischte sich Schweiß von der Stirn. »Meine Vermieterin. Ich hab doch gesagt, wir sollen uns nicht bei mir treffen.«
»Aber du hast doch den Computer«, zischte Küppers, fuhr in Zeitlupe den rechten Arm wieder ein und ließ seinen massigen Körper vorsichtig in den Sessel zurücksinken. Seine Lippen formten ein lautloses »Wichser« in Jaworskis Richtung.
»Das ist ein Laptop, das Ding kann man überallhin mit…«, versuchte Jaworski weinerlich einzuwenden, wurde aber von heißem Atem an seinem Ohr gestoppt.
»Jetzhömazu, du Lappen.« Hoffmann hatte die seltene Gabe, selbst sein Flüstern wie Kasernenhofgebrüll klingen zu lassen. »Wir schreiben gerade einen beschissenen Drohbrief an die Stadt. Und da geht’s um ziemlich viel Schotter, erinnerst du dich? Und wir sind noch nicht fertig. Das Ding ziehen wir jetzt durch. Und wenn deine verfickte Vermieterin nochmal aufkreuzt, mach ich die alte Fotze kalt!«
Jaworski schluckte trocken. Er kannte Hoffmann seit der Grundschulzeit. Der war unberechenbar. Schon damals hatten alle Angst vor ihm, selbst die Lehrer gingen ihm möglichst aus dem Weg. Noch bevor dem kleinen Heiner das erste Schamhaar spross, hatte er ein Terror-Regime wie aus dem Lehrbuch erschaffen: Dieter, einer der Klassenbesten, schrieb für ihn die Hausaufgaben, Jaworski hatte seinen Schulranzen zu tragen und jederzeit kleine Gefälligkeiten zu erledigen, zwei oder drei Jungs aus ihrer Klasse mussten in den umliegenden Läden seinen Bedarf an Zigaretten, Kaugummis, Alkohol und den St. Pauli-Nachrichten stehlen. Wenn nicht, gab es Senge. Und anschließend zuhause für blaue Flecken, blutig geschlagene Lippen, zerrissene Kleidung und kaputte und bepinkelte Schulbücher oft noch einen Nachschlag. Niemand beschwerte sich, niemand hielt ihn auf. Es schien damals so, als warteten alle Erwachsenen darauf, dass sich das Problem Heiner Hoffmann von selbst erledigte.
Auf gewisse Art sorgte er in den folgenden Jahren immer wieder mal für ein kurzzeitiges Aufatmen im Viertel. Mit zwölf steckte ihn das Jugendamt in ein Erziehungsheim, weil er in einen Kiosk eingebrochen war. Kaum zurück in freier Wildbahn, verschwand er mit fünfzehn für zwei Jahre hinter den Mauern einer Einrichtung für schwer erziehbare Jugendliche. Damals war er auf den Trichter gekommen, so lange an Geldautomaten herumzulungern, bis jemand etwas abhob – und es ihm dann einfach abzunehmen. Leicht verdientes Geld: Meistens reichte es, wenn er nur fest genug zuschlug. Eines Abends musste er mehrmals zuschlagen, weil die Oma ihre Scheine partout nicht loslassen wollte. Als sie nach einer Woche Koma wieder zu sich kam, nannte sie der Kripo seinen Namen – sie wohnte nur ein paar Häuser weiter und kannte den jungen Mann. Es kam, wie es kommen musste. Hoffmann fuhr mal für zwei Jahre ein, dann mal für vier, verfolgte seine Karriere als Kleinkrimineller aber weiter, als gäbe es für ihn schlicht keine Alternative.
Und jedes Mal, wenn er wieder herauskam, kehrte er wie ein treuer Hund an den Ort seiner verpfuschten Jugend zurück. Jedes Mal kam er brutaler, verrückter, muskelbepackter und bösartiger heim ins Viertel. Und sein erster Weg führte ihn über all die Jahre immer zu Jaworski.
»Das nennt man wahre Freundschaft!«, grölte er, wenn Jaworski dann wie ein begossener Pudel in der offenen Tür seiner Wohnung stand. »Uns zwei können so ein paar Jahre im Drecks-Knast doch nix anhaben, wat, Jürjen? Komm, wir müssen sprechen!«
Und so bezog Jaworski seine Couch mit einem Bettlaken, räumte im Badezimmer eine Ecke für den neuerdings glatzköpfigen Hoffmann frei, kaufte Bier und Lebensmittel für sie beide und ergab sich demütig der Situation. Zumeist dauerte es ja nur zwei, drei Wochen, bis das Sozialamt Hoffmann eine eigene Wohnung stellte. Nach all den Jahren hatte sich da eine gewisse Routine eingespielt.
»Hallooooo! Jemand zu Hause?«, schrie Hoffmann jetzt mit seiner Flüsterstimme und zog Jaworski ein zusammengerolltes Fernsehmagazin über den Schädel. »Wo sind wir stehen geblieben?«
Jaworski schreckte aus seinen Gedanken auf, hielt den Zeigefinger an die Lippen und drehte den Laptop in Hoffmanns Richtung – und kassierte einen weiteren Schlag mit der harten Rolle mitten ins Gesicht. »Willste mich verarschen? Du weißt doch, dass ich nich … Lies vor!« Der kahlrasierte Schädel wechselte seine Farbe von tiefrot zu dunkelviolett. Jaworskis Beine begannen unkontrollierbar zu zittern. Der muss runterkommen, sonst knallt er wieder durch!
»Sonst könnt ihr selber nachgucken, wo dat Wasser von Kölle nich mehr so joot ist und viel Spass dabei«, las Jaworski leise vor. »Das war der letzte Satz.«
»Schreib dazu, dass der beschissene Klüngelkoppverein uns nisch erzählen soll, die hätten kein Jeld«, zischte Koppnuss. Hoffmann nickte, und Jaworski tippte den Satz ein.
»Letzter Satz und Finito«, Hoffmann räusperte sich. »Um unserer Forderung etwas Nachdruck zu … eh …«
»Verleihen?«, schlug Jaworski vor.
»Ja, verleihen is’ gut. Eh …, zu verleihen, legen wir ein verschweißtes Plastiktütchen bei. Wir würden das nicht öffnen.« Diesmal nickte Jaworski, und seine Finger klackerten über die Tastatur.
Im Wohnzimmer herrschte einen Augenblick lang völlige Stille. Dann fragte Küppers: »Wat is denn in dem Tütschen?«
»Gift. Rizin. Habe ich besorgt.« Hoffmann blickte einen nach dem anderen an. »Muss sein.«
»Du willst die Leute vergiften? Hier in der Stadt? Ich dachte, wir tun nur so …?« Küppers starrte ihn ungläubig an.
»Quatsch: Verjiften …! Von Rizinus krischt man doch bloß Durschfall«, lallte Koppnuss und griff nach der Flasche Jägermeister auf dem Tisch. »Aber wat sein muss, muss sein. Dat is ja schließlisch kein Spielschen hier.«
»Egal«, sagte Hoffmann. »Wenn die Idioten die elf Millionen zahlen, passiert ja niemandem was. Wenn nicht, vergiften wir das Wasser in den Stadtteilen, wo die meisten Kanacken wohnen. Ich hab genug von dem Zeugs.«
Jaworski speicherte die Datei ab und wollte gerade den Laptop zuklappen, als Hoffmann ihm schon wieder die Fernsehzeitung auf den Kopf schlug.
»Wat is’ mit ausdrucken, du Dödel?«
Jaworski duckte sich. »Ich dachte …«
»Wat?«
»Als E-Mail …?« Und noch ein klatschender Schlag auf den Hinterkopf.
»Das nächste Mal nehm ich ein Stuhlbein, du hirnverbrannter Idiot! Als E-Mail! Du bist ja noch dämlicher als Koppnuss!«
»He …!«, protestierte Kopp.
»Schnauze! ’Ne E-Mail, vielleicht noch mit deinem eigenen Absender, du Vollhorst? Warum geht ihr nicht gleich hin und übergebt das persönlich, mit einem schon für den Knast gepackten Köfferchen unterm Arm?« Hoffmann ließ sich wieder auf die Couch fallen und griff nach seinem Bier. »Mann, Mann, Mann …!«
»Worski hat doch gar keine Mailadresse«, meldete Koppnuss sich zu Wort. »Der Computer gehört doch seiner Schwester.«
Hoffmann starrte ihn bloß an, an seiner violetten Schläfe pochte sichtbar eine dicke blaue Ader.
»Ich mein ja nur«, brummte Kopp und fing an, das Etikett von seiner Bierflasche zu knibbeln.
»Ja, ja«, stöhnte Hoffmann und sah Jaworski an. »Ausdrucken, du Idiot!«
»Aber …« Der schaute im Zimmer umher, als sei ihm das gerade erst aufgefallen. »Wir haben gar keinen Drucker. Wenn Rosi was ausdrucken muss, geht sie immer runter zu Meike im Erdgeschoss. Oder in’n Copyshop …«
In diesem Moment schoss der bierbäuchige Küppers mit einer Geschwindigkeit, die ihm niemand zugetraut hatte, aus seinem Sessel und riss den Rechner an sich. Die Steckdose neben der Couch gab mit einem Plopp! das Kabel des Netzteils frei, das sich graziös um den Ständer der Stehlampe wickelte. Küppers stürmte, den Laptop unterm Arm wie ein Football-Halfback, in Richtung Wohnungstür. Die mit dem Kabel verhedderte massive Lampe, ein Erbstück von Jaworskis Onkel Willi, vollführte drei perfekte Pirouetten, der mit Glasperlenschnüren gesäumte Schirm kam in Schwung wie der Rock einer Eiskunstläuferin, die Lampe hüpfte kurz hoch, verneigte sich zum Abschluss der Kür und krachte auf die Tischkacheln. Die Glühbirnen klirrten, flackerten zum Abschied noch einmal auf, und plötzlich war es finster.
Die Sicherung!, dachte Jaworski.
»Das ist doch Mord«, schrie Küppers aus dem Dunkel. Irgendetwas krachte, und er fluchte. Offenbar fand er die Tür nicht. »Das schicken wir nicht ab! Damit will ich nix zu tun haben!«
Jaworski hörte, wie eine Bierflasche an der Wand zerschellte und Küppers im Flur hämisch auflachte: »Daneben!«
»Komm zurück, oder ich mach dich platt«, donnerte Hoffmann in die Finsternis.
»Kameraden, wir müssen doch ruhisch sein«, jammerte Koppnuss. »Sonst kommt die Schmier tatsäschlisch noch.« Der Boden erzitterte, als der schwere Sessel, in dem Küppers vor Sekunden noch gesessen hatte, mit einem dumpfen Knall umfiel.
»Scheißdreck«, fluchte Hoffmann.
»Hol mich doch, du Wichser«, kreischte Küppers im Flur. Jaworski hörte, dass der Dicke an der Tür rüttelte. Pech für dich, die Tür ist abgeschlossen, und das Schlüsselbrett musst du im Dunkeln erst mal finden. Es klirrte leise, als Hoffmann eine weitere Bierpulle aus dem Kasten zog. Die Flasche zischte durch den Raum und fand mit einem hellen, fröhlichen Glockenton ihr Ziel. Das hörte sich ganz und gar nicht nach einer Wand an. Die daraufhin einsetzende Stille dauerte nur wenige Sekunden.
»Herr Jaworski!«, drang die quäkende Stimme der Vermieterin durch die Wohnungstür. »Das ist jetzt aber wirklich die letzte Warnung! Es geht mich ja nichts an, was Sie da drinnen machen. Aber wenn hier nicht augenblicklich Ruhe ist, dann wird das für Sie Konsequenzen haben. Hören sie mich, Herr Jaworski?«
»Ja, Frau Jäger«, stammelte er. »Wir hatten einen Stromausfall … Der Sessel ist umgefallen. Alles wieder gut …«
»Du alte Drecksau«, stöhnte Küppers, der offenbar wieder zu sich kam und sich an der Klinke der Wohnungstür hochzog. Selbstverständlich galt die Beschimpfung Hoffmann, der ihn mit der Flasche am Kopf erwischt hatte, doch damit läutete Küppers endgültig das bittere Finale des Abends ein, an dem Jaworskis Mietvertrag endete.
»Das habe ich gehört, Herr Jaworski!«, kreischte die alte Frau. »Und das lasse ich mir nicht bieten!«
Ihren Worten folgte ein minutenlanges Scheppern aus der Küche. Koppnuss war im Dunkeln mit voller Wucht in die mit Gläsern und Geschirr gefüllte Vitrine gelaufen. Er schaffte es zwar noch, den kippenden Schrank an einer der Türen zu packen und festzuhalten. Doch das hatte lediglich zur Folge, dass der Inhalt einzeln und nacheinander auf den Küchenfliesen zerschellte. Der reinste Polterabend. Als die Vitrine vollends leer war und Küppers die Sinnlosigkeit seines Tuns bewusst wurde, beendete er die Kakophonie gekonnt mit einem Paukenschlag, indem er das Möbelstück kurzerhand fallen ließ. Rumms!
Jaworski schlug die Hände vors Gesicht. Im Hausflur klapperten Frau Jägers Hausschuhe erstaunlich schnell die Treppe hinauf. Wohl unterwegs zu ihrem alten schwarzen Telefon im dritten Stock.
»Wie lange braucht die Schlampe nach oben?«, fragte Hoffmann.
»Bei dem Tempo höchstens zwei Minuten«, seufzte Jaworski.
»Du machst jetzt die Sicherung wieder rein. Dann nix wie weg.«
Als das Licht brannte, versetzte Hoffmann Küppers eine kräftige Schelle und nahm ihm den Laptop weg, den der Dicke, auf dessen Stirn eine monströse violette Beule wuchs, immer noch umklammerte. »Du kommst jetzt mit!«, herrschte Hoffmann den Benommenen an. »Koppnuss, komm her, wir müssen das Sackgesicht stützen!«
Jaworski fand den Schlüssel, öffnete die Tür und ließ seine Kumpane hinaus. Dann ging er zurück, steckte Handy und Portemonnaie in die Jackentaschen, schloss die Tür ab und folgte den dreien in die Nacht. Einige Straßenzüge entfernt jaulte ein Martinshorn auf.
»Mit denen will ich heute nicht diskutieren«, murmelte Jürgen Jaworski. »Nicht heute Nacht.«
2
Montag, 18. März
HEHLAU
An die Statt Köln!
Wir die Unterschreiber dieses Briefs protestieren gegen die GEZ-Diktatur und wollen die totahle Zerschlagung des Rotfunk! Wir sehen uns das nicht mehr tatenlos mit an das immer mehr sogenante Flüchtlinge den alt eingesessenen Kölner ihre Wohnung wegnehmen! Die erkennen doch ihre eigenen Viertel nicht mehr wieder!
Wir wollen 11 Millionen, elf denn wir sind kölner. sonst vergiften wir am 20. April das Trinkwasser in einem Kölner Wasserwerk. Die Mittel dazu haben wir, wir meinen das völlig ernst. Zum Beweiß werden wir ihnen am 20. April um Mitternacht das Wasser werk nennen, wo das Trinkwasser vergiftet ist. Wenn das Geld danach nicht gezahlt wird (Einzelheiten Wann und Wo geben wir noch durch), wird es keine weitere Warnung geben. Wenn ihr keine Toten wollt, dann schaltet eine Anzeige im Kölner Express in der steht: Dat Wasser vun Kölle is jut, dä Sultan hät doosch. Sonst könnt ihr selber nachgucken, wo dat Wasser von Kölle nicht mehr so joot ist und viel Spass dabei!
Und erzält uns nicht, ihr habt kein Geld, ihr Klüngelköppverein!
Um unserer Forderung ein wenig Nachdruck zu verleihen, haben wir ein verschweistes Plastiktütchen mit einer kleinen Überraschung für euch in den Umschlag gelegt. Kleiner Tipp: WIR würden das nich öffnen.
Wir hören vonenander!
gez.: KahaKa - Kölsche helfe Kölsche,
13. März 2019
Der Brief steckte in einer Klarsichthülle, obwohl es sich nur um eine Kopie handelte. Hilde Hehlau grunzte verächtlich und gab ihn ihrem Gatten zurück.
»Und das nehmt ihr ernst?«
»Müssen wir«, brummte Herbert Hehlau, Abteilungsleiter im Amt für Verfassungsschutz, in Köln zuständig für Terrorabwehr und organisiertes Verbrechen. Er seufzte. »Leider.«
Hilde gähnte. »Liest sich wie ein Dummerjungenstreich.«
»Was auch gewollt sein kann.«
Sie schnaubte wieder. »Ach ja, der superintelligente linksradikale Terrorist baut ein paar Rechtschreibfehler und Führers Geburtstagsdatum in seinen Erpresserbrief ein, um den Verdacht auf dumme Neonazis zu lenken, wie?«
»Zum Beispiel. Mach dich nicht immer lustig über meine Arbeit.«
»Das würde ich doch nie tun«, schnurrte sie, langte auf seine Bettseite und tätschelte seine Schulter. Dann streckte sie die Arme weit über ihren Kopf und räkelte sich. Ihre Bettdecke rutschte nach unten und bot Hehlau einen appetitlichen Einblick in das Dekolletee ihres sandfarbenen Satinnachthemds. Aber bevor er einer spontanen Aufwallung nachgeben und ihren braun gebrannten, immer noch attraktiven Busen berühren konnte, drehte sie sich auf die andere Seite.
»Ist ja auch egal«, sagte sie, »wann trinken wir schon mal Wasser …«, und griff nach dem Glas auf ihrem Nachtschränkchen. Ihr dritter Schlummertrunk, registrierte Hehlau und starrte missbilligend auf ihren halbnackten Rücken, während sie ihren Wodka mit Apfelsaft schlürfte.
»Ja, prost …«, brummte er und nahm seinerseits das Glas mit Tomatensaft von seinem Nachttisch. Keine fünf Minuten, und sie würde anfangen zu schnarchen.
»Ich würde aber an deiner Stelle mal darüber nachdenken, warum sie ausgerechnet dir dieses Machwerkchen geschickt haben«, murmelte sie über ihre Schulter hinweg. »Und dann noch an unsere Privatadresse.« Sie leerte ihr Glas, stellte es ab, knipste ihr Leselicht aus, legte ihre Schlafmaske an und zog sich die Decke bis über die Nase.
Hehlau saß erstarrt da, den Tomatensaft vor seinen Lippen, stierte auf den Brief in seiner anderen Hand und fluchte in sich hinein. Das hatte er sich allerdings selbst noch nicht gefragt.
FOLKER
»Ist neben dir noch ein Plätzchen frei?«
Folker, der auf einem alten Pappkarton in der viel zu warmen Märzsonne lag, hielt eine Hand schützend vor die Augen. »Klar, das ist ja mein Park. Der Folksgarten«, gab er in Richtung der schwarzen Silhouette zurück, die sich über ihn beugte.
»Na dann … Ich bin Me’Shell.«
Er stützte sich auf den rechten Ellbogen auf und sah zu, wie sie eine Decke aus ihrem Rucksack zog, sie ausbreitete und mit einer fließenden Bewegung die Schuhe von ihren Füßen gleiten ließ.
Signalrot lackierte Zehennägel. Michelle, ma belle …, summte er. Jetzt bloß keinen Fehler machen …!
Zu spät: »Nee, nee«, sagte sie und buchstabierte ihm ihren Namen. »Ich bin nämlich ein großer Fan von Frau Ndegeocello«, erklärte sie. Beschämt stellte er fest, dass er nicht einmal wusste, ob die Dame Musikerin, Sportlerin oder eine dieser Influencerinnen war. Traute sich aber nicht, nachzufragen und ließ sich nichts anmerken.
»Aha«, tat er wissend. »Ich bin Volker, aber alle nennen mich Folker, weil ich Musiker bin und ich …« Weiter kam er nicht.
»Kiffen?«, fragte sie und zauberte einen beeindruckenden vorgefertigten Joint aus dem Rucksack. Mindestens drei der gelben XL-Blättchen aus Maispapier. Sie blickte sich um und band ihre langen, rabenschwarzen Haare zu einem widerspenstigen Zopf. Es war schön anzusehen, wie sich dabei nicht nur ihre sehnigen Arme hoben. Und es gab allerhand zu sehen – sie trug ein dünnes schwarzes Schlabber-T-Shirt mit einem verwaschenen, ehemals bunten Aufdruck, der von der Seite nicht zu entziffern war. Aber da kramte sie auch schon ein Feuerzeug aus der Tasche ihrer engen Jeans, zündete in aller Ruhe den Joint an, nahm zwei tiefe Züge, wandte sich dann Folker zu und bot ihm den Spliff an. Auf dem Shirt warb Bob Marley mit wild schwingenden Rastazöpfen für seinen Auftritt in London – am 18. Juli 1975 …
»So alt siehst du gar nicht aus«, sagte Folker, nahm den Joint und zwei kräftige Züge. Ob ihr herzliches Lachen diesem Spruch galt oder seinem keuchenden Hustenanfall, war nicht zu erkennen.
Er brauchte drei Minuten, um sich einigermaßen zu erholen.
»Amateur?«, fragte sie mit einem mitleidigen Grinsen.
»Bin eher der Biertrinker.« Und würde dir jetzt am liebsten sagen, was für tolle grüne Augen du hast.
»Ach? Na ja, so’n frisches Gutgekühltes wäre ja bei dem Wetter auch nicht schlecht, wie?«
»Ehrlich gesagt, hatte ich den Gedanken auch schon.« Folker schickte den Worten einen letzten Huster hinterher und nickte in Richtung seines Gitarrenkoffers. »Allerdings müsste ich vorher ein bisschen Geld mit Straßenmusik verdienen. Ich bin willig, aber pleite.« Zum Beweis krempelte er das Innere seiner Hosentaschen hervor. Auf den Rasen kullerten ein noch verpacktes Kondom und eine kleine, schwarze Trillerpfeife, die er am Morgen auf der Straße gefunden hatte.
»Lustige Kombi«, gluckste Me’Shell.
»Ja, ich mag’s beim Sex gern laut«, antwortete er und beglückwünschte sich innerlich zu seiner Schlagfertigkeit. Ihr heiseres Lachen versetzte zwei fette Tauben in Panik, die mit klatschenden Flügelschlägen mühsam abhoben und in die Flugbahn eines Frisbees gerieten, und Folker in Siegesstimmung.
Ihre Hand landete wie zufällig auf seiner Schulter.
»Na, komm mit. Ich geb einen aus.«
In der Stadt öffneten an diesem überraschend heißen Märztag scharenweise die Biergärten. Zufrieden lächelnde Wirte schleppten aus dunklen Kneipen Tische und Stühle ans Tageslicht. Kein Zentimeter Bürgersteig wurde verschont, überall saßen Menschen, die das plötzliche Ende des Winters begossen und ihre Gläser auf den Frühling erhoben. »Endlich Sonne, wurde auch Zeit. Ich dachte schon, das wird nix mehr. War das ein langer Winter.« Die ewig gleichen Sprüche, die die Leute halt so brabbelten, wenn die Kälte die Stadt der Hitze überließ. Das Frühjahrs-Mantra.
Mitten in dem Gewühl, zwischen lässig Sonnenbebrillten, die ihre tätowierte Haut zu Markte trugen, Mädels, die mit lustigen Schirmchen drapierte Longdrinks schlürften, Dönergeruch und Schlangen von Kindern vor den Eislokalen, kamen sich Me’Shell und Folker näher. Sehr viel näher. Die Blicke wurden inniger, die Berührungen länger, diese knisternden Momente, die sich gewöhnlich in einem Kuss entladen, häufiger.
Wer sie waren und wohin sie noch wollten, erzählten sie sich im Schnelldurchgang auf der Fensterbank der Sansibar, während die Kellnerin Svenja gelegentlich für Biernachschub sorgte.
»Mutter Sizilianerin, Vater Fischkopp«, lachte Me’Shell. »Er eine waschechte Kieler Sprotte, trocken bis dröge, kein Wort zuviel, aber schwer zuverlässig, sie ein Temperamentbündel. Kannste dir ja vorstellen, dass meine Eltern es nicht allzu lange miteinander ausgehalten haben. Aber mein Erzeuger hat mir finanziell immer aus der Klemme geholfen, wenn es darauf ankam.« Dann: Jahre in Hamburg bei der Schwester des schweigsamen Fischkopps. Mutter hatte längst einen feurigen Sizilianer geheiratet und zwei weitere Kinder zur Welt gebracht und machte keine Anstalten, auch noch die Tochter aus der ersten Ehe mit durchzufüttern. Abi, ein paar Semester Sozialwissenschaften, Jobs, meistens in Kneipen, ein Jahr in Griechenland, und jetzt seit einer Woche in Köln.
»Ich bin erst mal bei ’ner Freundin untergekommen«, schloss Me’Shell. »Mein Dreißigster ist schon ’n paar Tage her, ich glaub’, ich sollte langsam mal mein Studium abschließen. Köln gefällt mir. Gibt es hier noch mehr so nette Leute?«, fragte sie mit einem bezaubernden Lächeln, das nichts anderes als »wie dich« bedeuten konnte. Folker beschloss augenblicklich, keinen seiner Freunde auch nur in ihre Nähe zu lassen. Nett waren sie ja alle, aber alle wollten sie nur das Eine.
Wie ich, aber das hier ist ja wohl was völlig anderes. Diese Frau ist eine Ausnahme. Scheiße, bin ich etwa verliebt?
Jetzt war er an der Reihe: »Hier geboren, Vater unbekannt, Mutter lebt mit einem neuen Lover in Karlsruhe. Abgebrochenes Musikstudium, dann gemeinsam mit einem Didgeridoo-Spieler aus Luxemburg Straßenmusik in Australien. War aber ziemlich eintönig«, seufzte Folker bei der Erinnerung an Down Under. »Ich wache manchmal heute noch wimmernd auf und habe Blowing in the Wind im Ohr, untermalt von einem dumpfen Dauerdröhnen. Aber ich schlage mich immer noch mit meiner Lilli hier durchs Leben.« Er klopfte auf den Gitarrenkoffer, ignorierte Me’Shells spöttisches Grinsen und erzählte ihr von seinem Projekt, dem deutschen Schlager der 1920er und 1930er Jahre neues Leben einzuhauchen. »Da gibt’s unvorstellbar gutes Song-Material in rauen Mengen. Zeitlose Perlen! Gar kein Vergleich mit dem, was dann nach dem Krieg hier als Schlager verbrochen wurde. Klar, kein Wunder – all die jüdischen Komponisten und Texter mit dem intelligenten Witz und dem Gespür für Melodie und Rhythmus waren ja entweder im Exil oder im KZ gelandet. Nimm bloß mal einen Song wie Die Männer sind alle Verbrecher …«
»Hä? Kenn ich nich«, unterbrach ihn Me’Shell mit gerunzelter Stirn.
Das ließ er sich nicht zweimal sagen und sang sofort los: »Die Männer sind alle Verbrecher, ihr Herz ist ein finsteres Loch, hat tausend verschied’ne Gemächer – aber lieb, aber lieb sind sie doch …«
Sie kicherte und schüttelte den Kopf. »Und das nennst du zeitlos?«
»Ja, klar! Und ich glaube, mein Konzept hat Zukunft. Musikalisch natürlich ein bisschen frisiert und modernisiert. Na ja, und bis dahin verdiene ich ein bisschen Kohle mit Gelegenheitsjobs. Zurzeit drei Mal die Woche halbtags in einem Wasserwerk.«
»Was machst du denn da so?« Diesmal schien Me’Shell ehrlich interessiert.
»Na ja …, eigentlich bin ich nur die Putze«, antwortete Folker und war erleichtert, das Thema wechseln zu können, als Svenja ihnen zwei neue Kölsch in die Hände drückte. »Also: auf uns. Und auf die Sonne«, sagte er.
»Lecker«, erwiderte Me’Shell, hob das Glas und schaute ihm tief in die Augen. So tief, dass Folker sich nicht sicher war, ob sie das Bier meinte – oder vielleicht sogar ihn.
Als sich am frühen Abend die Sonne auf ihren Sinkflug hinter die Hausdächer begab, kroch die Kälte wieder aus den Bürgersteigen hoch. Schließlich war erst März, und Väterchen Frost hatte die Koffer für seine alljährliche Reise in den hohen Norden noch nicht fertig gepackt.
»Wird ganz schön frisch«, sagte Me’Shell und schüttelte sich leicht. »Ich glaube, ich geht jetzt mal nach Hause.«
Sie lachte leise auf, als sie Folkers Blick bemerkte: die perfekte Parodie eines Kapuzineräffchens, dem man soeben eine Banane entrissen hatte.
»Das war wirklich ein netter Tag«, fügte sie schmunzelnd hinzu und stupste mit ihrem Zeigefinger an Folkers schief nach rechts abstehende Nasenspitze. »Sollten wir wiederholen.«
»Wohin … Wieso … Jetzt gleich?«, stammelte er. »Na klar, wiederholen … Unbedingt. UN-BE-DINGT!« Scheiße! Du redest ja wie ein bekackter Bankangestellter! Wo ist dein Charme geblieben? Was ist aus ›Ich brech die Herzen der stolzesten Frau’n‹ geworden? Nimm es wie ein Mann, du Stiefellecker! Und frag sie, wo sie wohnt!
»Ehm …, wo wohnst du denn?« Na also, geht doch.
Me’Shell orientierte sich kurz, schaute nach links und rechts und sagte »Brühler Straße. Das da hinten ist die Bonner, richtig? Ich muss stadtauswärts, an diesem Großmarkt vorbei und dann kommt rechts die Brühler. Oder nicht?«
»Ich bring dich hin.« Um nichts in der Welt wollte er diese Frau jetzt gleich wieder aus den Augen verlieren. »Sind ja nur ein paar Meter.«
Me’Shell zerrte die Decke, die sie im Volksgarten als Unterlage genutzt hatte, erneut aus ihrem Rucksack und legte sie sich über ihre Schultern. »Na, dann los. Danke, nett von dir. Ich kenne mich noch nicht so gut aus in der Stadt.« Sie winkte Svenja zu, die freudig zurückwinkte und sich gleich wieder laut schwatzend einem Pulk langhaariger Jungs zuwandte, die auf der Straße vor der Sansibar eine vergammelte Kühltruhe auf zwei Skateboards werweißwohin transportierten.
»Kommt die nicht, um abzukassieren?«, fragte Me’Shell verwundert.
»Nee, ich hab ’nen Deckel hier. Mit deinem Gewinke kann sie nix anfangen«, erklärte Folker.
Auf ihrem Weg sprang brummend und flackernd eine Straßenlaterne nach der anderen an und wies ihnen die Richtung. Großes Kino, dachte Folker und schlang seinen Arm um Me’Shells Schultern. Mal sehen, was der Abend noch bringt.
»Halt«, sagte sie, als sie am Großmarkt vorbei waren, und zeigte auf eine Hausecke, an deren Fassade sich ein windschiefes Kneipenschild festkrallte – ›Zum Büchel‹. »Das da ist ja wohl eine dieser urkölschen Kneipen, von denen mir alle immer so vorschwärmen. Absacker?«
Er nickte erfreut.
Innen brannte Licht, doch als sie die Kneipe betraten, stellten sie fest, dass außer ihnen niemand da war.
»Durstige Gäste!«, rief Folker in Richtung der halb offenen Schiebetür hinter der Theke. Obwohl er dankbar für jede Verlängerung seines Abends mit Me’Shell war, hatte er das ungute Gefühl, am falschen Ort zu sein. Die Klitsche kenne ich doch …?
»Komme sofort«, dröhnte eine tiefe Männerstimme aus dem Nebenraum. Sekunden später stand ein muskelbepackter Schnauzbart hinter dem Zapfhahn. »Was darf’s denn sein, Leute?«
»Zwei richtig kölsche Kölsch«, jauchzte Me’Shell und wickelte die Decke von ihren Schultern.
»Na, was denn sonst …« Der Keeper griff sich zwei Gläser, zapfte sie geschickt voll und stellte sie vor ihnen auf die Theke. Brummte »Prost! Gleich wieder da« und verschwand erneut hinter der Schiebetür. Sie tranken einen Schluck und lächelten sich an.
»Gibst du mir deine Nummer?«, fragte Folker und fischte sein Handy aus der Gesäßtasche.
»Klar, warum nicht.« Me’Shell nannte eine zehnstellige Zahlenfolge. Er tippte die Nummer ein und steckte das Telefon wieder weg.
»Ich gehe mal aufs Klo.«
»Viel Spaß!«
»Danke.«
»Und, schmeckt’s?«, hörte er den Schnauzbart hinter sich fragen, und Me’Shells fröhliches »Ja! Machst du uns noch zwei?« Dann stand er feixend an einer uralten blechernen Pissrinne und fand, dass der Abend verdammt gut anfing.
Als er zurückkam, mit nassen Händen wedelnd, damit seine Begleiterin auch ja bemerkte und hoffentlich zu würdigen wusste, dass er sie artig gewaschen hatte, waren sie nicht mehr allein: An dem vorsintflutlichen Flipper in der Nische neben der Eingangstür standen zwei junge Typen und eine junge Frau, die aussah, als würde sie ihre Kinder Kevin und Chantal nennen, und am anderen Ende des Tresens hockten zwei Ältere im Blaumann vor drei Rentnergedecken und einem ledernen Knobelbecher. Und schon betrat auch der dritte Blaumann den Laden.
Folker schwang sich wieder auf den Hocker neben Me’Shell, griff nach seinem vollen Glas, klickte damit lässig an ihres und leerte es in einem Schluck bis auf eine schmale Neige.
Sie schenkte ihm ein schiefes Grinsen. »Ganz schönen Zug am Leib … Kennste du das Lied ›Helja‹, von diesem Kölner Sänger – Jupp oder Jeck oder Bert …?«
»Jächt heißt der. Wieso?«
»Da singt er so was wie ›Ich weiß schon nicht mehr, wie es ist, wenn du nüchtern mit ’ner Frau zusammen bist‹ …«
Folker musste schlucken. Dabei war sein Glas fast leer. Baggerte sie ihn gerade an? Wurde jetzt von ihm ein lässiges ›Zu mir oder zu dir?‹ erwartet …? Und bin ich jetzt etwa rot geworden?!
Sie lachte wieder ihr rasselndes Lachen. »Überlegst du gerade wirklich, wann du bei so ’ner Gelegenheit das letzte Mal nüchtern warst?«
»Mh«, machte er ertappt.
»Und …?«
»’ne Weile her«, gestand er.
Sie stand auf und nahm ihm sein leeres Glas aus der Hand.
»Wie wär’s – ich geh mal eben für kleine Mädchen, und dann geh’n wir und … ändern das …?«
Auch ’ne Weile her, dass du auf so ein Angebot keine schlagfertige Antwort hattest. Ihm fiel tatsächlich nichts anderes ein, als sie mit halb offenem Mund ungläubig anzustarren.
»Okay«, sagte sie. »Wir trinken noch eins – und dabei kannst du’s dir ja überlegen.« Drehte sich um und schaukelte ihre Jeans, mit allem, was drin war, zur Toilettentür.
»Wow …«, murmelte er.
»Find ich auch«, brummte der Schnauzbart und stellte ihm ein Frischgezapftes vor die Nase.
»Geile Mucke«, sagte Folker.
»Ja, findest du? Nagelneue Playlist, heute Morgen erst gemacht.«
»Cool.« Ja, klar, J.J. Cale ist immer cool. Aber irgendwas an dieser Playlist ist komisch – Cale hat doch nie mit so viel Hall aufgenommen …?
Und auch das Klackern vom Flipper, das Kichern von Chantals Mutter und das Rattern des Knobelbechers klangen zunehmend, als säße er nicht in einer Kneipe, sondern in einem Hallenbad. Er zwinkerte ein paar Mal kräftig, schüttelte den Kopf, versuchte, sich aufrecht hinzusetzen. Aber seinem Schädel hatte das Schütteln offenbar gar nicht gefallen – er wurde immer schwerer, und Folker musste ihn, einen Ellenbogen auf dem Tresen, mit einer Hand stützen. Scheiß-Kifferei!, dachte er und nahm noch einen Schluck von seinem Bier. Auch das fühlte sich komisch an – als käme er gerade vom Zahnarzt, die Lippen noch taub von der Spritze.
Er schloss die Augen. In dumpfen Wellen dröhnten die Bässe der Musik durch seine Schläfen, und jetzt hatte irgendein durchgeknallter Toningenieur oder Discjockey obendrein ein Echo zugeschaltet – They call me the breeze – eeze – eeeeeze …, sang J.J., und das Hallenbad wurde immer größer und größer; Folker fühlte sich, als stünde er inzwischen auf dem Zehn-Meter-Brett. Aber es war ein hydraulisches Zehn-, nein: Zwanzig-, Dreißig-Meter-Brett, und all der Lärm, die Musik, der Flipper, die Stimmen verschwanden immer tiefer unter ihm. Außerdem wurde ihm zunehmend heißer; sehnsüchtig starrte er auf das kühle, penatenblaue Wasser da unten, beugte sich vor, kicherte. Von so hoch bin ich ja noch nie gesprungen … Aber was soll mir schon passieren?
Also neigte er sich noch weiter vor und ließ sich langsam, wie in Zeitlupe, nach vorne fallen …
3
Dienstag, 19. März
FOLKER
Das Nichts. Ein unendlicher schwarzer Raum, durchzogen von silbernen Fäden, an denen harzige Tropfen klebten.
Ist es hier, wo wir am Ende alle landen?, fragte Folker sich und berührte einen der Tropfen.
Sofort schoss ihm eine Erinnerung in den Kopf. Es war allerdings nicht seine: Eine junge, wunderschöne Frau in einem schwarzen Kleid stieg in ein Taxi und ließ einen weinenden Mann auf dem Bürgersteig zurück.
»Scheiße«, murmelte er und stieß seinen Zeigefinger in einen weiteren Tropfen. Sofort veränderte sich das Bild: Er saß in einem überfüllten Hörsaal und spürte ein Ziehen im Unterleib. Bruno will das Kind nicht, schrieb er in den Notizblock vor ihm und schob ihn seiner Nachbarin zu. Scheiß auf Bruno, es ist dein Baby, kritzelte die Frau darunter und tätschelte tröstend seinen Oberschenkel. Bevor er den nächsten Tropfen anzapfen konnte, kam eine Stimme über ihn wie Donnerhall, und die Fäden und Tropfen stoben auseinander, als hätte jemand mitten in einem Herbststurm sämtliche Fenster und Türen aufgerissen.
»Ey, Alter. Alles klar bei dir?« Trompeten, Posaunen und Pauken unterlegten die allmächtige Stimme. Folkers Gehirn fühlte sich an wie ein Blumenkohl in der Mikrowelle.
»Wer bist du?«, flüsterte er.
»Ah, okay. Dann also mit allen üblichen Höflichkeitsfloskeln«, dröhnte die Stimme. »Ich bin Taifun, und ich arbeite hier.« Ein einsamer, verspäteter Paukenschlag verlor sich in der Weite des Raums.
»Bist du ein Gott?«, fragte Folker, duckte sich und hielt sich sicherheitshalber die Hände vor die Augen, um sich vor dem schrecklichen Anblick des höheren Wesens zu schützen. Er würde garantiert zu Staub zerfallen, sollte er jemals das Antlitz dieses Taifuns erblicken.
»Es gibt Frauen, die das glauben«, dröhnte die Stimme und ließ ein meckerndes Lachen folgen, das Folkers Barhocker vibrieren ließ.
Barhocker? Der Begriff zog eine Schleife durch Folkers Gehirnwindungen und hinterließ ein Fragezeichen. Er wagte es, ein Auge zu öffnen.
»Willkommen zurück«, sagte der mehr als massige Kerl, der sich über ihn beugte. »Letzte Runde ist längst vorbei, du gehst mal besser nach Hause.« Nach Hause, Hause, ause, use, se, se, hallte es in Folkers Kopf, und dann kam die Erinnerung. Seine eigene.
»Wie lange …?«, fragte er den Rausschmeißer.
»Fast zwei Stunden, die Hälfte davon mit der Backe auf der Thekenkante. Muss jetzt ziemlich wehtun.« Taifun fasste sich mit seiner riesigen Pranke ins Gesicht und prüfte vorsichtig die Beweglichkeit des eigenen Unterkiefers.
»Und wo ist sie?«
»Das Mädel? Weg, aber dein Deckel ist bezahlt. Nachdem du eingeschlafen bist und sie dich nicht mehr wachgekriegt hat, ist sie gegangen. Heißes Gerät, übrigens. Aber du musstest ja vor ihren Augen abkacken. Entweder hast du kräftig vorgetankt, oder sie hat dir K.o.-Tropfen verpasst. Waren nur fünf Kölsch.«
»Nach fünf Kölsch werd ich normalerweise erst langsam wach.«
»Nicht heute Abend, offenbar. Aber warum sollte dir die Tante so was ins Bier kippen?«
»Gute Frage. Meinste, ich könnte noch eins …, für den Heimweg, ohne Tropfen?«
Taifun seufzte. »Für eins geh ich aber nicht nochmal hinter den Tresen.« Er grinste, als Folker müde zwei Finger hob. Begab sich an den Zapfhahn und füllte zwei Gläser. Stellte eins auf die Kühlung und das andere ans Ende des Tresens. Die Ecke, die Stammgäste Südkurve nannten, gleich an der Klotür.
Folker runzelte die Stirn.
»Du wirst mir hier nicht mitten vor die Theke kotzen«, sagte Taifun und nickte zu den Toiletten hinüber.
»Das’n Argument«, sagte Folker und schleppte sich mühsam dorthin. Prostete dem edlen Spender stumm zu und probierte es vorsichtig mit erst einem kleinen, dann einem größeren Schluck. »Unfallfrei«, verkündete er. Wollte befreit rülpsen, sah sich aber im gleichen Moment genötigt, so schnell wie möglich auf der Toilette zu verschwinden.
»Klar doch«, brummte Taifun, leerte sein Glas auf Ex und zapfte zwei neue. Gönnte der Klotür einen nachdenklichen Blick, zuckte mit den Schultern, drehte zwei Schnapsgläser um und füllte sie aus einer Flasche ohne Etikett mit einer bernsteinfarbenen Flüssigkeit. Trug alles zur Südkurve, holte sich einen Hocker hinter die Theke, setzte sich darauf, fischte ein Päckchen Lucky Strike aus seiner Hemdtasche, zündete sich mit einem Zippo eine Zigarette an und summte wartend leise vor sich hin.
»Echt?«, fragte Folker, als er mit offensichtlich gewaschenem, tropfendem Gesicht zurückkam und das Gedeck vor sich sah. Taifun zuckte nur mit den Schultern und hob sein Schnapsglas. »Ja, dann …« Folker klickte seins dagegen und kippte den Inhalt in einem Zug hinunter. »Huh!«, stieß er danach zischend aus und musste zwei, drei Mal tief durchatmen. »Was ist das denn?«
»Apfelkorn«, brummte Taifun, der sein Glas völlig ungerührt geleert hatte. »Karibisch.«
»Hä …?«
»Bisschen mehr Rum. Meine Mischung.«
»›Bisschen‹ …? Da schaff ich ja keine vier von, ohne umzukippen!«
»Kriegst du auch nicht«, sagte Taifun, ließ sein Bier auf Ex verschwinden und stand auf. »Ich mach jetzt wirklich Feierabend.«
Er nickte zu dem schweren, schwarzbraunen Filzvorhang mit dem ledernen Saum hinüber, hinter dem sich die Eingangstür verstecken musste. Folker sah sich um und nahm jetzt erst die Einrichtung der Kneipe wahr: Alles schien komplett aus der Zeit gefallen zu sein. Vor einer Sitzecke aus auf rustikal getrimmter Pseudo-Eiche stand ein schwerer Tisch, der seit den schätzungsweise Fünfzigerjahren ungezählte Hektoliter Bier aufgesogen hatte. An der Wand dahinter der billige Druck eines Ölgemäldes, das den Kölner Dom bei Sonnenuntergang zeigte, links davon, unter einem Messingschild mit der altmodisch verschnörkelten Gravur Sparkästchen-Verein Kimme, Korn, ran! hingen zwei Dutzend verblasste Porträt-Aufnahmen der Mitglieder und dazu einige Postkarten aus Mallorca, so wie es wohl in den 1970er Jahren ausgesehen haben mochte.
Ein etwas blasserer, rechteckiger Fleck auf der nikotinbraunen Tapete zeugte davon, dass das Sparkästchen vor längerer Zeit abgeschraubt worden war. Beschwerden an mich. Leckt mich am Arsch. Gruß, Pitter hatte jemand ungelenk an den unteren Rand gekritzelt. Aus dem verschmierten Glas einer leeren Frikadellen-Vitrine hinter der Theke starrte Folker sein eigenes Gesicht entgegen. Schwarzes, wirres Haar (»Wenn ich deinen Vater nicht eine Weile ganz gut gekannt hätte, würde ich glauben, du hättest einen Schuss Zigeunerblut abgekriegt«, pflegte seine Mutter zu sagen. »Andererseits habe ich seine Eltern nie kennengelernt.«), dunkle Augenringe (na, kein Wunder) und diese eigentümlich schiefe Nase, die manche Frauen an ihm so interessant fanden.
Als Kind war er ganz profan gegen einen Briefkasten gelaufen, doch den Damen erzählte er gerne von seinem langen Aufenthalt in Australien und der Begegnung mit einem boxenden Känguru. »Ich hatte natürlich ein Gewehr – niemand down under geht unbewaffnet in die Wildnis – und hätte es einfach abknallen können!« Die Ladies hingen an seinen Lippen, wenn er endlich zum Höhepunkt seiner Geschichte kam. »Doch ich wollte dem Tier eine Chance geben. Es war sozusagen ein Kampf Mann gegen Mann. Und am Ende habe ich gewonnen. Das Biest hat nur leider meinen Zinken erwischt.«
Es funktionierte fast immer: Neunzig Prozent seiner Zuhörerinnen schmolzen sofort dahin, nur wenige fragten empört, ob er es denn fair finde, ein unschuldiges Tier zu verprügeln. Egal, ein bisschen Schwund war ja immer.
»Wo bin ich hier überhaupt?«, fragte Folker, in dessen Blutbahn sich die Reste der chemischen Substanz, die ihm offenbar verabreicht worden war, mit dem karibischen Apfelkorn zu einer wilden Party verabredeten. Er befürchtete, die Sause würde schon bald, aber weitgehend ohne ihn stattfinden.
Bevor das Fest stieg, wollte er zuhause sein. Oder wenigstens in der Nähe.
»Ist das hier etwa …«, begann er. »Die Kneipe kommt mir bekannt vor.« Hinter seiner Stirn flackerten im Zeitraffer ein paar Filmszenen auf. Bärbel. Die blonde Bärbel! Hier bin ich schon mal aufgetreten. Und dann hat uns ihr Bruder auf dem Klo erwischt. Ach, du Scheiße – war das hier …?
Taifun stellte klirrend die leeren Gläser auf die Theke, breitete die Arme aus, warf theatralisch den Kopf in den Nacken und rief: »Willkommen in der Zukunft! Endlich darf ich das mal sagen! Alles, was du hier siehst, gibt es eigentlich gar nicht mehr. Ich werde hier …« Er stoppte seinen Redeschwall, als er Folkers leichenblasses Gesicht bemerkte. »Alter, was ist los?«
»Bin ich noch auf ’nem Trip? Bist du real? Bin ich in der Zukunft? Ist das hier alles echt?«, fragte Folker heiser zurück und sah sich verstohlen nach harzigen Tropfen um, an denen eventuell die Erinnerungen fremder Menschen klebten.
»Ach so, okay, verstehe. Alles gut, Mann.« Taifun nickte, ging hinter die Theke, zapfte zwei weitere Kölsch und stellte eines davon vor Folker auf den Tresen. »Ich habe den Laden vor ’n paar Wochen übernommen.« Er angelte noch eine Lucky aus der Brusttasche, zündete sie an und nahm einen tiefen Zug. »Der Besitzer ist verstorben, früher hieß der Laden ›Beim Büchel‹. Seit gestern heißt er ›Zukunft‹. Konntest du nicht wissen, draußen hängt noch das alte Schild.« Taifun stieß eine Rauchwolke zur Decke. »Beste Lage hier. Direkt am Großmarkt, nur ’n Steinwurf vom Chlodwigplatz entfernt. Das wird eine Szenekneipe vom Feinsten.«
»Da musst du aber noch ziemlich viel umstricken.« Folker hielt sein Glas prüfend vor die nackt über der Theke baumelnde Glühbirne. Das Kölsch schien okay zu sein – keine Trübung zu sehen.
»Nix da – ist doch voll originell! Aber vor allem muss ich die alten Säcke loswerden, die jeden Tag stundenlang an einem Glas rumnuckeln. Und die Scheiß-Nazis.«
»Braunes Pack? Hier …?!«
Ja, klar: ›Hey, du Arsch! Spiel mal das Horst-Wessel-Lied!‹ Die Spinner hatten ihn für eine Feier gebucht, weil sie glaubten, er hätte Nazi-Songs im Programm. Er hatte sich mit einer brachialen Version von Wir versaufen unser Oma ihr klein Häuschen, die natürlich zu mehreren Schnapsrunden geführt hatte, aus der Affäre ziehen können.
Folker warf einen Blick auf die Klotür. Damals war ihm ein Aufkleber der Böhsen Onkelz aufgefallen. Der war noch da. Halb abgeknibbelt, zumindest. Immerhin.
»Ja, vier, fünf Hackfressen. Den schlimmsten Wichser nennen sie Koppnuss. Der Anführer heißt Hoffmann. Die tun so, als wenn ihnen die halbe Stadt gehört. Aber wenn du mich fragst, kann keiner von denen auch nur geradeaus pissen.« Taifun trat seine Kippe auf dem PVC-Boden vor der Theke aus und ergänzte drei Millionen Brandlöcher um ein weiteres.
»Was wollen die Spinner denn ausgerechnet in diesem Laden?«
»Haben rausgefunden, dass der Großmarkt und die Kneipe auf einem ehemaligen jüdischen Friedhof stehen. Der hieß bei den Kölnern früher angeblich ›Judenbüchel‹ oder auch ›Dude Jüdd‹. Das geilt die Neos auf. Hat mir einer dieser Vollpfosten erzählt.«
Folker zuckte mit den Schultern. »Na und? So, wie du gebaut bist, kannste doch mit den Arschlöchern den Boden hier aufwischen. Der hätte das, unter uns gesagt, auch mal nötig.«
»Ich kann hier keine Bullen gebrauchen«, brummte Taifun und warf einen Blick auf die Uhr. »So, ich gehe pennen. Aber bevor du verschwindest: Mit wem habe ich eigentlich die Ehre?«
»Ich heiße Volker, aber alle nennen mich Folker.«
Taifun zog die rechte Augenbraue hoch. »Aha. Dir ist aber schon klar, dass das wenig Sinn macht, was du da erzählst?«
»Folker. Mit F. Von folk music. Bin Musiker, Stilrichtung Folk. Allerdings beschäftige ich mich seit einiger Zeit mit Schlagern der zwanziger und dreißiger Jahre. Also kannst du mich eigentlich auch Volker nennen.«
Taifuns Augenbraue hatte inzwischen den Haaransatz erreicht und zog die rechte Seite seines Schnurrbarts hinterher. Gleich fängt er an zu knurren. Folker beschloss, jetzt lieber die Klappe zu halten und heimzugehen.
»Was kriegst du?«, fragte er und kramte in seiner Hosentasche.
Taifun winkte ab. »Aber ich hör gern Geschichten. Erzähl mir bei Gelegenheit was über diese Tante – und wie’s weitergeht mit euch. Oder ob überhaupt. Ich bin ja schon länger im Gewerbe. Aber dass eine Frau einem Typen K.o.-Tropfen ins Bier kippt und hinterher auch noch seinen Deckel bezahlt, ist mir noch nicht untergekommen. Riecht irgendwie nach Ärger.« Er stand auf und schnappte sich einen Besen. »Und jetzt verpiss dich.«
HEHLAU
Hehlau öffnete das Schließfach und griff hinein. Das Handy war da.
Er nahm es heraus, verschloss die knallgelb lackierte Blechtür und blickte sich um. Niemand schien sich für ihn zu interessieren. Um ihn herum hasteten Menschen mit ausdrucksleeren oder von schlechter Laune zeugenden Gesichtern in Richtung Ausgang oder die Treppen zu den Bahngleisen hoch. In all dem Gewühl entdeckte er eine einzige Gestalt, die sich nicht bewegte. Neben einem Kiosk stand eine Frau mit Kopftuch und viel zu dickem Wintermantel, die still den Wachturm hochhielt. Niemand nahm Notiz von ihr. Ja, du hast es auch begriffen. Nur eben auf die falsche Art, dachte Hehlau. Es ist ein verdammter Ameisenhaufen. Und täglich werden es mehr Ameisen. Bis sie sich gegenseitig auffressen. Auffressen müssen, um zu überleben.
Er schob Handy und Schließfachschlüssel in seine schwarze Aktentasche, ließ die Schnalle einrasten und verließ schnellen Schrittes den Südbahnhof. Merke: In einem Bahnhof haben es alle eilig. Pass dich stets der Umgebung an, schnarrte die Stimme seines ehemaligen Ausbilders Hans-Theo Scherflein in seinem Kopf.
Er hatte Scherflein gemocht. Vor allem die Geschichten, die der drahtige, kleine Mann über seine Auslandseinsätze erzählte. Wien, Paris, Tel Aviv, Moskau: Städtenamen, die in den Ohren des damals noch jungen Hehlau klangen wie Musik. Er träumte von Abenteuern in den Gassen von Prag, von gefährlichen Missionen im Gewimmel asiatischer Großstädte und Verfolgungsjagden auf karibischen Inseln.
Doch dann trat Hilde in sein Leben, knapp neun Monate später kamen die Zwillinge dazu. Hehlaus Wortschatz erweiterte sich um Begriffe wie ›Pampers‹, ›Sicherheit‹, ›Eigenheim‹ und ›Hypothek‹. Die Bücher von John le Carré, Ken Follett und Ross Thomas setzten Staub an, und den James-Bond-Film im letzten Jahr hatte er nur gesehen, weil seine Töchter befürchtet hatten, der sei erst ab Sechzehn freigegeben, aber natürlich unbedingt Daniel Craig sehen wollten.
Nur wenige Jahre, überwiegend am Schreibtisch eines stickigen Büros an der Inneren Kanalstraße verbracht, hatten ausgereicht, ihm die Flügel zu stutzen und die Flausen auszutreiben. Jetzt, mit Ende Fünfzig, machte er sich keine Illusionen mehr. Bis zur Rente würde er kleinen Fischen hinterherjagen – Dealern, die ihre Finger nicht vom eigenen Stoff lassen konnten, Hehlern, die gestohlene Ware ausgerechnet bei eBay verkauften, und sogenannten Extremisten, die meist noch bei Mama wohnten.
An einem freien Tisch des Straßencafés am Bahnhofsvorplatz bestellte er einen Kaffee und tupfte sich mit einem Taschentuch den Schweiß von der hohen Stirn. Für Ende März ist es viel zu warm, den Mantel hätte ich mir sparen können. Dann nahm er das Handy aus der Aktentasche, schaute sich um und pulte die Kopfhörer in seine Ohrmuscheln. Er öffnete die Audiomemo-App, drückte auf Play und lehnte sich zurück.
»Hallo, Hehlau«, hauchte Me’Shells rauchige Stimme. Verdammt. Warum klingst du immer so, als würdest du dich nackt im Bett herumwälzen? Und außerdem heißt das »Herr Hehlau«, schließlich bin ich dein Vorgesetzter!
Er drückte auf Pause, als die Bedienung den Kaffee brachte, nahm einen Schluck und widmete sich wieder der Aufnahme.
»Ich bin seit drei Tagen in der Stadt mit K. Sie ist tatsächlich ein Gefühl.« Me’Shell kicherte leise, und er verdrehte die Augen. »Zielperson ist kontaktiert. Bisher keine Anzeichen irgendwelcher verfassungswidrigen Aktivitäten. Auch wenn ihr Sesselfurzer euch einen Dreck um meine Meinung schert: Der Typ ist völlig harmlos. Musiker, leicht bis völlig verpeilt und notorisch pleite. Eure Inflagranti-Fotos von ihm und dieser Nazi-Schlampe beweisen gar nichts. Außer, dass er alles vögelt, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Aber davon habt ihr in eurer Abteilung ja auch ein paar Exemplare.«
Längere Pause. Hehlau vernahm quiekende, gedämpfte Geräusche, als lachte seine verdeckte Ermittlerin in ein Kissen. Sie liegt tatsächlich im Bett. Und hoffentlich liegt die Zielperson nicht daneben!
Nach allen objektiven Gesichtspunkten und geltenden Statuten des Amts für Verfassungsschutz war die Frau eine völlige Fehlbesetzung. Me’Shell war unbestreitbar eine Schönheit und damit viel zu auffällig für den Job. Außerdem verweigerte sie jeglichen Respekt vor ihren Vorgesetzten und hatte sich und auch Kollegen mit ihrer unkonventionellen Art schon einige Male in gefährliche Situationen gebracht. Doch sie hatte Erfolg, alles schien ihr zu glücken. Fragt sich, wie lange das noch gutgeht …
Er wusste nicht, woher sie kam, wer sie rekrutiert hatte, und ob Me’Shell ihr wahrer Name war. Er war ihr nur einmal begegnet, als er sie in Duisburg aus der U-Haft herausholen musste. Damals hatte sie sich in einen Puff im Stadtteil Ruhrort einschleusen lassen. Irgendjemand in der Chefetage dachte wohl, sie würde eine überzeugende Hure abgeben. Die Ermittlungen mit dem Ziel, einem albanischen Familienclan Menschenhandel nachzuweisen, endeten für Me’Shell mit dem Vorwurf des versuchten Totschlags in zwei Fällen. Ein Zuhälter und ein Bruder des Clan-Oberhaupts mussten in Krankenhäusern wieder zusammengeflickt werden. Damals hatte Hehlau den leitenden Duisburger Staatsanwalt angerufen und ihm gesteckt, dass die Polizei eine seiner Mitarbeiterinnen in Gewahrsam habe. Und im Namen seiner Dienststelle um ihre Freilassung gebeten.
»Mein lieber Herr Gesangsverein«, hatte der schwer empört gequakt. »Sie wissen, dass Sie wilde Tiere als Mitarbeiter beschäftigen? Soll ich Ihnen mal die Krankenakten der beiden Opfer zuschicken? Mein lieber Herr Gesangsverein …!«
Als sich die Zellentür öffnete, stand Me’Shell unmittelbar vor ihm. Ihr rechtes Auge blutunterlaufen, Würgemale am Hals, deren Farbe bereits von blau zu gelb wechselte.
»Hehlau«, sagte er. Sie nickte stumm, bückte sich, um eine schon gepackte Tasche aufzuheben, und folgte ihm hinaus. Als sich die schwere Tür der Strafanstalt zu einer schmutzigen Seitenstraße öffnete, ging Hehlau nach rechts zum Parkplatz, und Me’Shell wandte sich wortlos nach links, wohin auch immer.
»Ach, übrigens …« Er schreckte aus seinen Gedanken auf, als sie nun weitersprach. »Hab mir mal diese Kneipe angeschaut. Gemeinsam mit der Zielperson.«
Verfluchte Scheiße, die ist doch völlig irre! Hehlau knallte seine Tasse auf den Tisch, dass es schepperte. Einige der Gäste um ihn herum warfen ihm erschrockene und verwunderte Blicke zu. Verhalte dich unauffällig, hörte er Scherflein predigen, vor allem in gastronomischen Betrieben! Schnell täuschte er hustend vor, sich verschluckt zu haben, und bat mit zerknirschter Miene stumm um Entschuldigung.
»Ja, ja, ich weiß, was du jetzt denkst, Hehlau.« Me’Shells Stimme in den Kopfhörern wurde leiser. »Da ist ein neuer Wirt drin. Der Braune Pitter sitzt seit drei Monaten mit seinem faltigen Arsch im Fegefeuer. Hoffe ich jedenfalls. Da gibt es nix mehr zu observieren.« Es folgte erneut eine lange Pause. Hehlau wollte schon ausschalten, aber Me’Shell hatte noch etwas zu sagen. »Ey, Hehlau … Die Sache ist nix für mich. Dafür bin ich doch klar überqualifiziert. Mit Spinnern, die anonyme Drohbriefe schreiben und Brunnen vergiften wollen, wirst du ja wohl spielend selbst fertig.«
Was glaubst du eigentlich, wer du bist? ›Überqualifiziert‹, du Miststück? Du bist dir zu schade für meine Aufträge? Seine Hand krampfte sich um die Kaffeetasse.
»Aber wenn ich schon mal hier bin …« Ihre Stimme wurde lauter, und er zuckte zusammen. »In der Stadt ist massenhaft Koks unterwegs, wirklich jeder hat die Taschen voll. Gutes Zeugs, kaum gestreckt und zu fairen Preisen.« Sie nieste, Hehlau stöhnte auf und hielt sich eine Hand vor die Augen. »›Wenn du was brauchst, frag doch Schuggermän‹, sagen die Leute.« Me’Shell lachte leise auf. »Süßer Name. Wie wär’s – ich serviere euch den Typen auf ’nem Silbertablett und bekomme ein gesalzenes Honorar?« Hehlaus Mundwinkel zuckten nach unten. »Eure angebliche Zielperson, diesen Musiker, hab ich schlafen geschickt«, fuhr sie fort. »Der Typ wurde mir zu anhänglich. Außerdem hat er mir eine Geschichte von einem Boxkampf mit einem Känguru erzählt. Was für ein Spinner.«
Hehlau kippte den Rest Kaffee in sich hinein und dachte an die krankenhausreif geprügelten Albaner. Tierlieb bist du also auch.
»Folgender Vorschlag: Neue Perücke, neues Make-up, neue Klamotten, neue Wohnung«, schloss Me’Shell. »Und du sagst durch, ob du Interesse an Schuggermän hast.«
Wieder eine Pause. Wieder ein Kichern. Dann ein Klicken. Und, in doppelter Lautstärke, Dillinger: »I got cocaine runnin’ around my brain …« Hehlau fluchte erst und wischte den Volume-Regler nach unten, dann wurde er wehmütig. Zu der Nummer hatte er mal mit Hilde getanzt, Ende der Achtziger, in irgendeinem Club auf der Luxemburger – Luxor? Er sah sie vor sich, jung und schön und in ihrem schweißnassen T-Shirt so begehrenswert, dass es schmerzte. Und später hatten sie es auf einer Bank im nächtlichen Volksgarten getrieben. Damals hatte sie noch Spaß daran gehabt, mehr sogar: oft nicht genug davon kriegen können. Wann hatte das aufgehört? Und warum …?
Stille. Die Aufnahme war zu Ende. Hehlau löschte sie und warf einen Blick auf seine Armbanduhr. Zeit, Hilde am Golfclub abzuholen. Wieder keine Aussicht auf ehelichen Sex – sie würde, wie üblich, nach ein paar Alibi-Abschlägen mit ihren Golfmädels an der Bar im Clubhaus gelandet sein und nach zwei Stunden Klatsch und Tratsch mindestens drei, vier Aperol Spritz oder Mojitos intus haben. Zuhause würde sie sich als Erstes einen kräftigen Wodka-Apfelsaft mixen und dann den Rest des Abends auf der Couch herumgammeln und hinaus in den Garten starren, mit einer ungelesenen Zeitschrift auf dem Schoß, Cosmopolitan oder Landlust oder neuerdings Happinez, während im Hintergrund Till Brönner eine Samtdecke aus pomadigen Balladen über das schicke Ambiente legte.
Hehlau seufzte frustriert, drückte die Aufnahmetaste der App und murmelte: »Okay, bis übermorgen. Ja, ich bin interessiert«, speicherte die Aufnahme ab, ging zurück zur Bahnhofshalle und deponierte das Handy wieder im Schließfach. Unterwegs hatte er erneut Scherfleins schnarrende Stimme im Ohr. Immer unauffällig bleiben, ist unsere Devise. Wer zu viel Trinkgeld gibt, ist genauso ein Idiot wie einer, der keins gibt. Natürlich merken sich Bedienungen solche Auffälligkeiten …!
Aber wie viel Trinkgeld war unauffällig, wenn eine Scheiß-Tasse Kaffee drei-vierzig kostete? Klar, aufrunden auf drei-fünfzig gälte sicher als knauserig, großzügig vier Euro zu geben ging Hehlau jedoch gegen den Strich. Ließe er sich auf drei-siebzig rausgeben, würde man ihn bestimmt als Pfennigfuchser in Erinnerung behalten. Er seufzte. Immerhin hatte die Kellnerin vorhin keine Miene verzogen, als er ihr drei-achtzig auf das Tischchen gezählt hatte, und ihre Blicke schon wieder über die Nachbartische schweifen lassen.
Ja, auch du schweifst ab! Die Sache mit dem Brief wird langsam unangenehm! Hehlau war durchaus in der Lage, Probleme auszusitzen, das lernte man in all den Jahren Arschplattsitzen. Doch es war abzusehen, dass schon bald Fragen auftauchen würden. Fragen, die zu beantworten kitzlig werden könnte. Vor vier Wochen hätte er seine Rolex darauf verwettet, dass er wusste, welche Trottel dahintersteckten. Doch nun schien die Spur ins Nichts zu führen.
Er würde darüber nachdenken müssen, beschloss Hehlau. Morgen.
4
Mittwoch, 20. März
FOLKER
»Mama, der Folker ist tot!«
Kai, der neunjährige Sohn seiner Mitbewohnerin Jutta, stand neben dem Bett und spritzte mit einer Wasserpistole vergnügt Folkers rechtes Ohr voll.
»Er bewegt sich gar nicht«, jubilierte das schrille Organ des kleinen Saftsacks in Richtung Küche, in der klappernde Pfannen und Töpfe verrieten, dass seine Mutter das Mittagessen zubereitete. Folkers matten Versuch, ihn aus dem Bett heraus zu packen, konterte Kai mit einem Wasserstrahl in die Nasenlöcher seines Opfers.
»Sitzen Fliegen auf seinem Gesicht?« rief sie herüber. »Riecht er heute besonders schlimm?«
»Nein, er stinkt wie immer!« Das Kreischen des Mini-Ungeheuers bohrte sich in Folkers Gehirn wie glühender Draht.
»Na, solange keine Maden aus seinen Augen kriechen, wird er schon wieder«, rief Jutta. »Komm essen!« Kai, gerade im Begriff, Folkers Bettdecke wegzuziehen, um weitere empfindliche Körperteile seines Lieblingsfeindes einem Kaltwassertest zu unterziehen, überlegte es sich anders und rannte stampfend in Richtung Küche.
»Milchzähniges Mondgesicht!«, krächzte Folker in sein Kissen. »Mögen deine Hoden die Bauchhöhle nie verlassen!« Er drehte sich auf die Seite, damit das Wasser aus seinem Ohr hinauslaufen konnte, und langte zwischen seine Beine, um zu überprüfen, ob bei ihm selbst noch alles an Ort und Stelle war.
Drei Tage waren inzwischen vergangen, seitdem Me’Shell mit der Urgewalt einer Büffelstampede so ziemlich alles niedergetrampelt hatte, was ihm bis dahin als normal erschienen war. Leider war dabei auch sein unerschütterlicher Glaube daran, jede Frau ins Bett zu bekommen, wenn er nur wollte, unter die Hufe geraten.
Na gut – jede außer Jutta. Aber das war ein anderes Thema. Ein zu schwieriges für seinen derzeitigen Zustand.