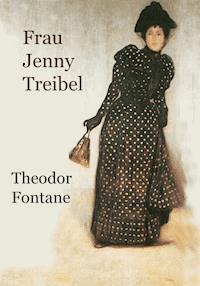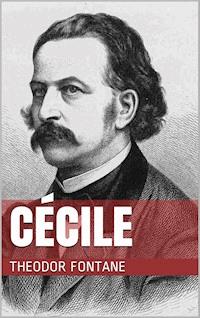Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Vergangenheitsverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Jenny Treibel, geborene Bürstenbinder, liebt die großen Auftritte und schwärmt für Poesie, was nicht minder aufgeblasen wirkt als ihr Luftkissen, auf welchem sie am Tische thront. Von einer Krämerstochter zur Kommerzienratsgattin aufgestiegen, möchte sie ihren Sohn Leopold verheiraten, ist jedoch empört, als die unbegüterte Corinna Schmidt ihn um den Finger wickelt und, wie sie selbst, nach höherem Rang strebt. Auch sie will Karriere machen. Doch mit einer derart dominanten Schwiegermutter hat die Schmidtsche Gymnasiallehrerstochter nicht gerechnet. Mit viel Witz und Ironie sowie Freude am atmosphärischen Detail entführt Theodor Fontane in das Berlin des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Es ist eine spannende Zeit, auch für Fontane selbst, der mit Frau Jenny Treibel einen großen Erfolg als Autor feierte. Komische Dialoge und mitreißende Schauplätze dominieren die Geschichte ebenso wie die starke Rolle der Frauen. Während die Männer an ihrer Seite sich eher eines dekorativen Charakters bedienen, brillieren die bourgeois gewordene Jenny Treibel und die Mittelstand gebliebene Corinna als Protagonisten des Berliner Frauenromans schlechthin. 100% Sachbuchklassiker: vollständig, kommentiert, relevant.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 342
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Theodor Fontane
Frau Jenny Treibel
Impressum
ISBN 978-3-86408-086-9 (epub) // ISBN 978-3-86408-087-6 (pdf)
Digitalisat basiert auf der auf der Erstausgabe basierenden Ausgabe von 1951 aus der Bibliothek des Vergangenheitsverlags; bibliografische Angaben:
Fontane, Theodor, Frau Jenny Treibel, Berlin 1951
Bearbeitung: Mireya Hütsch, Akmaral Gaparova, Lisa Schulze, Ranka Zgonjanin
Einleitendes Essay von Lisa Schulze / Akmaral Gaparova
Die Marke „100% - vollständig, kommentiert, relevant“ steht für den hohen Anspruch, mehrfach kontrollierte Digitalisate klassischer Literatur anzubieten, die – anders als auf den Gegenleseportalen unterschiedlicher Digitalisierungsprojekte – exakt der Vorlage entsprechen. Antrieb für unser Digitalisierungsprojekt war die Erfahrung, dass die im Internet verfügbaren Klassiker meist unvollständig und sehr fehlerhaft sind.
E-Book-Formate von readbox publishing, Dortmund www.readbox.net
© Vergangenheitsverlag, 2012 – www.vergangenheitsverlag.de
Inhaltsverzeichnis
Einleitendes Essay: Ein historischer Abriss über Fontanes Leben und seine Zeit im Hinblick auf den Berliner Zeitroman „Frau Jenny Treibel“
Theodor Fontane, Frau Jenny Treibel
Vorwort
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
Einleitendes Essay: Ein historischer Abriss über Fontanes Leben und seine Zeit im Hinblick auf den Berliner Zeitroman „Frau Jenny Treibel“
1888. Deutschland durchlebte ein Jahr mit drei Kaisern und Theodor Fontane begann einen seiner erfolgreichsten Romane zu schreiben. Er kreierte seine Jenny Treibel, die als typische Bourgeoise genug Stoff für einen Berliner Zeitroman lieferte und ein treffendes Portrait nicht nur seiner Zeit, sondern insbesondere auch der Berliner Verhältnisse ist. Berlin erblühte als kulturelle und wirtschaftliche Hauptstadt. Preußen war so stark wie nie zuvor. Nach dem siegreichen deutsch-französischen Krieg folgte die Gründung des Deutschen Reiches. Frankreichs Kriegsentschädigungen begünstigten das durch die Industrialisierung angekurbelte Wirtschaftswachstum. Firmen wurden gegründet. Die finanzielle Situation der Fabrikanten und Industriellen verbesserte sich ungemein. Eine neue Schicht – das Bürgertum – entstand. Viele zog es in die Stadt, hin zu den besten Industriestandorten. So hatte die Reichshauptstadt ein rasches Bevölkerungswachstum zu verzeichnen. Fortschritt wurde großgeschrieben. 1876 war das Rohrpostsystem betriebsbereit. Als das erste innerstädtische System dieser Art wurde es über 400 Kilometer lang werden und war damit eines der größten der Welt. Der Buchhandel blühte dank ausgereifter Drucktechniken. Auch Zeitschriften wurden beliebt. Sie verbanden Unterhaltung mit Informationen und wurden damit zu einem vielseitigen und weit verbreitetem Medium. Die Herausgeber konnten ihre Autoren gut bezahlen, weil das Bürgertum häufig Abonnements abschloss. Man definierte sich eben nicht nur über Vermögen, sondern auch über Bildung. Über letzteres versuchten sich die Bürger vom Adel abzugrenzen, vor allem das Bildungsbürgertum, das – trotzdem es bei Weitem kein so großes Einkommen wie das Besitzbürgertum hatte – gezwungen war, eine standesgemäß aufwändige Lebensweise zu führen. „Bildung“ wurde zu einer Tugend: „Nicht Geburt oder Herkunft [sind] die entscheidenden Faktoren für den Wert eines Menschen, sondern Tiefe des Gefühls, Versenkung ins Buch, Bildung der einzelnen Persönlichkeit.“1
Fontane war 1888 schon ein alter Mann. Geboren wurde er am 30. Dezember 1819 in Neuruppin, einer kleinen märkischen Stadt nordwestlich von Berlin. Er plante in die Fußstapfen seines Vaters zu treten und ging ab 1836 in die Apothekerlehre. Literarische Neigungen zeigten sich allerdings schon damals. Früh begann Fontane Gedichte, Novellen und Erzählungen zu schreiben. Seine Vorliebe für Balladen entdeckte er 1844, als er in der Berliner Autorenvereinigung Tunnel über der Spree u.a. Paul Heyse, Felix Dahn und Theodor Storm kennenlernte. 1849 gab er seinen Beruf als Apotheker auf, weil er wahrscheinlich schon in seinem Lehrherrn das ihm missfallende Bürgertum erkannte: „Diese Geheimbourgeois[...] sind die weitaus schrecklicheren, weil ihr Leben als einzige große Lüge verläuft. [...]jeder erscheint sich als ein Ausbund von Güte, während in Wahrheit ihr Tun durch ihren Vorteil bestimmt wird, was auch alle Welt einsieht, nur sie selber nicht. Sie[…] beweisen sich und andern in einem fort ihre Selbstsuchtslosigkeit“2.
Sein Interesse am Journalismus führte ihn nach England, wo er als Pressebeauftragter für zwei preußische Zeitungen arbeitete. Er schrieb mehrere Bücher über das englische Leben, darunter Ein Sommer in London (1854) und Jenseits des Tweed (1860). Fontane war fast 60 Jahre alt als 1878 sein Romandebüt Vor dem Sturm veröffentlicht wurde. Dieser sollte seinen großen literarischen Erfolg als Romanautor einleiten. Bewusst richtete sich der Dichterin den folgenden Romanen gegen die Vorliebe der deutschen Erzähler des 19. Jahrhunderts für abgelegene, provinzielle Handlungsorte. Nur die Schilderungen der Entwicklung in der Großstadt könne die Gesellschaft seiner Zeit ausreichend genug darstellen. So schloss er zur modernen europäischen Erzähltradition auf.3 Humoristische und ironische Elemente in seiner Klarheit und abgerundeten Schreibform, wie Fontane sie professionell beherrschte, sind typisch für den „poetischen Realismus“. Deutschland folgte damit erst verspätet den französischen und russischen Vorreitern, wie Honoré de Balzac (1799-1850), Gustave Flaubert (1821-1880), Fjodor M. Dostojewski (1821-1881) und Iwan Turgenjew (1818-1883). Inhaltlich sind auch Fontanes Romane fixiert auf zeitgenössische soziale Probleme, wie zum Beispiel die schwierige Rolle der Frau innerhalb des häuslichen Lebens. Sie ist ein zentrales Thema in L’Adultera (1882), Irrungen, Wirrungen (1888) und Effi Briest (1895). Letzterer ist wohl sein bekanntester Roman. Er gibt sich darin als guter Beobachter von Menschen und Auffassungen, der ein genaues Bild seiner Zeit zeichnet. Ausgeprägte inhaltliche Beziehungsgeflechte verleihen den Romanen Fontanes eine besondere Lebendigkeit. Seine Ausnahmestellung als Romancier formuliert Walther Paetow in der Freien Bühne für den Entwicklungskampf der Zeit (Nr. 4 / 1893) so: „Fontane ist der Zeit nach der erste gewesen, der sich im Berliner Roman im eigentlichen Sinne des Wortes versucht hat, und ist im Range nach der Erste geblieben, soviele Nachahmer sich mittlerweile auch um ihn gescharrt haben“4. Als außerordentlicher Stilist präsentiert sich Fontane ebenso in seinen Briefen. Er war einer der fleißigsten Briefeschreiber seiner Zeit. Nach seinem Tod am 20. September 1898 hinterließ er ein Briefwerk von über 5000 Druckseiten.
Auch in Frau Jenny Treibel spiegelt sich all sein dichterisches Können. Poetisch realistisch beschreibt er hier kritisch die Dünnhäutigkeit und leere Geschwätzigkeit der Gesellschaft des zeitgenössischen Preußens. Was aber lieferte so viel Grund zur Kritik? Mit dem Definieren über Besitz und Bildung schien es dem Bürgertum nicht genug. Das Bildungsverständnis wandelte sich zum Bildungswahn. Der Grad der Bildung maß sich plötzlich am Zitatenschatz und auswendig gelernten Gedichten, wobei die innere Auseinandersetzung derer vollkommen ungeachtet blieb.5 „Bildung [verhalf] also zu Besitz und Ansehen, und Besitz ermöglicht[e] Bildung. […]Geistiger ‚Reichtum‘ und materieller Reichtum [gingen] auf einmal Hand in Hand.“6 Für Fontane galt es, diese „Strategie bürgerlicher Gesinnung mit ihrem Widerspruch von Schein und Sein, von Anspruch und Wirklichkeit“7 zentral zu thematisieren. Letztendlich ließ er sich am 26. Februar 1884 von einem Theaterbesuch zu Frau Jenny Treibel inspirieren. Roderich Heller hieß das Stück, in welchem eine reiche Fabrikantenfrau ihrem Freund von einst – einem Dichter – nachschwärmt.8 Der damals 65 Jahre alte Theodor Fontane begann zu schreiben. „Zweck der Geschichte“ sei, so schrieb er am 9. Mai 1888 an seinen Sohn Theodor: „das Hohle, Phrasenhafte, Lügnerische, Hochmütige, Hartherzige des Bourgeoisesstandpunkts zu zeigen, der von Schiller spricht und Gerson [ein Berliner Modesalon] meint“9. Eine vorläufige Fassung des Werkes war bereits im Mai 1888 fertig und trug den Titel Frau Kommerzienrätin oder Wo sich Herz zum Herzen findt. Fontane griff erst 1891 das liegengelassene Werk wieder auf und überarbeitete es gründlich. Zwischen Januar und Juni des darauffolgenden Jahres erschien der Roman fortsetzungsweise in der Deutschen Rundschau. Noch heute dient diese Version als Grundlage für neuere Ausgaben, da das ursprüngliche Manuskript seit Ende des Zweiten Weltkrieges als verschollen gilt. Die erste Buchausgabe wurde mit eingedrucktem Erscheinungsjahr 1893 veröffentlicht.10
Die Hauptperson, Frau Jenny Treibel, stellt eine typische Vertreterin des Besitzbürgertums dar. Als Frau des Kommerzienrates und Fabrikbesitzers Treibel schwärmt sie allerdings immer noch in sentimentaler Weise für den Gymnasiallehrer Wilibald Schmidt und dessen Bildung. Dessen Tochter Corinna möchte Jennys Sohn Leopold heiraten und es kommt zu einigen Verwicklungen. Die dominante, prestigesüchtige Jenny wird dabei als „Musterstück von einer Bourgeoise“ gnadenlos vorgeführt und verhöhnt.11 Der Erzähler ironisiert das bürgerliche Selbstverständnis, indem er das Haus Treibel so eindeutig „Besitz“ repräsentieren lässt wie das Haus Schmidt „Bildung“ und deren Konflikt dann eine Ideologie Lügen straft, die noch das zusammendenkt, was in der Realität längst getrennt war.12 Durch den ganzen Roman zieht sich Ironie und Heiterkeit. Es sollte das humorvollste Werk Fontanes bleiben. Schon der Untertitel Wo sich Herz zum Herzen find‘t ist ironisch aufzufassen, da bei Jenny Treibel eindeutig nicht Herz zum Herzen gefunden und sie statt zu Rosen zum Gold gegriffen hat.13
Fontane verlieh seinen Figuren allerlei Züge real existierender Personen. Seine eigene Schwester Jenny Sommerfeldt – in seinen Augen eine typische Bourgeoise – verkehrte in Kreisen Berliner Großindustrieller14 und diente so als Vorlage für die Kommerzienrätin. Der Dichter selbst fand sich wohl in der Figur des Wilibald Schmidt wieder und auch dessen Tochter Corinna verlieh er Züge seiner eigenen Tochter Mete.15
1893, nicht einmal ein Jahr nach dem Erstdruck, erschien eine Neuauflage von Frau Jenny Treibel. Bis 1899 wurden drei weitere Auflagen verlangt und waren damit signifikant für den Erfolg des Buches. Nur Effi Briest toppte diese Zahlen noch. Die satirische Darstellung des modernen großstädtischen Besitzbürgertums wurde beinahe ausschließlich positiv kritisiert Vorwürfe, Fontanes Gesellschaftskritik, die humorvoll und humanistisch abgemildert sei, fehle es an Schärfe und Konsequenz, sind dabei zwar nicht zu unterschlagen16, aber die zahlreichen Bühnenbearbeitungen und Verfilmungen sprechen für sich. So ist es auch nicht verwunderlich, dass in der 17. Auflage des Brockhaus unter dem Stichwort „Bourgeoisie“ als einziges literarisches Beispiel dieser Roman aufgeführt wird.
Theodor Fontane, Frau Jenny Treibel
Vorwort
Der Künstler, der geistig schaffende Mensch freier Denkweise, wird mit dem Bourgeois17 verschiedener Schattierung keine Möglichkeit der Verständigung haben; ja, er wird in ihm einen Feind sehen müssen — und umgekehrt. Bei dem Verhältnis des Künstlers — im weitesten Sinne genommen — zum Kleinbürger18 liegen die Dinge einfach. Die Ablehnung der Arbeit und oft auch der menschlichen Persönlichkeit, der „Moral“ des Künstlers durch den Kleinbürger ist ehrlich; die Unvereinbarkeit der Denk- und Lebensweisen liegt klar zutage. Der Kleinbürger kann gar nicht anders, er muss die muffige Atmosphäre seines Daseinsbezirkes vor jedem frischen Luftzug bewahren. Er wird den Künstler gewähren lassen, er wird den Kopf schütteln über dessen ihm unfassbare Art des Denkens und Handelns und wird Türen und Fenster fest zusperren; gerade in dem Punkte des Sichabsperrens gegen alles Neue, Ungewohnte ist der Kleinbürger ja von großer Zähigkeit und Treue gegen sich selbst. Wird er angegriffen oder auch nur kritisiert, so versteht er entweder überhaupt nicht, dass er gemeint ist, oder aber er zieht sich auf das nicht zu erschütternde Bewusstsein seiner bürgerlichen Ehrbarkeit, seiner „Rechtschaffenheit“ in Denken und Handeln zurück; tückisch wird er erst, wenn das Neue, Fremde irgendwelche Ansprüche an seinen Geldbeutel stellt. — Komplizierter liegen die Dinge bei dem Verhältnis des Künstlers zum Großbürger. Denn dessen Mentalität ist eine zwiespältige. Einerseits wird er geneigt sein, auf die „Hungerleider“, die da Bücher schreiben, malen, in Stein meißeln, Komödie spielen oder sonst eine „brotlose“ Kunst treiben, mit der gleichen auf die Überlegenheit, die ein Bankkonto verleihe, gegründeten Verachtung herabzusehen, die er den von ihm Ausgebeuteten oder Übervorteilten entgegenbringt. Anderseits wird er sie irgendwie beneiden, weil er — im Gegensatz zum Kleinbürger, der seine Lebensform für die vollkommene hält — spürt, dass es doch Dinge gibt, die mit einem Bankkonto nicht zu erkaufen sind. Wird er daraufhin angesprochen, so wird er, je nach seiner spezifischen Bewusstseinshaltung, verschieden reagieren. Er wird entweder die Unterstellung, der von ihm betriebene Industrie- oder Geschäftszweig sei nicht das A und O seines Lebens, als absurd bezeichnen — die das tun, sind die relativ Aufrichtigen —, oder aber er wird sich in sentimentalem Bedauern ergehen, dass es ihm nicht beschieden gewesen sei, seiner wissenschaftlichen oder künstlerischen Neigung zu folgen, dass er dieses oder jenes habe fabrizieren oder verkaufen müssen. „Glauben Sie mir: ich beneide Sie, ich tauschte jeden Augenblick mit Ihnen — er kann das unbesorgt sagen, weil ein solcher Tausch außerhalb jeder Möglichkeit ist. Der also Angeredete wird höflich oder skeptisch lächeln und sich seinen Teil denken. Von diesem Lächeln aber, mag es auch noch so flüchtig sein, bleibt bei dem anderen ein unbehagliches Gefühl zurück. Denn der eigentliche Bourgeois weiß, wiederum im Gegensatz zum Kleinbürger, dass er durchschaut wird, dass sein geschäftliches und privates Gebaren die Geste sentimental-neidvollen Bedauerns allzu deutlich Lügen straft. Die Ablehnung des Künstlers, ja schon des Nicht-Kaufmannes, des Nicht-Unternehmers, des Beamten und Lehrers etwa, ist bei ihm eine bewusste. Wenn er dessen ungeachtet mit geistigen Menschen, Dichtern, Schriftstellern, Malern, Musikern, Schauspielern, Umgang sucht, so geschieht das, weil er seinemgünstigenfalls auf nüchternes „Verdienen“, oft jedoch auf fragwürdige geschäftliche Manipulationen gestellten Dasein dadurch ein Relief zu geben wünscht; zumal der Verkehr mit „Berühmtheiten“ schmeichelt dem Snob. Auch das so oft hervorgehobene „Mäzenatentum19“ reicher Leute gehört hierher. Auch hier ist das Motiv ein egoistisches. Als Förderer junger „Talente“ und „Begabungen“ gepriesen zu werden, verschafft der Eigenliebe des Bourgeois Genugtuung, und so investiert er sein Geld zur Abwechslung einmal in geistigen „Unternehmungen“. Wehe jedoch, wenn einer der mit seiner Gastfreundschaft oder gar mit Förderung in klingender Münze Beehrten sich erfrecht, in die private Sphäre des Besitzbürgers einzubrechen. Dann wirft der Bourgeois die Maske ab, dann ist der bislang Begönnerte plötzlich wieder ein vermessener Habenichts, der die von Herkommen und „Takt“ gezogenen Grenzen nicht respektiert, ja er wird der Undankbarkeit geziehen; die längst aufgestellte — denn der Bourgeois tut nichts umsonst — Rechnung wird präsentiert.
Die vorstehend skizzierte bourgeoise Mentalität, von der man nicht behaupten soll, dass sie heute der Vergangenheit angehöre, musste sich in Deutschland am stärksten auswirken in den 70er und 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts, als das liberale bürgerliche Unternehmertum, das durch die Gründung des Bismarck-Reiches einen gewaltigen Auftrieb erhalten hatte, wirtschaftlich, parlamentarisch und gesellschaftlich immer mehr Positionen eroberte. Es war die Zeit des Lebens und das Leben lassen unter entscheidender Akzentuierung des ersten Teiles dieses Mottos seitens derer, die darüber zu bestimmen hatten. Im Sozialistengesetz von 187820 bekam das deutsche Proletariat die harte Hand der mit den Junkern verbündeten nationalliberalen Gebieter der deutschen Wirtschaft zu fühlen; die von Außenseitern auf Wilhelm I. verübten Attentate boten den willkommenen Vorwand, die Forderungen der arbeitenden Klasse auf politische und wirtschaftliche Mitbestimmung — diese Forderungen waren für die Unternehmer in Wahrheit „gemeingefährlich“, nicht die Attentate, die dem Gesetz nur die Staffage liehen — abzudrosseln.
— Gesellschaftlich drängte dieses Unternehmertum die bis dahin, zumal in Preußen und Berlin, tonangebende Schicht zurück und spielte sich durch sein Geld in den Vordergrund. Wie Pilze aus der Erde schössen die „Kommerzienräte21“ empor und verpflanzten die Herrschaft, die sie in den Kontoren22 und Fabriken übten, auch in die ,,Salons“ der Hauptstadt; weitgehend wurde die Aristokratie der Geburt durch die des Geldsackes abgelöst. Geld, Geld und noch einmal Geld war die Losung. Die Zeit der Herrschaft der Gruppen, die Heinrich Mann in seinem „Schlaraffenland“ den „unheimlichen Clan der Geschäftsleute“ mit den „Raubtierinstinkten“ genannt hat, kündigte sich an, und als Folge davon jene Lage, die in dem gleichen Werk so umrissen ist: „Majestätsbeleidigungen und Gotteslästerungen kann sich bei dem Fortschritt heutzutage der Ärmste leisten, aber haben Sie schon mal jemand gekannt, der an Türkheimer geklingelt hat? Sehnsewoll! Das ist nämlich beträchtlich kitzliger.“
Man muss diese Verhältnisse überschauen, um die Schärfe voll verstehen zu können, mit der Theodor Fontane in seinem 1892 erschienenen Roman „Frau Jenny Treibel“ die Kritik an dieser Gesellschaft formulierte — die Schärfe wenigstens für seine auf Kompromiss und „Konzilianz“ gerichtete Art. Die Gesellschaftskritik bei Fontane wird ja vielfach überschätzt. Was als solche erscheint, ist häufig nur Ausdruck seines unbezähmbaren Hanges zu Spott und Ironie. Dabei war ihm ziemlich jedes Objekt recht, das er zum Ziel der freilich stets beschwingten, graziös gefiederten Pfeile seines Spottes machen konnte. Er verteilte die Geschosse, die er seinem schier unerschöpflichen Köcher entnahm, einigermaßen gleichmäßig. Van der Straaten, der Kommerzienrat in „L‘adultera“ wird von ihnen ebenso getroffen wie der altadlige Baron Duquede aus dem gleichen Roman, das gräflichfreiherrliche Freundespaar „Sarastro“ - „Papageno“ in „Stine“ ebenso wie die Witwe Pittelkow. Die Beispiele ließen sich mehren; im Wesentlichen hat Fontane der Neigung zu dieser karikierenden Art des Charakterisierens erst in den beiden letzten Romanen „Effi Briest“ und „Stechlin“ entsagt. Befremdend wird es nun für den, der Fontane nicht kennt, sein, dass oft auf eine Bemerkung dieser Art eine zweite unmittelbar folgt, die jene wieder aufhebt oder doch abschwächt; der mit der Wesenheit Fontanes nicht Vertraute weiß dann nicht recht, ob der Dichter die betreffende Gestalt ernst genommen wissen will oder sich über sie lustig macht. Es gibt eine für diese Figuren Fontanes ungemein aufschlussreiche Stelle aus einem frühen Brief. Als er im Herbst 1856 nach England reist, macht er in Paris Station und beantwortet dem Vater „die große Frage London oder Paris“ sehr zugunsten von London. Eben hat er jedoch sein für Paris wenig günstiges Urteil niedergeschrieben, da stutzt er und sagt: „Wie es mir immer geht, wenn ich ein Urteil ausgesprochen habe, so auch diesmal kaum steht es da, so fang‘ ich an, die Richtigkeit zu bezweifeln“; und nun folgt eine Nachschrift, die das erste Urteil entscheidend revidiert. Ähnlich ging es ihm wohl als in seinen Romanen. Hatte er eine seiner Gestalten gestreichelt, so hielt er einen satirischen Tatzenhieb für angebracht, und umgekehrt. Dieses Auf und Ab, das in seinem Werk zu verfolgen ist, ist wohl zu erklären an dem inneren Zwiespalt, in dem er sich je länger desto mehr befand, aus dem Widerstreit seiner innersten Sympathien und jenes unwiderstehlichen Hanges zu Ironie und Persiflage. Fontane war mit einem kaum zu übertreffenden Blick für die großen und kleinen Schwächen der Menschen begabt und seine Art ließ ihn diese Schwächen schärfer sehen als die Vorzüge. Aber der „preußische Konservative, der sich wohl selbst für einen Nationalliberalen hielt“, wie kürzlich gesagt worden ist, bejahte in seinem Herzen das, was er verspottete, und zwar nicht nur die Welt der brandenburgisch- preußischen Geschichte, sondern offenbar auch die der bürgerlichen Scheinblüte nach dem 70er Kriege23. In einem Reisebrief des Sommers 1880 zog er einen Vergleich zwischen Hamburg und Berlin und sagte: „Dabei sei bemerkt, dass ich mich doch mehr und mehr zum Preußen- und Berlinertum zu bekennen anfange. Freilich spät, aber besser spät als gar nicht. Das alte Berlin und das alte Preußen waren allerdings etwas Entsetzliches, und wo ihr Pferdefuß zum Vorschein kommt, find‘ ich es noch heute furchtbar. — Aber seit 1840, seit 1848 und namentlich seit 1870 ist alles anders geworden, und wir haben nun selbst die Gegenden in Deutschland weit überflügelt, die früher Vorbilder für uns sein konnten.“ Dresden war ihm ein „pauvres24, zurückgebliebenes Nest“ und Hamburg, auf dessen Menschen und Eigentümlichkeiten ja gerade auch in „Frau Jenny Treibel“ scharfe Seitenhiebe fallen, hatte vor der Reichshauptstadt nur seine „Gewaschenheit und Sauberkeit“ voraus. Sonst marschierten ihm Berlin und Berlinertum durchaus an der Spitze; auch er unterlag der Wirkung des äußerlichen Erfolges und Glanzes. Und was den Zeitpunkt seines Bekenntnisses zum Preußen- und Berlinertum angeht, so sieht es doch aus, als ob dieser weit früher liegt. Denn was sind die historischen Balladen preußischer Prägung, was auch die „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“, die in den 60er Jahren erschienen, anders als ein solches Bekenntnis? Und schon in den 50er Jahren war Fontane in manchem Streit mit dem allem, was Preußen und Berlin hieß, bitter abgeneigten Theodor Storm warm für jene eingetreten. Dass er beide immer wieder ironisierte, lag in seiner Art; er konnte nicht anders. —
Wenn Fontane nun in „Frau Jenny Treibel“ verhältnismäßig so scharfe Töne anschlug, so offenbar deshalb, weil der Künstler in ihm gegen das geldraffende bourgeoise Protzentum revoltierte, das zu beobachten er zwischen 1870 und 1890 so überreich Gelegenheit hatte, und — auch das kann in Anschlag gebracht werden; es ist ja durchaus menschlich — aus Groll darüber, dass man ihm doch nicht die Anerkennung zollte, auf die er Anspruch zu haben glaubte, materiell nicht und auch sonst nicht. In dem Brief aus dem Sommer 1880 findet sich auch eine bittere Bemerkung über die „Verehrer, die ja zeitlebens so viel für mich getan“, und Storm, der alte Freund und Widersacher in einem, der ihn nach langen Jahren 1884 wiedersah, fand ihn „sich etwas vereinsamend, wie ins Altenteil sich zurückziehend.“ Dass der märkische Adel seinem Dichter nur geringe Beachtung schenkte, verzieh Fontane ihm allenfalls; dass er aber auch für das Bürgertum nicht viel mehr war als ein gehobener „Literat“, dass es ihm trotz aller Arbeit auch materiell nicht sonderlich glänzend ging, verdross ihn und erzeugte mit der Zeit eine tiefe Verbitterung. Und diese fand offenbar in „Frau Jenny Treibel“ ihren Niederschlag; es ist wohl nicht zu viel gesagt, wenn man annimmt, dass sie Werden und Formung dieses mit seiner Gesellschaftskritik unter den Romanen Fontanes einen besonderen Platz einnehmenden Werkes nachhaltig beeinflusst hat.
Wer ist diese Jenny Treibel, née25 Bürstenbinder, Frau des Kommerzienrates Treibel, Berlinerblau und Blutlaugensalz in der Köpenicker Straße26, dieses „Musterstück von einer Bourgeoise“, diese „furchtbare Frau“? Sie gehört zu der üblen Spezies der Emporkömmlinge, die ihre bescheidene Vergangenheit durch verstärktes Pochen auf den Geldsack, durch doppelten Hochmut gegenüber allen Nichtbesitzenden wettzumachen suchen. Und sie, die berechnend und geizig und nur auf Äußerlichkeiten eingestellt ist, die „immer die Fäden in der Hand hat“, alles bestimmen will in Haus und Familie, die jede eigene Initiative bei dem Schwächling von Sohn lähmt — sie liebt es, das alles zu verbrämen mit einer peinlichen Sentimentalität, die sie in rührseligen Reminiszenzen und Liedchen, in platonischer Sehnsucht nach „einfachen Verhältnissen“ schwelgen lässt; bei jeder Gelegenheit verfügt sie über einen „Flimmer im Auge“, eine „Stehträne“. Sie entspricht dem Typ, von dem oben gesprochen wurde; es kommt ihr nicht darauf an, zu behaupten, dass sie als Gattin des Professors Willibald Schmidt wahrscheinlich glücklicher geworden wäre als an der Seite ihres Treibel, obwohl ihr klar sein muss, dass der, dem sie das sagt, eben jener Professor Schmidt, genau weiß, wie es in Wirklichkeit zugegangen ist, dass die jetzige Kommerzienrätin Treibel mit Villa und Equipage in dem Mädchen aus dem Apfelsinenladen von einst schon vorgebildet war. Und ihr „Herz für das Poetische“ wird denn auch in dem Augenblick zu dem „Kiesel, den die Geldleute hier links haben“, als die Tochter des Mannes, mit dem sie soeben noch in gefühlvollen Erinnerungen sich ergangen hat, durch die Verlobung mit dem Sohn in ihren Bezirk eindringen will. Da ist nichts mehr von Wohlwollen und „Poesie“; über Nacht ist die bisher begönnerte Corinna zu einer „Person“ geworden, ihr Benehmen ein „Skandal“, ist es „das alte Lied von Undank“. Und resolut macht sie sich ans Werk, der peinlichen Verwechslung von Theorie und Wirklichkeit ein Ende zu bereiten.––
Neben ihr erscheint der Mann, der „Berlinerblaufabrikant mit einem Ratstitel“, dem es nicht gelingen will, Generalkonsul oder „Geheimer“ Kommerzienrat zu werden, obwohl er zu den „geachtetsten Berliner Industriellen“ zählt, zunächst sympathischer, schon weil ihm die falsche Romantik abgeht. Aber auch der alte Treibel, der absolut an den „Ufern der wendischen Spree“ als Vertreter einer neuen Partei mit nebelhaften Zielen „Singer27 oder einen anderen von der Couleur28“, d. h. einen Sozialdemokraten, beiseiteschieben möchte, als „Bürger und Patriot“, und der sich dazu der Hilfe des Leutnants a. D.29 Vogelsang, eines obskuren Ehrenmannes, der in manchem als vorweggenommener Nazi erscheint, bedient, freilich ohne Erfolg — auch der joviale und auch äußerlich nüchterne alte Treibel kann nicht über seinen Schatten springen, bleibt, was er ist. „Und konnte es anders sein? Der gute Treibel, er war doch auch seinerseits das Produkt dreier im Fabrikbetrieb immer reicher gewordenen Generationen, und aller guten Geistes- und Herzensanlagen ungeachtet und trotz seines politischen Gastspiels auf der Bühne Teupitz-Zossen30 — der Bourgeois steckte ihm wie seiner sentimentalen Frau tief im Geblüt.“
Wie steht es nun mit den Gegenspielern des Paares? Corinna Schmidt, mit ihren 25 nach den Begriffen der Zeit schon nahe am „späten Mädchen“, aber klug und eine „aparte31“ Person, hat den „Hang nach Wohlleben, der jetzt alle Welt beherrscht“, sie kennt die kleinen Verhältnisse zu gut, um dafür zu schwärmen und sie hat ihr „bestimmtes Ziel“, nämlich aus diesen Verhältnissen herauszukommen — um dann freilich, nicht zuletzt unter dem Einfluss der braven, von Fontane prächtig gezeichneten Wirtschafterin und Schutzmannswitwe Schmolke, einzusehen, dass dieses Ziel durch eine erzwungene Ehe mit der „Suse“ Leopold Treibel nicht zu erreichen ist und, wenn auch mit einiger Resignation, den Vetter und Jugendkameraden, den Oberlehrer Marcell Wedderkopp, zu heiraten. Der eigentliche Gegenspieler Jenny Treibels aber ist der Vater Willibald Schmidt, Professor am Großen Kurfürsten-Gymnasium. Mit ihm hat schon das „halbwachsen Ding mit kastanienbraunen Locken“ seinen Mutwillen getrieben, um dem Lehramtskandidaten mit den bescheidenen Aussichten dann den ungleich mehr versprechenden Treibel vorzuziehen; mit ihm spielt die bald 60jährige nach vierzig Jahren noch das alte Spiel, bis es gilt, Farbe zu bekennen, bis aus dem Jonglieren mit Gefühlen in ihrem ureigensten Bezirk Wirklichkeit zu werden droht. Da ist ihre Demaskierung eine vollständige. Angesichts der brutalen Art und Weise aber wie die „alte Freundin“ diese Demaskierung vornimmt, wie sie die bourgeoise Devise „Gold ist Trumpf und weiter nichts“ gegen ihn und die Tochter kehrt, wie sie die Kluft zwischen den Treibelschen Millionen und einem Gymnasialprofessor aufreißt, bricht Schmidt in die Worte aus: „Corinna, wenn ich nicht Professor wäre, so würd ich am Ende Sozialdemokrat.“ Und die hinzukommende Schmolke, die nur das Letzte gehört hat, bestätigt: „Ja, das hat Schmolke auch immer gesagt.“ Dabei hatte der selige Schmolke im 1. Garderegiment in Potsdam gedient. Hier ist ohne Zweifel der Höhepunkt des Romans. Denn wie aufreizend mussten Herrschaft und Gebaren dieser Bourgeoisie erst auf die Arbeiter wirken, wenn sogar der loyale Schulmann und der altgediente Unteroffizier, beide doch „Säulen“ des preußischen Staates, zu einer solchen Erkenntnis kamen! Sie bleibt freilich theoretisch; Schmidt zieht die Konsequenzen nicht, kann sie nicht ziehen. Denn er ist und bleibt der Professor Schmidt, dessen Vater ein mit dem Roten Adler-Orden vierter Güte geschmückter Rechnungsrat war, und der selbst mit seinen altphilologischen Interessen dem wirklichen Leben viel zu fern steht, im alten Troja und Mykenä mehr zu Hause ist als in Berlin. Und so wenig er sonst mit Schmidt, dem Freund „großer Sätze“, gemeinsam bat — ähnlich war es wohl auch mit Fontane. Auch seiner Er- und Verbitterung über die „Treibelei“ aller Art, über die brutale bourgeoise Oberhebung, die er mit ansah und die auch ihm, mindestens gelegentlich, zu verstehen gab, dass er nur ein Habenichts war, ist in diesem Ausbruch Schmidts beschlossen. Auch er wäre wohl „am Ende“ Sozialdemokrat geworden — wenn, ja wenn er eben nicht Fontane gewesen wäre, der Fontane der Balladen und der „Wanderungen“, des Friedrich-, Seydlitz-, Louis Ferdinand- usw. Kultes, auch er in seiner Weise eine Säule, ein altgedienter Fahnenträger des alten Preußen, auch wenn er es dann und wann „entsetzlich“ fand — und wenn er weiter nicht jeder entschiedenen Stellungnahme so abhold, wenn er nicht so ausgesprochen „für Frieden und Kompromisse“ gewesen wäre, und sei es auf Kosten besserer, innerer Erkenntnis, ein so abgesagter Feind der peinlichen Menschen, die alles zur „Gesinnungssache“ machten, im Leben. Eben: wenn…
Ch. Coler
I.
An einem der letzten Maitage, das Wetter war schon sommerlich, bog ein zurückgeschlagener Landauer vom Spittelmarkt her in die Kur- und dann in die Adlerstraße32 ein und hielt gleich danach vor einem, trotz seiner Front von nur fünf Fenstern, ziemlich ansehnlichen, im Übrigen aber altmodischen Hause, dem ein neuer, gelbbrauner Ölfarbenanstrich wohl etwas mehr Sauberkeit, aber keine Spur von gesteigerter Schönheit gegeben hatte, beinahe das Gegenteil. Im Fond des Wagens saßen zwei Damen mit einem Bologneserhündchen, das sich der hell und warm scheinenden Sonne zu freuen schien. Die links sitzende Dame von etwa dreißig, augenscheinlich eine Erzieherin oder Gesellschafterin, öffnete von ihrem Platz aus zunächst den Wagenschlag und war dann der anderen, mit Geschmack und Sorglichkeit gekleideten und trotz ihrer hohen Fünfzig noch sehr gut aussehenden Dame beim Aussteigen behilflich. Gleich danach aber nahm die Gesellschafterin ihren Platz wieder ein, während die ältere Dame auf eine Vortreppe zuschritt und nach Passieren derselben in den Hausflur eintrat. Von diesem aus stieg sie, so schnell ihre Korpulenz es zuließ, eine Holzstiege mit abgelaufenen Stufen hinauf, unten von sehr wenig Licht, weiter oben aber von einer schweren Luft umgeben, die man füglich als eine Doppelluft bezeichnen konnte. Gerade der Stelle gegenüber, wo die Treppe mündete, befand sich eine Entreetür33 mit Guckloch, und neben diesem ein grünes, knitteriges Blechschild, darauf „Professor Willibald Schmidt“ ziemlich undeutlich zu lesen war. Die ein wenig asthmatische Dame fühlte zunächst das Bedürfnis, sich auszuruhen, und musterte bei der Gelegenheit den ihr übrigens von langer Zeit her bekannten Vorflur, der vier gelbgestrichene Wände mit etlichen Haken und Riegeln und dazwischen einen hölzernen Halbmond zum Bürsten und Ausklopfen der Röcke zeigte. Dazu wehte, der ganzen Atmosphäre auch hier den Charakter gebend, von einem nach hinten zu führenden Korridor her ein sonderbarer Küchengeruch heran, der, wenn nicht alles täuschte, nur auf Rührkartoffeln und Karbonade34 gedeutet werden konnte, beides mit Seifenwrasen untermischt. „Also kleine Wäsche,“ sagte die von dem allem wieder ganz eigentümlich berührte stattliche Dame still vor sich hin, während sie zugleich weit zurückliegender Tage gedachte, wo sie selbst hier, in eben dieser Adlerstraße gewohnt und in dem gerade gegenüber gelegenen Materialwarenladen ihres Vaters mit im Geschäft geholfen und auf einem über zwei Kaffeesäcke gelegten Brett kleine und große Tüten geklebt hatte, was ihr jedes Mal mit „zwei Pfennig fürs Hundert“ gutgetan worden war. „Eigentlich viel zu viel, Jenny“, pflegte dann der Alte zu sagen, „aber du sollst mit Geld umgehen lernen.“ Ach, waren das Zeiten gewesen! Mittags Schlag zwölf, wenn man zu Tisch ging, saß sie zwischen dem Kommis Herrn Mielke und dem Lehrling Louis, die beide, so verschieden sie sonst waren, dieselbe hochstehende Kammtolle und dieselben erfrorenen Hände hatten. Und Louis schielte bewundernd nach ihr hinüber, aber wurde jedes Mal verlegen, wenn er sich auf seinen Blicken ertappt sah. Denn er war zu niedrigen Standes, aus einem Obstkeller in der Spreegasse. Ja, das alles stand jetzt wieder vor ihrer Seele, während sie sich auf dem Flur umsah und endlich die Klingel neben der Tür zog. Der überall verbogene Draht raschelte denn auch, aber kein Anschlag ließ sich hören, und so fasste sie schließlich den Klingelgriff noch einmal und zog stärker. Jetzt klang auch ein Bimmelton von der Küche her bis auf den Flur herüber und ein paar Augenblicke später ließ sich erkennen, dass eine hinter dem Guckloch befindliche kleine Holzklappe beiseitegeschoben wurde. Sehr wahrscheinlich war es des Professors Wirtschafterin, die jetzt, von ihrem Beobachtungsposten aus, nach Freund oder Feind aussah, und als diese Beobachtung ergeben hatte, dass es „gut Freund“ sei, wurde der Türriegel ziemlich geräuschvoll zurückgeschoben, und eine ramassierte35 Frau von ausgangs vierzig, mit einem ansehnlichen Haubenbau auf ihrem vom Herdfeuer geröteten Gesicht, stand vor ihr.
„Ach, Frau Treibel...Frau Kommerzienrätin...Welche Ehre.“
„Guten Tag, liebe Frau Schmolke. Was macht der Professor? Und was macht Fräulein Corinna? Ist das Fräulein zu Hause?“
„Ja, Frau Kommerzienrätin. Eben wieder nach Hause gekommen aus der Philharmonie. Wie wird sie sich freuen.“
Und dabei trat Frau Schmolke zur Seite, um den Weg nach dem einfenstrigen, zwischen den zwei Vorderstuben gelegenen und mit einem schmalen Leinwandläufer belegten Entree freizugeben. Aber ehe die Kommerzienrätin noch eintreten konnte, kam ihr Fräulein Corinna schon entgegen und führte die „mütterliche Freundin“, wie sich die Rätin gern selber nannte, nach rechts hin in das eine Vorderzimmer.
Dies war ein hübscher, hoher Raum, die Jalousien herabgelassen, die Fenster nach innen auf, vor deren einem eine Blumenestrade mit Goldlack und Hyazinthen stand. Auf dem Sofatische präsentierte sich gleichzeitig eine Glasschale mit Apfelsinen, und die Porträts der Eltern des Professors, des Rechnungsrats Schmidt aus der Heroldskammer und seiner Frau, geb. Schwerin, sahen auf die Glasschale hernieder — der alte Rechnungsrat in Frack und rotem Adlerorden, die geborene Schwerin mit starken Backenknochen und Stupsnase, was, trotz einer ausgesprochenen Bürgerlichkeit, immer noch mehr auf die pommersch-uckermärkischen36 Träger des berühmten Namen, als auf die spätere, oder, wenn man will, auch viel frühere, posensche37 Linie hindeutete.
„Liebe Corinna, wie nett du dies alles zu machen verstehst und wie hübsch es doch bei euch ist, so kühl und so frisch — und die schönen Hyazinthen. Mit den Apfelsinen verträgt es sich
freilich nicht recht, aber das tut nichts, es sieht so gut aus...Und nun legst du mir in deiner Sorglichkeit auch noch das Sofakissen zurecht! Aber verzeih, ich sitze nicht gern auf dem Sofa; das ist immer so weich, und man sinkt dabei so tief ein. Ich setze mich lieber hier in den Lehnstuhl und sehe zu den alten, lieben Gesichtern hinauf. Ach, war das ein Mann; gerade wie dein Vater. Aber der alte Rechnungsrat war beinah noch verbindlicher, und einige sagten auch immer, er sei so gut wie von der Kolonie38. Was auch stimmte. Denn seine Großmutter, wie du freilich besser weißt als ich, war ja eine Charpentier, Stralauer Straße39.“
Unter diesen Worten hatte die Kommerzienrätin in einem hoben Lehnstuhle Platz genommen und sah mit dem Lorgnon nach den heben Gesichtern“ hinauf, deren sie sich ebenso huldvoll erinnert hatte, während Corinna fragte, ob sie nicht etwas Mosel und Selterwasser bringen dürfe, es sei so heiß.
„Nein, Corinna, ich komme eben vom Lunch, und Selterwasser steigt mir immer so zu Kopf. Sonderbar, ich kann Sherry vertragen und auch Port, wenn er lange gelagert hat, aber Mosel und Selterwasser, das benimmt mich...Ja, sieh Kind, dies Zimmer hier, das kenne ich nun schon vierzig Jahre und darüber, noch aus Zeiten her, wo ich ein halbwachsen Ding war, mit kastanienbraunen Locken, die meine Mutter, so viel sie sonst zu tun hatte, doch immer mit rührender Sorgfalt wickelte. Denn damals, meine liebe Corinna, war das Rotblonde noch nicht so Mode wie jetzt, aber kastanienbraun galt schön, besonders wenn es Locken waren, und die Leute sahen mich auch immer darauf an. Und dein Vater auch. Er war damals ein Student und dichtete. Du wirst es kaum glauben, wie reizend und wie rührend das alles war, denn die Kinder wollen es immer nicht wahr haben, dass die Eltern auch einmal jung waren und gut aussahen und ihre Talente hatten. Und ein paar Gedichte waren an mich gerichtet, die hab ich mir aufgehoben bis diesen Tag, und wenn mir schwer ums Herz ist, dann nehme ich das kleine Buch, das ursprünglich einen blauen Deckel hatte (jetzt aber hab ich es in grünen Maroquin binden lassen) und setze mich ans Fenster und sehe auf unsern Garten und weine mich still aus, ganz still, dass es niemand sieht am wenigsten Treibel oder die Kinder. Ach Jugend! Meine liebe Corinna, du weißt gar nicht, welch ein Schatz die Jugend ist, und wie die reinen Gefühle, die noch kein rauer Hauch getrübt hat, doch unser Bestes sind und bleiben.“
„Ja“, lachte Corinna, „die Jugend ist gut. Aber ‚Kommerzienrätin‘ ist auch gut und eigentlich noch besser. Ich bin für einen Landauer und einen Garten um die Villa herum. Und wenn Ostern ist und die Gäste kommen, natürlich recht viele, so werden Ostereier in dem Garten versteckt, und jedes Ei ist eine Attrappe voll Konfitüren von Hövell oder Kranzler, oder auch ein kleines Neçessaire40 ist drin. Und wenn dann all die Gäste die Eier gefunden haben, dann nimmt jeder Herr seine Dame, und man geht zu Tisch. Ich bin durchaus für Jugend, aber für Jugend mit Wohlleben und hübschen Gesellschaften.“
„Das höre ich gern, Corinna, wenigstens gerade jetzt; denn ich bin hier, um dich einzuladen, und zwar auf morgen schon; es hat sich so rasch gemacht. Ein junger Mr. Nelson ist nämlich bei Otto Treibels angekommen (das heißt aber, er wohnt nicht bei ihnen), ein Sohn von Nelson & Co. aus Liverpool, mit denen mein Sohn Otto seine Hauptgeschäftsverbindung hat. Und Helene kennt ihn auch. Das ist so hamburgisch, die kennen alle Engländer, und wenn sie sie nicht kennen, so tun sie wenigstens so. Mir unbegreiflich. Also Mr. Nelson, der übermorgen schon wieder abreist, um den handelt es sich; ein lieber Geschäftsfreund, den Ottos durchaus einladen mussten. Das verbot sich aber leider, weil Helene mal wieder Plätttag41 hat, was nach ihrer Meinung allem anderen vorgeht, sogar im Geschäft. Da haben wir‘s denn übernommen, offen gestanden nicht allzu gern, aber doch auch nicht geradezu ungern. Otto war nämlich, während seiner englischen Reise, wochenlang in dem Nelsonschen Hause zu Gast. Du siehst daraus, wie‘s steht und wie sehr mir an deinem Kommen liegen muss; du sprichst Englisch und hast alles gelesen und hast vorigen Winter auch Mr. Booth als Hamlet gesehen. Ich weiß noch recht gut, wie du davon schwärmtest. Und englische Politik und Geschichte wirst du natürlich auch wissen, dafür bist du ja deines Vaters Tochter.“
„Nicht viel weiß ich davon, nur ein bisschen. Ein bisschen lernt man ja.“
„Ja, jetzt, liebe Corinna. Du hast es gut gehabt, und alle haben es jetzt gut. Aber zu meiner Zeit, da war es anders, und wenn mir nicht der Himmel, dem ich dafür danke, das Herz für das Poetische gegeben hätte, was, wenn es mal in einem lebt, nicht wieder auszurotten ist, so hätte ich nichts gelernt und wüsste nichts. Aber Gott sei Dank, ich habe mich an Gedichten herangebildet und wenn man viele davon auswendig weiß, so weiß man doch manches. Und dass es so ist, sieh, das verdanke ich nächst Gott, der es in meine Seele pflanzte, deinem Vater. Der hat das Blümlein großgezogen, das sonst drüben in dem Ladengeschäft unter all den prosaischen Menschen — und du glaubst gar nicht, wie prosaische Menschen es gibt — verkümmert wäre...Wie geht es denn mit deinem Vater? Es muss ein Vierteljahr sein oder länger, dass ich ihn nicht gesehen habe, den 14. Februar, an Ottos Geburtstag. Aber er ging so früh, weil so viel gesungen wurde.“
„Ja, das liebt er nicht. Wenigstens dann nicht, wenn er damit überrascht wird. Es ist eine Schwäche von ihm, und manche nennen es eine Unart.“
„O, nicht doch, Corinna, das darfst du nicht sagen. Dein Vater ist bloß ein origineller Mann. Ich bin unglücklich, dass man seiner so selten habhaft werden kann. Ich hält ihn auch zu morgen gerne mit eingeladen, aber ich bezweifle, dass Mr. Nelson ihn interessiert, und von den anderen ist nun schon gar nicht zu sprechen; unser Freund Krola wird morgen wohl wieder singen und Assessor Goldammer seine Polizeigeschichten erzählen und sein Kunststück mit dem Hut und den zwei Talern machen.“
„O, da freu ich mich. Aber freilich, Papa tut sich nicht gerne Zwang an, und seine Bequemlichkeit und seine Pfeife sind ihm lieber als ein junger Engländer, der vielleicht dreimal um die Welt gefahren ist. Papa ist gut, aber einseitig und eigensinnig.“
„Das kann ich nicht zugeben, Corinna. Dein Papa ist ein Juwel, das weiß ich am besten.“
„Er unterschätzt alles Äußerliche, Besitz und Geld, und überhaupt alles, was schmückt und schön macht.“
„Nein, Corinna, sage das nicht. Er sieht das Leben von der richtigen Seite an; er weiß, dass Geld eine Last ist, und dass das Glück ganz wo anders liegt.“ Sie schwieg bei diesen Worten und seufzte nur leise. Dann aber fuhr sie fort: „Ach, meine liebe Corinna, glaube mir, kleine Verhältnisse, das ist das, was allein glücklich macht.“
Corinna lächelte. „Das sagen alle die, die drüber stehen und die kleinen Verhältnisse nicht kennen.“
„Ich kenne sie, Corinna.“
Ja, von früher her. Aber das liegt nun zurück und ist vergessen oder wohl gar verklärt. Eigentlich liegt es doch so: alles möchte reich sein, und ich verdenke es keinem. Papa freilich, der schwört noch auf die Geschichte von dem Kamel und dem Nadelöhr. Aber die junge Welt...“
„...Ist leider anders. Nur zu wahr. Aber so gewiss das ist, so ist es doch nicht so schlimm damit, wie du dir’s denkst. Es wäre auch zu traurig, wenn der Sinn für das Ideale verlorenginge, vor allem in der Jugend. Und in der Jugend lebt er auch noch. Da ist zum Beispiel dein Vetter Marcell, den du beiläufig morgen auch treffen wirst (er hat schon zugesagt), und an dem ich wirklich nichts weiter zu tadeln wüsste, als dass er Wedderkopp heißt. Wie kann ein so feiner Mann einen so störrischen Namen führen! Aber wie dem auch sein möge, wenn ich ihn bei Ottos treffe, so spreche ich immer so gern mit ihm. Und warum? Bloß weil er die Richtung hat, die man haben soll. Selbst unser guter Krola sagte mir erst neulich, Marcell sei eine von Grund aus ethische Natur, was er noch höher stelle als das Moralische; worin ich ihm, nach einigen Aufklärungen von seiner Seite, beistimmen musste. Nein, Corinna, gib den Sinn, der sich nach oben richtet, nicht auf, jenen Sinn, der von dorther allein das Heil erwartet. Ich habe nur meine beiden Söhne, Geschäftsleute, die den Weg ihres Vaters gehen, und ich muss es geschehen lassen; aber wenn mich Gott durch eine Tochter gesegnet hätte, die wäre mein gewesen auch im Geist, und wenn sich ihr Herz einem armen, aber edlen Manne, sagen wir einem Manne wie Marcell Wedderkopp, zugeneigt hätte...“
„...So wäre das ein Paar geworden“, lachte Corinna. „Der arme Marcell! Da hätte er nun sein Glück machen können, und muss gerade die Tochter fehlen.“
Die Kommerzienrätin nickte.