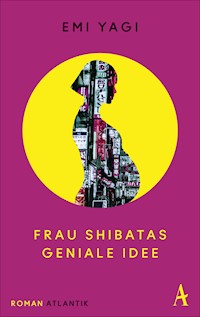
10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Atlantik
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Frau Shibatas geniale Idee ist eine kluge, moderne und feministische Antwort auf tief verankerte patriarchalische Strukturen in der japanischen Gesellschaft – und zugleich ein fulminantes Lesevergnügen! Frau Shibata ist vierunddreißig und arbeitet als Angestellte in einer Firma in Tokyo, in der Männer das Sagen haben. Ständig wird sie herumgeschubst, schlecht behandelt und soll Kaffee kochen. Doch dann hat sie eine geniale Idee: Sie behauptet, schwanger zu sein – und plötzlich wird sie rücksichtsvoll behandelt. Doch wie weit lässt sich dieses Spiel treiben? Frau Shibata geht aufs Ganze, stopft sich die Kleidung aus und 'erlebt' die gesamte Schwangerschaft. Bis schließlich unausweichlich der Moment der Wahrheit naht – und die sieht anders aus, als gedacht .
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 196
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Emi Yagi
Frau Shibatas geniale Idee
Roman
Aus dem Japanischen von Luise Steggewentz
Atlantik
Fünfte Woche
Es war kaum zu glauben, wie frisch und saftig das Gemüse am Nachmittag aussah, ganz anders als zu meiner gewohnten Einkaufszeit spät am Abend. An den Blattspitzen des Mizuna-Salats schienen fast noch Tautropfen zu hängen, so sehr strotzten sie vor feuchter Frische. Auch die Kunden wirkten nicht wie sonst. Gelassen suchten sie Lebensmittel für ihr Abendessen aus, das sie später zubereiten und in aller Ruhe verspeisen würden.
War das wirklich derselbe Supermarkt? Es gab kein angetrocknetes Sashimi, kein Hühnerfleisch, das in roter Flüssigkeit schwamm, weil es zu lange in seiner Packung gelegen hatte, keine feindseligen Blicke anderer Kunden, die stumm um reduzierte Fertiggerichte kämpften. Nein, hier wurde das perfekte Shoppingerlebnis inszeniert. Die helle Beleuchtung ließ den Fußboden weiß erstrahlen, und die Hintergrundmusik – eine unaufdringliche Melodie, in der wiederholt der Name des Supermarkts vorkam – vermischte sich harmonisch mit den Geräuschen der Einkaufenden. Ich stellte mich in einer kurzen Schlange hinter einem gebeugten Mann an, der mir kaum bis zu den Schultern reichte. In dem Einkaufskorb, der an seinem schlaffen Arm hing, sah ich ganz oben eine Vorteilspackung Schweinefleisch aus Kagoshima, das für einen Shabu Shabu-Eintopf gedacht war.
Als ich mit meiner gut gefüllten Einkaufstasche zu Hause ankam und die metallene Eingangstür aufschloss, war es draußen noch hell. Durch den abrupten Übergang zum Halbdunkel meiner Wohnung wurde mir schwindelig. Ich streifte die Pumps ab und ließ mich auf den Fußboden sinken. Für eine Weile lag ich einfach nur da und überlegte, was für ein Luxus es doch war, inmitten der nicht enden wollenden Spätsommerhitze die vertraute Kühle der Dielen genießen zu können. Wie gut es sich anfühlte, den Kopf zu heben und zu sehen, dass noch Nachmittagssonne in die Wohnung fiel.
Schwangerschaft. Purer Luxus, pure Einsamkeit.
Meine Schwangerschaft hatte plötzlich vor vier Tagen begonnen.
»Die Kaffeetassen stehen ja immer noch da«, hatte der Abteilungsleiter angemerkt, als er zur Schreibtischinsel in unserem Großraumbüro zurückgekehrt war. Der penetrante Zigarettengeruch, der ihn umgab, vermischte sich mit der sowieso schon stickigen Nachmittagsluft.
»Von wann sind die noch mal?«, fragte er, diesmal etwas lauter. »Ach ja, vom ersten Kundenbesuch heute Nachmittag.«
Statt die Stimme zu erheben und mehrmals auf die Uhr zu sehen, hätte er Tassen und Kanne auch selbst zur Spüle bringen können, aber auf die Idee kam er nicht.
Niemand sah auf. Niemand fühlte sich angesprochen. Ich tat es meinen Kollegen gleich und fixierte einen Punkt auf meinem Computerbildschirm. Die weiße Fläche teilte sich unter meinem starren Blick zu einem Muster auf. Ich bin beschäftigt, sagte ich mir. Ja, ich hatte wirklich genug zu tun. Der Liefertermin stand kurz bevor und ich musste noch den Halbjahresbericht fertigstellen. Ich hatte genauso wenig Zeit wie alle anderen in diesem Büro.
Ein Schatten legte sich über meine Exceltabelle.
»Die Kaffeetassen.«
Jemand schien etwas mit den Kaffeetassen besprechen zu wollen. Wie seltsam. Ich presste meine Lippen fest aufeinander, um den trockenen Atem der Person hinter mir nicht selbst einatmen zu müssen, und hämmerte mehrmals auf die Leertaste.
»Frau Shibata.«
Es war der Abteilungsleiter. Ich konnte den Zigarettengestank beinahe als Rauchwolke vor mir sehen.
»Frau Shibata, die Tassen stehen immer noch im Besprechungsraum. Die müssten mal weggeräumt werden.«
»Ja … Okay.«
Ich stand langsam auf, ließ mir absichtlich Zeit. Der Abteilungsleiter war bereits zurück an seinem Platz am anderen Ende der Schreibtischinsel und brachte sein orthopädisches Sitzkissen in Position, seine neueste Errungenschaft aus dem Internet, wie er uns hatte wissen lassen.
Keiner meiner Kollegen hob den Blick. Wieso sollten sie auch, Aufräumen ging sie ja nichts an. Es war ihnen bestimmt noch nie in den Sinn gekommen, dass es solche Arbeiten überhaupt gab. Also machte ich mich auf den Weg zum Besprechungsraum im selben Stockwerk und richtete nebenbei noch einen Papierkorb auf, der umgekippt auf dem Gang lag.
Der sogenannte Besprechungsraum war eine mit Wandschirmen abgetrennte Zimmerecke, in der ein paar Tische und Stühle standen. An den Wandschirmen hafteten Tesafilmreste. Ich wusste nicht, was sie dort zu suchen hatten, aber sie waren überall, und einige klebten noch, wenn man sie berührte. Im unteren Stockwerk gab es einen richtigen Sitzungsraum, doch der war dem Management vorbehalten, für uns also tabu.
Die ganze Sache hatte nur ein kleines Experiment sein sollen, das den Namen »Widerstand« gar nicht verdiente. Ich hatte mich gefragt, ob einer der Besprechungsteilnehmer die Tassen selbst in die Küche bringen würde. Vielleicht hätte ja einer von ihnen gedacht: »Endlich ist die Besprechung vorbei. Oh, da stehen noch die leeren Kaffeetassen! Den Kaffee hat uns freundlicherweise Frau Shibata gekocht und hergebracht, die Tassen wegzuräumen, ist das Mindeste, was wir tun können.«
Ich war neugierig, was passieren würde, wenn einmal keine Frau Shibata, die selbst gar nicht an der Sitzung teilgenommen hatte, den richtigen Moment abpassen würde, um das dreckige Geschirr abzuräumen und abzuwaschen.
Eigentlich hatte ich vor, es dabei zu belassen und alles wie immer selbst zu erledigen, wenn sich kein anderer darum bemühte. Und das hätte ich wohl auch getan, wenn in den Kaffeeresten keine Zigarettenstummel geschwommen hätten und der Gestank der abgestandenen Kippen um halb fünf nicht schon so unerträglich gewesen wäre.
»Verzeihung«, sagte ich, als der Abteilungsleiter mit einer Tasse und einem Teebeutel in der Hand an mir vorbeilief. Er wollte sich bestimmt einen Tee aus japanischem Engelwurz machen, von dem er in letzter Zeit immer schwärmte.
»Könnten Sie das Aufräumen heute für mich übernehmen?«
»Wie bitte?«
»Ich kann nicht.«
»Wie, Sie können nicht?«
»Ich bin schwanger. Vom Kaffeegeruch wird mir schlecht und von Zigarettenqualm auch. Schwangerschaftsübelkeit. Überhaupt ist das hier doch eigentlich ein Nichtraucher-Büro.«
Und so wurde ich schwanger.
Als mich die Personalabteilung nach dem voraussichtlichen Geburtstermin fragte, nannte ich ein willkürliches Datum Mitte Mai des nächsten Jahres. Nachträglich rechnete ich aus, dass ich mich in der fünften Schwangerschaftswoche befinden musste. Ein bisschen früh, um es dem Arbeitgeber mitzuteilen, aber was sollte man machen, jetzt hatte ich die Bombe platzen lassen.
In der Personalabteilung wurde mir gesagt, ich solle mich nicht überanstrengen und mit meinen Kollegen besprechen, wie viel ich während der Schwangerschaft arbeiten könnte. Ich ging zum Abteilungsleiter, der sich wiederum an den Sektionschef wandte, aber auch dieser wusste nicht, was zu tun war. Kein Wunder, denn in der Produktionskontrolle, meinem Arbeitsbereich, waren nur Männer beschäftigt. Bevor ich in dieser Firma, die Papierrollen herstellte, angefangen hatte, waren in der Abteilung offenbar noch zwei weibliche Halbtagskräfte angestellt gewesen, doch die eine hatte aufgehört, um ihre Eltern zu pflegen, und die andere hatte geheiratet und war Hausfrau geworden.
Ohne mir große Hoffnungen zu machen, fragte ich, ob ich vorerst pünktlich Schluss machen dürfe, zumindest bis ich die kritische Phase überwunden hätte. Ja natürlich, lautete überraschend die Antwort. Es war gut möglich, dass man sich hinter meinem Rücken über mich beschwerte, aber das war mir egal. Ich gab einen Teil meiner Arbeit ab und machte von nun an zwei, drei Stunden früher Schluss. Vermutlich lief das alles nur so reibungslos, weil meine Vorgesetzten keinerlei Erinnerungen an die Schwangerschaften ihrer eigenen Frauen hatten. Sowieso schien sie die Verkürzung meiner Arbeitszeit kaum zu interessieren, denn sie hatten ein viel dringenderes Problem: Kaffee.
Wer würde ab jetzt bei Kundenbesuchen den Kaffee kochen und servieren? Wer würde das Geschirr abräumen? Wen in der Firma musste man ansprechen, wenn die Milch ausgegangen war? Ich solle doch bitte mal in Word einen Leitfaden dazu erstellen. Die Männer diskutierten das Thema ohne mein Beisein aus und übertrugen die Aufgabe einem jungen Kollegen, der vorletztes Jahr frisch von der Universität zum Team gestoßen war.
»Das ist ja gar nicht so schwer!«, sagte er erstaunt, als ich ihm in der Teeküche vormachte, wie das mit dem Kaffeekochen ging. Er hatte mich um eine Einweisung gebeten.
»Stimmt«, antwortete ich. »Das hat Instantkaffee so an sich.«
Siebte Woche
Als ich vor zwei Wochen zum ersten Mal um diese Uhrzeit nach Hause gefahren war, dachte ich noch, all die Leute in der Bahn seien zu einer Veranstaltung unterwegs oder kämen von einem Kundinnenbesuch und seien auf dem Rückweg in ihre Firma. Als mir aufging, dass sie nach Hause fuhren, war ich wirklich verblüfft – so viele Menschen, die sich so früh auf dem Heimweg befanden und nicht einmal besonders froh darüber schienen. Kurz nach fünf Feierabend zu machen, war für sie offenbar normal.
Heute sah ich mir die Fahrgäste einmal genauer an. Ein Großteil war viel älter als ich, es gab aber auch eine Handvoll Frauen, die einige Jahre jünger waren. Die jungen Frauen blickten stumm auf ihre Handys und zupften ihre femininen Röcke zurecht. Sie waren besser geschminkt als meine Mitfahrerinnen am späten Abend. Bröckelndes Make-up schien ein Fremdwort für sie zu sein. Ihr Teint war frisch und ihre Wangen leuchteten blass rot, als hätten sie eben erst Rouge aufgetragen.
Dagegen waren die älteren Frauen überhaupt nicht geschminkt. Was sie kennzeichnete, war ihre Kleidung. Sie trugen fast ausnahmslos enganliegende »Langarmshirts«. Keine Hemden, Blusen oder Pullover, sondern etwas, das man nur »Langarmshirt« nennen konnte. Farblich war neben schwarz und weiß die gesamte Pastellpalette vertreten, von zartrosa über hellgelb bis hin zu fliederfarben. Weite Hosen und Sportschuhe rundeten das Outfit ab. Während ich in meine Betrachtungen versunken dastand, sah ich, wie eine Frau in pastellgrünem Langarmshirt eine Thermosflasche aus ihrer Tasche holte und unbekümmert kalten Tee trank. Es mussten Eiswürfel in der Flasche sein, denn beim Einschenken klirrte es leise.
Ich stieg aus der Bahn und ging in den Supermarkt, wo ich Fleisch und Gemüse für ein Gericht kaufte, das ich während der Heimfahrt im Internet herausgesucht hatte. Über ausverkaufte Zutaten musste ich mir nun ja keine Gedanken mehr machen. Ich konnte sogar Gemüse direkt vom Erzeuger und saisonalen Fisch ergattern. Als ich an der Kasse wartete, sah ich draußen eine Gruppe Jungen vor einem Takoyaki-Stand. Die einheitlichen Sporttaschen mit Schullogo, die sie über ihre Schultern geworfen hatten, verrieten, dass sie aufs Gymnasium gingen. Gierig verschlangen sie ihre Oktopus-Teigbällchen. Für mich sahen ihre gebräunten Gesichter alle gleich aus.
Schon wieder war es erst halb sieben, als ich zu Hause ankam. Ich trat auf den Balkon und hörte jemanden auf dem Klavier immer wieder dieselbe Passage spielen. Nachdem ich die Wäsche hereingeholt und die Wohnung gesaugt hatte, fing ich an zu kochen. Während Geflügel und Wurzelgemüse – die heutige Hauptspeise – in einer würzigen Fischbrühe vor sich hin köchelten, bereitete ich noch eine Misosuppe mit Aubergine und eine Beilage aus Spinat und Fischpastete zu.
Das Kochen war bereits zur Gewohnheit geworden. Ich hatte jetzt genug Zeit, um neue Rezepte auszuprobieren und auf eine ausgewogene Ernährung zu achten, wie es Schwangere so taten. Mein Hautbild hatte sich durch den neuen gesunden Lebensstil verbessert und ich hatte vom vielen Essen leicht zugenommen.
Gestern Mittag hatte mich der Kollege, der mir gegenübersaß, gefragt, wie es mittlerweile mit der Schwangerschaftsübelkeit aussähe.
»Nicht mehr so schlimm wie am Anfang«, antwortete ich.
»Ach, dann ist ja gut«, sagte er. »Ich hatte mich gewundert, was los ist, weil Sie in letzter Zeit gar keine Fertiggerichte aus dem Convenience Store mehr essen. Man muss in der Schwangerschaft wohl auf einiges achten.«
Er hatte recht. Seit letzter Woche machte ich mir täglich eine Lunchbox für die Firma.
Die Dunkelheit setzte ein, als ich mit dem Essen fertig wurde. Wie ein Vorbote der Nacht wehte ein Luftzug durch das geöffnete Fenster und strich über meine nackten Füße.
Ich stand auf und zog die Vorhänge zu. Dann ging ich ins Bad und ließ warmes Wasser in die Wanne einlaufen.
In letzter Zeit badete ich fast täglich und benutzte manchmal einen der Badezusätze, die ich im Laufe der Jahre geschenkt bekommen und im Schrank unter dem Waschbecken gesammelt hatte.
Vielleicht bildete ich es mir nur ein, aber diejenigen Zusätze, die teuer aussahen, kamen mir besonders erfrischend vor. In den wirklich stressigen Phasen, in denen ich erst spät nachts nach Hause gekommen und vor Erschöpfung zu nichts mehr fähig gewesen war, hätte ich sie wohl besser gebrauchen können als jetzt, aber damals hatte ich ans Baden gar nicht denken können.
Heute Abend würde sich meine Wanne in das Tote Meer verwandeln. Das Badesalz würde in meine Poren dringen, die Schweißdrüsen stimulieren und sämtliche Schadstoffe aus meinem Körper schwemmen – so zumindest versprach es der Verpackungstext. Ich legte meinen Kopf auf den Rand der Wanne und es kam mir vor, als triebe mich das Salzwasser nach oben. Während ich schutzlos im Toten Meer schwamm, musste ich unwillkürlich an einen Dugong denken, einen seltenen Vertreter der Seekuh, den ich ein einziges Mal in einem Aquarium gesehen hatte. Langsam war er durch das türkisfarbene Wasser geglitten und in seinen Augen hatte ich weder Berechnung noch die Angst, selbst Opfer einer Berechnung zu werden, erkennen können. Durch und durch gutmütig hatte er gewirkt.
Als ich mir nach dem Baden die Haare föhnte, wurde mir auf einmal ziemlich heiß. Das Meersalz zeigte seine Wirkung. Von der Straße wurden Stimmen von Schülerinnen, die an meinem Haus vorbeiliefen, hereingetragen. Während ich ihnen lauschte, stellte ich den Ventilator, den ich eigentlich schon im Schrank hatte verstauen wollen, in die Mitte des Zimmers. Ich setzte mich auf mein kleines Sofa. Musik machte ich keine an, obwohl ich mich eigentlich immer für musikaffin gehalten hatte.
Auf dem Weg zur Station und beim Warten auf Freundinnen oder die Bahn hörte ich ständig Musik über mein Handy und im Sommer besuchte ich regelmäßig Festivals. Aber seltsamerweise wusste ich jetzt, da ich Zeit zur Genüge hatte, nicht, wie ich in meiner leeren Wohnung unsichtbaren Künstlerinnen bei der inbrünstigen Darbietung ihrer Lieder lauschen sollte. Wo sollte ich meinen Blick lassen? Was für ein Gesicht müsste ich machen? Bei Bands mit vielen Mitgliedern war mein Unwohlsein am größten. Ich fragte mich, wie es andere machten, die Musik zu ihren Hobbys zählten. Schlossen sie beim Zuhören die Augen? Starrten sie Löcher in die Luft oder wippten sie leicht mit dem Kopf und schwangen ihre Hüften? Wie wenig ich doch mit meinen über dreißig Jahren von der Welt wusste.
Ich schaltete nur das warme Licht der Stehlampe ein und legte meinen Kopf auf die Armlehne des Sofas. In meiner Phantasie schrieb ich Sätze an die weiße Zimmerdecke. Dann fing ich an, eine Melodie zu singen, die mir spontan in den Sinn kam. Meine Stimme klang schwächer und kratziger als beim Reden, aber sie gefiel mir so. Es machte Spaß, also setzte ich dieses Spielchen noch ein wenig fort. Ich schaute auf die Uhr. In meinem früheren Leben hätte ich ungefähr jetzt mit dem Essen begonnen.
Der Abend war noch jung.
Achte Woche
Seit nunmehr einer Woche machte ich zwischen dem Abendessen und dem Baden Dehnübungen. Den Anlass dafür hatte eine Kollegin aus einer anderen Abteilung gegeben, die plötzlich an meinem Schreibtisch erschienen war und mir eine Kopie aus einer alten Zeitschrift mit Dehnübungen für die erste Schwangerschaftsphase in die Hände gedrückt hatte. »Achten Sie gut auf Ihren Körper«, hatte sie gesagt.
Ein weibliches Model mit auffällig dünnen Augenbrauen und schon lange aus der Mode gekommener, weiter Sportkleidung machte die Bewegungen vor. Unter dem Foto eines Mediziners standen Erklärungen, doch genau dieser Abschnitt war in der Kopie verschwommen. Ich hatte die Übungen trotzdem ausprobiert, Zeit hatte ich ja genug, und festgestellt, dass sie die Verspannung in meinen Schultern linderten, weshalb ich sie jetzt regelmäßig machte.
Einen Kräutertee mit hohem Folsäuregehalt, den ein befreundeter Gymnastiktrainer meiner Kollegin zubereitete, hatte ich auch noch geschenkt bekommen. Zwar rochen die strahlend grünen Blätter leicht nach Schwefel, aber der Tee daraus schmeckte wirklich gut. Heute hatte ich ihn für mehrere Stunden in kaltem Wasser ziehen lassen und nun sickerte die kühle Flüssigkeit langsam in meinen unbewohnten Bauch.
Außer der Frau mit den Dehnübungen, meinen direkten Sitznachbarn am Arbeitsplatz und dem Mitarbeiter aus der Personalabteilung sprach mich zunächst niemand auf die Schwangerschaft an.
Seit am Monatsende aber bei unserer Abteilungsversammlung bekanntgegeben worden war, dass ich im Frühling in Mutterschutz gehen und ab Jahresbeginn schrittweise meine Aufgaben übergeben würde, erkundigte man sich regelmäßig nach meinem körperlichen Befinden.
Bei jeder Bewegung, ob ich nun kurz stehenblieb oder von meinem Platz aufstand, konnte ich mir eines besorgten »Alles in Ordnung?« sicher sein. Die Frage, ob es ein Junge oder Mädchen werde, oder gar Glückwünsche blieben dagegen weitestgehend aus. Das lag sicher daran, dass ich nicht verheiratet war. Und diesem empörenden Umstand war es wohl auch geschuldet, dass fast die gesamte Belegschaft unserer kleinen Papierrollenfertigungsfirma über meine Situation Bescheid zu wissen schien, obwohl offiziell nur meine Abteilung in Kenntnis gesetzt worden war.
Wenn ich im Fahrstuhl oder am Kopiergerät stand, bemerkte ich verstohlene Blicke auf meinen Bauch. Und als ich mir letztens am Automaten ein Getränk hatte ziehen wollen, war die Unterhaltung in der Sekunde verstummt, als ich den Aufenthaltsraum betreten hatte. Irgendein Thema war abrupt peinlich berührtem Schweigen gewichen. In solchen Momenten hatte ich mir angewöhnt, meine Hand auf den leeren Bauch zu legen und ihn liebevoll zu streicheln.
Ich musste nur überzeugend genug auftreten, sagte ich mir, der Rest käme wie von selbst.
Einer der wenigen, der aktiv das Gespräch suchte, war Herr Higashinakano auf dem Platz neben mir. Er hatte mich sofort nach der offiziellen Verkündung meiner Schwangerschaft abgepasst.
»Haben Sie schon einen Namen?«, hatte er sich erkundigt.
»Ich weiß noch nicht einmal, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird.«
»Ah, verstehe.«
Daraufhin zählte er etwas an seinen Fingern ab, nickte mehrmals gewichtig und ging davon. Bei jeder Bewegung seines Kopfes regnete es weiße Flöckchen. Schuppen.
Ab diesem Zeitpunkt fragte mich Herr Higashinakano täglich, wie es mir gehe. Sobald ich mir eine Jacke überzog, wollte er wissen, ob ich fröre, und beim kleinsten Hüsteln drängte er mich zu einem Arztbesuch. Letztens hatte ich mitbekommen, wie der Abteilungsleiter Herrn Higashinakano wegen eines mangelhaften Berichts abmahnte. Hochkonzentriert tippte er danach etwas in seinen Computer. Natürlich hatte ich angenommen, er korrigiere seine Fehler, als ich plötzlich meinen Namen hörte. »Frau Shibata«, flüsterte Herr Higashinakano und drückte mir eine Liste mit der Überschrift »Nahrungsmittel in der Schwangerschaft: Das ist zu beachten« in die Hand. Einer der Einträge war in besonders großer Schrift hervorgehoben: »Hijiki-Seealgen: Dürfen verzehrt werden, aber nur zwei Portionen pro Woche«.
Herr Higashinakano roch immer nach Kleber. Genauer gesagt nach dem Flüssigkleber, den ich früher als Kind benutzt hatte. Es war kein Gestank, aber auch kein besonders guter Geruch. Kleber eben. Und das Seltsame daran war, dass ich ihn in dem ganzen Jahr, seit wir nebeneinandersaßen, kein einziges Mal mit Kleber in der Hand gesehen hatte.
Zehnte Woche
Dieses Wochenende war ich mit zwei Freundinnen verabredet, ehemaligen Kolleginnen aus meiner ersten Firma, bei der wir alle gleichzeitig angefangen hatten. Wir trafen uns in einer Kellergeschoss-Kneipe in Hibiya.
Hinter der dünnen Wand, die uns vom Nachbartisch trennte, saß eine Gruppe Männer, etwa im Alter meines Vaters. Ihre lauten Stimmen drangen zusammen mit dem Rauch ihrer Zigaretten zu uns herüber, sodass ich unweigerlich ihrem Gespräch über Erinnerungen an das Studium, große Geschäftsessen in den guten alten Zeiten und Investitionen in Parkplätze lauschen musste, während ich gleichzeitig Teil einer Unterhaltung war, die fließend zwischen Gesundheit, Pflegeprodukten und allerlei anderem hin und her sprang. Momoi erzählte, sie habe in letzter Zeit Beschwerden nach der Menstruation und versuche, mit traditioneller chinesischer Medizin etwas dagegen zu tun.
»Also ich war letztens mit meinem Mann unterwegs«, sagte Yukino, und ich wusste, dass sie nicht auf das vorangegangene Gesprächsthema eingehen würde. Das war immer so, wenn Yukino einen Satz mit »Also ich« anfing. Ich kaute auf einem Stück Tintenfisch, das innen noch eiskalt war. Es war anscheinend direkt aus der Tiefkühltruhe gekommen.
»Wir waren in einem Kunst-Aquarium mit riesigen beleuchteten Fischbecken, für das mein Mann über die Arbeit Karten geschenkt bekommen hatte«, erzählte Yukino. »An sich war es schön, aber ihr glaubt nicht, was da für ein Pärchen vor uns war, Studenten, vermute ich. Und der Junge hat doch wirklich zu seiner Freundin gesagt: ›Selbst, wenn du dir die Welt zur Feindin machst, werde ich immer zu dir halten.‹ Mit so einem Quatsch kann ich überhaupt nichts anfangen.«
»Ja, es gibt wirklich Leute, die derart geschwollen daherreden«, pflichtete ihr Momoi bei, während sie angestrengt die Getränkekarte betrachtete. Sie berührte sie fast mit der Nase, so schlecht schien sie die Schrift in dem etwas zu dunkel gehaltenen Laden ausmachen zu können.
»Das auch, aber«, setzte Yukino an, ohne den Satz zu Ende zu führen.
»Aber was?«, hakte Momoi nach.
»Ich meinte eher, dass der Kerl gar nicht erst zulassen sollte, dass sich seine Freundin die Welt zur Feindin macht. Wann passiert so etwas denn schon? Ehrlich gesagt hätte sie dann sowieso keine Chance. Wenn er sie wirklich liebt, sollte er sie stoppen, bevor sie sich in so eine Situation begibt.«
Yukino nahm einen Schluck ihres Getränks, in dem eine Kugel Eis schwamm. Beim Trinken blubberte die Kohlensäure und ich fragte mich, ob es vielleicht ein Whisky-Highball mit Eiscreme war, wenn es so etwas überhaupt gab. Kurz spielte ich mit dem Gedanken, das Getränk auf der Karte ausfindig zu machen, gab aber auf, als ich sah, dass Momoi immer noch mit zusammengekniffenen Augen darin herumblätterte.
Von uns dreien war Yukino schon immer die Vorreiterin gewesen. Sie hatte als Erste den Job gewechselt und als Erste geheiratet, und als wir vor einiger Zeit zu dritt eine Thermalquelle besucht hatten und nach dem Abschminken bemerkten, dass Yukinos Augen immer noch dunkel umrandet waren, erfuhren wir, dass sie sich als Erste ein Permanent-Make-up hatte machen lassen. »Ich kann euch sagen, es tut richtig weh«, begann sie ihre Geschichte über das Eyeliner-Tattoo, während wir in der heißen Quelle badeten. Im Folgenden quälte sie Momoi und mich mit einer Beschreibung der schmerzhaften Prozedur.
»Ihr versteht euch immer noch gut, du und dein Mann, oder?«, fragte Momoi, die es aufgegeben hatte, die Karte zu entziffern, und stattdessen ein weiteres Bier bestellte. »Wie lange seid ihr jetzt eigentlich schon verheiratet?«
»Sieben oder acht Jahre«, erwiderte Yukino. »Ob wir uns gut verstehen, weiß ich selbst nicht so genau. Zumindest ist es einfach, weil wir keine Kinder haben.«
»Dein Mann hat seine eigene Firma, oder? Vor einiger Zeit habe ich im Netz ein Interview mit ihm gesehen.«
»Ja genau. Wenn es in der Firma gut läuft, ist alles super, wenn nicht, kann er unausstehlich werden. Oh, wenn man vom Teufel spricht … Er ruft gerade an. Das tut er in letzter Zeit ständig. Ich gehe kurz nach draußen.«
Mit dem Handy am Ohr verließ Yukino die Kneipe und Momoi und ich zückten ebenfalls unsere Handys. »Mist«, entfuhr es Momoi. Sie hatte das Picknick mit den Freunden ihrer Kinder vergessen, das für den nächsten Tag geplant war.
»Ich habe keine Ahnung, was ich vorbereiten soll. Nur Tiefkühlessen kann ich kaum mitbringen. Auf dem Rückweg muss ich noch in den Supermarkt.«
»Wie lange ist es her, dass ich Picknicken war«, bemerkte ich. »Es ist sicher viel Arbeit, das alles vorzubereiten.«
»Das Treffen morgen ist zum Glück entspannt, weil ich die Mütter gut kenne. Aber bei Sportfesten im Kindergarten sind immer extrem aufwendige Lunchboxen gefragt. Das ist die Hölle.«
Als Yukino zurückkam, beschlossen wir, uns langsam auf den Heimweg zu machen. Momoi trank das Bier, das der Kellner eben erst gebracht hatte, in einem Zug aus und fragte nach der Rechnung. Draußen wimmelte es von Leuten auf der Suche nach einem geeigneten Lokal und viele Studentinnen waren in Gruppen unterwegs. Yukino und Momoi wollten bis Yurakucho laufen, ich entschied mich für die U-Bahn, die direkt in Hibiya abfuhr. Als ich vor den Ticketschranken in meiner Tasche nach der Monatskarte kramte, entdeckte ich die Mitbringsel von meinem letzten Besuch bei den Eltern, die ich Momoi und Yukino hatte geben wollen.





























