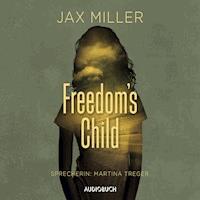4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Niemand weiß, dass sie noch lebt. Nicht mal ihre Kinder. Doch die sind nun in höchster Gefahr. Sie raucht, sie flucht, sie trinkt. Und lässt sich von niemandem was sagen. Jeder in der Stadt schätzt – oder fürchtet – Freedom Oliver. Keiner kennt ihren wahren Namen, ihr altes Leben: ausgelöscht. Das Leben, in dem sie ihren Mann erschoss, den Schwager ans Messer lieferte und ihre Kinder verlor. Das Leben, das sie für das Zeugenschutzprogramm hinter sich ließ. Nur spät in der Nacht verfolgt Freedom per Facebook, wie Mason und Rebekah erwachsen werden. Und dann kommt der Tag. Der Tag, an dem ihre Feinde Rache schwören. An dem Rebekah verschwindet. Und Freedom weiß: Sie kann sich nicht länger verstecken, sie muss handeln … Eine Heldin wie keine andere. Eine Geschichte von Liebe, Rache, Schuld und Tod.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 442
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Jax Miller
Freedom’s Child
Thriller
Über dieses Buch
Niemand weiß, dass sie noch lebt. Nicht mal ihre Kinder. Doch die sind nun in höchster Gefahr.
Sie raucht, sie flucht, sie trinkt. Und lässt sich von niemandem was sagen. Jeder in der Stadt schätzt – oder fürchtet – Freedom Oliver. Keiner kennt ihren wahren Namen, ihr altes Leben: ausgelöscht. Das Leben, in dem sie ihren Mann erschoss, den Schwager ans Messer lieferte und ihre Kinder verlor. Das Leben, das sie für das Zeugenschutzprogramm hinter sich ließ. Nur spät in der Nacht verfolgt Freedom per Facebook, wie Mason und Rebekah erwachsen werden.
Und dann kommt der Tag. Der Tag, an dem ihre Feinde Rache schwören. An dem Rebekah verschwindet. Und Freedom weiß: Sie kann sich nicht länger verstecken, sie muss handeln …
Eine Heldin wie keine andere. Eine Geschichte von Liebe, Rache, Schuld und Tod.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 2015 unter dem Titel «Freedom’s Child» bei HarperCollins Publishers, London.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, August 2015
Copyright © 2015 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
«Freedom’s Child» Copyright © 2015 by Jax Miller
Redaktion Jan Valk
Umschlaggestaltung Hafen Werbeagentur, Hamburg
Umschlagabbildung Gary Isaacs/Trevillion Images
ISBN 978-3-644-54271-6
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Widmung
Prolog
Erster Teil
1 Freedom und die Schaumschläger
2 Mason und Violet
3 Die Schabe
4 Nach Hause zu Ma
5 Es wissen müssen
6 Teufelsmusik
7 Highschool Sweetheart
8 Das Selbstmordglas
9 Freedom und Passion
10 Daheim bei den Delaneys
11 Der Cop
12 Die Kanzlei und der Erzengel
13 An der Brust
14 Mattley
15 Der leere Schoss
16 Peter
Zweiter Teil
17 Das Bluegrass
18 Freedominjesus
19 Die Dritter-Tags-Adventisten
20 Die Nase der Viper
21 Ein Gefallen
22 Das Land der Freiheit
23 Freedom und das Opfer
24 Freedom und der weniger begangene Weg
25 Katzenwiege
26 Der Herbst ist vorbei
27 America the Beautiful
28 Behütet
29 Die Legende von Freedom
30 Kuckuck
31 Sonnenuntergang
32 Lauf, Rebekah, Lauf
33 Wenn man vom Teufel spricht
34 Der Schandpfahl
35 Freedom und die Entdeckung
36 Ruhestand
37 Freedom und die Kapitulation
38 Freedom McFly
39 Die Schatten des Phoenix
40 Die Haut von Schmetterlingsflügeln
41 Sonnenaufgang
Dritter Teil
42 Eierschalen
43 Der Kramladen
44 Rechtskräftig
45 Entkleidet
46 Alle Schulden beglichen
47 Gibt das Leben dir Zitronen
48 Die Diakone
49 Ihr Blut, Deine Hände
50 Hüttenkoller
51 Ein weißer Festzug
52 Whistler’s Field
53 Ein schwarzer Festzug
54 Sonntag
55 Painter
56 Sovereign Shore
Danksagungen
Für Babchi und den Boss of the City
und für Pat Raia, den Robin zu meinem Gotham
Prolog
Mein Name ist Freedom Oliver, und ich habe meine Tochter getötet. Das ist extrem surreal, und ich weiß nicht, was mir mehr wie ein Traum vorkommt: dass sie tot ist oder dass sie mal gelebt hat. Schuld bin ich an beidem.
Vor gar nicht langer Zeit ließ hier auf Whistler’s Field noch eine warme Brise die Ähren wogen und rauschen wie tanzendes Gold unter der glühenden Mittagssonne. Am Feldrand galoppierten die Vollblüter, die man in Goshen überall sieht. Wenn man aufmerksam lauscht, kann man fast noch das Lachen der Farmerskinder im Getreide hören – eine reiche Ernte unschuldiger Geheimnisse junger Menschen, die einen Ausweg suchten, aber nirgendwo hinkonnten. Genau wie meine Rebekah, meine Tochter. Gott, sie muss wunderschön gewesen sein.
Aber zwei Wochen sind eine lange Zeit, wenn man auf einer Reise wie der meinen ist. Fast könnte man was Erhabenes daran finden. Aber nur fast.
Die Erinnerung raubt mir den Atem. Irgendwo auf diesem Feld liegt meine zerstückelte Tochter.
Goshen, benannt nach dem biblischen Goschen, irgendwo in der Gegend des berühmten Bourbon Trail in Kentucky, mitten im Bible Belt. Der Galopp der Vollblüter, die gespenstisch dieses tote Land durchstreifen, weicht dem Hämmern in meiner Brust. Unter mir platzt der Lehm auf, als ich über den gefrorenen Boden laufe. Der Himmel hat diesen silbrigen Ton wie kurz vor einem Schneesturm: die Farbe meiner beschmutzten, beschissenen Seele.
Der Sheriff fällt mir wieder ein, sein nervöser Finger am Abzug der Remington, die auf meinen Rücken gerichtet ist. Meine eigene Pistole fällt mir wieder ein, meine Knöchel weiß an ihrem Griff.
Nennt mich, wie ihr wollt: Mörderin, Copkiller, Entlaufene, Säuferin … Glaubt irgendwer, das macht mir noch was aus? In diesem Augenblick? Die Kälte brennt mir so schmerzhaft in den Lungen, dass ich glaube, kotzen zu müssen. Muss ich aber nicht. Immer noch atemlos, wische ich mir mit dem schmutzigen Ärmel Blut aus dem Gesicht. Keine Ahnung, ob das meins ist. Falls ja, strömt mir ausreichend Adrenalin durch die Adern, dass ich es nicht spüre.
«Endstation, Freedom», leiert der Sheriff in seinem schleppenden Südstaaten-Sound. Warme Tränen strömen mir über die kalten Wangen. Mein Gesicht ist taub geschrien, die Lippen kribbeln wie von Nadelstichen. Der Kloß im Hals droht, mich zu ersticken. Was habe ich nur angerichtet? Wie bin ich hier gelandet? Was habe ich verbrochen, dass Gott mich für jede Gnade so verdammt unwürdig hält? Keine Ahnung. Im Fragen-Stellen war ich schon immer besser als im Antworten-Geben.
Erster Teil
1Freedom und die Schaumschläger
Zwei Wochen zuvor
Mein Name ist Freedom, und heute ist ein ganz normaler Abend in der Bar. Ein neues Mädchen ist da, blond, vielleicht sechzehn. Sie hat leuchtende Augen, ist noch nicht lang genug im Geschäft. Wird sich bald ändern. Sieht aus, als könnte sie was zu essen vertragen, bisschen Fleisch auf den Knochen. Dass sie neu ist, erkenne ich auch an den weißen Zähnen, dem hübschen Lächeln. In ein, zwei Monaten werden ihr nur noch schwarze Kiesel im Zahnfleisch stecken und die Knochen sich unter der Haut abzeichnen wie vakuumverpackt. Ganz normal in der Branche: Die Vorzüge der Jugend werden zerstört von schäbiger Männerlust und der Versklavung durch Drogen. So ist das Leben.
Ein Biker packt sie an den goldenen Locken und schleift sie Richtung Parkplatz. Zu viel los hier drin, keiner kriegt’s mit. Zwischen all den anderen Lederwesten und fettigen Pferdeschwänzen fällt er gar nicht auf. Aber ich kriege es mit. Ich sehe sie. Und sie sieht mich – feuchte, flehende Augen, ein Funken Unschuld, der vielleicht sogar überlebt, wenn ich was tue. Aber ich muss es sofort tun.
«Pass auf die Bar auf», rufe ich niemand Bestimmtem zu. Ich staune über meine eigene Beweglichkeit, als ich über den Tresen mitten in die Horde springe, drücke, schiebe, trete, rufe. Dann finde ich sie – die Kleine zieht eine Parfümfahne hinter sich her. Mit den Zähnen reiße ich den roten Deckel einer Flasche Tabasco ab und spucke ihn aus. Der Biker will grade durch die Tür gehen, sieht mich hinter sich nicht kommen. Er ist gut zwei Köpfe größer als ich. Ich schütte mir eine ordentliche Ladung Soße in die hohle Hand.
Die Klamotten, in denen ich vergewaltigt wurde, habe ich immer noch. Was soll ich sagen? Bin eben eine Masochistin. Mein Name ist Freedom, aber frei fühle ich mich nur selten. So war das eben mit den Schaumschlägern ausgemacht: Ich würde nur dann ins Zeugenschutzprogramm einsteigen, wenn ich meinen Namen zu Freedom ändern durfte. Freedom McFly. Das McFly erlaubten sie mir aber nicht. Klingt zu sehr nach Burger King, sagten sie. Zu sehr nach den Achtzigern. Verdammte Schaumschläger.
Dann eben Freedom Oliver.
Ich lebe in Painter, Oregon, einer Kleinstadt voller Schmutz, Regen und Crystal Meth. Dort stehe ich hinter dem Tresen einer Rockkneipe namens Whammy Bar. Meine Stammgäste sind fette Biker aus West-Coast-Clubs wie den Hell’s Angels, den Free Souls und den Gypsy Jokers, die bei jeder Gelegenheit meine üppigen, tätowierten Kurven betatschen.
«Lass mal deinen Hintern sehn!»
«Wie wär’s mit ’ner Spritztour?»
«Soll ich dich nicht mal aus deiner Hose befreien, Freedom?»
Ich verberge meine Abscheu hinter einem souveränen Lächeln und strecke meine Brust noch etwas weiter raus; das bringt Trinkgeld, auch wenn es mich anwidert. Sie fragen nach meinem Akzent, und ich sage Secaucus, New Jersey. In Wahrheit ist er aus Mastic Beach, einer zwielichtigen Gegend von Long Island, New York. Diese Kleinstadtidioten merken den Unterschied sowieso nicht.
Am frühen Morgen ist meine Schicht zu Ende, die Bar schließt, und ich spanne meinen Regenschirm auf. Mit zugekniffenen Augen blicke ich durch den Oktoberregen und den Rauch einer Pall Mall. Hat es seit meiner Geburt eigentlich mal einen Tag lang nicht geregnet? Links, gleich neben der Whammy Bar, ist das Hotel Painter. Sein Neonschild surrt im Regen. Ein paar Buchstaben sind kaputt, sodass vom Namen nur die Worte «Hot Pie» übrig bleiben. Passend, denn das Hotel Painter ist eins dieser kakerlakenverseuchten Stundenhotels, die jedem ein marodes Dach über dem Kopf bieten, der eine billige Möse mieten will. Zusammengedrängt unter dem Vordach der Rezeption, suchen die Ladys Schutz vor dem Regen und rufen mir irgendwas zum Abschied zu. Ich winke zurück. Goldlöckchen ist nicht dabei. Gut so. Wohl nicht mehr viel los heute Nacht.
Der Schirm geht nicht mehr zu. Scheiß drauf. Ich werfe ihn in den Matsch und steige in meinen klapprigen, verrosteten Kombi. Im Auto nehme ich den Nasenring raus und drücke die Kippe in den überquellenden Aschenbecher.
Ich zucke zusammen, als plötzlich jemand ans Fenster klopft. Die Scheibe ist beschlagen, und ich muss sie erst ein Stück runterlassen, um die beiden Anzugtypen zu sehen. «Verf…luchte Schaumschläger.» Sie sehen mich an, als hätte ich einen Dachschaden. Aber der Meinung waren sie eh von Anfang an. Den meisten Leuten fällt schwer zu verstehen, was ich sage. «Bisschen spät für euch, oder?»
«Du zwingst uns ja immer wieder, hier rauszufahren», antwortet einer der beiden.
«War doch bloß ein Unfall.» Ich zucke die Achseln und steige aus.
«Ein Unfall? Du hast versucht, jemanden mit Tabasco zu blenden.»
«Auslegungssache, Gumm.» Ich fummle mit dem Schlüsselbund herum. «Der Typ hat sich an einem der Mädels vergriffen, also hab ich ihm eine gescheuert. Blöderweise hab ich nicht die Wange, sondern die Augen erwischt. Rein zufällig hatte ich mir vorher Tabasco auf die Hand gekleckert. Außerdem erhebt er nicht mal Anklage. Tut mir leid, dass ihr dafür extra aus Portland hergefahren seid.»
«Du bewegst dich auf dünnem Eis, Freedom», sagt Howe.
«Von Tabasco ist noch keiner blind geworden.» Ich schüttle mir den Regen aus dem Haar. «Tut nur übelst weh und macht schön wach.»
«Na, zumindest war er sauer genug, die Bullen zu rufen», entgegnet Gumm. «Ohne uns würdest du jetzt in einer Zelle sitzen.»
«Ne Augenklappe würde ihm sowieso ganz gut stehen.» Ich steige aus und gehe voraus zur abgeschlossenen Bar. Drinnen schalte ich den Strom wieder an und stelle uns drei Budweiser hin. Mit großen Augen begaffen sie das Bier. «Entspannt euch, ich verrat’s schon keinem», versichere ich.
Das Licht ist schummrig, fast wie in einem Verhörraum. Rings um den Tresen erstreckt sich der alte Holzfußboden des Ladens, hier und da steht ein Billardtisch. Kalter Rauch hängt schwer in der Luft, liegt in den Rillen der Bodendielen wie ein Song auf einer Schallplatte. Aus den Boxen kommt Lynyrd Skynyrd. Die US-Marshals Gumm und Howe nehmen sich Barhocker und setzen sich.
«Du weißt ja, wie’s läuft», sagt Agent Gumm. Er hat grau meliertes Haar, einen Zwirbelbart, schlaffe Wangen und ganz offensichtlich überhaupt keine Lust, hier zu sein. Ich will auch nicht, dass er hier ist. Aber das Gericht. Scheiß Schweinesystem. Bringen wir’s hinter uns: Wir füllen die Formulare aus, ich kriege eine Gardinenpredigt. Wir haben dich gewarnt, denk dran. Ja, ja, ich denke, wie immer. Neben Gumm wirft Agent Howe einen schnellen Blick auf meine Akte. «Wie läuft der Job so, Freedom?»
«Ich würd mir ja ’ne schlaue Antwort ausdenken, aber ich bin zu müde für solchen Mist.» Ich wische meine Lederjacke mit einem Barhandtuch trocken. «Haut mir einfach auf die Finger, dann können wir alle nach Hause, okay?»
«Wollte ja nur wissen, ob das hier in Ordnung ist», meint Howe. Gut sieht er aus, Anfang vierzig, pechschwarzes Haar, grüne Augen. Ich würd ihn vögeln. Na ja, wenn er nicht so ein Arsch wäre. Obwohl, das würde mich vermutlich auch nicht aufhalten.
«Jetzt kommt schon zum Punkt. Ihr seid doch nicht extra aus Portland gekommen, um mir wegen so einer Lappalie auf den Sack zu gehen.»
Sie rollen die Flaschen zwischen den Händen. Gumm wischt mit dem Ärmel den Bierkranz vom Tresen. Sehen mich mit hochgezogenen Augenbrauen an, so ein Blick, der sagt: Erzählst du’s ihr, oder soll ich?
«Rückt ihr jetzt bald mal raus mit der Sprache?» Ich verdrehe die Augen und schwinge mich vor ihnen auf den Tresen. Ich verschränke die Beine wie ein Indianer, die Knie auf Höhe ihrer Augen.
«Matthew wurde vor zwei Tagen aus der Haft entlassen. Er hat Berufung eingelegt. Mit Erfolg.» Gumm hustet gekünstelt, während er das sagt. Na wunderbar. Ich stütze die Ellbogen auf die Knie und das Kinn auf die Fäuste. Welchen Gesichtsausdruck täusche ich am besten vor? Ich entscheide mich für ahnungslos, so als wüsste ich nicht mal, um was für einen Matthew es überhaupt geht. Weiß ich aber. Darum bin ich ja im Zeugenschutz. Beschützt von diesen beiden Gangsterjägern. Diesen Schlipsträgern. Schaumschlägern. Zum Glück wurde die Klage gegen mich damals rechtskräftig abgewiesen, und ich kann nicht noch mal für dieselbe Straftat angeklagt werden. Schwein gehabt.
«Na und?» Sie sollen nicht merken, wie mein Herz hämmert und mir der Schweiß ausbricht.
Gumm beugt sich vor. «Wir verstärken deinen Schutz auf unbestimmte Zeit. Einer unsrer Leute kommt jede Woche bei dir vorbei. Und du hältst schön den Kopf unten.»
«Noch weiter unten als in ’ner Bikerkneipe am Arsch der Welt?»
«Ein moderater Preis für Polizistenmord, Freedom.» Da sind sie wieder, die altbekannten bösen Blicke und verzogenen Mundwinkel. «Ach, komm, was hast du denn zu verlieren, wenn du’s einfach mal zugibst? Noch mal angeklagt werden kannst du ja nicht. Du warst es, garantiert.»
«Na, dann beweist es doch. Echt nett jedenfalls von euch Arschlöchern, dass ihr mich vorwarnt.» Ein kräftiger Schluck Bier, dann nicke ich Richtung Tür. «Fahrt vorsichtig bei dem Regen. Nicht dass ihr auf dem Rückweg in die große Stadt noch bei ’nem tragischen Unfall draufgeht.» Ich trinke aus. «Nicht auszudenken wär das.»
Zumindest kapieren sie den Wink. Ist nicht immer der Fall. Manchmal bleiben sie länger, als mir passt. Manchmal mit Absicht, nur, um mir ans Bein zu pinkeln. «Ach, ja», Howe steht auf und knöpft seinen Mantel zu. «Ich muss leider fragen … Vorschriften, du weißt ja …» Er beißt beim Sprechen die Zähne zusammen, als steckte ihm ein Dorn im Arsch.
Ich erspare ihm die Mühe, allein schon, damit die beiden schneller verschwinden. Ihre Akten bleiben an meinen nassen Stiefeln kleben, als ich vom Tresen springe. Ich reiche ihnen die feuchten Papiere und sage: «Keine Sorge, ich nehm meine Medikamente noch.» Das ist dreist gelogen. Ich glaube, sie wissen das auch, aber es ist ihnen egal. «Ihr braucht nicht zu fragen.»
Ich denke an Matthew. Jetzt ist er also raus, nach achtzehn Jahren. Achtzehn Jahre Gefangenschaft, die mir achtzehn Jahre Freiheit garantiert haben.
Allein steige ich in meinem schäbigen Apartment aus den nassen Klamotten und trockne meinen nackten Körper an den Polstern des muffigen Tweedsofas. Allein weine ich. Allein betrachte ich ein altes Bild meines toten Mannes, Mark – das einzige Foto, das den Vorfall mit dem Spülbecken und den Streichhölzern vor zwanzig Jahren überlebt hat. Allein mache ich eine Flasche Whiskey auf. Allein flüstere ich zwei Namen in der Dunkelheit.
«Ethan.»
«Layla.»
Allein. Verfluchte Schaumschläger.
2Mason und Violet
Ich bin ein kleiner Junge. Die Arme dieser Frau schützen mich vor den Weiten des Ozeans – blau, so weit das Auge reicht, bevor er sich in einer grauen, mit Schiffen gesprenkelten Linie verliert. Ich vergrabe das Gesicht an ihrem Hals; ihr Lachen schüttelt meinen kleinen Körper durch. Ich weiß nicht, wer sie ist. Durch ihr rotes Haar blicke ich hinauf zum Himmel; Inseln aus Sonnenlicht blitzen hypnotisierend durch nasse Locken. Ihr Körper ist wärmer als alles, was ich je gespürt habe, wie eine Decke in den kalten Wellen. Ihre Haut riecht nach Kokos und Limone. Das Geschrei der Möwen hallt in meinen Ohren, und ich spüre meine Liebe zu dieser Frau. Ich weiß nur nicht, wer verdammt noch mal sie ist. «Wer bist du?», frage ich. Doch sie gibt in diesen Träumen niemals eine Antwort, nur blendendes Weiß strahlt aus ihrem Mund. Ich kann nicht aufwachen. Will ich überhaupt? Sie dreht sich um, sodass die Wellen sich an ihrem Rücken brechen. Freudenschreie an meinem Hals. Ich schlinge ihr die Beine fester um die Taille. Und in der Stille zwischen den Wellenschlägen fahre ich mit dem Finger die Tattoos auf ihren Schultern nach, zupfe ihr Sandkörner von den Haarspitzen und sage ihr, dass ich sie lieb habe.
«Wo ist deine Schwester?», fragt sie.
Mason Paul wacht auf, zitternd, schweißgebadet, und die Luft ist auch Stunden nach dem Sex noch schwer, ihr Geschmack immer noch auf seinen Lippen. Wieso dieser wiederkehrende Traum ein Albtraum ist, weiß er selbst nicht. Behutsam umfasst er Violets Handgelenk mit Daumen und Zeigefinger und hebt ihren Arm von seinem Bauch. Er nimmt die Zigaretten aus dem Versteck in der Sockenschublade und schleicht nach draußen – vorsichtig, um sie nicht zu wecken.
Immer noch viel zu warm für eine Oktobernacht in Kentucky. Mason steht nackt in der Flügeltür zum Balkon, unsicher, ob er wegen der Befriedigung, die seine Freundin ihm verschafft hat, die Schultern so breit macht oder um die Beklemmung nach dem Traum loszuwerden. Hinter ihm, ausgestreckt auf Seidenbettwäsche, die farblich mit ihrem Namen harmoniert, schnarcht Violet. Er zieht an der Marlboro, betrachtet die passend zum bevorstehenden Allerheiligenfest orangefarben leuchtenden Sterne und mixt sich einen Bourbon Manhattan mit einem Schuss Karamellschnaps. Riecht wie Candy-Corn. Riecht wie Halloween. Diese Träume … Ich bin doch kein Psycho. Er räuspert sich etwas Katerschleim aus der Kehle.
Im großen Garten der Villa im New-Orleans-Kolonialstil – schwarz umrandetes Elfenbein – schaukelt Louisianamoos im Wind. Vor über hundert Jahren haben hier vermutlich Sklaven und ihre Herren gewohnt. Mason führt seine silberne Halskette an die Lippen, wärmt das kleine Kreuz mit seinem Atem, aber er tut es nur aus Gewohnheit. In den letzten Jahren ist er zu dem Schluss gekommen, dass das Enttäuschungspotenzial geringer ist, wenn man Gott als leere Vokabel akzeptiert, anstatt ihn für etwas Bedeutsames zu halten. Doch das Kreuz erinnert ihn an seine kleine Schwester, an Rebekah, die Einzige aus seiner Familie, die ihn nicht verstoßen hat. Sie fehlt ihm unglaublich. Da hilft auch der Bourbon nicht.
Die Villa ist mit altem Südstaatengeld gebaut, das aus den Tabakplantagen rings um das Grundstück stammt: wohlhabende Bankiers und eine lukrative Investition, im goldenen Zeitalter der amerikanischen Wirtschaft. Und jetzt Mason, vierundzwanzig, mit dem Zeug zum erfolgreichsten Strafverteidiger Kentuckys, seit er nur Wochen nach seiner bravourösen Anwaltsprüfung den Fuß in die Tür einer der bestgehenden Kanzleien des Staates bekommen hat. Beeindruckend für sein Alter, wenn auch nicht ganz beispiellos. Momentan ist er noch Associate, aber im Büro kursieren schon Gerüchte über ihn als nächsten Senior Associate. Schneller als er hätte das vor ihm noch keiner geschafft; zu verdanken hätte er es einer Menge Praktika, seinem brillanten Kopf und vielen, vielen Arbeitsstunden. Violet dreht sich im Bett um, und er schnippt die Zigarette auf den Rasen, tut, als bemerke er sie nicht.
Einen Augenblick später schlingt sie ihm von hinten ihre dünnen Arme um die nackte Brust. «Du hast geraucht, stimmt’s?» Mason hört ein Lächeln in der Frage. Ich hab immer gewusst, dass ich irgendwann mit einer Kollegin enden würde. Aber musste es auch noch eine Wirtschaftsanwältin sein, die sich auf einem Kreuzzug gegen die großen Tabakunternehmen befindet?
In der Ferne zirpen Zikaden, unter den Trauerweiden in den nahen Sümpfen quaken Ochsenfrösche. Mason grinst. «Wer, ich?» Der Manhattan schimmert im Mondlicht, und er legt seine Hand auf ihre, ohne den Blick vom Garten abzuwenden.
Sie drückt sich an ihn, und er spürt ihren Atem am Rücken. «Ich fühle an den Lippen, wie dein Herz rast.» Sie küsst ihn zwischen die Schulterblätter.
«Hab wieder geträumt …» Er nimmt einen tiefen Schluck aus dem Martiniglas.
«Denk nicht mehr dran …»
Mason löst sich aus ihrer Umarmung, geht ins Schlafzimmer und setzt sich mit der Flasche Maker’s Mark auf einen Polsterhocker. Zu seinen Füßen der Laptop und ein Haufen Akten. Er loggt sich in seinen Facebook-Fakeaccount unter dem Namen Louisa Horn ein. Gedanken an seine Schwester Rebekah strömen ihm durchs Hirn. Seit Tagen kein Wort von ihr. Ungewöhnlich. Hoffentlich war sie endlich so schlau, von dort zu verschwinden. Vielleicht kann er sich mit dem Wirbelsturm aus Akten um sich herum ablenken. Er blättert sie durch, atmet seine Bourbonfahne auf jede Seite. Er fühlt sich schlecht, weil er es nicht schafft, richtig mit seiner Freundin zu schlafen. Die Funkstille seiner Schwester und der Vergewaltigungsfall, der morgen endlich erledigt sein wird, lenken ihn zu sehr ab. Solches Zeug geht ihm immer an die Nieren. Wie soll man einen hochbekommen, wenn man die Sorge um seine Schwester und eine miese Gerichtsverhandlung im Kopf hat?
«Arbeitest du immer noch an dem Becker-Fall?»
«Will nur auf Nummer sicher gehen. Die Sache morgen muss laufen.» Er blickt auf und lächelt. «Sonst kannst du dir Turks und Caicos abschminken.»
«Nur über meine Leiche.» Violet streckt sich und gähnt.
Er betrachtet die Fotos aus dem Krankenhaus St. Mary’s, von der Untersuchung der Vergewaltigten. Die auberginefarbenen Blessuren unter den Augen und zwischen den Schenkeln wühlen ihn jedes Mal auf. Er nimmt noch einen Schluck. Über seine Schultern sieht Violet, was er sieht.
«Wie oft musst du die denn noch anschauen?»
«Glaub mir, mir macht das auch keinen Spaß.» Mit den Fingerspitzen fährt er die Seitenränder entlang. Manchmal wünscht er, er würde abstumpfen, könnte jedes Mitgefühl mit dem Opfer abschütteln, so wie manche seiner Kollegen. «Nur noch, bis ich Senior bin. Vielleicht Partner, in ein paar Jahren.»
«Und dafür verkaufst du deine Seele an den Teufel?»
«Na ja, ich würde eher von einem Mietverhältnis sprechen.» Er zieht ein Foto aus einem Umschlag und reicht es Violet, spricht leise über den Rand seines Glases hinweg. Damals war das die einzige freie Stelle in einer guten Kanzlei. Sie konnten ihn brauchen. Aber sobald es ging, wollte er in einen anderen Bereich wechseln – Wirtschaftskriminalität vielleicht, Immobilien, irgendwas in der Art.
Sie betrachtet das Foto. «Wie zum Henker bist du da überhaupt drangekommen?»
«Anonymer Tipp.» Er nimmt ihr das Foto ab und sieht es sich selbst an. «Damit gewinn ich den Fall. Damit werd ich Partner.»
«Indem du das Opfer als Schlampe hinstellst …»
«Ich weiß.» Mason reibt sich die Stirn.
«Perfekt.» Sie küsst ihn auf den Kopf und wendet sich ab. «Das macht dich zum Star.»
Er sieht ihr nach, wie sie auf den Flur hinausgeht, genießt den Anblick ihres nackten Hinterns – wie ein Kunstwerk im Traum eines großen Malers. Sie verschwindet die Treppe hinab, und er spült das Bild mit einem Schluck Whiskey runter. Sein Blick schweift zurück zu den Fotos, zu dem, das Violet abgesegnet hat: das Opfer, am Abend der Vergewaltigung, oben ohne, lachend, auf dem Schoß seines Klienten. Der Maker’s Mark macht ihn zuversichtlich, gibt ihm etwas mehr Hoffnung, als er nüchtern aufbrächte: Wenn er nur diesen einen Fall gewinnt, stehen ihm sämtliche juristischen Bereiche offen, und er braucht nie mehr solche Drecksäcke zu verteidigen.
«Wo ist deine Schwester?» Die Frage der rothaarigen Fremden aus dem Traum hallt ihm durch den Schädel.
«Verdammt gute Frage, Lady», sagt er und greift nach dem Laptop. «Hoffentlich so weit weg von Goshen, wie jemand wie sie nur kann.»
Dass Rebekah sich nicht meldet, gefällt ihm gar nicht. Sie ist naiv und ein wenig leichtgläubig, was man für Beschränktheit halten, aber auch südstaatlerischer Freundlichkeit zuschreiben kann. Mason klickt sich auf ihr Facebook-Profil. Diese Untätigkeit passt nicht zu ihr – sonst postet sie täglich erbauliche Bibelzitate. Ihr letzter Status lautet: Galater 5, 19–21.
Nach all den Jahren seiner Kindheit, in denen er damit vollgestopft wurde, kennt Mason die Bibel noch immer gut genug, um die Stelle nicht nachschlagen zu müssen: «Offenkundig sind aber die Werke des Fleisches, als da sind: Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Davon habe ich euch vorausgesagt und sage noch einmal voraus: die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben.»
Unter der Bibelstelle ist ein Foto von Rebekah und ihrer kleinen Schwester Magdalene, die Mason nicht mehr kennenlernen konnte, bevor die Kirche ihn verbannt und seine Familie ihn verstoßen hat.
Das falsche Profil als Louisa Horn hat Mason nur angelegt, um mit seiner Schwester in Kontakt zu bleiben. Ob seine Eltern nun doch endlich kapiert haben, was da hinter ihrem Rücken ablief? Soweit er weiß, konnte Rebekah das Misstrauen ihres Vaters beschwichtigen, indem sie ihm erzählte, Louisa Horn interessiere sich nur für die Kirche. Die Gläubigen predigten oft vor Kaufhäusern und dergleichen, versuchten, verlorene Seelen zum Heil zu führen und sich weitere Bonuspunkte für das Reich des Herrn zu verdienen … die fiktive Louisa Horn war bloß eine Kandidatin unter vielen.
Hätte Mason gewusst, dass sein Wunsch, Anwalt zu werden, ja überhaupt von zu Hause wegzuziehen, zu diesem plötzlichen Kontaktabbruch führen würde, wäre er vorsichtiger gewesen. Doch mit den Jahren hatten sich offenbar die Schaltkreise im Hirn seines Vaters verschoben, waren ein paar Leitungen durchgebrannt, bis er von einem halbwegs normalen evangelikalen Priester zu etwas anderem wurde, zu etwas Fanatischerem. Die Gerüchte schienen erst haltlos, und Mason konnte sie leicht mit einem Lachen abtun. Aber als die Veränderung begann, war Mason schon ein Teenager, vier Jahre älter als Rebekah, und er bekam den glühenden Dogmatismus seines Vaters hauptsächlich aus der Ferne mit, im Nachhinein. Richtig schlimm wurde es erst, nachdem er ausgezogen war. Nachdem sie ihn verstoßen hatten.
Mason lehnt sich zurück, reibt sich das Kinn und runzelt die Stirn. Fest umklammert er den Hals des Maker’s Mark. Das rote Kunstwachs an der Öffnung lässt es aussehen, als würden seine Hände bluten. Stigmata, denkt er und erinnert sich an die alte Frau aus der Gemeinde, die irgendwann Rat bei seinem Vater suchte, weil sie überzeugt war, die Wunden Christi am Leib zu tragen. Aber das war vor langer Zeit, in Goshen. Religiöse Spinner gibt es dort an jeder Ecke. Noch einmal liest Mason die Bibelstelle auf dem Laptop. Ein Schauer läuft ihm über den Rücken. Lauf, Rebekah, lauf!
3Die Schabe
Mein Name ist Freedom, und meine Lider sind schwer. Verkatert winde ich mich nackt auf dem zerwühlten Bett. Ein Geschmack im Mund, als wäre irgendwas darin verendet, Whiskey sickert mir aus den Poren, die Wangen hängen vom Rye. 11:30. Nicht übel. Meine Schenkel sind von Hüftknochen wund gerieben. Kenne ich gut, das Gefühl. Ich drehe mich zu Cal, der neben mir wie ein Toter auf dem Bauch liegt und seinen nackten Arsch in die Luft streckt.
«Du Kakerlake», japse ich und trete ihn aus dem Bett. Er reißt die wirren Laken mit sich. «Wer zur Hölle hat dir erlaubt, herzukommen und mich zu ficken?»
«Du hast mitten in der Nacht angerufen und mich in dein Bett gezerrt!», mault er vom Fußboden zurück. Es gibt keinen Grund, seine Version anzuzweifeln, wär nicht das erste Mal. Cal ist ein Cowboy, besser kann man ihn nicht beschreiben. Ich bin fünf Jahre älter als er, und er wirkt noch mal fünf Jahre jünger – einer der wenigen Menschen, die mit langem blondem Haar und Cowboystiefeln nicht scheiße aussehen. Natürlich würde ich das niemals laut sagen, aber er hat einen Körper wie ein junger Gott und ist besser bestückt als Jesus Christus.
Ich werfe sein weißes T-Shirt nach ihm, ziehe selbst ein XL-Shirt vom CBGB über und wanke in die Küche. Keine Ahnung, wessen Shirt das ist. Könnte jedem gehören. Jetzt ist es meins.
Ein sauberer Teller zwischen einem Haufen anderer, die ich irgendwann noch spülen wollte. Ich schütte trockenen Grieß in eine angemackte Schüssel und ertränke ihn in aromatisiertem Rum. Ich seufze. «War ich wenigstens gut?» Bei Aktionen wie dieser reißt mir öfter mal der Film. Plötzlich steht er hinter mir, dreht mich um. Er hebt mich hoch, und ich schlinge die Beine um ihn, den Hintern auf der schmutzigen Spüle.
«Wie immer, Free-free.» Er lächelt mich an. Ich bin zu verkatert dafür. Schubse ihn weg.
«Vorsicht, Cowboy.» Ich nehme einen Schluck Rum gegen den Kater. Der Verschluss ist schon seit Tagen verschollen. Die folgende Stille wäre den meisten wohl unangenehm, mir aber nicht. Ich mag’s still. Stille ist gut. Er steht vor dem Kühlschrank und schüttet sich Orangensaft direkt aus der Packung in den Hals. Dann schnaubt er sich den Mundgeruch aus den Backen wie ein feuerspeiender Drache.
«Wer ist Mason?» Es interessiert ihn nicht wirklich. Er liest die Liste mit den Zutaten auf der Saftpackung. Steht auf das Biozeug. Verdammter Hippie …
«Wer?» Ich sehe mich in der dreckigen Küche um. Zum Putzen fehlt mir einfach die Kraft. Lange schon.
«Nachdem du eingepennt bist», spricht er in einen jämmerlich leeren Kühlschrank hinein, «hattest du wohl ’nen Albtraum, hast dauernd ‹Mason!› gerufen.» Ich stell mich dumm, das kann ich gut. Was soll ich sagen? Ich bin umgeben von unfähigen Pfosten, und Cal ist keine Ausnahme. Aber im Bett macht er das wieder wett.
«Hab noch nie keinen Mason gekannt.» Eine doppelte Verneinung, also nicht mal gelogen. Nur eine kleine Wortverdreherei, die Cal gar nicht auffällt. «Hab den Namen wahrscheinlich im Fernsehn gehört oder so.» Das Telefon klingelt, und ich durchstöbere die Küchenschränke. Da lege ich es immer rein, wenn die Kopfschmerzen kommen. Cal sieht mich an wie die meisten Leute: irritiert. Ich folge der Leitung und finde das Telefon ganz hinten auf ein paar Erbsendosen. «Ja? Hallo? Hallo?» Ich drücke den Hörer fest an den Kiefer. Dann tue ich, als ob ich auflege, die Hand zwischen Hörer und Gabel. «Falsch verbunden. Irgendso’n nichtsnutziger Telemarketer …» Stimmt nicht.
«Dein Gesicht sagt was anderes, Free-free.»
Ich hasse es, wenn er mich Free-free nennt. Das klingt wie was, das ein Kind zu seinem Hamster sagen würde. Er nimmt noch einen Schluck Orangensaft. Muss wohl der Gin sein, den ich gestern dazugemischt habe. In Kombination mit seinem dämlichen Grinsen und dem Waschbrettbauch ergäbe das eine super Werbung für Tropicana. Ich denke an ihren Slogan: Tropicana – Der Geschmack, den man Ihnen ansieht. Klarer Fall – sofern «dumm» ein Geschmack ist.
«Ich muss mal duschen.» Ich entwirre das Telefonkabel und gehe zum Badezimmer. «Bitte sei weg, wenn ich rauskomme.»
4Nach Hause zu Ma
Vor drei Tagen
Matthew Delaney sitzt auf der brillenlosen Metalltoilette einer Einzelzelle. Ossining, New York, Heimat des Gefängnisses Sing Sing. Auf den nackten Schenkeln hält er einen kleinen Stapel Papiere und wischt sich den Hintern ab.
«Los jetzt, Delaney», drängt der Vollzugsbeamte Jimmy Doyle. Matthew lächelt höflich, bittet um nur noch eine Minute. Der Beamte sieht weg. Sie sehen immer weg. Eine nach der anderen reißt er die Seiten in kleine Stückchen und spült sie runter, zusammen mit seiner Pisse und Kacke.
Dem letzten, zentimeterlangen Rechteck – perfekt zugeschnitten mit der Nagelschere, die er vor über einem Jahr reingeschmuggelt hat – drückt er einen Kuss auf. Auf dem Schnipsel steht «Nessa Delaney».
«Nessa, Nessa, Nessa», flüstert er der Wand seiner eins achtzig mal zweivierzig großen Zelle zu. Ein altes Foto von ihr mit ausgekratzten Augen ist mit Klebestreifen über der Pritsche befestigt. «Ich weiß nicht, was besser ist. Damals mit dir zu schlafen …»
«Mach hin, Delaney.» Doyle öffnet die Stahltür.
Aber Matthew ist noch nicht fertig. «… oder dich jetzt zu finden, dir die Arme abzuschneiden und dein Blut zu trinken?» Ein aufgeregtes Kribbeln im Bauch: die Vorstellung, sie sterben zu sehen, fühlt sich an wie Verliebtheit. Hass und Sehnsucht sind über die Jahre zu einer einzigen Emotion verschmolzen, die er weder verdrängen noch ganz begreifen kann.
Auf dem Weg durch Block C kriecht ihm ein Grinsen übers Gesicht. Am Nordende ist der Med-Sec-Bereich, medium security. Doppelzellen mit Gitterstäben, anders als die Einzelhaft, die Matthew hinter sich hat.
Er schwingt den Beutel mit seiner persönlichen Habe über die Schulter und folgt dem Beamten, mit dem er gut bekannt ist. Die Insassen johlen, bejubeln seinen Abgang. Sie klappern mit Blechtassen an den Gitterstäben und machen Konfetti aus Seifenpapier – wenn einer seine Zeit abgesessen hat, ist das ein Grund zu feiern. Doch da wirft aus der letzten Zelle vor dem nächsten Sicherheitsabschnitt ein Insasse mit «Aryan-Race»-Tattoos Matthew einen Schuh an den Kopf.
Und das Grinsen wird zu Zähnefletschen.
In einer fließenden Bewegung, fast wie einstudiert, lässt Matthew seine Tasche fallen, greift mit beiden Armen in die Zelle und reißt den Häftling mit dem Rücken gegen die Stäbe. Er legt ihm den Arm um den Hals und drückt zu. «Hast du ein Problem, Arschloch?», zischt er den Kerl an, dessen Lippen schon die Farbe verlieren. Antworten kann er nicht: Matthews Ellbogen verschlägt ihm die Sprache.
«Lass den Mist, Delaney.» Der Wachmann packt ihn am Bizeps. «Noch zwei Schritte bis zur Freiheit. Willst du dir das wegen diesem Arsch versauen?»
«Freiheit …» Er lässt den Mann los. «Freedom …»
«Komm jetzt.» Doyle tippt einen Code ein. «Deine Familie wartet.»
Als sie durch die Schleuse sind und eine Minute für sich haben, seufzt Matthew auf, und das Blut verteilt sich aus seinem Kopf wieder in den Rest des Körpers. Er packt den Wachmann freundschaftlich an der Schulter. «Ich kann dir gar nicht oft genug für alles danken, was du für mich getan hast, während ich hier zur Untermiete war, Jimmy.»
«Ich kenn dich, seit wir klein waren, Matty.» Aber Matthew weiß, er verdankt die Hilfe nur dem Umstand, dass seine Mutter für den Wachmann Anlaufstelle Nummer eins für gutes Koks und ein gelegentliches Abendessen gewesen ist. Das war ihm aber gleich, solange er nur die Informationen bekam, die er so dringend wollte: Informationen über Nessa Delaney, heute bekannt als Freedom Oliver, wenn seine Quellen richtig liegen. «Ich komm bald mal bei euch vorbei, muss sowieso mal wieder meine Mom besuchen», fügt Jimmy hinzu.
Als sie ein paar anderen Beamten begegnen, gibt er Matthew einen Schubser. «Beweg dich, Delaney.»
Mastic Beach, New York: einst ein verborgenes Juwel an der Südküste Long Islands, geschmückt mit Ferienhäusern und Bungalows für sommerliche Strandurlauber aus Manhattan. Vor gar nicht allzu langer Zeit war das hier noch ein idyllisches Plätzchen, wo jeder jeden kannte und die Straßen von knackig weißen Gartenzäunen gesäumt waren. Bunt lag Mastic Beach unter blauem Himmel, und alle hörten gern zu, wenn die Alten erzählten, wie es früher war, als die Straßen noch nicht geteert, das Automobil noch nicht erfunden und die Landschaft noch unberührt war. Aus familiengeführten Läden strömte der Duft frischen Brotes durch die Neighborhood Road. Die Jachthäfen quollen über von wunderschönen Segeln, die sich aus der Moriches Bay in den Himmel erhoben.
Dann aber sickerte das Heroin durch die Kanalisation aus Brooklyn ein und ergoss sich auf die Straßen von Mastic Beach. Die Kriminalitätsrate schoss in astronomische Höhen. Wo die Menschen einander auf der Straße früher zulächelten, heben sie jetzt kaum noch den Kopf – vor lauter Furcht, aus heiterem Himmel eins auf die Fresse zu kriegen. Messerstechereien sind so alltäglich wie Supermarktbesuche. Die Alten werden ausgeraubt, die Kinder viel zu schnell erwachsen. Schwanger mit dreizehn? Na, herzlichen Glückwunsch! Und wer tatsächlich ein Stück Rasen hat, das groß genug ist, um als Garten durchzugehen, wurde ziemlich sicher schon das ein oder andere Mal beim Fernsehen von den Scheinwerfern eines Polizeihubschraubers auf der Suche nach einem fliehenden Verdächtigen gestört. Und wenn das passiert, geht man im Kopf schnell die Liste von Unruhestiftern in der unmittelbaren Nachbarschaft durch, bis einem einfällt, hinter wem sie her sein könnten.
Heute ist Mastic Beach ein Sammelbecken für Wohngeldbezieher und registrierte Sexualstraftäter. Auf den entsprechenden Landkarten leuchtet die Stadt wegen Letzteren knallrot. Wie im Megan’s Law vorgeschrieben, bekommen die Anwohner wöchentlich Briefe über Vergewaltiger und Kinderschänder, die nur ein paar Blocks entfernt wohnen. Mittelständische Unternehmen wurden zu Enklaven für arabische Illegale. Und auch Gangs haben sich angesiedelt: die Bloods, die Crips und MS-13. Weiße sind inzwischen in der Minderheit. Aber da sind ja noch die Delaneys. Ihre eigene Gang, sozusagen. Eigentlich ihre eigene Spezies.
Peter braucht nicht zu zählen, wie viele Weinkartons nötig sind, bis Lynn Delaney betrunken ist. Die Antwort lautet zwei, das Äquivalent von sechs Flaschen. Kein Wunder, die Mutter der Delaney-Brüder bringt fast dreihundert Kilo auf die Waage.
Lynn gerät jedes Mal außer Atem, wenn sie das Weinglas hebt und daran nippt. Die tiefen Falten um ihr Lächeln sind fleckig vom Cabernet, und das Lächeln selbst ist kaum hinter der Vierteltonne Speck zu erkennen, die über ein Kingsize-Bett quillt, das statt auf den vorgesehenen Messingfüßen auf Ziegelsteinen steht. Zum ersten Mal, seit Peter denken kann, tut seine Mutter etwas für ihr Äußeres. Lilafarbener Lippenstift ist auf den grauen, hohlen Zähnen verschmiert, dem Ergebnis zu vieler Wurzelbehandlungen vor vielen Jahren, als sie auf so was noch Wert legte.
«Luke», brüllt sie durchs Haus.
«Was?», johlt Luke aus der Küche.
«Gib mal mein Haarspray, da auf der Kommode!» Von der Schreierei muss sie keuchen.
«Sag’s Peter! Der ist näher dran!»
«Peter kann das nicht. Der ist zu blöd.» Aus seinem Rollstuhl beäugt Peter seine groteske Mutter. «Jetzt gib schon das scheiß Haarspray, verdammt.»
«Scheiße, Ma.» Luke stürmt den Flur runter und wirft ihr das Haarspray zu, das keinen Meter von ihr entfernt stand.
Das Fett unter ihren Armen schwabbelt, als sie sich das Aqua Net – eher Feuerzeugbenzin als Haarspray, Haltbarkeit zehntausend Jahre – in die krausen, grauen Locken sprüht. In der Küche brüllen John und Luke die New York Yankees an, eiskalte Dosen Heineken werden aufgerissen. Peter riecht den Fisch an seinen Brüdern, die den Tag am Cranberry Dock verbracht haben.
Eine Menge Männer in dieser Gegend leben noch bei ihren Müttern. Könnte man der beschissenen Wirtschaft in die Schuhe schieben, aber meistens sind es herrische Ladies, die Geld brauchen, und/oder faule Männer. Von beidem gibt es in Mastic Beach mehr als genug.
«Undankbarer kleiner Bastard», knurrt Lynn Luke hinterher.
«Hey, Ma, da kommt Matthew!», schreit John.
«Scheiße, bin ja schon auf dem Weg!» Sie pumpt den restlichen Billigwein aus dem Karton und kramt in einer Pillendose voll verschreibungspflichtiger Tabletten herum, bis sie eine Xanax zum Lutschen findet. Dann zupft sie sich Mascara-Klumpen von den blauen Lidern, streift das lavendelfarbene Nachthemd glatt und stellt mit einem Rülpser eine ihrer Gerichtsshows ab.
Strampelnd quält sie sich auf Mr. Mobility, den bemitleidenswerten Elektro-Scooter, der ihren überbordenden Körper den Flur runterbringt. Peter folgt in seinem Rollstuhl. Vorbei an den Kruzifixen rollt sie, vorbei an den Fotos der Jungs aus der Zeit, als sie wirklich noch Jungs waren. Am Ende des Flurs ein kleiner Tisch, ein Schrein für ihren toten Sohn Mark: ein gerahmtes Foto, von dem aus er in New Yorker Polizeiuniform über ausgebrannte Teelichter hinweglächelt. Sie küsst ihre Fingerspitzen und berührt sein Gesicht auf dem Bild. Sie verehrt die Toten. Machen viele in dieser dreckigen Stadt. Sie gießen die ersten Tropfen jedes Drinks auf den Boden und halten bei Hochzeiten Reden über ruhmreiche verstorbene Verwandte, auch wenn die nichts als Abschaum waren. So ist das eben. Tote werden besungen, Dreckschweine verwandeln sich in Helden. Neben Marks Foto stehen drei lavendelfarbene Kerzen, eine für jede von Lynns Fehlgeburten. Obwohl sie alle drei verloren hat, bevor ihr Geschlecht bestimmt werden konnte, ist sie ganz sicher, weiß es einfach, dass sie alle Mädchen waren, und hat sie entsprechend getauft: Catherine, Mary und Josephine.
Lynn ist irisch-katholisch und lebt prima von Sozialhilfemissbrauch und fünf Söhnen von ebenso vielen Vätern, die lieber ihren Namen angenommen haben als den von Vater Staat. Delaney – ein Name, in dem Ärger und hohe Whiskey-Toleranz mitschwingen. Die Nachbarn scherzen, selbst der Postbote gebe Briefe für die Delaneys einfach den Cops, weil die dort eher früher als später eh vorbeikämen. Als Matthews Auto in die Einfahrt biegt, beobachtet Peter, wie Lynn ihre an der Haustür angetretenen Söhne inspiziert.
Zuerst ihr Jüngster, Luke, dreißig Jahre, der charmante Frauenheld unter den Delaney-Brüdern. Auch als alle Mädchen schon wussten, dass er einigen aus der Gegend Chlamydien verpasst hatte, war er noch unwiderstehlich. Mit dem blonden Haar, den grünen Augen, mit denen er einen förmlich aufspießen kann, und Gerüchten über einen Schwanz wie ein Pornostar, spielte er vor ein paar Jahren noch mit der Idee, Model zu werden. Er hat das aber nie konsequent verfolgt, sondern sich stattdessen entschieden, seinen Lebensunterhalt als Trockenbauer zu verdienen und seinen Samen über ganz Long Island zu verstreuen. Sechs Kinder – von denen er weiß. Peter verzieht den Mund vor dem überwältigenden Gestank des Eau de Cologne, mit dem Luke vergeblich versucht, den Geruch von Schweiß und Staub zu überdecken.
Dann kommt John, ein kräftiger Kerl, der all die rezessiven Gene abbekommen hat: grüne Augen, rotes Haar und ein Gemüt, das die Straße zum Beben bringen kann. Er hat einen silbernen Schneidezahn und das ganze Gesicht voll rotem Bart. Er spricht nicht viel, war schon immer so und wirkt immer zu warm angezogen. Sogar im Sommer trägt er Flanellhemden. John ist als der Kredithai von Mastic bekannt und geht nie ohne seinen Baseballschläger vor die Tür. Wer seine Schulden bezahlen kann, findet keinen Besseren. Wer nicht, ändert am besten seinen Namen und zieht in eine andere Stadt. Zwar weiß jeder, dass er nicht wirklich stumm ist, aber niemand außerhalb der Familie erinnert sich, ihn auch nur ein einziges Mal sprechen gehört zu haben. Lynn kratzt ihm den Bart. «Warum versteckst du bloß immer dein hübsches Gesicht?»
Dann kommt Peter, der im Rollstuhl, der mit der Zerebralparese, den alle für zurückgeblieben halten – manchmal sogar seine eigene Mutter. Peter ist Lynns Vorwand, Behindertengeld vom Sozialamt zu beziehen. Im Gegensatz zu seinen Brüdern sitzt Peter am liebsten in seinem Zimmer, guckt Piratenfilme und liest Bücher im Internet. Er hält sich aus allem Ärger raus. Peter hasst seine Mutter. Sie spricht mit ihm, als wäre er ein Kind, zwingt ihn, Sachen zu essen, von denen sie weiß, dass er sie nicht leiden kann, und stiehlt das ihm zustehende Geld vom Staat, um sich selbst das Maul vollzustopfen, während Peter die Reste bekommt wie ein Schrottplatzhund. Ja, Schrottplatz trifft die Sache gut, das Haus ist ein echtes Messie-Paradies.
Seine Mutter zieht sein weites Spiderman-Shirt zurecht, glättet ihm das schwarze Haar mit Spucke und tut, als bemerke sie nicht, wie er vor ihr wegzuckt. Er flüstert, sie soll sich verpissen, aber niemand hört zu. Oder sie tun zumindest so.
Dann, als wäre ein Damm gebrochen, treten sie alle in einer einzigen, fließenden Bewegung auf die Veranda, um Matthew zu begrüßen. Er steigt aus einem alten Buick und fällt seinen Brüdern johlend und lachend in die Arme, eine durchsichtige Plastiktüte mit seiner «persönlichen Habe» in der Hand. Schwitzkästen und Schläge auf Arme und Oberschenkel sind der traditionelle Delaney-Gruß. Und was wäre das für ein Wiedersehen, wenn nicht die neugierigen Nachbarn rüberglotzten, dieselben, die jedes Mal die Polizei rufen, wenn es bei den Delaneys nachts etwas zu laut wird? Luke macht als Erster eine Bierflasche auf.
«Kommt schon rein!», übertönt Lynn den Tumult.
Matthew hält das Bier gegen das Licht eines bedeckten Himmels. «Junge, nach achtzehn Jahren im Bau war das wirklich Zeit.»
«Wie ist das so, achtzehn Jahre nicht zu vögeln?», witzelt John. Lynn boxt ihn auf den Arm.
«Ich sag mal so: Die Ladys da draußen werden es noch mehr vermisst haben als ich», lacht Matthew auf dem Weg ins Haus. «’tschuldigung, Ma.»
Im Haus läuft Metallica, und sie bringen den Vormittag damit zu, einander auf den neuesten Stand zu bringen. Doch dann ist es Zeit, endlich das Thema anzuschneiden, wegen dem so lang eine Wolke über der Familie hing: Nessa Delaney.
Nessa finden.
Ihre Kinder finden, die Nichte und den Neffen, die sie nie kennengelernt haben.
Beide nach Hause bringen.
Die Familie vereinen.
In Gegenwart von Matthew und ihrer Mutter ist es, als jage elektrischer Strom durchs Rückenmark der übrigen Delaney-Brüder. Die Hintertür zu dem kleinen Garten steht offen, und die Küche riecht nach nassem Herbstlaub und Marihuana. Schwer zu sagen, wo der Oktobernebel anfängt und der Rauch aufhört.
«Achtzehn Jahre sind ’ne lange Zeit zum Nachdenken. Zum Sammeln. Zum Träumen», sagt Matthew, während er an seinem Heineken nippt. Er legt den Kopf zur Seite. «Klar will ich die Fotze tot sehen.» Seine Stimme ist immer so samtig weich wie ein Lied auf einer Beerdigung. Während er die Worte ausspricht, könnte er schwören, Nessas Duft zu wittern. Wie sollte er seine Liebe zu ihr jemals seiner Familie erklären? Wer würde das verstehen? Obwohl er fast sein halbes Leben eingepfercht war wie ein Tier, hat er immer ein Lächeln in den Augen, als könne er es nicht erwarten, der Welt sämtliche Geheimnisse des Universums zu offenbaren. Rings um den Küchentisch rutschen die Jungs nervös auf ihren Stühlen umher. Sie nicken, tun, als verstünden sie ihn, aber nur aus Angst.
«Bringt einfach Mark um. Deinen Bruder. Meinen Sohn», setzt Lynn an, zugedröhnt vom Cocktail aus Xanax und Cabernet. «Versteckt meine Enkel, sodass wir sie nie mehr zu Gesicht kriegen. Marks Kinder.» Geistesabwesend schabt sie sich den roten Lack von den Fingernägeln. Sie spürt, wie ihr das Blut in den Adern gerinnt. Spürt, wie ihr die Füße anschwellen, sich Wasser darin sammelt, weil sie nicht mehr im Bett liegt, entscheidet aber, dass sie nur unterzuckert ist, und stopft sich einen orangefarbenen Cupcake in den Mund. «Und dann schwärzt sie dich an, meinen braven Matthew, und bringt dich für achtzehn verschissene Jahre hinter Gitter.» Lynn schüttelt grinsend den Kopf, und orangige Krümel kullern ihr in die Halsfalten. Sie verschränkt die Finger, fette, kleine Würste, die Enden so rot, als hätte sie jemanden damit aufgeschlitzt. «Nessa Delaney.» Sie streckt die Zunge raus und krümmt sich angewidert, wütend, sich einmal den Nachnamen mit ihr geteilt zu haben. «Diese unverschämte Fotze. Bezahlen soll sie.» Vom Kauen und Schlucken bricht ihr der Schweiß aus. «Und ihre Kinder müssen wir finden. Dafür hat man schließlich Familie, oder?» Ihre Söhne erkennen das Leuchten in ihren Augen, das lodernde Feuer der Arglist, das sie oft sehen, kurz bevor sie was in einem Laden mitgehen lässt, einen Typen auf Craigslist abzockt oder die Jungs schickt, etwas zu besorgen, was wie will, aber nicht haben kann. «Hätten wir schon vor zwanzig Jahren machen sollen.»
«Stimmt, Ma, aber es ist ja auch meine Rache.» Matthew legt eine Hand auf ihre. «Meine genauso wie deine.»
«Die sollten mich heiligsprechen, so verschissen lange, wie ich gewartet hab.»
«Sollten sie, Ma. Und dass du gewartet hast, bis ich raus bin, damit ich meine Rache kriege, bedeutet mir mehr, als du dir vorstellen kannst.» Lynn klimpert mit den Augen angesichts dieser Wertschätzung.
Peter will Einspruch erheben, stolpert aber über seine eigenen Worte. Matthew wirft ihm einen derart grimmigen, hasserfüllten Blick zu, dass er im Rollstuhl erstarrt. Ausdruckslos sagt er: «Und wir halten alle zusammen.»
Zum ersten Mal sieht Peter sich Matthew genauer an. Die dünnen weißen Strähnen an den Ansätzen seines schwarzen Haars lassen ihn noch monströser aussehen als früher. Wie eine langsam zufrierende Löwenmähne. Die blauen Augen sind immer noch zu hell für das übrige Gesicht, diese Augen, die beinahe weiß werden, wenn er etwas Böses tut. Er ähnelt Lynn mehr als je zuvor, nur dass er drahtig ist und hart. Hart vom Knast.
«Aber wie zur Hölle sollen wir sie und die Kinder aufspüren? Sie ist im Zeugenschutzprogramm, seit sie Mark umgebracht hat», stellt John fest, während er einen neuen Joint baut.
«Oh, ihr Kleingläubigen! Im Gefängnis kriegt man alles, wenn die Kohle stimmt. Auch Informationen.» Matthew tippt einen Finger an die Schläfe. «Alles, was ihr über Nessa Delaney wissen müsst, ist hier drin.» Lächelnd blickt er zu Lynn.
In ihrem ganzen Leben war Lynn Delaney noch nie so stolz auf ihre Söhne. Jetzt, wo sie Matthew vor sich hat, scheint sich das lange Warten fast gelohnt zu haben. Jetzt kann er die anderen anführen, kann Lynns Augen und Ohren sein, wenn sie sich aufmachen, ihre Ex-Schwiegertochter zu erledigen. «Ich bitte euch nur um eins: Tut Nessa Dinge an, von denen keine Mutter was wissen will. Bis sie fleht, dass ihr sie umbringt. Und ich brauch ja wohl nicht zu sagen, dass nichts davon auf unsere Familie zurückgeführt werden darf, oder?» Sie seufzt. «Und was eure Nichte und euren Neffen angeht … bringt’s ihnen vorsichtig bei. Seid lieb zu ihnen. Sagt ihnen, ihre Großmutter hat zwanzig Jahre geduldig auf sie gewartet und freut sich drauf, sie in den Arm zu nehmen.» Sie nimmt sich eine Zigarette von John und zieht daran. Ihre Zähne sind verkohlt.
«Sie nennt sich jetzt Freedom Oliver», sagt Matthew.
«Freedom?», spottet Lynn. «Hält sich wohl für besonders clever.»
«Dann lasst uns morgen früh losziehen.» Beim Gedanken an das Blutvergießen muss John grinsen.
«Einen Scheiß!» Vom Scooter aus tritt Lynn gegen den Kühlschrank. «Ich warte keine Minute mehr!» Dampf scheint ihr aus den Ohren zu schießen, kurz davor, das Aqua-Net-Haarspray in Brand zu stecken, wenn sie sich noch mehr aufregt. Sie wischt sich schwarze Katzenhaare von den Ärmeln, sammelt sich mit einem Räuspern und drückt die Zigarette auf dem Küchentresen aus. «Meine lieben, lieben Jungs …» Aus dem Ärmel zieht sie zwei Fünfzig-Dollar-Tütchen Koks und legt mit ihrem Führerschein fünf Lines auf den Tisch. Der Führerschein ist seit Ewigkeiten abgelaufen. Das Haus hat sie seit drei Jahren nicht mehr verlassen. Die Wirbelsäulen der Jungs strecken sich etwas mehr durch. Als sie fertig ist, leckt sie den Rand der Karte ab und rollt einen Zwanzig-Dollar-Schein zu einem Röhrchen. Peter fragt sich unwillkürlich, wie eine Gewohnheitskokserin wie seine Mutter so krankhafte Ausmaße bewahren kann. «Ihr wollt eure Mutter doch nicht warten lassen, oder?» Sie zieht eine Line durchs linke Nasenloch und reicht den Zwanziger ihrem Ältesten. Vom metallischen Geschmack des Koks wackelt ihr der Kiefer, zucken ihre kleinen Finger.
Matthew starrt stur geradeaus, bevor er die nächste Line zieht. «Nein, Mutter, auf uns musst du niemals warten.» Die anderen nicken, würden zu allem Ja und Amen sagen, um was von dem Koks abzubekommen. Sie sehen zu, wie die Nase ihrer Mutter wie üblich zu bluten anfängt, wie ihr das Blut übers Gesicht rinnt und auf dem verbleibenden Orangen-Cupcake landet, rote Flecken auf der weißen Glasur. Aber Lynn schert sich nicht darum, dass ihr warmes Blut drauftropft. Sie stopft ihn sich dennoch ins Maul. Dann blickt sie jedem ihrer Söhne fest in die Augen. «John fährt.» Sie wirft einen Schlüsselbund auf den Tisch. «Die Nummernschilder sind gefälscht, der E-ZPass für die Mautstationen ist gestohlen. So kommt ihr unerkannt und gratis über Brücken und Mautstraßen. Fahrt besser gleich los, sonst bleibt ihr in der Rushhour stecken.»
Und so brechen sie auf. Ihre Herzen schlagen höher vom Koks, von der Vorfreude und ihrer Folgsamkeit.
Vom Fenster aus beobachtet Lynn die Abfahrt von Matthew, Luke und John. Das ist die Rache für Mark, du beschissene Schlampe, faucht sie ihr Spiegelbild an. Eine Königin ist sie, die ihre Wölfe in die Wildnis hinausschickt, auf die Jagd. Als das Auto aus der Einfahrt zurückstößt, fällt ihr Blick auf ihren Nachbarn. Ein alter Mann aus Puerto Rico, der in einem abgerissenen grünen Kleid mit schwarzen Punkten pausenlos im Kreis herumgeht. Seine Tochter hatte schon mal erwähnt, dass er Anzeichen von Demenz zeigt. Ist eigentlich irgendwer noch normal?
Sie leckt sich das Blut von den Lippen, als sie plötzlich Peters Rollstuhl hört. Er stottert, als wollten ihm die Stimmbänder aus der Kehle springen.
«D-du v-v-verd-dammte Dr-drecksschlampe!»
Mit dem Handrücken wischt Lynn sich das Blut übers Gesicht auf die Wangen wie Kriegsbemalung. Sie lächelt. «Und ich dachte, d-du wolltest h-h-heute noch was essen …»
5Es wissen müssen
Heute
Mein Name ist Freedom, und ich kann nicht leiden, wie die Frau mich anglotzt. Ja, schon gut, Antipsychotika, rück sie endlich raus, dann bin ich weg. Die Apothekerin bei Walkers, ich nenne sie die Botox-Bitch. Zu viel Collagen in den Lippen. Vielleicht glotzt sie gar nicht wirklich blöd. Vielleicht sieht sie einfach so aus.
Die Therapie ist nicht meine Idee. Die Marshals zwingen mich dazu. Einmal die Woche, seit achtzehn Jahren. Neunhundertsechsunddreißig Stunden. Und was hat’s genutzt? Ich schnappe mir die Medikamente und verschwinde.
Mein Name ist Freedom, und ich freue mich auf den Tag, von dem an ich nie wieder ZZ