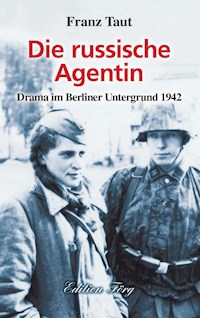16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rosenheimer Verlagshaus
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Nach der Schlacht von Stalingrad zerschlägt die Rote Armee mit einem Großangriff die italienischen Reihen, was zu Chaos und Panik führt. In den fluchtartigen Rückzug der Verbündeten gerät eine deutsche Infanterie-Division. Sie wird aufgespalten, zerrieben, bis auf klägliche Reste zermalmt. Nur in einem kleinen Steppendorf hält sich noch ein verbissener Widerstand. Doch früher oder später müssen die Eingeschlossenen einen Ausbruch versuchen. Der Anschluss an eigene Einheiten gelingt, doch die Rote Armee lässt sie nicht zur Ruhe kommen … Dieser Zeitzeugenroman beruht auf authentischen Erlebnissen des Kriegsteilnehmers Franz Taut, der selbst an der Ostfront verwundet wurde.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Der Ablauf des militärischen Geschehens entspricht der geschichtlichen Wahrheit. Die handelnden Personen sind frei erfunden. Eventuelle Ähnlichkeiten, auch des Namens, sind daher rein zufällig.
LESEPROBE zu Vollständige E-Book-Ausgabe der im Rosenheimer Verlagshaus erschienenen Originalausgabe 2004 Ursprünglich erschienen unter dem Titel »Abendmeldung«.
© 2015 Rosenheimer Verlagshaus GmbH & Co. KG, Rosenheimwww.rosenheimer.com
Titelfoto: © Bundesarchiv Bild 101I-004-3626-16A / Fotograf: Wulf Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling Datenkonvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
eISBN 978-3-475-54492-7 (epub)
Worum geht es im Buch?
Franz Taut
Front ohne Helden Im Schatten Stalingrads
Nach der Schlacht von Stalingrad zerschlägt die Rote Armee mit einem Großangriff die italienischen Reihen, was zu Chaos und Panik führt. In den fluchtartigen Rückzug der Verbündeten gerät eine deutsche Infanterie-Division. Sie wird aufgespalten, zerrieben, bis auf klägliche Reste zermalmt. Nur in einem kleinen Steppendorf hält sich noch ein verbissener Widerstand. Doch früher oder später müssen die Eingeschlossenen einen Ausbruch versuchen. Der Anschluss an eigene Einheiten gelingt, doch die Rote Armee lässt sie nicht zur Ruhe kommen …
Dieser Zeitzeugenroman beruht auf authentischen Erlebnissen des Kriegsteilnehmers Franz Taut, der selbst an der Ostfront verwundet wurde.
1
General Körner überprüfte die Abendmeldung, die ihm zur Abzeichnung vorlag. Der Ia hatte ihm soeben den Bericht über den ereignislosen Ablauf dieses 15. Dezember 1942 herübergebracht. Am bemerkenswertesten war ohne Zweifel, dass wiederum im Divisionsbereich keine Verluste eingetreten waren und dass keinerlei Munitionsverbrauch zu melden war. Und das tief in Russland, sechzig Kilometer südlich des Don, dort, wo der Strom, ostwärts Kalitwa, in zahlreichen Windungen nach Osten zur großen Schleife ausholte und runde fünfzig Kilometer westlich des Tschir, der, nach Süden und dann ebenfalls nach Osten und Südosten fließend, sich bei Werchnetschirskaja in den Don ergoss. Der Don und der Tschir bildeten in stumpfem Winkel die Front, wie sie im letzten Novemberdrittel, nach dem Erdrutsch bei der 3. rumänischen Armee, entstanden war. Etwa zweihundert Kilometer weiter im Osten war jene andere hufeisenförmige Frontlinie, in der sich die vom Russen eingekesselte 6. deutsche Armee, Teile der in alle Winde zerblasenen rumänischen 3. und Teile der 4. deutschen Panzerarmee festkrallten.
Stalingrad war die Hölle; jeder wusste es. In Schepetowka, dem Sitz des Stabes von General Körners Division, dagegen war es ruhig, so ruhig, wie die Meldung in der Hand des Generals es darlegte. Eine Ruhe freilich, an deren Fortbestand weder der General noch sein Ia, Major von Talvern, glaubte.
Der Meldung, die nichts Kriegsmäßiges berichtete, lag die von Tenente Cornalli, dem frisch eingetroffenen Dolmetscher und Verbindungsoffizier, verfasste Übersetzung ins Italienische bei. Erst vor drei Tagen war der Stab der »Fuchskopf«-Division nach Schepetowka gekommen und hatte sich im Schulhaus des von allen russischen Bewohnern verlassenen Ortes einquartiert.
Am frühen Morgen dieses 15. Dezembers war der Ia von seiner Fahrt zum Oberkommando der 8. italienischen Armee zurückgekehrt. Die italienischen Herren hatten hinsichtlich der weiteren Entwicklung der Lage Optimismus zur Schau getragen. Sie waren der Meinung, der Russe habe seine ganze Kraft zur Vernichtung der in Stalingrad Eingeschlossenen konzentriert und sei außer Stande, gleichzeitig auch am Don ostwärts Kalitwa offensiv zu werden. Ein Colonello allerdings, ein Oberst und Regimentskommandeur in einer der von Talvern besuchten Stellungen, Südtiroler aus der Gegend von Meran, hatte dem Ia unter vier Augen unumwunden seine Bedenken mitgeteilt. Bedenken, die Talvern ganz ähnlich schon vor Antritt seiner Fahrt zu den Italienern geäußert hatte.
Major von Talvern, Anton mit Vornamen, mittelgroß und schlank, zweiunddreißig Jahre alt, von einem Gutshof am Chiemsee in Oberbayern stammend, Monokelträger, Inhaber des Ritterkreuzes, Träger des Infanteriesturmabzeichens und der Nahkampfspange, war nicht nur ein fähiger Generalstäbler, sondern auch ein Mann mit dem Ruf schon fast legendärer Tapferkeit. Das Ritterkreuz war ihm im vergangenen Winter, bei Orel, verliehen worden. General Körner wusste, was damals geschehen war. In jenen Tagen hatte er als Oberst das Infanterieregiment 836 geführt. Der Russe war bis zu seinem Regimentsgefechtsstand durchgebrochen. Mit durchschossener Lunge hatte Körner gemeinsam mit den Resten der Stabskompanie den Gefechtsstand verteidigt. In letzter Stunde war Talvern, damals Hauptmann und Ic, mit einer aus Trossleuten, Nachrichtlern und Baupionieren zusammengewürfelten Eingreifreserve auf der Bildfläche erschienen und hatte die Lage bereinigt, wie es so schön hieß. Seither war Körner eng mit Talvern verbunden, mit Talvern, dem Windhund, der in der Ruhe- und Auffrischungszeit in Frankreich wie kein anderer hinter den Mädchen her war und zudem erstaunliche Mengen von Champagner, Cognac und Calvados konsumierte. Wenn er dann entsprechend in Stimmung war, lästerte er sträflich über alles, was das herrschende Regime und dessen Repräsentanten betraf. Mehrmals hatte der General seinen Ia in heikler Situation gedeckt.
Nun saß man, frisch aus dem milden Spätherbst des südlichen Burgund importiert, wieder in Russland, und niemand konnte sagen, was die nächste Zeit bringen würde. Zwar war im Süden, am Sal, Generaloberst Hoth mit der halbwegs aufgefüllten 4. Panzerarmee zur Entsetzung Stalingrads angetreten. Hoths Anfangserfolge waren beachtlich. Seine Armee näherte sich dem Aksaiabschnitt oder war schon darüber hinaus. Aber es gab Gerüchte, die, falls sie sich bewahrheiten sollten, eine entscheidende Wende bedeuten würden. Generalfeldmarschall von Manstein war von der Leningrad-Front zur Übernahme des Katastrophenabschnittes »Don« herangeholt worden. Es hieß, er habe Generaloberst Paulus, dem Oberbefehlshaber der in Stalingrad eingekesselten Verbände, nahe gelegt, mit der 6. Armee und deren Anhang, entgegen dem Befehl, auszubrechen. Manstein, hieß es, beabsichtige, Hitler an die Front zu rufen und in seinem Hauptquartier zu verhaften.
General Körner schüttelte den schmalen Kopf mit dem schütteren, stark ergrauten Haar. Hitler verhaften! Wenn damals, anno 16, als er als junger Oberleutnant vor Verdun lag, jemand geäußert hätte, S. M. solle verhaftet werden! Aber Hitler war nicht der Kaiser, wenn er auch wie dieser Oberster Befehlshaber aller Streitkräfte war.
General Körner fragte sich, ob an den Gerüchten, die Talvern vom italienischen Oberkommando mitgebracht hatte, etwas Wahres sei. Doch wenn dem auch so sein sollte, gab es immerhin nach wie vor eine unbekannte Größe in der derzeit völlig offenen Rechnung. Die unbekannte Größe waren Stärke und Verhalten des Gegners, dem auch jetzt wieder, wie vor seinem Großangriff gegen die Stellungen der Rumänen, eine undurchdringliche Nebeldecke zugute kam. Im Schutze solchen Nebels konnten unerkannt Armeen aufmarschieren. Die große Frage war nur, ob der Russe noch über derart bedrohliche Verbände verfügte. Im Führerhauptquartier, in Rastenburg, bestritt man es. Aber dort war man weit vom Schuss, viel weiter als in Schepetowka.
»Herr General.«
General Körner drehte den Kopf. Der Obergefreite Warnke, Fahrer und Ordonanz in Personalunion, war eingetreten. In lässiger Haltung stand er unweit der Türschwelle der dürftigen Unterkunft, der eine nackte, vom Aggregat mit Strom gespeiste Glühbirne ihr grelles Licht spendete.
»Herr Leutnant Walter wartet draußen«, sagte Warnke. »Er will die Abendmeldung abholen. Kann er reinkommen?«
»Er kann«, erwiderte Körner belustigt. Warnke war völlig unmilitärisch, aber er war zuverlässig, und das war wichtiger als übertriebenes Männchenbauen.
Leutnant Walter, der Gehilfe des Ia, kam herein und nahm die unterzeichnete Meldung entgegen. Kurz nachdem er sich entfernt hatte, klingelte das Feldtelefon. General Körner hob ab.
»Ja, was gibt es? Ach Sie sind’s, Talvern.«
Am anderen Ende, drüben, im knapp fünfzig Meter entfernten Schulhaus, sagte Major von Talvern: »Eine tolle Neuigkeit, Herr General. Vorn am Don, beim italienischen Bataillon ›Derrutti‹, ist ein russischer Überläufer aufgetaucht. Wenn man dem Überläufer Glauben schenken kann, steht ein Großangriff starker russischer Verbände unmittelbar bevor.«
»Wenn das zutrifft«, fuhr Talvern nach kurzer Pause fort, »kann es fürs Erste nur von Vorteil sein, dass das Artillerieregiment die schwere Batterie nach Lysselkowo vorgezogen hat. Fraglich ist allerdings, ob die Italiener der Batterie im Falle eines Russeneinbruchs oder – durchbruchs ausreichend Infanterieschutz geben können. Aus diesem Grund schlage ich als erste Maßnahme vor, dass wir die Pionierkompanie, die in Jeminowka liegt, sofort nach Lysselkowo in Marsch setzen.«
Der General stimmte zu. »Und was weiter, Talvern?«, fragte er.
»Ich bin in wenigen Minuten bei Herrn General«, gab der Ia zurück.
»Schön.«
General Körner legte auf. Nun war es also doch so weit, sofern man den Überläufer nicht, wie gehabt, von drüben zur Irreführung herübergeschickt hatte.
Der General wandte sich der Tür zum Nebenraum zu.
»Hostege!«
Die Tür ging auf. Major Hostege, untersetzt, mit rundem, rosigem Gesicht, erschien. Er war IIa im Divisionsstab und Adjutant.
»Herr General?«, fragte er mit der ihm eigenen Beflissenheit.
»Wir werden vermutlich einiges zu tun bekommen«, sagte General Körner. »Allem Anschein nach steht bei den Italienern etwas bevor. Wir tappen noch im Dunkeln – buchstäblich, denn es wird ja kaum mehr Tag.«
In diesem Augenblick klopfte es an der Außentür. General Körner drehte sich um.
»Herein!«
Major von Talvern trat ein, straff aufgerichtet, die Schirmmütze unter den linken Arm geklemmt. Den rechten Arm reckte er steil hoch zum vorschriftsmäßigen »deutschen Gruß«. Für General Körner, der Talverns Einstellung zu kennen glaubte, war diese Übertreibung jedes Mal wie offener Hohn. Aber die Gesinnung eines Mannes war nicht zu reglementieren, und Talvern war im Übrigen ein hervorragender Offizier und Generalstäbler. Großen Wert legte er auf militärische Formen. Seine Feldbluse, mit dem Ritterkreuz und allen sonstigen Auszeichnungen dekoriert, war ebenso tadellos gebügelt wie die Breeches mit den breiten karminroten Streifen. Vor dem linken Auge saß das Monokel, jenes nicht mehr ganz zeitgemäße Attribut, das Talverns hagerem Gesicht einen Ausdruck von Arroganz verlieh.
Er ging zu der Karte, die zwischen den beiden kleinen, vollständig vereisten Fenstern an der Wand befestigt war, und begann sofort mit seinem Vortrag. Die Division war in Alarmbereitschaft versetzt worden. Talvern hatte wieder einmal an alles gedacht.
Mit einer Verbeugung zu General Körner hin beendete er seine Ausführungen.
»Ich glaube, mehr können wir für den Augenblick nicht tun, Herr General.«
»Ja, Talvern, das scheint mir auch so. Aber nehmen Sie doch Platz. Wie wär’s mit einem Cognac?«
»Herr General wissen doch«, meinte Talvern mit mokantem Lächeln.
»Ja, ja, ich weiß«, bestätigte General Körner trocken. Major Hostege brachte Gläser und eine Cognac-Flasche aus dem Bestand, den man vor dem Abmarsch aus Frankreich für die triste Zeit in Russland gesichert hatte. Steif schenkte Hostege ein, bevor auch er an dem kleinen Tisch Platz nahm.
Der General bot Zigaretten an. Talvern förderte ein Päckchen englischen »Navy cut« zu Tage. »Von einem der italienischen Herren«, sagte er mit leichtem Grinsen. »Die Herren sind gut versorgt. Sie haben angenehme Quartiere, sogar vorn in den Stellungen habe ich einen gewissen Komfort vorgefunden. Anscheinend hat man sich auf einen längeren Aufenthalt eingerichtet.«
Talvern beugte sich vor.
»Es ist genau so, wie es im November bei den Rumänen gewesen sein soll. Dichter Nebel über dem Don und beiden Ufern. Seit zehn Tagen ist jede Luftaufklärung flach gefallen. Ich habe mir übrigens die vorbereiteten Auffangstellungen angesehen. Alles sehr schön. Aber wenn unsere Freunde überrannt werden wie vor kurzem die Rumänen! Wir kämen zweifellos in Teufels Küche, denn wir müssten nicht nur mit Front nach Norden, sondern auch mit Front nach Osten halten. Wenn der Russe die Italiener am Don angreift, müsste er gleichzeitig auch am Tschir angreifen.«
»Dann«, warf Major Hostege, der bisher geschwiegen hatte, mit gepresster Stimme ein, »dann hätte Generaloberst Hoth keine Chance mehr, die Stalingradarmee zu erreichen.«
»Hat er die überhaupt?«, fragte Talvern in sarkastischem Ton.
Hostege hob den Kopf. Die Röte seines vollen Gesichtes vertiefte sich.
»Ich muss doch bitten, Herr von Talvern. Die sechste Armee in Stalingrad hat das Wort des Führers.«
»Hier geht es nicht um das Wort eines Mannes«, versetzte Talvern gereizt. »Hier geht es nicht um Mythen, Herr Hostege. Rund dreihunderttausend Mann sind an der Wolga eingeschlossen. Der Russe ist im Gegensatz zur offiziellen Auffassung ungeheuer stark geworden. Er hat sich seit dem Sommer in erschreckendem Ausmaß erholt. Das sind die Fragen, um die es jetzt geht.«
»Glauben Sie, der Führer weiß das nicht besser als Sie?«, warf Hostege bissig ein.
Talvern maß den anderen mit spöttischem Lächeln. »Sie machen es sich einfach, Herr Hostege. Der Führer wird’s schon richten, wie?«
Hostege pumpte seine Lungen voll Luft, ehe er mit Pathos erklärte: »Ich glaube an das Wort des Führers.«
Talvern nahm das Monokel ab und betrachtete es aufmerksam, als enthülle es ihm die Geheimnisse der nächsten Zukunft.
»Sie werden sich noch wundern, Herr Hostege«, sagte er schließlich.
General Körner hob beschwichtigend beide Hände. »Aber meine Herren! Jetzt ist doch nicht die Zeit für eine solche Auseinandersetzung!«
Unbemerkt hatte sich die Tür geöffnet. Der Obergefreite Warnke stiefelte gemächlich herein.
»Draußen steht ein italienischer Leutnant«, sagte er, ohne von der Anwesenheit der beiden Majore Notiz zu nehmen. »Er möchte sich bei Ihnen melden, Herr General.«
General Körner erhob sich. Talvern und Hostege folgten seinem Beispiel.
Mit kurzen, flinken Schritten kam Tenente Cornalli durch die Tür. Am Morgen war er mit dem Ia in Schepetowka eingetroffen. Er war schlank und kaum mittelgroß. Seine steingraue Uniform war noch eine Spur eleganter geschnitten als die des Ia. Sein welliges schwarzes Haar schimmerte im Lampenlicht wie gelackt, ebenso wie seine hohen, nach Maß gearbeiteten Stiefel. Er nahm Haltung an, verbeugte sich vor dem General und sagte: »Leutnant Cornalli, Verbindungsoffizier und Dolmetscher, meldet sich zur Stelle.«
General Körner reichte dem Italiener die Hand.
»Bitte, stehen Sie bequem, Herr Leutnant«, sagte er in freundlichem Ton. »Sie wollen also hier in Schepetowka mit uns Weihnachten feiern.«
»Mit großem Vergnügen, Herr General«, erwiderte Cornalli in seinem etwas singenden, aber sonst einwandfreien Deutsch.
Er verbeugte sich nun auch vor Talvern, der mit den Worten »Wir kennen uns ja von der Fahrt her« lässig abwinkte. Major Hostege dagegen sagte gespreizt: »Ich bin sehr erfreut, einem italienischen Kameraden und Achsenpartner die Hand zu drücken.«
Himmel!, dachte Talvern, ein Zweihundertfünfzigprozentiger – dieser Hostege! Der General war nicht darum zu beneiden, den größten Teil seiner Zeit mit diesem Parteihengst zusammen zu sein. Im Übrigen war durchaus nicht klar, wozu dieser Fanatiker gegebenenfalls fähig war.
Tenente Cornalli kippte den Cognac, der ihm angeboten wurde. Dann meldete er sich ab. Talvern schloss sich ihm an. Eine lange Nacht stand ihm bevor. Noch war alles still. Aber Talvern hatte es im Gespür, dass die ohnehin verdächtige Stille nicht mehr lange anhalten würde.
Am Vormittag dieses 15. Dezember war die dritte schwere Batterie der ersten Abteilung des Artillerieregiments 786 in Lysselkowo eingerückt, zweiundzwanzig Kilometer vom Divisionsgefechtsstand entfernt.
Hauptmann Martin, der Batteriechef, war bei seinen Männern beliebt. Aber jetzt hassten sie ihn und wünschten ihm alles Schlechte an den Hals. Vor einer halben Stunde, schon in tiefer Dunkelheit, hatte man sie aus den Quartieren gescheucht. Jetzt waren sie mit Spaten und Pickeln dabei, am Ortsrand von Lysselkowo Deckungslöcher in die verschneite, beinhart gefrorene Erde zu wühlen.
Auf einem Meldekrad fuhr Hauptmann Martin umher und überzeugte sich vom Fortschritt der befohlenen Arbeiten. Zwar herrschte vollkommene Ruhe in der nächtlichen Schneewüste, die in dichten Nebel eingehüllt war, aber der alarmierende Anruf der Abteilung sagte genug.
Als er die Feuerstellung am nördlichen Ortsrand verlassen hatte, fluchten die Kanoniere hinter ihm her. Blödsinn, dieser Zirkus! Als ob der Russe in der nächsten Stunde vor Lysselkowo stünde! Eine Alarmübung, meinten einige, damit die Knochen nicht einrosteten. Aber die Mehrzahl war der Überzeugung, der »Alte« wäre übergeschnappt.
Sogar der Schirrmeister, Wachtmeister Urban, war nahe daran, zu meutern, als der Chef ihm befahl, sämtliche entbehrlichen Fahrzeuge, vor allem die Zugmaschinen, in der Balka in Deckung zu bringen, einer jener schmalen, tief eingeschneiten Schluchten, wie sie überall in den Steppen Russlands zu finden sind.
In der grimmigen Kälte schippten die Fahrer den mehrere Meter hoch angewehten Schnee aus der Schlucht. Erst tief in der Nacht war es möglich, die Fahrzeuge heranzuholen. Zu allem Überfluss begann es auch wieder zu schneien. Oder war es Treibschnee, den der schneidende Wind in Wolken vor sich herjagte?
Unterdessen geisterte Hauptmann Martin durch das Dorf. Die russischen Bewohner von Lysselkowo waren schon im Sommer, bei Beginn der Kämpfe, abgezogen. Eine Zeit lang hatten Rumänen in dem Ort gehaust und später, bis vor kurzem, eine italienische Nachschubeinheit. Viel Brennbares war nicht mehr zu finden, aber so viel war es doch immerhin, dass die Quartiere wenigstens einigermaßen angewärmt waren. Kleine Lehmkaten waren es, dicke Schneehauben saßen auf den Strohdächern, und die mit vergilbtem Zeitungspapier beklebten winzigen Fenster waren mit Eisblumen bedeckt. Auch im Dorf wurde gearbeitet. Vor den Hütten wurde Schnee aufgehäuft und danach mit Wasser übergossen. Mit den so entstehenden Eispanzern hatte man im vergangenen Winter gute Erfahrungen gemacht. Sie schützten gegen Granatsplitter und hielten sogar Gewehr- und MG-Geschosse ab.
Im Haus neben dem Quartier des Chefs, in dem auch Leutnant Holler, der Beobachtungs-Offizier, und die Männer des Batterietrupps untergebracht waren, hatte sich die Nachrichtenstaffel eingerichtet. Die Fernsprecher hatten mehrere Stunden lang Leitungen gelegt; jetzt schippten sie draußen wie alle anderen und murrten über den Irrsinnseinfall des Chefs. Nur die Fernsprechwache war im Haus. Am Funkgerät in dem gesonderten Raum des Funktrupps saß Unteroffizier Kolb, der Nachrichtenstaffelführer. Er hatte die Kopfhörer angelegt; das Gerät befand sich auf Empfang. Wofür dieser ganze Aufwand gut war und weshalb man Wachtmeister Fendt nach Einbruch der Dunkelheit zu den Italienern in Marsch gesetzt hatte, war selbst Kolb, dem »Intelligenzler«, der sonst vieles durchschaute, völlig unverständlich. Doch so viel Umsicht traute er dem Chef zu, dass der nicht aus einer Laune oder gar aus Bosheit die Batterie am Abend hochgescheucht hatte. Und schließlich war ja da auch der Anruf der Abteilung. Vermutlich war doch etwas Besonderes im Gange. Schon mehrmals hatte der Chef nachgefragt, ob Fendt sich gemeldet habe.
Jetzt kam er wieder, schüttelte den Schnee von der verbeulten Feldmütze und knöpfte den Übermantel auf, den er über dem Tarnanzug trug.
»Nichts, Herr Hauptmann«, sagte Kolb, »immer noch nichts.«
Hauptmann Martin nickte und murmelte: »Schlechtes Fahren in der Dunkelheit, dazu dieser Nebel und der Schnee.« Er zündete sich eine Zigarette an, rauchte ein paar Züge und fügte dann hinzu: »Wir sind draußen so weit fertig. Ich gehe ins Quartier. Lassen Sie mich wecken, sobald Fendt Laut gibt.«
Kolb hatte die Kopfhörer abgestreift. Die Miene des Chefs war verschlossen, als trüge er etwas mit sich, was ihm ernste Sorgen bereitete.
Hauptmann Martin merkte, dass der Unteroffizier etwas sagen wollte.
»Ist noch was, Kolb?«, fragte er.
»Ist der Russe vorn bei den Italienern durch?«, brachte Unteroffizier Kolb stockend hervor.
»Unsinn, Menschenskind!«, antwortete Hauptmann Martin mit erzwungener Heiterkeit. Ohne ein weiteres Wort ging er hinaus. »Streng geheim«, hatte der Kommandeur ihm bei seinem Anruf eingeschärft, »wenn es bekannt wird, drehen uns die Hiwis schon vorher durch.«
Die Hiwis waren eines der Probleme der Division. Nach der letzten großen Kesselschlacht, im Mai, südlich von Charkow, hatte man ein paar Hundert von ihnen eingestellt, um die im Winter entstandenen Fehlstellen einigermaßen auszugleichen. Man hatte die Ukrainer, Weißrussen, und was sie immer waren, nach Frankreich mitgenommen. Nun waren sie – offensichtlich zu ihrem Missvergnügen – mit der Division in ihre russische Heimat zurückgekehrt. Auch in der dritten Batterie waren etliche von ihnen. Einige der Zuverlässigsten bei der Munitionsstaffel, alle übrigen beim Tross.
Hauptmann Martin ging die paar Schritte zu seinem Quartier hinüber. Unter seinen Filzstiefeln knirschte der Schnee. Sonst war es still in Lysselkowo. Kein Lichtschein, tiefe Dunkelheit. Johlende Windstöße und stiebender Schnee, der wie tausend Nadeln ins Gesicht stach. Welch ein Gegensatz: Aus dem milden Spätherbst des südlichen Frankreich ins winterliche Russland! Man selbst hatte ja schon einen russischen Winter durchgestanden, aber viele waren als Ersatz neu zur Division gekommen, im Sommer, als man in Frankreich in Ruhe lag. Eilig ausgebildete Rekruten zumeist, die den Osten und den russischen Gegner nur vom Hörensagen, von Zeitungsberichten und von der Wochenschau kannten.
Allem Anschein nach ist da ein verdammt fauler Braten im Rohr, dachte Hauptmann Martin. Doch was auch geschehen mochte, er war entschlossen, es diesmal nicht so weit kommen zu lassen wie im vergangenen Winter, als sie hinten am Donez die Geschütze sprengen und sich bei meterhohem Schnee mit dem Karabiner durch den Feind schlagen mussten.
Durchgefroren betrat er die Kate, die man für ihn als Quartier ausgesucht hatte. In der kleinsten der drei vorhandenen Stuben erwartete ihn Leutnant Holler, auch ein Neuer ohne Osterfahrung.
Martin nahm die Feldmütze ab und zog den Übermantel aus.
»Nun, Herr Holler«, fragte er, »haben Sie noch was auf dem Herzen?«
»Warum das alles, Herr Hauptmann?«, fragte Holler, der befehlsgemäß draußen mit den anderen Spaten und Pickel geschwungen hatte. »Warum diese Schinderei im Dunkeln bei diesem Frost?«
»Ja, warum«, sagte Hauptmann Martin unbewegt. »Vielleicht wird Ihnen schon morgen Früh jemand anders die Antwort geben.«
Rittmeister von Ehrenfeld erwachte aus unruhigem Schlaf. Ehrenfeld war Balte. In seiner Jugend, während der Kämpfe im Baltikum, hatte er als Fähnrich eine Schwadron in einem der Freiwilligenverbände geführt. Dem Divisionsstab gehörte er als Russlandexperte und Dolmetscher für Ostsprachen an. Zudem war er Chef der als Stabswache eingeteilten Ost-Kompanie, die er selbst im vergangenen Frühsommer aufgestellt hatte.
Ehrenfeld bewohnte allein eine der dürftigen Hütten von Schepetowka, die so grau und trostlos aussahen, als hätte die Steppe selbst sie hervorgebracht. Er erwachte, aufgestört durch ein Geräusch, das wie das gepresste Stöhnen eines Sterbenden anzuhören war. Dazu war es, als scharrte jemand an der Tür.
Ehrenfeld schlüpfte in seinen Mantel. Sicherheitshalber griff er zur Maschinenpistole, ging zur Haustür, die mit einem Holzriegel verschlossen war. Die Waffe schussbereit im Arm, schob er vorsichtig den Riegel zurück.
Im Schnee vor der Tür lag, sich krümmend und sich windend, ein Mann. Auf dem Kopf trug er eine pelzbesetzte Mütze, wie Ehrenfeld sie für die Hiwis seiner Ost-Kompanie hatte anfertigen lassen.
Ehrenfeld beugte sich nieder. Im fahlen, schwachen Licht, das vom Schnee ausging, erkannte er den Mann, der sich offensichtlich mit letzter Kraft zu seiner Tür geschleppt hatte. Es war Nikolai Doroschenko. Erst vor kurzem war der Ukrainer zum Unteroffizier befördert worden. Er versuchte zu sprechen, doch nur unartikulierte Laute kamen über seine Lippen.
Ehrenfeld fasste den Mann unter den Armen und schleifte ihn in die Kate. Er schloss die Tür und verriegelte sie. Dann zündete er die Kerosinlampe an, die auf einem kleinen Tisch stand. Im Lichtschein der Lampe sah er: Doroschenkos feldgrauer Mantel war am Rücken mit Blut durchtränkt.
Partisanen, dachte der Rittmeister, während er neben dem Ukrainer niederkniete. Partisanen in Schepetowka! Aber warum hatte Doroschenko, der ja heute Nacht Wachhabender war, nicht seine Landsleute im Kolchos alarmiert, anstatt sich durch den Schnee hierher zu schleppen?
Mühsam hob Ehrenfeld den verwundeten Ukrainer hoch. Wankend trug er ihn zu dem mit schwarzem Wachstuch bezogenen Einheitssofa.
»Doroschenko«, rief er, »ich muss wissen, was geschehen ist!«
Doroschenko blieb stumm. Blicklos starrten seine Augen ins Leere.
Ehrenfeld wandte sich von dem Toten ab. Hastig kleidete er sich an. Mantel, Mütze, das Koppel mit der Pistole. Die MP nahm er mit. Doch vor der Tür seiner Unterkunft, in der eisigen Dunkelheit, verharrte er einen Moment unschlüssig. Wohin zuerst: zum Schulhaus oder zum Kolchos, wo die Ost-Kompanie einquartiert war? Er entschied sich für die Schule. Dort war die Zentrale. Von dort aus konnten, wenn wirklich Partisanen in Schepetowka eingedrungen waren, wirksame Gegenmaßnahmen eingeleitet werden.
Der Posten vor dem Schulhaus, das knapp fünfzig Meter entfernt war, rief Ehrenfeld an.
»Halt! Parole!«
»Mackensen.«
Der Posten gab den Eingang zum Schulhaus frei. Als er den Rittmeister erkannte, nahm er Haltung an. Ehrenfeld jagte die Treppe zum ersten Stockwerk hinauf. Er klopfte an die Tür, an der das Schild mit dem Aufdruck »Ia-Geschäftszimmer« befestigt war.
Ehrenfeld betrat den Raum, an dessen einer Wand einfache Schulbänke aufgetürmt waren. Der Gefreite, der Telefonwache hatte, sprang auf. Im gleichen Augenblick öffnete sich die Verbindungstür zum Nebenraum. Im Türrahmen stand Major von Talvern, und hinter ihm zeigte sich Leutnant Walter, der O I.
»Sie, Herr von Ehrenfeld?«, rief Talvern verwundert. »Und so kriegerisch, mit Maschinenpistole! Was verschafft uns Ihren Besuch zu so später Stunde?«
»Unteroffizier Doroschenko ist tot, Herr Major.«
»Doroschenko – wer ist das? Bitte drücken Sie sich etwas deutlicher aus, Herr Rittmeister!«
Talverns Stimme klang gereizt. Er hatte Dringendes zu tun. Niemand konnte sagen, wie viel für die Division, ja, womöglich für die ganze Front von der Planung dieser Nacht abhing.
Rittmeister von Ehrenfeld verbeugte sich steif.
»Verstehe, Herr Major. Bin etwas konsterniert. Dachte an Partisanen. Doroschenko war einer der zuverlässigsten Gruppenführer unserer Hiwi-Einheit. Ich fand ihn schwer verwundet vor der Tür meines Quartiers. Ehe er sprechen konnte, ist er gestorben. Beim Kolchos muss etwas passiert sein, Herr Major. Dachte, ich sollte als Erstes hier Meldung von dem Vorfall machen.«
Talvern nickte. »Richtig.« Schon war er beim Feldfernsprecher, hob den Handapparat ab, drehte die Kurbel und verlangte »Ringstraße«. Es war der Deckname der Feldgendarmerie.
»Schicken Sie zwei Mann zum Kolchos«, befahl er, als die Verbindung hergestellt war. »Lassen Sie feststellen, was dort anliegt. Einer der Russen, Unteroffizier Doroschenko, ist tödlich verwundet worden.«
Talvern legte auf. Er wandte sich zu Ehrenfeld.
»Partisanen«, sagte er kopfschüttelnd, »nein, ich glaube viel eher an etwas anderes.«
»Herr Major glauben, dass meine Russen gemeutert haben?«, fragte Ehrenfeld betroffen.
Talvern wiegte den Kopf.
»Das wäre auch möglich. Aber ich befürchte, dass es den Brüdern hier zu ungemütlich wurde. Dass sie sich empfohlen haben, Herr Rittmeister. Und das wäre kein gutes Zeichen.«
»Das – das wäre unfassbar, Herr Major«, stammelte Ehrenfeld. »Wenn Herr Major gestatten – ich will mich selbst vergewissern.«
Aufgeregt verließ der Rittmeister die Abteilung Ia. Wenig später klingelte der Fernsprecher. Hauptmann Eyrich, der Chef der Feldgendarmerie, bestätigte Major von Talverns Befürchtung: Die Ost-Kompanie war mit Waffen, Munition und der gesamten sonstigen Ausrüstung aus Schepetowka verschwunden. Eyrich sprach die Vermutung aus, der ukrainische Unteroffizier habe sich dem Ausbruch widersetzt und sei von seinen Landsleuten überwältigt worden.
Talvern rief im Quartier des Divisionskommandeurs an.
»Die Hiwis sind fort«, sagte er, als General Körner sich mit verschlafener Stimme meldete. »Wir wissen ja, der Russe hat den sechsten Sinn für Neuigkeiten. Wir haben jetzt Mitternacht. In sechs oder sieben Stunden werden wir mehr wissen. Aber es wird nichts Gutes sein, Herr General.«
Um fünf Uhr morgens erreichte Wachtmeister Fendt, Hauptmann Martins Beauftragter, den mit Schnee bedeckten Erdbunker, der dem Stab des Bataillons »Derrutti« als Unterkunft und Gefechtsstand diente.
Der Kübelwagen, mit dem Hauptmann Martin den Wachtmeister am vergangenen Abend zu den Italienern in Marsch gesetzt hatte, war in der Dunkelheit von der Rollbahn abgekommen und in einer tiefen Schneewehe stecken geblieben. Stundenlang hatten Fendt und der Fahrer des Chef-Kübels, der Obergefreite Erdmann, sich abgemüht, bis das Fahrzeug wieder flott war. Fendt hatte zunächst erwogen, sogleich zur Batterie nach Lysselkowo zurückzukehren, doch anscheinend lag dem Batteriechef sehr viel daran, zu erfahren, wie es vorn bei den Italienern aussah. Und da kaum zu erwarten war, dass der Nebel sich am Morgen lichten würde, und der Schneefall, der schon vor Stunden eingesetzt hatte, zudem ständig zunahm, war sicher nicht zu befürchten, dass man die Rückfahrt unter Feindeinsicht würde antreten müssen.
In dem Bunker, der in mehrere Räume abgeteilt war, wurde Wachtmeister Fendt, der über der Uniform den weißen Tarnanzug und darüber wie der Fahrer einen Wachmantel aus Schafspelz trug, von einem schwarzhaarigen Korporal empfangen.
Der Korporal sprach kein Wort Deutsch und Fendt kein Italienisch, aber so viel verstand der Italiener doch, dass der Deutsche den Capitano, der den Bataillonskommandeur vertrat, dringend sprechen wollte. Vielleicht hing es mit dem Überläufer zusammen, den man am vergangenen Nachmittag vereinnahmt und nach kurzem Verhör zum Regimentsstab in Marsch gesetzt hatte.
Der Korporal verschwand hinter einer Zeltbahn. »Pronto, pronto«, sagte er, als er wieder auftauchte. Wenig später kam Capitano Berti, ein groß gewachsener, sehr schlanker Offizier mit tiefschwarzem, glatt anliegendem Haar, hinter der Zeltbahn hervor. Er streckte Fendt seine Rechte entgegen.
»Molto bene! Ich habe schon nicht mehr mit Ihrem Kommen gerechnet. Man hat bei meiner Funkstelle angefragt.«
Sein Deutsch war mustergültig. Fendt atmete auf. Man brauchte keinen dieser lästigen Dolmetscher einzuschalten.
Plötzlich jedoch blieb Capitano Berti stehen. Seine Hand fiel herab. Sein scharf geschnittenes, längliches Gesicht, grell von der an einem Deckenbalken hängenden Benzinlampe beleuchtet, wurde maskenhaft starr.
In die Stille der Front, die auch während Fendts Fahrt durch Dunkelheit und Schnee nur zeitweilig durch einen Artillerieschuss unterbrochen worden war, schnitt jäh ein dumpf grollendes Donnergeräusch, gedämpft, wie aus großer Entfernung, aber deshalb nicht weniger drohend.
»Kalitwa«, murmelte der Capitano zwischen den Zähnen, »das muss bei Kalitwa sein.«
Kalitwa, fragte sich Fendt, war das nicht ein Ort westnordwestlich, stromaufwärts am Don, etwa hundert Kilometer entfernt?
»So weit trägt der Schall nicht«, sagte er.
Das Geräusch pflanzte sich fort; es kam näher, rasend schnell immer näher! Der Russe trommelt, dachte Fendt, es geht los! Sekundenlang überlegte er. Sollte er Hauptmann Martin Meldung machen? Aber wichtiger war es, den Fahrer und natürlich auch das Funkgerät, das im Wagen war, in Sicherheit zu bringen.
Schon war Fendt beim Ausgang des Bunkers. Und während er durch den kurzen, von Bohlenwänden eingefassten Laufgraben hastete, warf er den schweren, behindernden Schafspelzmantel ab. Der fahle Schein ununterbrochen zuckender Mündungsblitze erhellte gespenstisch die Mauerstümpfe des zerschossenen Uferdorfes.
Während der Feuerschlag mit brüllendem Getöse den Abschnitt des Bataillons »Derrutti« erfasste und zusehends weiter nach Osten übersprang, dieses tausendschlündige Wummern, Krachen und Bersten, erreichte Wachtmeister Fendt das halbwegs erhaltene Haus, hinter dem sie bei der Ankunft den Kübelwagen abgestellt hatten. Der Wagen stand am Ort, auch das Tornister-Funkgerät war vorhanden. Verschwunden dagegen war der Obergefreite Erdmann.
»Erdmann!«, rief Fendt, obgleich er wusste, wie sinnlos es war, gegen das Höllengebrüll des russischen Trommelfeuers ankommen zu wollen.
Mit Feuerblitzen krepierten die ersten Granaten in der Nähe. Mauerreste stürzten ein, Schneestaub und Erdbrocken wurden hochgeschleudert.
»Erdmann!«, rief Fendt noch einmal. Der Obergefreite antwortete nicht. Sicher hatte er sich mit der Findigkeit des erfahrenen Frontsoldaten irgendwo in Deckung gebracht.
Fendt sprang in den Laufgraben hinunter, das schwere Funkgerät im Arm. Die Luft war durchsetzt mit dem bitteren Geruch von Pulverqualm. Zur Linken schlugen Flammen hoch.
Fendt sah vor sich den Eingang des Bunkers. Die Öffnung schien zu schwanken, die Erde schwankte, es war wie der Weltuntergang, wie das Ende von allem. Fendt fand sich im Dunkeln, die Lampe war erloschen. Dann dröhnte ein Schlag wie von einer Riesenfaust auf die Decke des Bunkers. Splittern, Bersten, etwas traf Fendt am Kopf. Rot kreisendes Licht, dann Schwärze, in die Fendt trudelnd hinabstürzte. Und dann nichts mehr; Wachtmeister Fendt hatte das Bewusstsein verloren. Er hörte nicht das Rumoren und Rasseln der vom Don heraufkriechenden Panzer und nicht das »Urrä« der russischen Angriffswellen.
2
Major von Talvern legte den Handapparat des Feldtelefons auf. Nichts. Schepetowka war schon seit Stunden von der Außenwelt abgeschnitten. Sämtliche Fernsprechverbindungen waren unterbrochen. Waren die Russen, nachdem sie am frühen Morgen dieses 16. Dezember 1942 zum Großangriff gegen die italienischen Stellungen am Don angetreten waren, schon so weit vorgestoßen – mit Reitertrupps wie vor siebenundzwanzig Tagen ins Hinterland der 3. rumänischen Armee? Oder hatten Partisanen die Kabel durchschnitten? Oder hatten die verschwundenen Hiwis geheime Sabotagebefehle durchgeführt?
»Die Leitungen sind tot«, sagte Talvern zu General Körner, der sich über die große, über zwei Tische ausgebreitete Karte beugte.
General Körner wischte mit dem Rücken seiner knochigen Hand über die Karte, als wolle er etwas auslöschen, was mit Kohle eingezeichnet war und den Eindruck erweckte, als sei es unaustilgbar.
Nimm doch wenigstens jetzt dein Monokel ab, dachte der General, irritiert durch die Selbstsicherheit, die der Ia auch jetzt noch zur Schau trug, als wäre nichts Bemerkenswertes geschehen. Dabei befand man sich in völliger Ungewissheit. Seit dem alarmierenden Anruf des Verbindungsstabes beim Oberkommando der 8. italienischen Armee hatte man nichts mehr gehört. Weder von vorn, von der Front, noch aus dem Hinterland. Man wusste nicht, ob die Italiener den Angriff abgewehrt hatten, ob im Falle von Feindeinbrüchen die Auffangstellungen besetzt worden waren, ob die Donfront überhaupt noch bestand. Nach dem Anruf vom italienischen Oberkommando hatte General Körner die Regimentskommandeure und die Kommandeure der selbstständigen Formationen, wie es das Pionierbataillon, die Panzerjägerabteilung und die Aufklärungsabteilung waren, nach Schepetowka befohlen. Seit der Besprechung waren Stunden vergangen, aber bisher war in der Funkstelle, die nach dem Ausfall der Fernsprechleitungen mit den Teilen der Division Verbindung hielt, kein Spruch eingegangen, der zur Klärung der undurchsichtigen Lage hätte beitragen können. Und die Funkanlage des italienischen Oberkommandos schwieg.
Im Schulhaus von Schepetowka war es kalt. General Körner trug seinen pelzgefütterten feldgrauen Mantel mit den prächtigen roten Aufschlägen und den golddurchwirkten geflochtenen Schulterstücken. Bei der Ankunft in Schepetowka hatte der General es untersagt, Bestandteile unbeschädigter Gebäude oder irgendwelche Einrichtungsgegenstände als Brennmaterial zu verwenden. Insbesondere die Einrichtung der drei Klassenzimmer im Schulhaus – Bänke, Katheder und Schränke – war durch einen eindeutigen Befehl vor Entnahme oder Vernichtung geschützt. Es war ja überhaupt ein Wunder, dass die Einrichtung bei der Ankunft des Divisionsstabes noch vorhanden gewesen war. Das mittlerweile beschaffte Heizmaterial war streng rationiert und wurde vom Kommandanten des Stabsquartiers persönlich zugeteilt. Nur Talvern als Einziger im Stab wusste, was den sonst nicht zu Konzilianz und Nachsicht neigenden General bewogen hatte, solche Rücksichtnahme im Feindesland zu üben. Der General glaubte nicht an allzu langes Verweilen in der windigen Ecke zwischen Don und Tschir, und er wollte nicht, dass die russischen Bewohner von Schepetowka bei ihrer Rückkehr ausgeplünderte Wohnstätten vorfänden.
Talvern horchte plötzlich auf. War es Einbildung, oder war nicht aus großer Ferne ein Grummeln zu vernehmen, wie wenn schwere Eisenkugeln über einen Bohlenbelag rollten?
Er blickte zu General Körner.
Der General nickte. »Da haben wir’s, Talvern! Aber kommt das nicht von Osten?«
Jetzt vibrierten ganz leise die mit Streifen aus Zeitungspapier überklebten Fenster. Kam der Kampflärm näher, oder hatte nur der Wind sich verstärkt oder gedreht?
»Die Hauptsache ist, es kommt«, sagte der Major. »Es war ja unabwendbar. Wenn es da ist, kann man Entscheidungen treffen –«
»Entscheidungen?«, warf General Körner nachdenklich ein. »Ist es nicht so, Talvern, dass unser Handeln uns neuerdings aufgezwungen wird? Stalingrad, diese erste große Niederlage, die im Begriff ist, einen Mythos zu zerstören, scheint die Herren im OKW paralysiert zu haben.«
General Körner trat ans Fenster und lauschte hinaus. Der ferne Geschützdonner wurde auf einmal von anderen Geräuschen übertönt. Ein Pulk vieler Fahrzeuge näherte sich Schepetowka.
General Körner drehte sich zu Talvern um. »Was ist das? Hören Sie?«
Talvern rief Leutnant Walter vom Nebenzimmer. »Schauen Sie nach, was da vorgeht!«, befahl er. Seine Stimme klang ruhig. Gab es denn nichts, was Anton von Talvern aus der Fassung bringen konnte?
Leutnant Walter lief die Treppe hinunter. Als er zurückkam, war er erregt und außer Atem.
»Italienische Fahrzeuge«, meldete er, »eine Rückzugskolonne, die nicht abreißt.«
»Anhalten!«, rief der General mit rauer Stimme. »Sofort anhalten! Holen Sie den italienischen Leutnant! Nehmen Sie ihn als Dolmetscher mit!«
»Zu Befehl, Herr General!«
Leutnant Walter hinkte hinaus. Ein Stecksplitter in seinem linken Oberschenkel behinderte ihn. Er klopfte an die Tür zum Vorzimmer des Ic und winkte Leutnant Cornalli heraus.
»Ihre Landsleute rollen Richtung Heimat«, sagte er. »Wir sollen Sie aufhalten, Befehl vom General.«
Sie zogen ihre Mäntel über, die auf dem Flur an den Haken hingen, an denen früher die Schulkinder von Schepetowka ihre Mäntel aufgehängt hatten. Sie schnallten um, setzten ihre Mützen auf und stiegen eilig die knarrende Holztreppe hinunter. Als sie ins Freie hinaustraten, empfing sie der eisige Steppenwind und trieb ihnen winzige Schneekristalle ins Gesicht. Der Nebel, der sich tagelang nicht gelichtet hatte, war verschwunden, aber die jagenden Schneewolken zogen so niedrig, dass sie die Dächer der schemenhaft ragenden Häuser zu berühren schienen. In Schwaden wirbelten die winzigen Flocken.
In das Johlen des Windes mischte sich Motorengedröhn.
Auf einem schmalen Seitenweg gelangten die beiden Offiziere zur Rollbahn, die den Ort von Nord nach Süd durchschnitt, ein breites Band festgefahrenen Schnees. In Zweierreihe, dicht bei dicht, bewegten sich Lkw der italienischen Armee im Schritttempo vorwärts. Die Spitze der Rückzugskolonne hatte Schepetowka bereits passiert.
Winkend und rufend versuchten Leutnant Walter und Tenente Cornalli sich Aufmerksamkeit zu verschaffen. Aber niemand achtete auf sie. Die winterlich vermummten Fahrer hatten die Wagen vor sich im Auge, die Beifahrer blickten stur geradeaus, und so weit sich Mannschaften unter den Planen verbergen mochten, hielten sie sich unsichtbar.
Tenente Cornalli hatte Tränen ohnmächtigen Zorns in den Augen. Wer hatte die Führung dieses verdammten Haufens? War denn hier niemand, der noch bei klarer Überlegung, der noch bei Verstand war? An dem deutschen Offizier und an ihm rollten diese Elenden vorbei, als ob sie beide räudige Köter wären, die die Kolonne ankläfften!
»Hat keinen Zweck«, rief Leutnant Walter, »diese Burschen bringt man nicht einmal mit Gewalt zum Stehen.«
Mit Gewalt, dachte er, wenn wir uns denen in den Weg stellen, fahren die uns bedenkenlos über den Haufen.
Auf einmal hatte Cornalli seine Beretta in der Hand. Mit der Pistole fuchtelnd, brüllte er auf Italienisch Befehle und Flüche. Doch auch von der drohend geschwungenen Waffe nahm niemand in der langsam vorbeirollenden Kolonne Notiz. Bis Leutnant Walter plötzlich den Lauf eines kurzen italienischen Karabiners entdeckte, der sich durch ein heruntergekurbeltes Seitenfenster schob.
»Herr Cornalli!«, rief Walter warnend. Zu spät. Ein Schuss hatte sich gelöst. Der italienische Leutnant drehte sich wie bei einem grotesken Tanz um sich selbst. Die Waffe entglitt seiner Hand. Schwer stürzte er in den Schnee.
Walter stand wie erstarrt. Dann warf er sich neben den Dolmetscher, nur wenige Schritte von den unaufhaltsam rollenden Rädern entfernt.
Cornalli stöhnte schwach. Walter sprang auf. In der nahen Nachrichtenvermittlung berichtete er stockend, was geschehen war. Zwei Mann rannten mit einer Krankentrage hinaus, während Walter im Laufschritt, so weit es sein verletztes Bein zuließ, den Weg zum Divisionsgefechtsstand fortsetzte.
So ungeheuerlich war das, was er gesehen und erlebt hatte, dass es beinahe über sein Fassungsvermögen ging. Der Anfang vom Ende, dachte er bruchstückhaft, Mord – sie schießen auf die eigenen Offiziere …
Als er keuchend, mit verzerrtem Gesicht vor dem Ia stand, fragte Major von Talvern: »Menschenskind, ist Ihnen ein Gespenst begegnet?«
Leutnant Walter suchte nach Worten.
»Kann verstehen, dass Sie durcheinander sind«, meinte Talvern. »So eine Rückzugskolonne ist kein erfreulicher Anblick. Sie haben nur den Vormarsch kennen gelernt. Das andere ist die Kehrseite.«
»Man hat auf Cornalli geschossen«, stieß Walter hervor.
»Was?«
Walter versuchte sich zu fassen. »Aus einem der Fahrzeuge ist auf Leutnant Cornalli geschossen worden, Herr Major. Niemand wollte anhalten. Cornalli hat die Pistole gezogen. Da ist es geschehen.«
»Weiter! Was ist mit dem Italiener?«
»Kopfschuss, Herr Major. Ich habe veranlasst, dass man ihn von der Rollbahn wegholte, und bin, so schnell ich konnte, hierhergelaufen.«
»Wohin hat man ihn gebracht?«
»Sicher zunächst zur Nachrichtenvermittlung.«
»Ich muss mich um ihn kümmern«, sagte Talvern. »Melden Sie den Vorfall dem Herrn General, Leutnant Walter!«
»Zu Befehl, Herr Major.«
Walter ging hinaus. Mehr als sonst zog er das linke Bein hinter sich her.
Talvern riss die Tür zum Geschäftszimmer auf. »Mantel, Mütze und Koppel!«, rief er dem Dienst habenden Obergefreiten zu.
Im gleichen Augenblick schrillte das Läutwerk des Feldtelefons. Mit einem Sprung war Talvern beim Apparat.
»Major von Talvern.«
Am anderen Ende sprach Oberleutnant Schenk, der Führer der 2. Nachrichtenkompanie.
»Ein Funkspruch von ›Waldhorn‹, Herr Major«, meldete er.
»Waldhorn« war der Deckname des Infanterieregiments 628.
Schenk wollte den Text des Spruches übermitteln, doch Talvern unterbrach den Nachrichtenoffizier. »Liegt der italienische Leutnant bei Ihnen?«, fragte er.
»Jawohl, Herr Major. Wollte es Herrn Major anschließend sagen. Wir haben den Herrn Oberfeldarzt gerufen. Aber jede Hilfe kam zu spät. Nach Meinung des Herrn Divisionsarztes muss der Leutnant schon tot gewesen sein, als sie ihn hereinbrachten.«
»Geben Sie jetzt den Spruch durch!«, befahl Talvern schroff, ohne auf Schenks schwer wiegende Mitteilung einzugehen.
»Jawohl, Herr Major.«
Schenk verlas den Klartext des verschlüsselt durchgegebenen Spruchs. Das Regiment meldete Feindberührung bei seinem ersten Bataillon. Zum zweiten und dritten Bataillon war bei Aufgabe des Funkspruches seit zwei Stunden die Verbindung abgerissen. Zwei Stoßtruppunternehmen waren zur Klärung der Lage angelaufen.
Talvern ging hinüber zum General.
»Das Erste sechsachtundzwanzig hat bereits Feindberührung«, sagte er. »Sonst bis jetzt nichts Neues. Was hier geschehen ist, wissen Herr General.«
General Körner nickte schwer.
»Es ist, als ob Schnee und Dunkelheit alles verschlängen«, murmelte er. »Die rumänische Armee – Stalingrad –, jetzt die Italiener. Und wir?«
Der General schwieg. Auch Major von Talvern sagte nichts mehr. Etwas Unheimliches bahnte sich an. Ein Gefühl des Unbehagens schlich sich in Anton von Talverns Gelassenheit. Er kehrte in seinen Dienstraum zurück. In den kahlen Raum mit den mit Zeitungsstreifen beklebten, vereisten Fenstern. Mit dem helleren Fleck an der vom Ofenrauch gedunkelten Wand, wo einst Stalins Bild gehangen hatte. Ein Bild des »Führers« aufzuhängen, hatte man versäumt.
Es war Zeit, die Abendmeldung vorzubereiten. Was war zu melden? Der Tod eines italienischen Offiziers. Sonst war alles unklar, alles in der Schwebe. Das Fernsprechnetz war zerstört und nicht wieder in Stand gesetzt. Man hing in der Luft. Auf die Funkgeräte war nur bedingt Verlass. Man sollte führen. Aber wer konnte befehlen, wenn er sich wie der Stab in Schepetowka in völliger Ungewissheit, in der Isolierung befand? Wer?
Seit seiner Abfahrt von Lysselkowo am Abend des 15. Dezember hatte die 3. Batterie nichts mehr von Wachtmeister Fendt gehört. Auch von dem italienischen Bataillon, mit dem man noch in der Nacht Funkverbindung hatte, wusste man nichts. Den ganzen 16. Dezember und die folgende Nacht hindurch hatte der Funktrupp in Lysselkowo die Italiener immer wieder gerufen, aber deren Gerät hatte keine Antwort gegeben.
Trüb brach der Morgen des 17. Dezember an. Die Fenster der kleinen, niedrigen Lehmkate, die Hauptmann Martin als Quartier und zugleich als Gefechtsstand diente, waren mit einer dicken Eisschicht überzogen. In dem kleinsten unheizbaren Raum schlief der Hauptmann auf einer von Trossleuten gezimmerten Pritsche.
In der größeren Stube lagen Leutnant Holler, der B-Offizier, und die Männer vom Batterietrupp dicht aneinander gedrängt auf einer dünnen Schütte von mit Zeltbahnen bedecktem Stroh.
Als Hauptmann Martin sich auf der Pritsche aufrichtete, war es ihm, als habe sich das Artilleriefeuer, das gestern noch im Norden rumpelte, nach Westen, möglicherweise auch nach Südwesten, verlagert. Auch im Osten, allerdings in größerer Entfernung, schien Geschützfeuer aufzuleben. Das musste an der Tschir-Front sein, die sich Ende November nach dem Durchbruch der Russen bei der 3. rumänischen Armee gebildet hatte.
Hauptmann Martin hatte fest mit einem nächtlichen Alarm gerechnet. Doch die Nacht hatte nichts Ungewöhnliches gebracht – jedenfalls nicht für Lysselkowo.
Martin warf den Übermantel und die Decken zurück und stand stöhnend auf. Morgens, beim Aufstehen, machte sich das Rheuma, das zeitweilig seine ganze linke Körperhälfte erfasste, am übelsten bemerkbar. Erst beim zweiten Versuch gelang es ihm, sich nach seinen Filzstiefeln zu bücken. Dieser zweite Winter, der für ihn in Russland angebrochen war, wartete wieder mit strengen Frösten auf. Wie alle anderen schlief auch Martin in voller Uniform. Und auch ihn plagten bereits wieder die Läuse, die nicht danach fragten, ob einer Schulterstücke mit zwei Sternen, Korporalslitzen, einen Gefreitenwinkel oder überhaupt keine Rangabzeichen besaß.
Als Hauptmann Martin in den Nebenraum trat, kam der kleine Leutnant Holler soeben aus seinen Decken hoch.
»Merken Sie was?«, sagte der Batteriechef. »Das hört sich doch so an, als ob der Russe durch wäre. Aber das ist doch nicht möglich. Wenn da etwas passiert wäre, hätte man uns doch verständigen müssen.«
Leutnant Holler hob die Schultern.
»An sich schon, Herr Hauptmann. Aber wir wissen ja: Die Makkaroni betreiben hier ihren eigenen Laden.«
»Sie sollen nicht ›Makkaroni‹ sagen!«, warf der Hauptmann ein. »Die Italiener sitzen auf dem gleichen Ast wie wir. Es sind unsere Verbündeten, und ich wünsche nicht, dass man abfällig über sie spricht.«
Heute hat es ihn wieder, dachte Holler. Wenn das Rheuma den Chef packte, war er sich selbst zuwider. Doch sonst kam man gut mit ihm aus. Im Übrigen war Hauptmann Martin nicht nur auf artilleristischem Gebiet ein ausgesprochener Könner.
»Man sollte ›Blaumeise‹ anrufen«, schlug Holler vor. »Vielleicht weiß man dort etwas.«
»Blaumeise« war der Deckname einer deutschen Sicherungskompanie, die zwanzig Kilometer nordostwärts in der Kosaken-Stanize Nikolskaja lag. Oder gelegen hatte.
»Gut«, meinte Hauptmann Martin, »versuchen wir’s.«
Der Leutnant nahm den Handapparat des Feldtelefons ab und drehte die Kurbel.
»Holen Sie ›Blaumeise‹ ran«, sagte Leutnant Holler. »Und schicken Sie auch gleich den Nachrichtenstaffel-Führer zum Gefechtsstand.«
Der Gefreite wiederholte den Befehl. Als er gleich darauf wieder sprach, klang seine Stimme erregt.
»›Blaumeise‹ antwortet nicht, Herr Leutnant«, sagte er. »Die können doch nicht klammheimlich abgebaut haben?«
»Unsinn«, versetzte Holler. »Wird ’ne Störung sein. Versuchen Sie’s später noch mal!«
Er legte auf und läutete ab. Im gleichen Augenblick trat der Nachrichtenstaffelführer ein.
»Unteroffizier Kolb zur Stelle.«
»Störungssucher immer noch nicht zurück?«, fragte Hauptmann Martin. Gestern Mittag waren zwei Mann losgezogen, um die gestörte Fernsprechleitung zum Abteilungsgefechtsstand zu flicken.
Der Unteroffizier nahm erneut Haltung an.
»Nein, Herr Hauptmann. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was da los ist. Lenk und Pohlmann sind doch zwei alte Hasen. Wenn etwas Besonderes wäre, hätten die beiden unter allen Umständen den Draht angezapft, um Meldung zu machen. Es ist beinahe so, als ob ringsherum alles weg wäre, und wir wären allein übrig geblieben.«
»Wie kommen Sie darauf, Kolb?«, fragte der Batteriechef.
»Alle Leitungen nach außerhalb sind tot, Herr Hauptmann«, antwortete der Unteroffizier. »Und mit dem Funkverkehr sieht es praktisch nicht anders aus. Was zu hören ist – sogar zum Teil auf unseren Frequenzen –, sind verschlüsselte russische Sprüche. Und das Arifeuer im Westen. Die Italiener werden doch nicht getürmt sein?«
Hauptmann Martin schüttelte den Kopf, obgleich er im Stillen die Befürchtung des Unteroffiziers teilte. Zweifellos war seit gestern Schwerwiegendes an der Front geschehen.
Martin griff zum Handapparat des Fernsprechers und befahl, ihn mit dem Gefechtsstand der Pioniere zu verbinden. Gestern früh war die Pionierkompanie unter Oberleutnant Mareiner auf Weisung der Division als Verstärkung in Lysselkowo eingerückt. Mit den Pionieren hatte es eine besondere Bewandtnis: Sie waren am 21. November in die Katastrophe im Donbogen geraten und waren im Gegensatz zu den meisten anderen Einheiten nicht nach Osten in Richtung Stalingrad, sondern nach Westen abgedrängt worden. Zwei Wochen lang hatten sie als Bestandteil einer Alarmeinheit am Tschir gekämpft, dann waren sie auf höheren Befehl dem Pionierbataillon der Division zur besonderen Verwendung unterstellt worden. Martin fand es beruhigend, dass jetzt außer seiner Batterie noch etwas im Dorf war. Eine Artilleriestellung, vor der möglicherweise nichts Eigenes mehr war, ließ sich mit den Geschützen und den Trossleuten allein nicht verteidigen. Die Pionierkompanie jedoch war eine erprobte Kampfeinheit. Vor allem war sie reichlich mit Minen aller Art ausgestattet.
Am anderen Ende der Leitung meldete sich Oberleutnant Mareiner, ein Tiroler aus der Gegend von Kufstein, die auch Martin gut bekannt war.
»Können Sie mal ’rüberkommen, Herr Mareiner?«, fragte der Hauptmann.
»Schon im Bild«, gab Mareiner zurück. »Bin in fünf Minuten bei Ihnen, Herr Hauptmann.«
Martin wandte sich dem Nachrichtenstaffelführer zu.
»Ist gut, Kolb. Sehen Sie weiter zu, dass die Verbindungen wieder zu Stande kommen! Sobald Sie Erfolg haben, läuten Sie mich an!«
Der Unteroffizier verließ den Gefechtsstand, in dem währenddessen auch der Batterietrupp munter geworden war.
Einer der Melder, der Obergefreite Kranz, legte trockenes Holz, das von einem abgerissenen Zaun stammte, auf die Glut im Ofen.
Bevor Hauptmann Martin in seine kleine Stube zurückkehrte, bedeutete er Leutnant Holler, sich mit dem Pionieroffizier bei ihm einzufinden, sobald dieser im Gefechtsstand eintreffe. Die bevorstehende Besprechung sollte nicht vor den Männern stattfinden. Wenn man die Mannschaft vorzeitig beunruhigte, war das nur der Keim für Parolen und Gerüchte, die womöglich dem Ausbruch einer Panik Vorschub leisteten. Im vergangenen Winter hatte Hauptmann Martin eine solche Panik bei einer schwer angeschlagenen Kompanie erlebt, die Hals über Kopf ihre Stellung verlassen hatte.
In der Stube war es empfindlich kalt. Der Hauptmann zog seinen Übermantel an und rieb sich das schmerzende linke Bein. Als er sich gerade eine Zigarette anzündete, auf nüchternen Magen, da die Feldküche den so genannten Kaffee erst später ausgab, erschienen Oberleutnant Mareiner, der athletische, abgehärtete Tiroler, dem die Kälte nichts anzuhaben schien, und der kleine Leutnant Holler.
Mareiner hielt nicht viel vom steifen Komment des großdeutschen Offizierskorps. Mit einem »Servus, Herr Hauptmann« ging er, die Hand zur Begrüßung ausgestreckt, auf Martin zu.
Der Batteriechef ergriff die hart zupackende Hand des Pionieroffiziers. Im Stillen sagte er sich, ein richtiger Kerl sei mehr wert als alle preußische Akkuratesse.
»Kann mir denken, weshalb Sie mich gerufen haben, Herr Hauptmann«, sagte Mareiner. »Mir scheint, dass es hier in der Gegend obergewaltig stinkt. Haben Sie inzwischen etwas von Ihrem Wachtmeister gehört?«
»Nein«, gab Martin zurück, »das kommt ja zu allem Übrigen noch dazu. Fendt ist mein bester Portepeeträger. Wenn der sich in Schweigen hüllt, muss es vorn bei den Italienern mehr als mulmig aussehen. Denken Sie, auch von den ausgeschickten Störungssuchern haben wir nichts mehr gehört.«
»Wenn Sie mich fragen, Herr Hauptmann«, meinte der Oberleutnant, der über der Uniform einen Mantel aus abgeschabtem Schaffell trug, »also, wenn Sie mich fragen, dann sage ich Ihnen klipp und klar: der Russ’ hat die Italiener am Don überrannt und ist längst an Lysselkowo vorbei.«
Martin wiegte bedächtig den Kopf.
»Wenn es so wäre, Herr Mareiner, dann hätten doch wenigstens ein paar Versprengte hier auftauchen müssen. Es ist undenkbar, dass der Russe die ganze italienische Armee einfach geschluckt hat.«
»Ich habe im November den Zauber bei den Rumänen erlebt«, warf der Oberleutnant ein. »Da hat man auch nicht mehr gewusst, wo oben ist und wo unten. Für solche Pannen ist nicht jeder gebaut, Herr Hauptmann. Das kann nur die deutsche Wehrmacht mit ihrer Elefantenhaut verkraften. Aber was sollen wir viel herumreden? Ich schlage vor, dass ich mich mal in der näheren Umgebung umschaue.«
»Gerade das wollte ich anregen, Herr Mareiner«, entgegnete der Hauptmann. »Wir müssen Klarheit haben. Erst dann können wir Entschlüsse fassen.«
»Sehr richtig«, stimmte Mareiner zu, »und deshalb will ich keine Zeit verlieren.«
Oberleutnant Mareiner, im langen Russenschneehemd, glättete, auf die hohen Stöcke gestützt, die Laufflächen seiner schmalen karelischen Skier. Die acht Mann, die sich mit ihm am Westrand von Lysselkowo zum Aufbruch ins Ungewisse bereitstellten, hatten die gleiche russische Winterausrüstung wie er. Ende November, auf dem Rückzug zum Tschir, als die Kompanie, oft in schwere Nachhutgefechte verwickelt, in der verschneiten Steppe T-Minen verlegte, um das Vordringen der feindlichen Panzer aufzuhalten, hatten sie eine starke russische Schneeschuh-Patrouille überwältigt und die Schneehemden, Skistöcke, Schuhe und Skier vereinnahmt. Da die Kompanie sich vorwiegend aus Tirolern und Oberbayern zusammensetzte, war es Mareiner nicht schwer gefallen, Leute zu finden, die mit der Skiausrüstung umgehen konnten. Schon bei den nächsten Unternehmungen hatte er festgestellt, wie brauchbar der Ski, insbesondere der Langlaufski, auf der winterlichen Steppe war. Und in dieser Stunde, als er auszog, um zu erkunden, was sich im Laufe des gestrigen Tages und der Nacht im Abschnitt der Italiener ereignet hatte, begrüßte er es ganz besonders, dass seine Pioniere und er gut getarnt und beweglich waren und somit rasch verschwinden konnten, wenn seine Vermutung zutraf. Für ihn hatte die italienische Front sich unter dem Ansturm der Russen aufgelöst wie vor knapp vier Wochen die der Rumänen. Wenn seine Annahme richtig war, würde er nach seinem Dafürhalten bei seinem Spähtruppunternehmen eher auf Rotarmisten als auf Italiener stoßen.
Er rückte seine Maschinenpistole zurecht, die ihm vor der Brust hing, stieß einen Skistock hoch und wandte sich in zügigem Gleitschritt der von dichtem Schneetreiben verhüllten Steppe zu.
Als er nach kurzer Zeit verhielt und den Kopf drehte, um sich zu vergewissern, ob seine Leute die befohlenen Abstände einhielten, waren die schneevermummten Hütten von Lysselkowo kaum mehr zu erkennen.
Der heftige Geschützdonner, der seit Mitternacht von Nordwesten nach Westen gewandert war, hatte nachgelassen. Ein Zeichen, dass die Russen ihre Angriffe eingestellt haben könnten, war das freilich nicht. Auch die Rote Armee vermochte sich nicht leichter Hand über die Härte des Winterkrieges hinwegzusetzen. Die Schwierigkeit, den Nachschub durch tief verschneites Gelände der kämpfenden Truppe zuzuführen, verlangsamte auch drüben die Bewegungen im Verhältnis zur Ausdehnung der Strecken, die zu überwinden waren.
Oberleutnant Mareiner fragte sich, warum man nach den Erfahrungen mit den Rumänen bei Kletzkaja die lebenswichtige Donfront südostwärts Kalitwa nicht mit deutschen Verbänden besetzt hatte. Den Italienern fehlte, allein schon von der mittleren und unteren Führung her, das Vermögen, in windigen Stellungen massierten Angriffen der Russen standzuhalten. Die persönliche Tapferkeit des Einzelnen zählte dabei nicht. Es war eine Frage der Taktik und im Übrigen der Persönlichkeit des jeweiligen Führers, ob man im Stande war, sich in einem Abschnitt zu behaupten, an dem der Feind womöglich links und rechts vorbeigeflutet war. Außerdem waren die Italiener, mit Ausnahme der Alpinisoldaten, für den Krieg im winterlichen Osten weder körperlich geeignet noch geschult.
Als Mareiner den Befehl erhalten hatte, mit seiner Kompanie nach Lysselkowo zu gehen und sich dort einzurichten, war er überzeugt gewesen, dass man eine Ausweitung der russischen Winteroffensive gegen den Abschnitt der 8. italienischen Armee erwartete. Aber mit einem Durchbruch, wie er mutmaßlich mittlerweile eingetreten war, hatte man anscheinend nicht gerechnet.
Das Schneetreiben wurde immer dichter. Der eisige Nordwind verstärkte sich und wurde zum Sturm. Tief geduckt schob Mareiner sich auf seinen Skiern vorwärts, gefolgt von seinen acht Pionieren, die nun näher aufrückten, um einander nicht aus den Augen zu verlieren.
Sie gelangten zu einer Balka, wie sie zu Hunderten die Steppen Südrusslands durchziehen, und da der vom Sturm gepeitschte, dicht fallende Schnee jegliche Sicht verwehrte und infolgedessen die Gefahr bestand, dass der kleine Spähtrupp ahnungslos in den Feind rumpelte, beschloss Oberleutnant Mareiner, in der windgeschützten Schlucht abzuwarten, bis der Schneesturm sich ausgetobt hatte, was erfahrungsgemäß nicht allzu lange dauern würde.
Als Sicherung gegen unliebsame Überraschungen stellte Mareiner einen Doppelposten an den nordwestlichen Zugang zur Balka.
Sie warteten nur wenige Minuten und rauchten gerade die ersten Züge ihrer mit Mühe angesteckten Zigaretten, als einer der Posten mit der Meldung erschien, eine größere Kolonne von Fußtruppen nähere sich. Mareiner machte seine Maschinenpistole frei und führte seine Leute, die ihre Karabiner schussbereit hielten, zum Ausgang der Balka. Dort übergab er Unteroffizier Perch, einem Landsmann aus dem Inntal, das Kommando und glitt selbst ins Schneetreiben hinaus, um nach Möglichkeit festzustellen, ob die näher kommende Kolonne, die nur schattenhaft zu erkennen war, zur »anderen Feldpostnummer« gehörte.
Hinter einen verschneiten und vereisten Strauch geduckt, beobachtete Mareiner die schwerfällig durch den Schnee stapfenden Gestalten, die wie gespenstische Schemen vorbeizogen und es offenbar nicht im Sinn hatten, ebenfalls in der Balka Schutz vor dem Sturm zu suchen.
Auf einmal vernahm er einen schwachen Kommandoruf, der vermutlich italienisch, keinesfalls jedoch russisch war. Einer plötzlichen Eingebung folgend brüllte er: »Evviva Italia – evviva Italia!«
Im nächsten Augenblick löste sich die Ordnung der Kolonne auf. Soldaten in dunkelgrauen Mänteln und den Stahlhelmen des italienischen Heeres stürzten auf den Skiläufer im Schneehemd zu, der hinter dem vereisten Strauch hervorkam, und ungezählte Stimmen sprachen und riefen aufgeregt durcheinander. Das einzige, ständig wiederholte Wort, das Mareiner verstand, war: »Tedesco«.
Mit eifrigem Kopfnicken und »si, si, si« bestätigte er, dass er Deutscher sei, und steigerte damit die Aufregung der Italiener so gewaltig, dass diese einander nur noch überschrien. Bis schließlich von der Spitze der Kolonne ein Offizier herankam, mit scharfer Stimme Ruhe gebot und sich dem »Tedesco« gegenüber als Tenente Giuseppe Favere bekannt machte.
»Hoch erfreut«, sagte Mareiner und nannte seinerseits Dienstrang und Namen.
»Ich bin glücklich, Herr Kamerad«, sagte Leutnant Favere in gut verständlichem Deutsch. »Der Himmel schickt Sie uns. Aber – per Dio – Sie sind doch nicht auch versprengt wie wir?«
Mareiner verneinte lachend.
»Ich bin auf Erkundung«, sagte er, »aber von Ihnen kann ich sicher erfahren, was bei Ihnen passiert ist. Wir sind seit gestern ohne jede Verbindung.«
»Das glaube ich wohl«, entgegnete der italienische Leutnant. »Es ist bei mir nicht anders. Der Russe ist durchgebrochen. Mehr weiß ich auch nicht. Ich habe mit meiner Kompanie meine Stellung geräumt, als sie nicht mehr zu halten war. Wir sind unterwegs in starkes Artilleriefeuer geraten und später von russischen Reitern angegriffen worden. Meine Verluste waren sehr hoch, Herr Kamerad. Zuletzt habe ich im Schneesturm die Richtung verloren.«
»Welches Bataillon?«, schrie Oberleutnant Mareiner. Das Tosen des Sturms schwoll plötzlich so sehr an, dass es einem förmlich die Worte vom Mund wegriss. Doch Leutnant Favere hatte verstanden.
»Bataillon ›Derrutti‹ – stellvertretender Bataillonsführer Capitano Berti«, gab er ebenso lautstark zurück.
»Was ist mit Fendt? Wo ist er?«, fragte Mareiner. »Der deutsche Wachtmeister Fendt. Er war unterwegs zu Ihrem Bataillon.«
Der Italiener antwortete mit einer hilflosen Geste.
»Ich weiß nichts von einem deutschen Wachtmeister.«
»Wohin wollen Sie mit Ihren Leuten?«, fragte Mareiner, beunruhigt durch das sichere Gefühl, sich nicht länger aufhalten zu dürfen.
»Kein Befehl«, erwiderte Favere.
»Wir bringen Sie erst einmal nach Lysselkowo«, sagte Mareiner. »Rufen Sie Ihre Kompanie zusammen. Ich hole nur rasch meine Leute.«
Er drehte seine Skier um und lief mit langen Gleitschritten zur Balka.
»Wir kehren um«, rief er den Pionieren zu. »Es sind Italiener – eine versprengte Kompanie. Perch, Sie übernehmen mit zwei Mann die Führung. Die anderen kommen mit mir.«
Die Kolonne der Italiener tauchte im Flockenwirbel auf. Man hörte die anfeuernden Avanti-Rufe des Offiziers. Unter den Soldaten, von denen manche nicht einmal mehr ihre Gewehre bei sich hatten, waren auch mehrere Verwundete. Einige wurden von Kameraden gestützt.
Als Mareiner Favere erblickte, rief er ihm zu, er solle den drei Mann auf Skiern folgen. Er selbst werde sich mit dem Rest seiner Leute an den Schluss der Kolonne setzen, um dafür zu sorgen, dass niemand zurückbleibe.
Die grauen Schemen zogen dicht aufgeschlossen vorbei. Nach Mareiners Schätzung waren es etwa siebzig Mann. Wenn die Kompanie bei Beginn des russischen Angriffs ihre volle Kriegsstärke gehabt hatte, mochte Favere die Hälfte seiner Männer verloren haben.
»Die müssen ganz hübsch Federn gelassen haben«, bemerkte einer der Pioniere. »Sind halt Spagettifresser.«
»Halt die Luft an, Franz!«, versetzte Mareiner scharf. »Meinst du, ihr seht besser aus, wenn euch der Iwan die Stellung unter dem Sitzfleisch wegschießt?«
Er wartete, bis die letzten Italiener – eine Gruppe humpelnder Nachzügler, die offenbar erfrorene Füße hatten – vorbei waren. Dann schloss er sich mit seinen Pionieren an.
Im Grunde war Mareiner jetzt vollkommen im Bilde. Wenn der Feind die Gegend bereits mit Reiterspitzen unsicher machte, war es nicht ratsam, die Erkundung noch weiter vorzutreiben. Den Reitertrupps folgten zumeist Panzer mit aufgesessener Infanterie. Auch nach dem Erdrutsch bei Kletzkaja war es so gewesen. Fraglich war nur, was aus den Italienern werden sollte, wenn sie glücklich nach Lysselkowo gelangten. Doch das zu entscheiden, war Sache des Ortskommandanten Hauptmann Martin. Zur Stunde war nur eines wichtig: man besaß die Gewissheit, dass die Front am Don vom Russen aufgerissen worden war, und dass man nichts Wesentliches an eigenen Kräften mehr vor sich hatte. Alles andere würde sich ergeben, wenn die Panik sich legte, die allem Anschein nach große Teile der italienischen Front erfasst hatte.
Mareiner vermutete, dass in Kürze auf irgendeinem Weg bei Hauptmann Martin der Befehl eintreffen würde, Lysselkowo, das sicherlich bereits überflügelt war, zu räumen und Anschluss zur neuen Front zu suchen, die sich weiter rückwärts bilden würde. Die sich bilden musste, dachte Mareiner. Bisher war das immer so gewesen, selbst nach der Katastrophe bei den Rumänen. Aber was dann, wenn es einmal anders lief, wenn es zu keiner Frontbildung mehr kam, wenn alles ins Fließen geriet? Hatte man nicht 1941 den Russen in der Zeit von Ende Juni bis Oktober durch die ganze Ukraine bis an den Donez zurückgeworfen? Wenn nun das Blatt sich wendete, wenn plötzlich der Feind am Zuge war? War nicht Stalingrad, die Einschließung einer ganzen deutschen Armee, das böseste Vorzeichen? Nein, versuchte Mareiner sich einzureden, wir sind ja noch da!
Der Sturm verebbte. Auch der Schneefall ließ nach. Das Grollen des Geschützfeuers war wieder zu vernehmen. Seltsam war nur, dass die Gegend um Lysselkowo anscheinend ausgespart blieb. Jedenfalls war dort, wo das Dorf lag, das an das schneebeladene Tannenwäldchen im Norden grenzte, alles ruhig.
Die licht ragenden Tannen, zwischen denen die vier schweren Feldhaubitzen der 3. Batterie in Feuerstellung standen, und die kleinen lehmfarbenen Katen mit ihren dicken weißen Hauben und dem bis an die Fenster angeschaufelten Schnee kamen in Sicht. Aus den Schornsteinen stieg Rauch in die eisige Luft.
Leutnant Favere kam von der Spitze zu Oberleutnant Mareiner zurück.
»Ich verstehe nicht, dass der Russe Ihr Dorf noch nicht angegriffen hat«, sagte er.
»Seien Sie froh«, entgegnete Mareiner. »Auf diese Weise können Ihre Leute sich aufwärmen und sich von ihrem Schock erholen. Ich bringe Sie zu Hauptmann Martin. Er führt die Batterie, die in Lysselkowo liegt. Mit ihm können Sie beraten, was weiter geschehen soll.«
Sie erreichten das Dorf. Während die Italiener sich, von deutschen Soldaten bestaunt, auf dem Platz drängten, auf dem das Stalindenkmal aus Gips gestanden hatte, von dem nur noch die Beine vorhanden waren, geleitete Oberleutnant Mareiner, der seine Skier abgeschnallt hatte, den italienischen Tenente zum Batteriegefechtsstand.
Mareiner gab Hauptmann Martin Bericht und entfernte sich.
Favere wurde von dem Hauptmann aufgefordert, abzulegen und es sich bequem zu machen. Er zog seinen Mantel aus und streifte den Kopfschützer ab, den er unter dem Stahlhelm trug. An seinen schwarzen Augenbrauen hing Eis, das langsam abtaute. Wie Tränen bildeten sich Rinnsale auf seinen hageren Wangen.
Hauptmann Martin stand vor dem Tenente, der sich, auf einmal von Erschöpfung übermannt, auf einen klobigen Stuhl niedergelassen hatte.