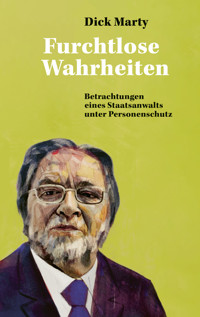
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Rotpunktverlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Am 18. Dezember 2020 erhielt Dick Marty einen Anruf vom Kommandanten der Tessiner Kantonspolizei, sein Leben sei bedroht, er und seine Familie müssten sofort unter Personenschutz gestellt werden. Marty fragte nur: »Balkan?« 2009 hatte ihm der Europarat die Ermittlungen zum Handel mit Organen serbischer Gefangener nach dem Kosovokrieg übertragen. So wurde Marty gleich zu Beginn seines Ruhestands zum Gefangenen im eigenen Haus. In der folgenden von Bedrückung geprägten Zeit bleibt ihm nichts anderes übrig, als die Geschehnisse in der Welt zu beobachten, die Stürmung des Kapitols, den russischen Überfall auf die Ukraine, den Zusammenbruch der Credit Suisse. Mit seiner Erfahrung und seinem Wissen zieht er Schlüsse daraus und fängt an zu schreiben. Er denkt nach über die Krise des Rechtsstaats, die Zerbrechlichkeit der Demokratie und die politische Neutralität. Er vollzieht die Schlüsselmomente seines politischen Lebens nach, rekonstruiert die Fakten, die ihn zur Zielscheibe eines unbekannten Feindes gemacht haben, und reflektiert die Phasen der laufenden Ermittlungen, die sich immer mehr wie eine Ermittlungsverweigerung präsentieren. Der Text ist das Vermächtnis eines Ausnahmepolitikers, der sein gesamtes Leben in den Dienst der Gerechtigkeit gestellt hat.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 207
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dick Marty
Furchtlose Wahrheiten
Dick Marty
FurchtloseWahrheiten
Betrachtungeneines Staatsanwaltsunter Personenschutz
Aus dem Italienischen
von Stefano di Lorenzo
Rotpunktverlag
Der Rotpunktverlag wird vom Bundesamt
für Kultur mit einem Strukturbeitrag für
die Jahre 2021 bis 2025 unterstützt.
© 2024Rotpunktverlag, Zürich
www.rotpunktverlag.ch
Umschlagbild: Andrea Ventura
Lektorat: Andreas Simmen
Korrektorat: Jürg Fischer
eISBN 978-3-03973-043-8
1. Auflage 2024
Inhalt
Das Sandkorn
I Ein Fluss und seine Windungen
II Der Advent
III Wenn die Vergangenheit ruft
IV Ein perverser Plan
V Die Pandemie, unerwarteter Lackmustest
VI Die Demokratie, ein zartes Pflänzchen
VII Die beste Demokratie der Welt?
VIII Über Geranien und die Neutralität
IX Keine Demokratie ohne Gerechtigkeit
X Anatomie einer verweigerten Untersuchung
XI Hat es sich gelohnt?
Anmerkungen
Das Sandkorn
»Was ist ein Rebell?
Ein Mann, der Nein sagt.«
Albert Camus
Warum schreibe ich wieder ein Buch, wo ich doch nie gerne über mich selbst gesprochen habe?
2009, zwei Jahre nach dem enormen Wirbel um den Bericht über die geheimen CIA-Gefängnisse, nötigte mich (der Begriff ist nur leicht übertrieben) der Lausanner Verlag Favre, ein Buch zu schreiben. Ich führte ins Feld, dass jeder das tun müsse, wozu er sich in der Lage fühle, und Schreiben liege mir nicht besonders. Später hatte ich gesundheitliche Probleme: eine vorübergehende allgemeine Amnesie (ausgerechnet an dem Tag, an dem ich die Volksinitiative für Konzernverantwortung vor einer parlamentarischen Kommission verfechten sollte) und fast gleichzeitig zwei orthopädische Operationen, die mich zum ersten Mal nach einem halben Jahrhundert aktiven Lebens dazu zwangen, fast vier Monate lang unbeweglich zu Hause zu bleiben. Und ich entdeckte, dass mir das Schreiben guttat, dass es mir erlaubte, über das Erlebte nachzudenken, auch über die Gründe für bestimmte Entscheidungen. Eines späten Abends kam mir der Verleger Favre in den Sinn, und ohne groß darüber nachzudenken, mailte ich ihm die Datei mit dem, was ich geschrieben hatte. Die Antwort kam sehr schnell: Ja, wir veröffentlichen! Ich bedauerte es fast, ich hätte am liebsten alles abgebrochen, aber es war zu spät. Ich hatte auf Französisch geschrieben, weil ich nach dem, was mir passiert war, etwas Schwieriges tun musste, um mich selbst zu testen, und Französisch als Schriftsprache ist verdammt schwer (in welcher anderen Sprache gibt es Diktatmeisterschaften, bei denen niemand jemals null Fehler macht?), aber es ist auch eine Sprache, die ich sehr mag. So entstand Une certaine idée de la justice (Eine bestimmte Vorstellung von Gerechtigkeit), das später auch auf Italienisch erschien.
Und nun wieder ein neues Buch: ein Zeichen, dass mir ein weiteres Unglück widerfahren ist? Besser gesagt zwei. Und wenn das erste vorhersehbar war, so nicht das zweite: Es war ein Kampf, der nicht gewonnen werden konnte, es sei denn durch ein Wunder. Schreiben als Selbsttherapie, anstatt Prozac zu nehmen; schreiben für sich selbst, ohne in erster Linie an die Leserschaft zu denken (und ich entschuldige mich dafür). Mir ist klar, dass ich in all meinen Funktionen Wege eingeschlagen habe, die nicht immer den von der Allgemeinheit vorgespurten Gleisen folgten. Als Kind war ich für meine Geschwister eine Nervensäge (und für meine Eltern ein Grund zur Sorge). So war ich im Lauf der Jahre für viele andere bestenfalls das Sandkorn, das so lästig sein kann. Nicht aus Spass, sondern um kohärent zu bleiben – der Preis dafür war oft hoch.
Wenn ich heute schreibe, dann deshalb, weil ich glaube, dass die Affäre, die an einem Adventssonntag begann, über mich hinausgeht, weil sie sehr beunruhigende Fragen über das Funktionieren unserer Institutionen aufwirft. Es ist eine Überlegung, die mich auch dazu veranlasst hat, auf den Weg zurückzublicken, den ich zurückgelegt habe, und über die heutigen Probleme nachzudenken, von der Demokratie über die Neutralität bis hin zur Gerechtigkeit. Ein dornenvoller, unberechenbarer Weg, so wie es dieser letzte Lebensabschnitt für mich war. Ich hatte es mir so anders vorgestellt.
Dick Marty
6. September 2023, Geburtstag von Gabriela, ohne die ich nie in der Lage gewesen wäre, diese lange Reise anzutreten und deren schwierigste Passagen zu meistern.
I Ein Fluss undseine Windungen
»Wie ein langer Fluss ist das Leben nur dann faszinierend, wenn es sich windet«, sagte Chen Zi’ang, ein chinesischer Dichter aus dem 7. Jahrhundert. Nach allem, was geschehen ist, sage ich mir, dass mein Leben selten einem langen, ruhigen Fluss geglichen hat, der durch angenehme Landschaften floss. Um in der Metapher zu bleiben, erinnert der Anfang eher an Tröpfchen, die sich abmühen, ein Rinnsal zu bilden, das sich hartnäckig seinen Weg in feindlicher Umgebung sucht. Eine liebe Freundin meiner Mutter, die für mich die Großmutter war, die ich nie gekannt habe, pflegte mir zu sagen: »Denk daran, dass deine Mutter dich zweimal geboren hat.« Gleich nach meiner Geburt und in den ersten zwei Jahren meines Lebens bereitete ich meinen Eltern viel Kummer, ich schien fast ununterbrochen zu schreien (wie gesagt, meine beiden älteren Brüder ließen keine Gelegenheit aus, mich daran zu erinnern, was für eine Nervensäge ich gewesen sei). Dann teilte der einzige Augenarzt in der Region, offenbar mit dem Taktgefühl einer Planierraupe ausgestattet, meiner Mutter mit, dass »dieses Kind niemals sehen wird«. Er irrte sich – und vor allem unterschätzte er meine Mutter.
Wenn ich diese Episode erzähle, dann nicht aus Selbstmitleid. Natürlich wurde damals jeder, der eine Brille trug, dazu eine so hässliche mit sehr dicken Gläsern, systematisch verspottet. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich damals gelitten hätte. Ich bin in einer protestantischen (aber keineswegs bigotten) Familie aufgewachsen. In der Primarschule musste ich zusammen mit einem jüdischen Kameraden das Klassenzimmer unter den spöttischen bis ungläubigen Blicken der anderen verlassen, wenn der Priester seinen Religionsunterricht begann. Aber auch daran habe ich keine besonders unangenehmen Erinnerungen. Ich glaube immer noch, dass ich dank solcher Erlebnisse die Existenz von Vielfalt und die Notwendigkeit, sie zu verstehen und zu respektieren, gelernt habe, und – auch dank des Beispiels meiner Eltern – den Wert des Durchhaltens, des Nicht-Aufgebens, der Bereitschaft, allein zu stehen, wenn man glaubt, im Recht zu sein, des Vertrauens darauf, dass, wo nicht alles, so doch vieles möglich ist.
Ich denke mit Zärtlichkeit an meine Mutter, die behutsam versuchte, mir einen Beruf schmackhaft zu machen, der es mir ermöglichte, im Grünen zu arbeiten, um meine Augen zu schonen. Indessen las ich, nicht ohne Anstrengung, heimlich die vielen Bücher, die im Haus herumstanden und -lagen, mit einer Taschenlampe unter meiner Bettdecke. Die Pfadfinderei, die Bücher und das Radio (es gab keinen Fernseher im Haus) waren die wichtigsten Ingredienzien meiner Jugend, während ich mich in der Schule mit dem Minimum begnügte – die Freude am Lernen stellte sich erst an der Universität ein.
Die Nachrichten über das, was in der Welt geschah, weckten bald mein Interesse. Ich war elf Jahre alt und erinnere mich noch gut an die Neugier und Aufmerksamkeit, mit der ich die tragischen Ereignisse in Budapest nach dem Einmarsch der sowjetischen Panzer gegen die von Imre Nagy verkörperten Freiheitsbestrebungen verfolgte. Ebenso die französisch-britische (und im Geheimen auch israelische) Militärexpedition am Suezkanal, der vom ägyptischen Premierminister Gamal Abdel Nasser verstaatlicht worden war, sowie die Entführung des Flugzeugs mit den Führern der algerischen Revolution von Rabat nach Tunis durch die französische Armee.
Das war im Jahr 1956. Dann wurde auch der Algerienkrieg und damit die französische Politik zu meiner Leidenschaft und lehrten mich, die Bedeutung von Begriffen wie Demokratie und Achtung der Menschenrechte zu schätzen. Während meine Kameraden in der Lage waren, die Spieler der verschiedenen italienischen Fussballmannschaften aufzuzählen, zählte ich die verschiedenen Premierminister auf, die sich in dieser Zeit in Paris die Klinke in die Hand gaben. Dann kam Charles de Gaulle, den ich immer noch als eine der größten politischen Persönlichkeiten des letzten Jahrhunderts schätze. Ich schwänzte die Schule, um auf Langwellenrundfunk seine legendären Pressekonferenzen zu hören – die Hälfte davon habe ich wegen des schlechten Empfangs allerdings verpasst. Wenn man seine Schriften und Reden heute liest, ist man erstaunt, wie aktuell die Vorahnungen des Generals heute noch sind.
Ich erinnere mich, dass ich anfangs ein glühender Anhänger der »Algérie française« war, was zu lebhaften Diskussionen am Esstisch führte, so sehr, dass meine Mutter drohen musste, zum Teppichklopfer zu greifen; sie war entschieden der Meinung, dass man beim Essen nicht über Politik spricht! Meine Geschwister, aber auch mein Vater, machten sich lustig über mich wegen meiner hitzigen Reaktionen. Diese Provokationen führten aber dazu, dass ich nachdachte und meine Meinung änderte. Irgendwann verstand ich, wie wichtig das Recht der Völker war, frei über ihr eigenes Schicksal zu entscheiden und wie ungerecht die europäische Minderheit in Algerien die indigene und muslimische Mehrheit behandelte.
Der Algerienkrieg war lang und erbittert. Zu Beginn vermieden französische Politiker und Medien den Begriff Krieg und sprachen stattdessen von den »Événements d’Algérie« (wie sehr erinnert das doch an eine ominöse »Militärische Spezialoperation« der letzten Zeit!). Zahlreiche Verbrechen wurden von der französischen Armee begangen, darunter auch umfangreiche Folterungen. Niemals gab es im Land der Menschenrechte eine gerichtliche Verurteilung für solche Taten, obwohl viele Folterer bekannt waren und sind und einige sich sogar damit brüsteten. ▶ Siehe »Gewalt und Zensur«1
Der Algerienkrieg und insbesondere die Entführung des Flugzeugs der Air Maroc mit den Führern der Nationalen Befreiungsfront (FLN) an Bord hatte damals unvorhergesehene und sogar aufsehenerregende Folgen, die zum Selbstmord des schweizerischen Bundesanwalts und Chefs der Spionageabwehr René Dubois führten. Dubois hatte die Überwachung der Kommunikation der ägyptischen Botschaft in Bern angeordnet. Ägypten war der wichtigste Unterstützer der algerischen Revolutionäre, die die ägyptische Botschaft in Bern zur Kommunikation mit Nasser nutzten. Der sozialistische französische Premierminister Guy Mollet fand heraus, dass Bundesanwalt Dubois wie er Sozialist war und lud ihn nach Paris ein, um ihn davon zu überzeugen, dass Nassers Ägypten, das gerade den Suezkanal verstaatlicht hatte, eine ernste Gefahr für die Demokratien darstellte und dass ganz Nordafrika im Chaos zu versinken drohte. Dubois ließ sich überzeugen und gab alle abgefangenen Informationen, die über die ägyptische Botschaft in Bern gelaufen waren, an die französische Spionageabwehr weiter, und mit ziemlicher Sicherheit auch die Informationen über die Flucht der algerischen Führer von Rabat nach Tunis. Eine klare Verletzung der Neutralität durch einen der höchsten Justizbeamten des Landes. Die Presse bekam Wind von der Affäre, und der Skandal war riesig; Staatsanwalt Dubois konnte dem Druck nicht widerstehen und nahm sich das Leben.
Nach der Matura, als es darum ging, den weiteren Weg zu wählen, geriet alles in unvorhergesehene, ungeplante Bahnen. Ich war begeistert von der Psychiatrie, eine weitere jugendliche Leidenschaft, die entstanden war, als die neuen Ideen der Antipsychiatrie und die von Franco Basaglia eingeführten revolutionären Behandlungsmethoden an Boden gewonnen hatten. Dann, bei einem Abendessen nach einem Berufsberatungstreffen, saß ich zusammen mit zwei Psychiatern an einem Tisch. Die beiden Fachleute sprachen kaum mit mir, stattdessen diskutierten sie untereinander in einer unverständlichen Sprache. Ich war sehr enttäuscht, und mein Vater tröstete mich, indem er mir sagte, dass ich an diesem Abend indirekt ein Attest für psychische Gesundheit erhalten hätte, denn wenn ich ein Fall für die Psychiatrie gewesen wäre, hätten sie sich sicher für mich interessiert! So wandte ich mich der Juristerei zu.
Ich wusste von Anfang an, dass ich nicht Anwalt werden wollte, sondern dachte eher an die Gefängniswelt, die Forschung, die Lehre, vielleicht an ein Richteramt. Von da an geschah alles fast zufällig, durch ein zufälliges Treffen oder Telefonanrufe, die mich jedes Mal dazu zwangen, mich in kürzester Zeit zu entscheiden. Tatsächlich ist es so, dass ich mich nie aus eigenem Antrieb um eine Stelle beworben habe, ich wurde immer dazu gedrängt.
Während meiner Abschlussprüfungen an der Universität traf ich zufällig den Professor für Strafrecht, bei dem ich mich für die Promotion entschieden hatte. Er erzählte mir, dass es eine Ausschreibung für ein Stipendium der deutschen Regierung gebe, und er erklärte, dass ich damit an das Max-Planck-Institut für Internationales Strafrecht und Kriminologie in Freiburg im Breisgau gehen könnte. Eigentlich wollte ich nach Montreal gehen, um dort Kriminologie zu studieren, ein Fach, das es damals in der Schweiz so gut wie nicht gab, aber ich hatte keine Lust, meine Eltern ein weiteres Mal um Geld zu bitten. Das Auswahlverfahren für das Deutschlandstipendium lief am selben Tag oder am Tag danach aus. Ich füllte eilig die erforderlichen Formulare aus, ohne große Hoffnung, denn es war nur ein einziges Stipendium für die gesamte Universität zu vergeben. Innerhalb weniger Tage erhielt ich mein Stipendium, bestand meine Abschlussprüfungen in Jura, heiratete und reiste mit meiner Frau nach Deutschland.
Wir erlebten, wie es ist, Ausländer im Ausland zu sein, ertrugen die umständlichen Formalitäten einer schwerfälligen Verwaltung mit unfreundlichen Beamten, und das alles in einem Schuldeutsch (das ich nie wirklich in den Griff bekam). Wir haben eine winzige Wohnung, die bald zu einem Treffpunkt für die ausländischen Stipendiaten und Wissenschaftler des Instituts wird. Das Stipendium wird verlängert und ich erhalte einen Beitrag vom Schweizerischen Nationalfonds. Dann werde ich vom Institut als Forscher und Leiter der Abteilung für Schweizer Recht angestellt. Eine sichere Stelle, hervorragende Sozialleistungen, gute und konkrete Aussichten auf eine Zukunft in der Wissenschaft.
An einem Mittwoch erhält das Max-Planck-Institut in Freiburg im Breisgau einen Anruf aus dem Tessin: Es ist der Jurist Ferruccio Bolla, Staatsrat und Herausgeber des Repertorio di giurisprudenza patria, ein Mann von großer Kultur und Rechtschaffenheit. Er ist wahrscheinlich die einzige Person im Tessin, die einige meiner in Fachzeitschriften veröffentlichten Beiträge gelesen hat. Er verschwendet keine Zeit mit Vorreden: »Sind Sie daran interessiert, als Vertreter der Anklage bei der Staatsanwaltschaft des Sopraceneri zu arbeiten?« In Deutschland war ich auf dem Weg zum Professor für Strafrecht: Ich hatte meine Doktorarbeit abgeschlossen und diskutierte mit dem Institutsleiter über die Themenwahl für die Habilitationsschrift. Genau zu diesem Zeitpunkt wuchsen jedoch meine Zweifel an einer akademischen Karriere: ich vermisste die Konfrontation mit der realen Welt und den menschlichen Kontakt – der zwischen Forschern oft distanziert und kompetitiv ist. Ich bat vergeblich um etwas Zeit, um nachzudenken: das Vorsprechen der Kandidaten würde in drei Tagen, am Samstagmorgen, in einem Klassenzimmer der Kunstgewerbeschule in Bellinzona stattfinden. Ich nahm den Zug und wurde ein paar Monate später vom Großen Rat zum stellvertretenden Staatsanwalt gewählt.
Etwa fünfzehn Jahre später – intensive und aufregende Jahre! – verändert ein Telefonanruf am Sonntagmorgen erneut mein Leben: Ich habe bis Dienstagmittag Zeit, die Kandidatur für die Nachfolge des zurücktretenden Staatsrats Claudio Generali anzunehmen. Die Nominierung durch den kantonalen Parteiausschuss der Freisinnigen (im Tessin PLR, Partito Liberale Radicale) erfolgt einige Tage später, als ich mich in Malibu, Kalifornien, bei einem Treffen mit amerikanischen Ermittlern aufhalte, die an einer großen Ermittlung über Drogenhandel und Geldwäscherei in Höhe von Hunderten von Millionen Dollar beteiligt sind.
Als mich die Nachricht erreichte, saß ich im 14. Stock des Hotels mit Blick auf den Pazifischen Ozean, erschöpft und schockiert. Bis dahin hatte ich noch nie ein solches Gefühl der Fassungslosigkeit und Ohnmacht erlebt. Unter diesen Umständen gab ich mein erstes Interview als Politiker am Telefon. Der Kollege und Freund Piergiorgio Mordasini sollte später von mir sagen: »… ein an die Politik ausgeliehener Staatsanwalt.«
1995 wurde ich 50. Mein Vater starb. Für mich eine schwierige Zeit. Ich verspürte ein Gefühl der Verwirrung und des Zweifels. Ohne eine genaue Ursache zu kennen, hatte ich das Gefühl, dass ich nicht mehr die nötige Motivation hatte, um weiterzumachen wie bisher, und ich beschloss, für eine neue Amtszeit als Staatsrat nicht mehr zu kandidieren. Eine Entscheidung, die ich traf, ohne zu wissen, was ich als Nächstes tun würde. Eine wichtige Anwaltskanzlei in Zürich bot mir einen Auftrag an. Ich zog das Angebot nicht einmal in Betracht, so interessant es auch aus finanzieller Sicht gewesen wäre. Es war nicht das Leben, das ich wollte, ebensowenig wie das Leben, das mir die Rituale der Politik aufgezwungen hatten: Unnötig theatralisch, oft nervenaufreibend, irrational, zwischen falschen Freunden und falschen Wahrheiten – das, obwohl die Aufgabe, ein Departement zu leiten (in meinem Fall das der Finanzen), durchaus befriedigend war.
Und dann kommt der Anruf von Fabio Rezzonico, einem wahren Gentleman der Tessiner Politik. Er wird von der FDP/PLR beauftragt, Listen für die Parlamentswahl vorzuschlagen und fragt nach meiner Verfügbarkeit. Ich antworte ihm mit einem Lachen. Als Vorsitzender der Konferenz der Kantonalen Finanzdirektoren war ich schon mehrmals Gast in Parlamentarischen Kommissionen gewesen und kenne daher deren Arbeitsweise sehr gut. Ich füge hinzu: »Das ist nichts für mich, vielleicht Ständerat, wo die Diskussionen weniger politisiert und polarisiert sind.« Ein Scherz ohne Hintergedanken, der vielleicht sogar hochmütig und arrogant wirkt. Ich erwähne den Ständerat in der Gewissheit, dass sich die Frage gar nicht stellen wird.
Nur vier Jahre zuvor, im Jahr 1991, fand ein Wahlkampf statt, wie es ihn in unserem Kanton noch nie gegeben hatte. Ein Kampf der Titanen innerhalb der FDP um den Ständeratssitz: Sergio Salvioni gegen den bisherigen Franco Masoni. Ich denke, dass ein kantonaler Kongress wie der, den wir in der Markthalle in Mendrisio gesehen haben, in den Annalen der FDP/PLR einzigartig war, und zum ersten Mal waren an allen Wänden des Kantons riesige Plakate mit den Bildnissen der Kandidaten angebracht. Und so kam es heraus: Die beiden bisherigen Tessiner Ständeräte waren abgewählt, das Duell im Haus der Liberalen gewann Salvioni; Camillo Jelmini von der CVP war überraschend von dem Mediziner Giorgio Morniroli von der Lega dei Ticinesi verdrängt worden.
1995 ist es daher für mich selbstverständlich, dass Sergio Salvioni nach einem solchen Kampf für eine zweite Amtszeit kandidieren würde. Stattdessen kündigt Salvioni an, dass er nach nur einer Amtszeit aufhören wolle: seine Verpflichtungen in Bern und die Führung seiner Anwaltskanzlei seien eine zu große Belastung. Also kommt ein zweiter Anruf von Fabio Rezzonico, der mich an das erinnert, was ich ihm gesagt hatte. Ich habe drei Tage Zeit, mich zu entscheiden. Und schon sitze ich im Ständerat, zusammen mit Renzo Respini von der damaligen CVP (heute Mitte), mit dem ich zu verschiedenen Zeiten ein Stück Weges durch die drei Gewalten des Staates gegangen bin.
Ich wäre wahrscheinlich nicht sechzehn Jahre lang im Ständerat geblieben, wenn da nicht noch das parallele Mandat für die Parlamentarische Versammlung des Europarates gewesen wäre. Zwar mangelte es nicht an Versuchen, mich wegzudrängen, aber in Straßburg warteten noch Aufgaben, die ich nicht abbrechen wollte und konnte. Darüber hinaus glaube ich, dass ich meine Arbeit in Bern nie vernachlässigt habe, wo ich nacheinander die Rechtskommission präsidierte, dann die Außenpolitische und schließlich die Finanzkommission – eine außerordentlich arbeitsintensive Zeit!
In Straßburg übernahm ich die Präsidentschaft der Menschenrechtskommission und der Überwachungskommission, verantwortlich dafür, zu überprüfen, ob die neuen Länder, die nach der Implosion der Sowjetunion unabhängig wurden, die Verpflichtungen bezüglich Menschenrechte, Demokratie und Schutz von Minderheiten, die sie mit ihrer Aufnahme in den Europarat eingegangen waren, auch respektierten. Es wird oft ignoriert: Straßburg hat eine wichtige und wertvolle Arbeit bei der Begleitung dieser Länder bei ihren nicht einfachen ersten Schritten in Richtung Unabhängigkeit und Demokratie geleistet.
Beim Europarat wurden mir innerhalb weniger Jahre Aufträge anvertraut, die Experten als »unmögliche Missionen« bezeichneten. Darunter: Berichte über die Geheimgefängnisse der CIA in Europa, die Menschenrechtssituation in Tschetschenien und im Nordkaukasus und unmenschliche Behandlung und Verdacht auf Menschen- und Organhandel durch die Kosovo-Befreiungsarmee UÇK.1
Natürlich gab es für diese Aufgaben keine Spontanbewerbungen. Ich wurde ausgewählt, weil ich Präsident der Kommission und Schweizer war (und deshalb vermutlich neutral) und mit einer Vergangenheit als Ermittler, bekannt von einigen Fällen, die für Aufsehen gesorgt hatten, sogar über die Schweizer Grenzen hinaus. Ich hätte glaubwürdige Gründe vorbringen können, um solche Aufträge abzulehnen, von denen ich wusste, dass sie nicht nur äußerst schwierig und heikel waren, sondern mit ziemlicher Sicherheit auch eine Quelle von Ärger jeglicher Art, ganz sicher aber nicht von Ruhm. Nein, ich habe diese Aufträge nicht aus Selbstüberschätzung angenommen, wie mir einige unterstellt haben, sondern nur aus Selbstachtung: Hätte ich mich vor ihnen gedrückt, hätte ich, glaube ich, für immer eine unerträgliche innere Wunde gespürt, nämlich die der Scham, die Pflichten des von mir gewählten Amtes nicht erfüllt, mich aus Angst vor dem Versagen gedrückt zu haben.
1Gewalt und Zensur
Viele Jahre nach dem Algerienkrieg hat General Jacques Massu, militärischer Führer in Algerien und Oberbefehlshaber in der sogenannten »Schlacht von Algier« die Anwendung von Folter ausdrücklich zugegeben: »Wenn ich an Algerien zurückdenke, betrübt mich das. Man hätte gut ohne die Folter auskommen können. Sie war Teil des damals herrschenden Klimas. Man hätte das anders machen können.« (Le Monde, 22. Juni 2000). Ein anderer General, Paul Aussaresses, gab zu, dass er persönlich den Befehl zum Mord an dem Mathematiker Maurice Audin, einem Unterstützer des algerischen Aufstandes, gegeben hatte: »Man hat ihn mit dem Messer getötet, um glauben zu machen, die Araber hätten ihn umgebracht.« (Jean-Charles Deniau, La vérité sur la mort de Maurice Audin, Éditions des Équateurs, Paris 2014) Ich erinnere auch an Gillo Pontecorvos Film Die Schlacht von Algier, der 1966 in Venedig den Goldenen Löwen gewann und in Frankreich zensuriert wurde, wie andere Filme, die sich mit dem Algerienkonflikt befassten.
Allerdings war Frankreich zu dieser Zeit nicht das einzige Land, das zur Zensur griff. Giulio Andreotti war in Italien der Urheber des Gesetzes, das es ermöglichte, sogar präventiv gegen Filme vorzugehen, die »die katholische Welt beleidigten«. In diesem Zusammenhang fiel sein berühmter Satz: »Schmutzige Wäsche wäscht man zu Hause.« Der Film Der Löwe der Wüste (1980) von Moustapha Akkad über das Leben des libyschen Helden Omar al-Mukhtar, der mit aller Kraft gegen die von Mussolini befohlene kolonialistische Invasion Italiens in Libyen kämpfte, wurde in Italien ebenfalls zensuriert, weil er als »schädlich für die Ehre der italienischen Armee« angesehen wurde. Er wurde in Italien nur einmal, 2009, auf einem privaten Fernsehsender ausgestrahlt. Die Gräueltaten der italienischen Armee, angeführt vom faschistischen General Rodolfo Graziani (späterer Kriegsminister der sogenannten Republik Salò, ein Kriegsverbrecher der Sonderklasse), kosteten Hunderttausende von Zivilisten in Libyen und Eritrea das Leben.
II Der Advent
»Viele ruhige Flüsse entspringen
in donnernden Wasserfällen,
aber keiner von ihnen rauscht
und schäumt bis zum Meer.«
Michail Lermontow
Kehren wir zur Flussmetapher zurück, wieder mit einem Dichter, diesmal einem russischen, und zwölf Jahrhunderte nach dem Chinesen Chen Zi’ang. Auch ich dachte, dass dieser ungestüme und unberechenbare Strom, während er sich seinem Ziel nähert, schließlich zu einem ruhigen Fluss werden würde, der mit Diskretion und unerschütterlichem Phlegma durch ruhige grüne Landschaften fließt.
Und tatsächlich hatte ich 2020 im Alter von 75 Jahren zum ersten Mal mein Leben geplant. Nach dem Ende meiner parlamentarischen Tätigkeit und nach zehn Jahren leidenschaftlichem Engagement für die Konzernverantwortungsinitiative hatte ich beschlossen, mich nach der Volksabstimmung endgültig zurückzuziehen und die öffentliche Bühne zu verlassen; am Tag nach der Abstimmung würde ein neuer Lebensabschnitt beginnen. Kein Hetzen mehr von einem Termin zum nächsten, kein Ärger mehr mit unpünktlichen Lieferungen, kein nervenaufreibendes Warten in Flughäfen, die mit ungeduldigen, oft unfreundlichen und hysterischen Menschen überfüllt sind. Nein, zum ersten Mal in meinem Leben würde ich eine Zeit erleben – zwangsläufig meine letzte – in der ich mit meinen Hunden in den Wäldern spazieren gehen, mich ausruhen und entspannen, all die Bücher lesen, die schon lange ungelesen herumliegen, und mich mit meinen Freunden, meinen echten Freunden, treffen würde. Eine Zeit, die ich der Erziehung zum Müssiggang widmen wollte, jenem Müssiggang, der »nur für die Mittelmäßigen fatal ist«, wie Albert Camus zu sagen pflegte; Müssiggang, von dem ich so oft träumte, den ich aber nie in die Tat umsetzte, so sehr, dass Schuldgefühle jeden bescheidenen Versuch in dieser Richtung im Keim erstickten. Man wird vielleicht sagen: »Ach ja, deine protestantische Erziehung!«
Adventssonntag des Jahres eins der Pandemie. Die Konzernverantwortungsinitiative erhält eine Ja-Mehrheit vom Volk, scheitert aber am erforderlichen Ständemehr – nicht zuletzt wegen ein paar kleinen bis sehr kleinen Kantonen. Wenn man bedenkt, dass die Initiative von zivilgesellschaftlichen Organisationen mit Tausenden von Freiwilligen ins Leben gerufen und durch kleine Beträge finanziert wurde, die regelmäßig von einer beeindruckenden Zahl von Menschen gezahlt wurden, ist das Ergebnis ein beachtlicher Erfolg, zumal die Gegner auf die Unterstützung globaler Giganten mit Sitz in der Schweiz zählen konnten. Die Kampagne fand während der Pandemie statt, mit zwangsläufig halbleeren Märkten und Hallen. Es war auch schwierig, weil der Ton bald sehr gereizt, wenn nicht sogar bösartig wurde.
Die Forderung, dass ein multinationales Unternehmen für die Schäden, die es der Bevölkerung und der Umwelt in den fragilen Ländern, in denen es tätig ist, zufügt, zur Rechenschaft gezogen wird, scheint mir absolut selbstverständlich zu sein. Umso erstaunter, ja schockierter war ich, dass unsere Justizministerin die Initiative mit solchem Eifer und einer solchen Lässigkeit im Umgang mit der Wahrheit bekämpfte. Unsererseits fehlte es nicht an Beweisen für den guten Willen.
Wir hatten sogar einen Gegenvorschlag unterzeichnet, der in Zusammenarbeit mit Politikern verschiedener Parteien und wichtigen Wirtschaftskreisen ausgearbeitet und von einer klaren Mehrheit des Nationalrats angenommen worden war, in dem wir schriftlich festhielten, dass wir die Initiative zurückziehen würden, wenn die andere Parlamentskammer in dieselbe Richtung entscheiden würde. Karin Keller-Sutter, die Justizministerin, kämpfte zusammen mit Economiesuisse und SwissHoldings mit allen Mitteln, um den Ständerat zu überzeugen, den vom Nationalrat beschlossenen und unterstützten Gegenvorschlag abzulehnen. Ein absolut ungewöhnlicher Eifer eines Bundesratsmitglieds, wenn das Parlament einen Entscheid zu fällen hat.





























