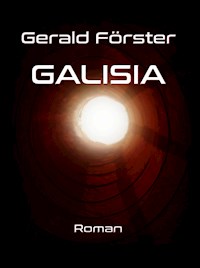
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Deutschland in einer möglichen Zukunft. In der Chefetage einer Bank kommt es zu einer folgenschweren Begegnung, ein Wirtschaftsmagnat wird ermordet aufgefunden und kurz darauf stirbt ein hochrangiger Politiker einen grauenvollen Tod. In den metaphorisch inszenierten Taten glauben Kommissar Vincent Brandt und Kriminalpsychologin Thea Voss Botschaften zu erkennen. Während die Menschen im Land, deren Alltag von Versorgungsproblemen und elektronischer Überwachung geprägt ist, den Täter feiern, wie den wiederauferstandenen Robin Hood, kollidiert Brandts unerschütterliches Gerechtigkeitsempfinden zunehmend mit dem Werteverständnis gesellschaftlicher Entscheidungsträger. Begleitet und inspiriert von inneren Konflikten kommt er Schritt um Schritt einer unglaublichen Wahrheit auf die Spur. Der Autor entwirft ein beunruhigendes Zukunftsszenario mit Tiefgang und einer guten Portion Wortwitz.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 520
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Galisia
Titel SeitePrologKapitel 1Kapitel 2Kapitel 3Kapitel 4Kapitel 5Kapitel 6Kapitel 7EpilogGerald Förster
Galisia
Prolog
Und ich sah einen Engel vom Himmel fahren, der hatte den Schlüssel zum Abgrund ... in seiner Hand.
(Offenbarung des Johannes 20,1)
Er sah noch einmal nach dem Kuvert, das Mariella Popp ihm am Nachmittag auf den Schreibtisch gelegt hatte. »Dem Herrn von Aktien und Papieren - zum Fünfzigsten! Wir gratulieren« stand in schnörkeliger Handschrift auf seiner Vorderseite. Das kommt dabei heraus, wenn Sekretärinnen sich im Reimen versuchen, dachte Wolf Gulau amüsiert. Eine Perle, diese Frau.
Gedankenversunken blickte er durch die breite Glasfront hinaus auf das hell erleuchtete Bankenviertel. Es war eine unglaubliche Aussicht von Deutschlands höchstem Gebäude. Vorhin hatte er fasziniert den farbenprächtigen Sonnenuntergang hinter dem Taunus betrachtet und dabei an den Tag vor dreizehn Jahren denken müssen, an dem der neue Germania Bank Tower mit Pomp und großem Tamtam eingeweiht worden war. Es war ein denkwürdiger Tag gewesen. Und ein richtungsweisender zugleich. Nach Käsehäppchen hatte es im Atrium nicht wieder geduftet, ebenso wenig, wie das alberne Gekicher der Hostessen dort je wieder gehört worden wäre. Was seither hingegen wie eine gute Tradition gepflegt wurde, waren die Zusammenkünfte mit dem Kanzler, hier in der achtundneunzigsten Etage, wo seinerzeit die Erwartungen formuliert und die Kompetenzen abgesteckt worden waren. In der Folge kam es zu einem für beide Seiten gedeihlichen Arrangement, von dem man fortan einträchtig profitierte. Seine Bank war zu einem der potentesten Geldhäuser in Europa aufgestiegen, er selber rangierte auf der Forbes-Liste der European Billionaires unter den Top Ten, noch vor den russischen Gasoligarchen, und Kanzler Brutus Aitel war mit seiner inzwischen vierten Amtszeit belohnt worden. Keinerlei Anlass zur Klage, war sein stilles, nicht uneitles Resümee. Gelegenheit für den Puppenspieler, die Fäden für einige Tage aus der Hand zu geben und sich eine Verschnaufpause zu gönnen.
Die Führungsebene hatte zusammengelegt und ihm eine Reise nach Kanada geschenkt. Kanada. Land des Ahorns und der Grislybären. Allein im Klang dieses Namens schwang noch immer etwas mit, das seine Sehnsüchte weckte, grenzenlose Sehnsüchte, die sich für ihn in der Unendlichkeit der nordamerikanischen Prärien versinnbildlichten.
Es war Samstag. Die Angestellten, die sonst die oberen Etagen mit Leben erfüllten, waren längst im Wochenende. Den ganzen Abend hatte er sich durch Aktenberge gegraben. Jetzt sah er zum ersten Mal auf die Uhr. Gleich zwölf. Rasch sortierte er noch einige Unterlagen auf einen Stapel, bevor er seinem gläsernen Turm für zwei Wochen den Rücken kehren würde. »Vancouver Island, ich komme«, summte er einstimmend zu »Fare fare away«, der Hymne der Weltenbummler, vor sich hin. Dabei schien es ihn in keiner Weise zu stören, dass sein Text nicht auf die Melodie passen wollte. Eben stellte er sich vor, wie er vor der imposanten Kulisse des Golden Hinde einen kapitalen Lachs aus dem Sproat Lake zog, als er aus der Garderobe hinter sich ein leises, sirrendes Geräusch und, aus dem Augenwinkel heraus, einen sonderbar fahlen Lichtschein wahrnahm. Was ist das, fragte er sich eher beiläufig und ohne sich umzublicken. Egal, was sollte es schon sein. Er musste sich jetzt beeilen. In wenigen Stunden ging der Flieger.
Beschwingt küsste er den Briefumschlag und wollte sich just erheben, als er plötzlich heftig zusammenfuhr. Etwas Kaltes drückte gegen seinen Nacken. Für einige Sekunden stockte ihm der Atem. Schweiß trat auf die Stirn. Sein Puls begann zu hämmern. »Was ... wer sind Sie?«
Im gleichen Maße, in dem er versuchte sich umzudrehen, spürte er den Druck zunehmen. Ein dünnes, warmes Rinnsal lief an seinem Hals herab und versickerte im Hemdkragen. »Wer sind Sie? Wie sind Sie hier hereingekommen? Was wollen Sie? Geld? Ich habe Geld.« Mit jedem Wort klang seine Stimme hektischer. Er zeigte auf einen in die gegenüberliegende Wand eingelassenen Tresor. »Der ist voll davon. Bedienen Sie sich. Es gehört Ihnen. Alles!« Verstohlen blickte er zum Alarmknopf.
»Denken Sie erst gar nicht daran«, warnte der Eindringling grimmig entschlossen.
»Sie dürfen sich nehmen, so viel sie wollen. Bitte!«
»Glauben Sie, ich würde um Ihre Erlaubnis bitten, wenn ich mir etwas nehmen wollte?«
»Um Himmels willen! Was wollen Sie denn von mir?«, wimmerte der Bankdirektor. »Tun Sie mir nichts. Bitte! Heute ist doch mein Geburtstag.«
Gulau war beileibe nicht das, was man einen zupackenden Typ nannte. Er war es gewohnt, dass andere für ihn Dinge erledigten. Bis weit ins Teenageralter hinein hatte ihm seine magere Erscheinung und eine vorstehende Zahnreihe, die sein Profil denkbar unvorteilhaft beeinträchtigte, kaum mehr als die Häme der Mitschüler eingebracht. »Kein Gesicht, sondern ein Malheur, was die Natur dir da an den Kopf gebastelt hat«, spotteten sie, aber ihre Demütigungen sollten bald in Respekt umschlagen. Das Erweckungserlebnis hatte er auf dem Internat. Sein Ruf als Schwächling und die damit einhergehende Erfolglosigkeit beim anderen Geschlecht hatten ihn zunehmend in Selbstzweifel stürzen lassen, als er eines Tages beherzt einer Kommilitonin einen Packen Scheine in die Hand drückte und diese sich daraufhin, zu seinem ungläubigen Erstaunen, auf ein Rendezvous mit ihm einließ. Mit dem Geld des Großvaters, der sechzig Jahre zuvor die größten Banken Deutschlands zu einem mächtigen Finanzkartell zusammenführte, hatte er das Mädchen gekauft. Menschen waren käuflich. Es war eine Erkenntnis, die sein Weltbild maßgebend prägen sollte. Von diesem Tag an zweifelte er nicht mehr. Er bediente sein Ego, wo und wann immer sich die Gelegenheit bot.
Ein athletisch wirkender junger Mann mit rotblondem Schopf, er mochte Mitte zwanzig sein, vielleicht etwas älter, trat um ihn herum und hielt ihm eine japanische Klinge vor das Gesicht. Gulau fasste sich an den Hals. An drei seiner Finger klebte Blut.
»Es heißt, Schwertmeister Masamune Okazaki selbst habe es geschmiedet.« Mit einem sonderbaren, fast leidenschaftlichen Blick sah der Fremde auf den glänzenden Stahl. »So alt schon und dennoch teilt es eine Kokosnuss ebenso leicht, wie eine grüne Gurke.«
»Verstehe! Ich werde Ihnen keine Schwierigkeiten machen.«
»Ich weiß«, entgegnete er in aller Gelassenheit. Gemächlich schritt er durch das großzügige Büro, blieb vor der Fensterfront stehen und sah hinaus in die Nacht. »Ziehen Sie Ihr Jackett aus. Und das Hemd!«
»Was? Warum? Ich verstehe nicht.«
Er hob das Schwert in die Höhe. »Genauso, wie vor dreizehn Jahren.«
Gulau stutzte. »Wie? Was meinen Sie? Was wollen Sie denn von mir?«, jammerte er ein weiteres Mal und mühte sich nach Kräften, die Selbstbeherrschung nicht vollends zu verlieren. Der ungebetene Gast sah ihn mit stechendem Blick an und einen Moment lang bildete er sich ein, Flammen in dessen Augen lodern zu sehen.
»Es war in einer lauen Augustnacht. Wie heute. Sie erinnern sich?«
»Was? Nein! Dreizehn Jahre, das ist lange her.«
»Dann will ich Ihrem Gedächtnis nachhelfen. Man hatte Sie an dem Tag zum Vorstand ernannt. Und es war Ihr Geburtstag. Wie heute. Ihr siebenunddreißigster. Erinnern Sie sich jetzt?«
»Ja, äh ... ja«, stammelte der Bankier unsicher.
»Gut. Dann erinnern Sie sich gewiss auch daran, dass es die Nacht war, in der Sie einen Menschen töteten. Das Jackett!«
Im Bruchteil einer Sekunde lief Gulaus Hirn auf Hochtouren. Was meinte der Kerl? Er konnte nur ... Nein, das war nicht möglich. Wusste er ...? Unsinn! Gar nichts konnte er wissen. Niemand wusste etwas. Er versuchte einen Strategiewechsel. »Sie haben keine Ahnung, mit wem Sie sich anlegen. Ich spiele in der Oberliga. Und dort an der Spitze. Was Sie hier veranstalten, wird Sie den Kopf kosten. Also lassen Sie es besser sein. Ich brauche nur ...«
Unvermittelt zuckte er zusammen. Die Klinge war leicht an seinem Hals entlanggefahren und jetzt spürte er ihre Spitze direkt an der Kehle. »Im Augenblick sollte Ihrem eigenen Kopf die größere Sorge gelten. Zum letzten Mal: ausziehen!«
Gulau musste einsehen, dass sein Fluchtversuch nach vorn fehlgeschlagen war. Angesichts des schneidenden Argumentes an seinem Hals zog er sein Sakko aus und begann mit zittrigen Fingern, das Hemd aufzuknöpfen. »Wer, zum Teufel, sind Sie?«
Der Fremde beugte sich langsam zu ihm herunter. »In jener Nacht vor dreizehn Jahren waren Sie mit ihrem Wagen im Bahnhofsviertel unterwegs. Sie waren auf der Suche. Auf der Suche nach jungem Fleisch. In der Kaiserstraße haben Sie zwei Burschen angesprochen. Einer der beiden stieg bei Ihnen ein. Ich konnte ihn nicht zurückhalten. ›Hör auf, dir Sorgen zu machen‹, rief er mir lachend zu, ›morgen dinieren wir im Hilton‹. Es waren die letzten Worte, die ich von ihm hörte. Am nächsten Tag hat ihn die Polizei tot aus dem Main gefischt. Erwürgt. Vergewaltigt, erwürgt und weggeworfen. In seinen Taschen hat man mehr als zehntausend Neue D-Mark gefunden. Ihr Geld. Ich habe keine Sekunde gezweifelt, dass Sie ihn umgebracht haben.« Er kam dicht an Gulaus Gesicht heran. »Hat er genauso hilflos geschaut, wie Sie jetzt? Der Junge hieß Leon. Er war mein Freund. An seinem Grab habe ich geschworen, eines Tages Genugtuung für seinen Tod einzufordern. Dieser Tag ist heute gekommen. Bevor Sie sterben, will ich Ihnen die Gelegenheit geben, ihr Gewissen zu erleichtern.«
»Sterben?«, schrie Gulau entsetzt auf. »Nein! Ich will nicht sterben. Ich kenne Ihren Freund nicht. Gehen Sie doch endlich!«
»Sie sind nicht nur ein Mörder, sondern auch ein erbärmlicher Feigling«, schäumte der Fremde. Dabei verzerrte sich seine bislang gleichgültige Miene zu einer irren Fratze. Er holte zum Streich aus. »So soll es geschehen!«
»Halt!«, kreischte Gulau bebend vor Angst. »Hören Sie auf! Ich gebe es zu. Ich gebe alles zu.«
Langsam sank der Arm wieder nach unten. »Ich höre.«
Verängstigt blickte der Bankier auf die Klinge, die unmittelbar vor seinem Gesicht schwebte. Die Adern an seine Schläfen waren angeschwollen. »In jener Nacht bin ich mit ihm zu einem Parkplatz am Mainkai gefahren«, erzählte er stockend. »Ich habe ihm keine besondere Beachtung geschenkt. Er war ein Stricher, so gut wie jeder andere. Wir hatten dreihundert Mark vereinbart. Als er mitbekam, wer ich bin, wurde er unverschämt. Plötzlich wollte er dreitausend. Sonst würde meine Frau morgen aus der Boulevardpresse erfahren, dass ihr Gatte kleine Jungs fickt. Da habe ich ihn geschlagen. Immer und immer wieder habe ich auf ihn eingeschlagen. Er hat sich nicht gewehrt. Ich habe ihm dann alles Geld in die Taschen gestopft, das ich bei mir trug.« Seine Stimme wurde heiser. Er atmete hastig. »Dann tat ich, wofür ich bezahlt hatte. Dabei habe ich zugedrückt. Fester und fester habe ich zugedrückt. Erst als er sich nicht mehr bewegte, habe ich losgelassen. Dann war es zu Ende. Wie erstarrt bin ich neben ihm gesessen ... wie erstarrt ... nur dagesessen. Als es dämmerte, habe ich seinen toten Körper aus dem Auto gezogen und in den Fluss geworfen.« Gulau sah zu Boden. »Ich habe ihn getötet. Und in den Fluss geworfen!« Erschöpft sank er in sich zusammen. »In den Fluss ...«, wiederholte er noch einmal tonlos.
Im gleichen Moment riss ihm der Rotschopf das Hemd auf und presste einen metallenen, zylinderförmigen Gegenstand gegen seine Brust.
Gulau schrie auf. »Was tun Sie da, was hat das zu bedeuten?«, stöhnte er und verzog gequält das Gesicht.
Der Fremde war jetzt wieder völlig ruhig. »Wolf Gulau. Nomen est Omen. Ein passenderer Name für Sie hätte selbst mir nicht eingefallen können. Einer, der nicht fragt, der sich nimmt was er will. Und immer zu viel davon. Einer, der andere in den Ruin treibt oder beseitigt, wenn sie ihm im Licht stehen. Einer, der Milliarden hortet und für dreitausend Mark tötet. Haben Sie nie damit gerechnet, dass Ihnen diese Verfressenheit eines Tages zum Verhängnis wird?«
Der Bankier fasste sich an die schmerzende Brust. Er war aschfahl geworden. Von seiner Stirn perlten Schweißtropfen. »Was soll das werden, ein Ethiktribunal? So funktioniert die Welt. Ich kann sie nicht ändern«, krächzte er matt.
»Wenn nicht Sie, wer dann? Aber das spielt jetzt keine Rolle mehr.« Der Fremde sah sich suchend um. Sein Blick blieb an dem alten, mannshohen Geldschrank hängen. »Öffnen Sie ihn!«
Gulau schaute auf. Also doch! Ein blasser Hoffnungsschimmer. Mühsam erhob er sich und stolperte hinüber zu dem Safe, einem alten Hammeran von 1920. Eigentlich diente er nur der Dekoration, aber es sollte sich eine ausreichend große Menge Geld darin befinden, so spekulierte er. Bisher hatte noch jeder seinen Preis.
»Ein schönes Stück«, befand der Fremde.
»Nicht wahr? Das ist noch solide deutsche Wertarbeit«, erklärte Gulau, neuen Mut schöpfend. »Höchste Sicherheitsklasse, feuersicher bis zweitausend Grad, angeblich sogar wasserdicht. Eine echte Rarität.« Er drehte das Zahlenschloss abwechselnd nach links und rechts. Dann zog er die schwere Tür auf und zeigte hinein. In seinem Inneren türmten sich Geldbündel, die von unterschiedlich farbigen Banderolen zusammengehalten wurden. »Es dürften vier oder fünf Millionen sein. Nehmen Sie es. Machen Sie sich ein schönes Leben. Ich sorge dafür, dass Sie das Gebäude unbemerkt verlassen können.«
Die Klinge fuhr wieder nach oben. »Sie haben es nicht verstanden«, erwiderte der unheimliche Besucher in einem Tonfall, der so frostig und erbarmungslos klang, dass es dem Bankier einen kalten Schauer über den Rücken jagte. Der schwache Funke der Hoffnung, den er eben noch hatte glimmen sehen, erlosch. »Steigen Sie hinein« hörte er, wie durch einen Vorhang gedämpft, die unheilvolle Stimme sagen. Er begann am ganzen Leib zu zittern. Fahrig nestelte er an den Knöpfen seines offenstehenden Hemdes. »Steigen Sie hinein« hallte es wie ein düsteres Menetekel in seinen Ohren und schlagartig begriff er die Endgültigkeit, die in diesen drei Worten lag. Sehr schnell würde die Luft in dem stählernen Schrank aufgebraucht sein. Und in den nächsten zwei Wochen käme niemandem in den Sinn, nach ihm zu suchen. »Nein! Das dürfen Sie nicht! Hören Sie ... mein Flieger ... Frau Popp! Zu Hilfe!«
»Mach schon.«
Seine Pupillen weiteten sich vor Angst. »Ich werde ersticken!«
»Das werden Sie. Vereint mit Ihrem Kostbarsten.«
»Bitte ...«, flehte er schwach. Dann versagte ihm die Stimme. Etwas Spitzes in seinem Rücken drängte ihn voran.
»Na los!«
Wolf Gulau sträubte sich nicht mehr. Seine Kräfte waren verbraucht. Ein Schritt noch, ein dumpfes Fauchen. Finsternis. Das Zahlenschloss ratterte. Dann war es still.
Kapitel 1
Niemand kann zwei Herren dienen: entweder er wird den einen hassen und den andern lieben, oder er wird dem einen anhangen und den andern verachten.
(Bergpredigt, Matthäus 6,24)
Es muss um 1820 bei einem Dampferausflug auf dem Rhein geschehen sein: Der als Schöngeist geltende preußische Kronprinz und spätere König Friedrich Wilhelm IV. verliebte sich unsterblich in das malerische Flusstal, und um sich seiner neuen Liaison ausgiebiger widmen zu können, ließ er sich auf den Fundamenten der mittelalterlichen Burgruine Stolzenfels eine Sommerresidenz errichten. Die »Perle der Rheinromantik«, als die das gleichnamige Schloss bis heute bezeichnet wird, hatte sich nach mehreren Besitzerwechseln lange Zeit in Landeseigentum befunden, bis es im letzten Jahr wieder privatisiert worden war. Der Vorstandschef von EuroPharm, dem größten Pharmaunternehmen der Welt, hatte sich das ehrwürdige Gemäuer als lieu de villégiature und späteren Alterssitz auserkoren. Von den Dividenden eines einzigen Jahres hatte er sich seinen lang gehegten Wunsch, ein eigenes Schloss zu besitzen, leicht erfüllen können. Wie nahezu alle historischen Herrenhäuser war nun auch die »Stolze Schöne« in die Hände eines Wirtschafts- oder Politikmächtigen gewechselt, und auf dem Schlossberg, den man nach seinem Verkauf mit einer videoüberwachten Umzäunung gesichert hatte, war es still geworden.
In dieser Nacht war der Stolzenfels’sche Friede jäh gestört worden. Blaulichter umkreisten den Innenhof. Hell erleuchtete Treppenhäuser und hektisches Tun und Treiben auf den Fluren zeugten von einem schwerwiegenden Zwischenfall. Schlag zwölf war auf dem Monitor, der die obere Etage überwacht, die elektronische Lebensanzeige erloschen. Ein Wachmann hatte daraufhin die Polizei alarmiert. Rikard Avaran, einer der einflussreichsten Männer der deutschen Industrie, lag tot in seinem Schlafgemach.
Um viertel nach eins hatte man Hauptkommissar Brandt benachrichtigt. Die Stadt ist wie ausgestorben, bemerkte er auf der kurzen Fahrt von seiner kleinen Wohnung am Florinsmarkt zum Schloss. Sommerliche Temperaturen hätten in einer Nacht wie dieser vor nicht allzu langer Zeit noch für gut gefüllte Weinlokale und reges Treiben am Deutschen Eck gesorgt. Auf den Straßen aber herrschte leere Tristesse, wie in jeder Nacht seit der Ausgangssperre. Außer einem Patrouillenfahrzeug des Militärs blieb es leer auf dem linken Rheinufer. Er lenkte den alten Daimler die Serpentinen zum Schloss hinauf. Gegenüber dem Torwächterhaus gewahrte er, im Schutze der Bäume, mehrere dunkel gekleideter Gestalten, die Richtmikrophone und Kameras bei sich trugen. Er stoppte seinen Wagen an der provisorischen Absperrung und zeigte dem Posten seine Polizeimarke. »Ich frage mich, wie diese Zeitungsfritzen schon wieder Wind davon bekommen konnten.«
»Lästiges Pack! Wir kümmern uns darum«, winkte der mit verächtlicher Geste ab und ließ den Kommissar, nachdem er noch einen Blick in den Fond geworfen hatte, passieren.
Als Brandt eintrat, fand er den Rechtsmediziner, Jan Uhland, bereits geschäftig über den toten Hausherrn gebeugt. Uhland, ein drahtiger Mittvierziger mit kernig-markanten Zügen, der sein Haupthaar so kurz trug wie seinen Dreitagebart, galt als Koryphäe der forensischen Pathologie. Sie warfen sich einen kurzen Blick zu.
»Doc, was gibt’s?«
»Einsetzender rigor mortis.« Er klang mürrisch, wie immer, wenn man ihn aus dem Schlaf gerissen hatte.
»Und das heißt?«, fragte Brandt müde.
»Exitus vor höchstens zwei Stunden.«
»Kannst du schon etwas zur Todesursache sagen?«
»Letale Intoxikation. Er hat einen Einstich am Hals, stark gerötet und von einer ringförmigen Schwellung umgeben. Ihm wurde eine giftige Substanz injiziert.«
In all seinen Jahren bei der Mordkommission war Brandt der Tod schon in jeder denkbaren Variante begegnet. Ein Giftmord also. Abgesehen von der Prominenz des Opfers auf den ersten Blick nichts Außergewöhnliches. »Gift«, wiederholte er deshalb eher ungerührt.
»Ein Giftmischer, der an Gift gestorben ist. Da sage noch einer, die Welt sei nicht gerecht.« Wenn es neben dem Analysieren toten Gebeins eine zweite Passion in Uhlands Leben gab, dann war es seine erfrischende Renitenz, die sich gern in semantischem Feinsinn, bisweilen auch in bitterbösem Sarkasmus äußerte. Gesellschaftliche Mechanismen sezierte er mit Worten ebenso messerscharf wie eine Leiche mit dem Skalpell. Ungefragt aber blieb er eher wortkarg. Den Mainstream bedachte Uhland allenfalls mit einem gleichgültigen Schulterzucken, und was seine Lebensplanung anging, gab er den klassischen Modellen bedenkenlos das Nachsehen. Er lebte in einer alten, von Efeu umrankten Wassermühle an einem Eifelflüsschen, zusammen mit seiner koreanischen Lebensgefährtin, kinderlos, glücklich und ohne Ambitionen auf staatlichen oder gar kirchlichen Segen. Er und Brandt arbeiteten seit vielen Jahren zusammen. Ihre anfängliche gegenseitige Wertschätzung war im Laufe der Zeit zu einer soliden Freundschaft herangewachsen. Der Kommissar schätzte ihn als kompetenten Fachmann und Ratgeber, ebenso wie als guten Zuhörer.
»Hat er sich gewehrt?«
»Ich schätze, dafür fehlte ihm die Gelegenheit. Er hat eine leichte Schnittverletzung am Hals, so, als wäre ihm ein Messer an die Kehle gehalten worden bis das Gift wirkte. Mehr nach der Obduktion.«
»Habt ihr ein Tatwerkzeug gefunden?«
»Nein, nichts. Aber das hier solltest du dir ansehen.« Uhland schob die Decke beiseite.
Brandt riss die Augen auf. »Was ist das?«
»Nun, wenn du mich so direkt fragst, das ist ein A.«
Der Kommissar sah den Doktor strafend an. »Was du nicht sagst.«
»Eine Verbrennung, post mortem zugefügt.«
»Du meinst, mit einem Brenneisen?«
»Nein, es sieht eher aus, als hätte sich seine Kosmetikerin bei der Haarentfernung mit der Lasertemperatur vertan. Eine oberflächliche Hautverkohlung mit glatten, sauberen Wundrändern. Ich habe so etwas noch nie gesehen.«
»Ein Laser? Warum lasert jemand seinem Opfer ein A auf die Brust? Eigenartig. Gibt es sonst noch etwas?«
»Auf dem Kissen neben seinem Kopf lag ein Filmdragee. Es ist schon auf dem Weg ins Labor.«
Brandt machte sich ein paar Notizen und wandte sich dann um. »Was hat die Auswertung der Satellitendaten ergeben?«, fragte er in Richtung der Spurensicherer, die damit beschäftigt waren, Türklinken und Mobiliar nach Fingerabdrücken und genetischem Material zu scannen.
»Ich fürchte, wir haben ein Problem«, bemerkte einer der in weiße Overalls Gekleideten und drehte sich dabei langsam um. Anton Kallenbach war der Leiter des Erkennungsdienstes und, neben Uhland, wichtigster Mann in Brandts Team. Die beiden kannten sich schon aus Kindheitstagen. Zusammen waren sie zur Schule gegangen und gemeinsam hatten sie in Köln Kriminalwissenschaften studiert. Nach dem Studium trennten sich ihre Wege, und mehr als zehn Jahre später war es beiden wie eine glückliche Fügung erschienen, dass sie ihre Arbeit bei der Koblenzer Polizei wieder zusammengebracht hatte. Seinen alten Schwung hatte Kallenbach peu à peu gegen das Rundumbehagen eines erfüllten Familienlebens eingetauscht, und auch äußerlich machten sich die Jahre bemerkbar. Die hellblonde Lockenpracht hatte den Kampf gegen das Dahinschwinden aufgegeben, seine Sehkraft benötigte inzwischen das Zutun optischer Hilfsmittel und die Taille war längst nicht mehr die schmalste Stelle zwischen Brust und Hüfte. Ihn selbst focht es wenig an, dass die Zeiten vorbei waren, in denen er von Unterwäsche-Labels für den Laufsteg gebucht wurde, denn in gleichem Maße, wie er sowohl an empirischer Erfahrung als auch an Umfang gewann, hatte er die Prinzipien des ungezwungenen Laissez-faire in seine Lebensmaxime aufgenommen. Nur im Kopf war er noch immer der Freigeist von früher.
»Toni, nun sag schon, wem wir diese schlaflose Nacht verdanken.«
Das nonchalante Begrüßungslächeln des Kriminaltechnikers verwandelte sich übergangslos in eine skeptische Miene. »Dieser Fall wird das Nervenkostüm des Staatsanwaltes auf eine harte Probe stellen.«
»Es ist fraglich, ob es unser Fall bleibt. Avaran war nicht irgendwer. Mich wundert, dass die Schlapphüte noch nicht hier sind. Aber was meintest du mit ›Problem‹?«
Kallenbach runzelte die Stirn. »Um null Uhr gab es ein schwaches Signal, keine zwei Minuten lang. Es wurde nicht identifiziert!«
»Eine Störung?«
»Unwahrscheinlich. Es gab noch nie eine Störung.«
»Dann wurde die Datenübertragung manipuliert?«
»Ausgeschlossen. Der Stream kann weder beeinflusst noch unterbrochen werden. Jeder Versuch wäre tödlich.«
Brandt sah ihn ungläubig an. »Du willst mir also sagen, dass wir keine Aussage zum Täter treffen können?«
»So ist es.«
Jetzt war der Kommissar wach. »Dann dürfte es allerdings zu einer Angelegenheit für den Staatsschutz werden.« Sichtbar erheitert schnippte er mit den Fingern. »Aber bis es soweit ist, werden wir die Gelegenheit wahrnehmen, unsere Fähigkeiten in klassischer Detektivarbeit unter Beweis zu stellen.«
»Ich habe das dumme Gefühl«, orakelte Kallenbach, »dass uns diese Geschichte noch arge Kopfschmerzen bereiten wird.«
Seine Intuitionen hatten Brandt schon oft auf die richtige Fährte geführt. Heute aber schien etwas anders zu sein. So zweifelnd hatte er ihn bislang selten erlebt. Doch jetzt wollte er nicht darauf eingehen. Ganz sicher würde das Tageslicht bereits die eine oder andere Erleuchtung mit sich bringen. »Wer hat ihn gefunden?«, fragte er, als hätte er die Andeutung eben überhört.
»Ein Wachmann hat uns informiert, als sein Dienstherr plötzlich vom Monitor verschwunden war.«
»Wie kam der Täter herein?«
»Preisfrage! Niemand kommt hier herein.«
»Was meinst du damit?«
Kallenbach sah den Kommissar an. »Hatte ich schon erwähnt, dass uns diese Geschichte noch Kopfschmerzen bereiten wird? Das Gebäude ist eines der am besten gesicherten in ganz Deutschland. Alle Überwachungssysteme waren eingeschaltet, als wir eintrafen. Detaillierte Auswertungen laufen noch, ich kann dir aber jetzt schon sagen, dass es zur fraglichen Zeit keinerlei Bewegungen auf dem Gelände gab. Und die Wachmannschaft hat mir versichert, dass nicht einmal eine Maus ihre Checkpoints unbemerkt hätte passieren können. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, wie er das angestellt hat.«
»Aber das er hereinkam, steht doch außer Frage, oder?«, fragte Brandt und klang dabei fast ein wenig spöttelnd.
»Das ist das einzige, was ich dir bestätigen kann. Es ist, als sei er aus dem Nichts aufgetaucht und dorthin auch wieder verschwunden.«
»Was spricht dagegen, dass er durch den Keller oder über das Dach kam?«
»Neueste und teuerste Gerätschaft. Zusätzlich zu unserem Schutzprogramm hat sich Avaran seine Sicherheit einiges kosten lassen. Er hat einen Lifescanner installieren und den gesamten Gebäudekomplex mit einem PSC1 umgeben lassen.«
»Mit einem was?«
»Ein Energieschirm. Der Mann vom Wachdienst hat es mir wie eine überdimensionale, über den Schlossberg gestülpte, unsichtbare Glocke beschrieben. Wer oder was dem Schirm zu nahe kommt und größer ist als eine Elster, löst Alarm aus.«
Brandt bekam große Augen. »Ein Energieschirm?«
»Ein neues Spielzeug für die Leuchttürme der Gesellschaft, erst seit drei Monaten auf dem Markt. Der Wachmann kann es dir besser erklären.«
»Größer als eine Elster«, überlegte er. »Also angenommen, ein Kind wirft einen Ball über den Zaun, wird Alarm ausgelöst?«
»Abgesehen davon, dass es nicht ohne weiteres in die Nähe des Zaunes käme, so ähnlich haben es sich die Konstrukteure wohl gedacht.«
Der Kommissar war beeindruckt. »Apropos Elster, kann man schon sagen, ob etwas gestohlen wurde?«
»Nichts, soweit wir das bisher beurteilen können.«
»Vielleicht fand der Täter eine Gelegenheit, sich im Gebäude einschließen zu lassen.«
»Welche Gelegenheit? Das Schloss ist längst nicht mehr für die Öffentlichkeit zugänglich. Außerdem widerspräche es dem, wenn auch nur fragmentarischen, Satellitensignal, und auch der Lifescanner hat nichts dergleichen angezeigt.«
Brandt stutzte. »Ich glaube, ich muss meine Kenntnisse in Sicherheitselektronik mal wieder auffrischen. Was, in aller Welt, ist denn nun wieder ein Lifescanner?«
Kallenbach lächelte milde. »Auch das lässt du dir am besten von dem Wachmann erklären. Laut seiner Aussage jedenfalls hat der Lifescanner kein unbefugtes Leben im Schloss erkannt. Und der nimmt sogar die fürstliche Hauskatze wahr. Schau hier.«
Er deutete auf einen kleinen roten Punkt auf dem Bildschirm seines Interface, mit dem er sich Zugriff auf die Computer des Wachdienstes im Erdgeschoss verschafft hatte. »Und diese großen Kleckse hier, das sind wir.«
Nachdenklich ging Brandt im herrschaftlichen Schlafzimmer auf und ab. Er blieb am Fenster stehen und sah hinunter auf den Rhein, wie sich seine seichten Wellen gläsern im schwachen Mondlicht kräuselten. Dieses Schloss ist abgeschirmt wie Fort Knox. Niemand spaziert hier unbemerkt ein und aus. Ganz davon abgesehen, man geht nicht einfach zu jemandem wie Avaran. Man nähert sich ihm nicht einmal. Das ist verbotenes Terrain.
Das Leben hatte es mit Vincent Brandt nicht immer gut gemeint. An Schicksalsschlägen aber war er nie zerbrochen. Nicht, als seine Eltern bei einem Verkehrsunfall starben und er, als damals Neunjähriger, fortan bei seinen Großeltern aufwuchs und auch nicht, als seine Frau und seine kleine Tochter der Großen Grippe zum Opfer fielen. Unlängst hatte er seinen dreiundfünfzigsten Geburtstag gefeiert und er war sein einziger Gast. Die Jahre hatten dem schlanken, großgewachsenen Mann tiefe Furchen ins Gesicht gezeichnet und sein Haar war ergraut. Er war ein ernsthafter Analytiker, ein scharfer Beobachter mit verlässlichen Intuitionen und einem ausgeprägtem Rechtsbewusstsein.
Brandt stammte aus einem mittelrheinischen, von dunkelgrauem Moselschiefer geprägten, kleinen verschlafenen Dörfchen. Urbane Betriebsamkeit war seinen Einwohnern so fremd wie die sterile Anonymität der Stadt. Man fühlte sich als Teil einer verschworenen, die Beschaulichkeit schätzenden Gemeinschaft. Wenn er sich heute an seine Kindheit erinnerte, erschienen ihm immer wieder die gleichen Bilder: Wie er mit dem flachsblonden Toni aus der Nachbarschaft durch die nahen Wälder streifte, wie sie sich mit blauen Zähnen anlachten, wenn sie wieder einmal zu viele der köstlichen Heidelbeeren gefuttert hatten oder wie sie auf einer Wiese lagen, Grashalme kauten und, was bei den beiden Jungs stets zu außerordentlicher Erheiterung führte, mit einer selbstgebauten Zwille die nebenan weidenden Schafe beschossen, die dann unter entsetztem Geblöke davonstoben.
Eine einschneidende Wendung nahm das Leben des kleinen Vincent, als eines Tages Vater und Mutter von einer Spritztour in das nahegelegene Koblenz nicht wieder nach Hause gekommen waren. Ein Sattelzugfahrer hatte eine rote Ampel übersehen. Der Kleinwagen und seine Insassen wurden bis zur Unkenntlichkeit zerquetscht. Später bezeichnete er es als Glück im Unglück, dass er aus seiner vertrauten Umgebung nicht herausgerissen wurde, weil seine Großeltern, die den Nachbarhof bewohnten, ihn wie selbstverständlich aufnahmen. Seine kindliche Unbeschwertheit aber hatte an diesem Tag ihr jähes Ende gefunden.
Brandt war ein Mann ohne Fassade, indes mit direkter Ansprache. Im Gegensatz zu Uhland, der sich eher des eleganteren Floretts, respektive der scharfzüngigen Ironie als verbale Waffe bediente, sagte man ihm nach, dass die seine eher der mittelschwere Säbel sei. Seit mehr als zwanzig Jahren war er Polizist und bis heute fiel es ihm schwer, zwischen Arbeit und Freizeit zu unterscheiden. Seine Karriere fand ihren vorläufigen Höhepunkt vor sechs Jahren, als er zum Leiter der Mordkommission ernannt wurde. Brandt redete weniger aber sah mehr als andere, was ihm in seiner Dienststelle den, wie Kallenbach fand, adelnden Beinamen »Holmes vom Hunsrück« eingebracht hatte.
Nach dem Tod seiner Frau war er keine neue Beziehung wieder eingegangen. Der Schmerz über den Verlust saß zu tief. Noch nach Jahren, als die Zeit die Wunden leidlich geheilt hatte, glaubte er, seine Erfüllung allein in seinem Beruf gefunden zu haben und dass eine Frau in seinem Leben wohl keinen Platz wieder fände. Mit dem Alleinsein hatte er sich arrangiert, auch wenn ihm die allabendliche Leere in seiner kleinen Wohnung bisweilen schwermütige Momente bescherte.
Nach dem Studium hatte es ihn zur Marine gezogen. Einmal die Meere zu befahren war ein Traum, den er als kleiner Junge schon träumte. Er entschied sich für eine Offizierslaufbahn bei den Seestreitkräften. Eine degenerierte Bandscheibe bereitete seiner militärischen Karriere jedoch ein vorzeitiges Ende. Nach achtjähriger Dienstzeit wurde er als Fähnrich zur See entlassen.
Danach tauschte er die eine Uniform gegen eine andere. Er absolvierte ein Praktikum bei der Kriminalpolizei in Hamburg. Brandt wurde der Sonderkommission »Robin Hood« zugeteilt, die seit Wochen hinter einem Serienmörder her war, der seine Verbrechen ausschließlich in Hautevolee-Kreisen beging. Man fand seine Opfer allesamt erstickt. Robin Hood, wie sich der Täter selber nannte, hatte ihnen bündelweise Geldscheine in den Rachen gestopft und dann Mund und Nase mit Paketklebeband verschlossen. Er verstand sich, so hatte er es in einem Bekennerschreiben kundgetan, als korrigierendes Element in einer Welt voller Missverhältnisse. Wer im Überfluss lebe, solle auch am Überfluss sterben, lautete sein Credo. Tatsächlich fand er in den Reihen der armen Bevölkerungsschichten Sympathisanten, die ihn geradeheraus zum Helden verklärten. Für Brandt aber, in dessen Weltanschauung Recht und Gerechtigkeit höchste Wertschätzung genossen, war dieser Kerl nichts anderes als ein brutaler Verbrecher. Er war maßgeblich an seiner Ergreifung beteiligt. Dass dank seiner Hilfe dem Recht Genüge getan werden konnte, hatte ihm eine tiefe Genugtuung bereitet. Ebendieses Hochgefühl und ein gleichzeitiger nüchterner Kassensturz seiner Talente und Interessen verschafften ihm die Gewissheit, dass eine andere Laufbahn als die des Kriminalisten für ihn nun nicht mehr in Frage käme.
Jetzt, mehr als zwanzig Jahre später, als er vor dem toten Industriebaron stand, kam ihm der Fall von damals wieder in den Sinn. Reflexartig suchte er nach Zusammenhängen. Robin Hood hatte noch in der Untersuchungshaft seinem Leben ein Ende gesetzt, indem er sich einen Kugelschreiber bis zum Anschlag ins Auge rammte. Trieb da vielleicht wieder so ein Verrückter sein Unwesen, ahmte da womöglich jemand diese kaum zu begreifenden Taten nach?
In diesem Moment fielen ihm die eindringlichen Worte, die Staatsanwalt von Stauffen ihm vorhin mit auf den Weg gegeben hatte, ein: »Wir brauchen einen schnellen Ermittlungserfolg, Herr Brandt! Wir reden hier von einem Wirtschaftsmagnaten, der von uns aufwendig bewacht wurde. Sein Tod könnte unabsehbare Konsequenzen haben. Die Mittel für ARGUS werden nur solange fließen, wie wir erfolgreich sind. Wenn sich die Souveräne unseres Schutzes nicht mehr sicher sind ... Ich meine, wir leben zu einem guten Teil von diesen Einnahmen. Wir müssen unabkömmlich bleiben, verstehen Sie. Also schaffen Sie mir den Täter her!«
Mit der Reform der bewaffneten Exekutivorgane waren Polizei und Militär zu den »Supranationalen Sicherheitsorganen« zusammengelegt worden. Fortan veränderte sich die Aufgabe der Kriminalpolizei dahingehend, dass sie weniger für die Verfolgung von Straftaten im Allgemeinen zuständig war, sondern vorzugsweise dann tätig wurde, wenn Souveräne, wie sich die Eliten der Gesellschaft neudeutsch nannten, direkt oder indirekt von Delikten berührt waren. Konflikte in den unteren Schichten überließ man weitgehend dem Selbstlauf. Erziehungsmaßnahmen wie Gefängnisstrafen kamen immer seltener zur Anwendung, weil eine andere Form des Freiheitsentzuges sich als rentabler wie auch umfassend wirksamer erwiesen hatte, als jeder Aufenthalt in einer Zelle: Die Mangelsituation zwang die Bevölkerung, unverhältnismäßig viel Zeit zur Deckung ihrer natürlichen Lebensbedürfnisse aufzuwenden. Gleichzeitig vertraute man auf die zunehmende Entbildung der Massen, die Begehrlichkeiten und damit einhergehende Straftaten schon deshalb einschränkte, weil sie dort kaum noch vorstellbar waren.
Ein wesentlicher Bestandteil der Reform war ARGUS, ein Programm zum Schutz der Souveräne. Mit seiner Einführung erhielten die Kriminalämter Anteile aus den Erlösen, die die Nutznießer des Programmes zu entrichten hatten. So stellte man sicher, dass die Polizei den Privilegierten ihre ungeteilte Aufmerksamkeit widmete. Diese Praktik hatte sich seit einigen Jahren bewährt und in Polizeikreisen wollte man das großzügige und somit heißbegehrte Zubrot längst nicht mehr missen. Ein Ausfall der Maßnahme hätte unweigerlich eine drastische Minderung ihrer Einkünfte zur Folge. Die Honoratiorenschaft zahlte für ihre Sicherheit und erwartete dafür zuverlässigen Schutz.
Brandt war damals der Ideengeber für das Programm - ARGUS stand für adaptable & reliable guard system - gewesen. Nach dem massenhaften Exodus der Industrie aus Deutschland und den nachfolgenden Unruhen wurde ein kleines Team beauftragt, ein verbessertes Konzept für den privaten Personenschutz zu entwickeln. Der »Vorzeigebulle der Nation«, wie die Medien ihn damals nannten, war für seine Planung und die anschließende Umsetzung verpflichtet worden. ARGUS war ein ausgeklügeltes Zusammenspiel aus lückenlosem Monitoring schutzwürdiger Personen, ihrem sicheren Transport sowie individuell anpassbarer Überwachungselektronik auf deren Privatgrund. Nach einem Jahr Entwicklungsarbeit war ARGUS soweit ausgereift, dass es vom Innenminister erwartungsvoll und dankend absegnet werden konnte. Danach hatte Brandt die Zuständigkeit wieder abgegeben. Er sah seine Aufgabe nicht darin, die Funktionalität eines Bewachungssystems auf dem neuesten Stand zu halten, um dem Einfallsreichtum politisch Andersdenkender zu begegnen. Das wäre ein Job für jemanden, der den bequemen Beamtenalltag in einem geheizten Büro suchte. Nachdem das Konzept stand, sollte seine Sache wieder die Arbeit an den Brennpunkten sein.
Ursprünglich war ARGUS nur für die Bewachung von Politikern und Großindustriellen vorgesehen. Später wurde der maßgeschneiderte Schutz jedem ermöglicht, der Willens und in der Lage war, die nicht unerheblichen Kosten dafür zu berappen. Der zu schützende Personenkreis umfasste inzwischen auch Militärs, kirchliche Würdenträger, Adlige, prominente Ärzte und Anwälte, ebenso wie zu Wohlstand gekommene Sportler oder Künstler. Als sich die Krawalle auszuweiten begannen, ging die Angst unter den Souveränen um. Eines Morgens fand man einen Abgeordneten, der sich als erster für die Abschaffung der Rentenzahlungen ausgesprochen hatte, am Terrassendach vor seinem Haus erhängt auf. Seither verkaufte sich ARGUS wie die sprichwörtlichen warmen Semmeln.
Brandt war besorgt. »Ich muss nicht erwähnen, welche Auswirkung Avarans Tod auf unsere Budgetierung haben könnte. Stellt sich unser Schutzprogramm als unzuverlässig heraus, haben wir ein Problem.«
Uhland grinste. »Da fällt mir spontan ein Personenkreis mit einem weit größeren Problem ein.«
Verbindungen, wie die Natur sie versteht, zeichnen durch ihre Fertilität für Bestand und Entwicklung des Seins auf diesem Planeten verantwortlich. Ihre Früchte weisen elterliche Merkmale auf, wobei sich über die Generationen immer die mit dem besseren Anpassungsvermögen an die vorhandenen Umweltbedingungen durchsetzen. Somit ist das Werden, wenngleich nur eingeschränkt vorhersehbar, gewährleistet. Es ist ein kontinuierlicher Fluss hin zu einer nie vollendeten Reife.
Aus einer Verbindung von Kapital und Politik hingegen entsteht ein Artefakt, ein impotenter, inkurabler Homunkulus, in dem jegliche Entwicklung ihren Schlusspunkt findet. Um aber ihrer Profit generierenden, Macht verbriefenden Frucht die Existenz zu wahren, bedienen sich ihre Eltern verschiedener lebenserhaltender Strategien, wie Manipulationen auf der einen und Verordnungen, welche dieselben legitimieren sollen, auf der anderen Seite. Wesentliche Voraussetzung, dass die gesellschaftliche Balance währenddessen nicht in eine womöglich gefährliche Unwucht trudelt, ist die umfassende Kontrolle derer, die derlei Methodik nicht nur hinzunehmen, sondern auch tunlichst zu bejubeln haben.
Ein gutes Jahrzehnt war es her, dass der Staat die Aufsicht über die Haushalte von Städten und Gemeinden übernommen hatte. Ziel war der Zugriff auf das gesamte Steueraufkommen durch den Finanzminister, was nichts anderem als einer kommunalen Komplett-Insolvenz gleichkam. Wenn Regierung und Länder anfangs noch um einen tragfähigen Kompromiss zur geänderten Mittelverteilung gerungen hatten, wurden letzten Endes alle Kontroversen durch ein Machtwort des Kanzlers für »einvernehmlich beigelegt« erklärt.
Weitere fünfzehn Jahre zuvor, einhergehend mit der Wiedereinführung der nationalen Währungen in Europa, war Deutschland in eine prekäre wirtschaftliche Situation geschlittert. Bankenlobbyisten hatten noch gewarnt, ein Ende der Einheitswährung werde eine Krise auslösen, die einem Weltkrieg gleichkäme, doch den hatten die Finanzkartelle längst selber entfesselt. Freilich nicht mit militärischen Mitteln, sie bedienten sich einer subtileren Waffe: Geldmanipulationen. Das bot einen weit weniger martialischen Auftritt, die Auswirkungen aber waren nicht minder verheerend. Viele Jahre hatte die europäische Gemeinschaftswährung als Instrument zur reibungsfreien Durchsetzung von Finanzinteressen gedient. Ihre Grablegung hatte am Ende, trotz aller vorausgegangen Kassandrarufe, außer der turnusfälligen Rezession keine Folgen für die Geldindustrie. Nach einer kurzen Einrüttelphase lief die Maschinerie wieder wie geschmiert.
Konzerne und Industrieunternehmen dagegen waren in dieser Periode sukzessive, gemäß ihrem Drang, lohnendere Märkte zu erobern, nach Asien und Südamerika weitergezogen. Das Gros der Arbeitsplätze wurde in sogenannte aufstrebende Nationen ausgelagert. In Deutschland beließ man, wenn überhaupt, nur die Konzernzentralen. Lediglich in einigen der alten Produktionsstätten wurden noch diverse Jobs angeboten. Arbeitsverträge vergab man nur wochenweise und die Verdienste, die dort zu erzielen waren, reichten kaum zum Leben. Trotzdem spielten sich an jedem Montagmorgen die gleichen Szenen vor den Werkstoren ab. Um jede angebotene Stelle wetteiferten ein Dutzend Interessenten, und wem es nicht gelang, einen der heißbegehrten Wochenverträge zu ergattern, und wer auch ansonsten keine Möglichkeit des Gelderwerbs fand, wie etwa durch private Dienstleistungen, dem blieb oftmals nur der Einsatz von Überlebenstechniken, die getrost als akrobatisch zu bezeichnen waren.
Auch EuroPharm beschäftigte Wochenlöhner. Um seine Verbundenheit zur Heimat zu demonstrieren, residierte der Vorstand weiterhin in Berlin. Entwicklung, Produktion und andere wichtige Ressorts, insgesamt fast dreihunderttausend Arbeitsplätze, waren schrittweise nach China verlegt worden. In Deutschland existierten, neben einigen Prüf- und Kontrolllabors, nur noch die Auslieferungslager für den inländischen Handel. Jeden Sonntagnachmittag bildeten sich vor dem Firmengelände bereits Schlangen. Die Frühschicht begann am Montag um sechs, das Auswahlverfahren für die Arbeitskräfte zwei Stunden vorher. Für die Prozedur ging man durch eine der Schleusen am Werkstor, wo ein Lesegerät den Gesundheitszustand vom personal chip scannte. Wer für tauglich befunden wurde, erhielt eine sechs Tage gültige Arbeitserlaubnis, die ihm für die nächste Woche beileibe kein üppiges Leben, zumindest aber das Überleben sicherstellte.
Im Gegensatz zu anderen großen Unternehmenssparten hatte die Rüstungsindustrie Deutschland nicht den Rücken gekehrt. Um unabhängig von Vorschriften weltweit ihre Güter zu vertreiben, strebte ihre Lobby nach rechtlicher Autonomie, die sie mit der Drohung erwarb, als eine der letzten produktiven Gewerbe das Land zu verlassen. Die Regierung lenkte ein und ließ die Manager gewähren.
Die Abwanderung der Konzerne und die damit einhergehenden Steuerrückgänge brachten Deutschland an den Rand des Staatsbankrottes. Verschärft wurde die ruinöse Bilanz zusätzlich durch die Auswirkungen der Großen Grippe, die zwischenzeitlich wütete. Das Land verlor ein Drittel seiner Bevölkerung, vornehmlich junge Leute. Vielerorts lohnte es nicht mehr, die Infrastruktur zu erhalten, geschweige denn auszubauen. Der Verfall der Städte vollzog sich schleichend. Aufgrund des stark zurückgegangenen Individualverkehrs wurden kaum noch Straßen repariert, wichtige Bahnlinien mussten aufgegeben werden und viele öffentliche Einrichtungen fielen notwendigen Sparmaßnahmen zum Opfer. Einzig in Ämter und Behörden, in Polizei und insbesondere in das Militär investierte man weiterhin großzügig.
Eine andere Strategie als die Industriekonzerne verfolgte die Finanzbranche, die am Standort Deutschland festhielt. Der Einfluss der Geldmärkte hatte rund um den Globus dramatisch zugenommen. Durch ihre Kreditsysteme kontrollierten sie alle wichtigen Nationen. Ziel der Bankenkartelle war es in letzter Konsequenz, an der Spitze einer elitären »Eine-Welt-Regierung« zu stehen, was sie seit einiger Zeit auch immer öfter und vehementer einforderten. Deutschland, ein von fortschreitender Deindustriealisierung ergriffenes Land, in dem man sich von jeglichem Engagement, das mit Geldwirtschaft zu tun hatte, den dringend herbeigesehnten Aufschwung erhoffte und wo deshalb kaum mit politischer Gegenwehr zu rechnen war, bot als Standort zur Verfolgung ihrer ehrgeizigen Ziele beste Bedingungen. So war der Kanzler in der Hoffnung, die völlig aus dem Ruder gelaufene Staatsverschuldung wieder in den Griff zu bekommen, damals der Forderung des Vorstandes des größten nationalen Bankenkonsortiums, Wolf Gulau, nachgekommen, ihm das Finanzministerium zu unterstellen. Die Finanzen von einem Fachmann managen zu lassen hielt er offenbar für eine vernünftige Idee. Der größte Gläubiger aber war dessen eigene Bank, die Germania Bank. In seiner neuen Funktion als Finanzminister trieb dieser den Staat in immer höhere Schulden. Aber damit nicht genug: Er legte dem Parlament einen Gesetzentwurf vor, nach dem alle Steuergelder, die bisher in die Länder- und Gemeindetöpfe flossen, an die zentrale Staatskasse abzuführen und von dort wieder neu aufzuteilen waren. Außer den zwingend notwendigen Zuweisungen zur Erfüllung der kommunalen Pflichten, die im Wesentlichen nur noch aus der Vollzugskontrolle von Gesetzen und Vorschriften bestanden, oblag jede weitere Mittelvergabe allein seinem Gutdünken.
Ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur uneingeschränkten Herrschaft über die Finanzen war, die Öffentlichkeit hinter sich zu bringen. Durch absichtsvoll herbeigeführte Krisen und geschickt orchestrierte Medienkampagnen hatten viele Menschen ihre Ersparnisse verloren. So aufgestachelt verlangten sie daher immer lauter nach einem fähigen Mann an der Spitze des Finanzressorts, einem, der etwas vom Geld verstünde. Und wer anderes konnte das sein, als ein mit allen Wassern gewaschener Banker. Dass sie dabei ausgerechnet nach dem Verursacher ihrer Misere riefen, erkannten sie auch dieses Mal nicht. Damit war Gulaus Bank de facto in der Lage, den Staatshaushalt lückenlos zu kontrollieren. Auf die Frage eines Journalisten, was ihn denn eigentlich zu politischer Arbeit befähige, antwortete Gulau einmal: »Der Staat benötigt Geld. Meine Bank erzeugt Geld.« Als der Journalist nachfragte, ob es denn nicht eher so sei, dass speziell die Germania Bank weniger Geld erzeuge, als vielmehr vorhandene Werte so abstrahiere, dass die Verbindlichkeiten immer beim Staat, die Gewinne aber immer bei der Bank lägen und dass er den Fiskus somit zu seiner privaten Profitmaschine umfunktioniert habe, brach er das Interview mit einem: »Wie war nochmal Ihr Name?« ab.
Korrumpierte Parlamentarier segneten Gulaus neues Gesetz ab, ohne sich auch nur im Ansatz über seine Folgen im Klaren zu sein. Von nun an existierten die Prinzipien des Föderalismus und die Souveränität der Länder als Bestandteil im politischen System Deutschlands nur noch auf dem Papier. Bürgermeister und Landräte prophezeiten, dass die neue Gelderverteilung, wie man sie sich hinter verschlossenen Türen ausgedacht und dann in den staatlichen Medien als innovative Reform des deutschen Finanz- und Steuerrechts verkündet hatte, nicht funktionieren würde. Eine Einschätzung, mit der sie recht behalten sollten. Städte und Gemeinden verhungerten am ausgestreckten Arm. Notwendige Mittel zur Aufrechterhaltung des öffentlichen Lebens waren praktisch nicht mehr vorhanden. Der Betrieb von Kliniken und Krankenhäusern konnte, ebenso wie der von Bildungseinrichtungen, nur noch in stark eingeschränktem Maße sichergestellt werden. Auch für den Erhalt von kulturhistorisch wertvollen Gemäuern standen keine Gelder mehr zur Verfügung. Die finanzielle Notlage zwang die Länder, Schlösser, Burgen und Museen samt ihrer Kunstschätze zu veräußern. Kultur rechnete sich ohnehin nicht mehr, seit der größte Teil der Menschen im Land kein regelmäßiges Einkommen mehr erzielte und sein knappes Salär für etwas Essbares zusammenhalten musste. Zudem verband man mit dieser Maßnahme die Hoffnung, dass das kulturelle Erbe von privaten Händen besser gepflegt werden würde, als die klammen Länder und Gemeinden dazu noch imstande gewesen wären.
Die Grundstruktur der Gesellschaft hatte sich verändert. Nachdem der Mittelstand durch einen nicht länger verkraftbaren, finanziellen Aderlass weitgehend zerrieben war, gliederte sie sich im Wesentlichen in ein auf nur noch zwei Schichtungen reduziertes System: in die oben positionierten Eliten und die dominierten Massen in den unteren Etagen der Gesellschaftspyramide. Die umgreifende Verarmung hatte viele in eine prekäre Lebenssituation gebracht. Irgendjemand hatte sich selbst einmal als »Brick« bezeichnet, was im Englischen so viel wie »Ziegel« bedeutet, in erweitertem Sinne aber auch mit »Brikett« übersetzt werden kann. Eine kritische Selbstreflexion hatte ihm die Erkenntnis eingebracht, dass er, gleich einem Mauerstein, wohl nützlicher Teil eines Bauwerks sei, bei nachlassendem Nutzen aber wie ein Stück Kohle verfeuert werden würde. »Brick« wurde sehr schnell zur Modevokabel. Es klang nach einer Mischung aus Sarkasmus und Galgenhumor, wenn sich Angehörige der unteren Schichten fortan selber »Bricks« nannten. Von besser Bemittelten ausgesprochen indes haftete dem Begriff immer ein leiser Beigeschmack der Verachtung an. »Bricks« wurde bald zur allgemeingebräuchlichen Bezeichnung für jene drei Viertel der Bevölkerung, deren Leben sich zwischen täglichem Überlebenskampf, Sorge um Nest und Nachwuchs, Sportübertragungen, digitalen Verführungen und Streitereien ums Nichts abspielte, die sich in Drogen, Religionen, Alkohol und Promiskuität flüchteten, die ihrer Kompetenz enteignet worden waren und in deren abgeschottetes, kleinkriminelles Milieu sich der Staat kaum noch einmischte. Dieser Schicht, so hieß es, fehle sowohl das Interesse als auch das intellektuelle Verständnis für Recht und Ordnung, soziale Verständigung und kulturelle Identität. Allein die Staatsdiener, zu denen auch Brandt und sein berufliches Umfeld zählte, Banker, vermögende Freiberufliche und einige Sportidole, denen in den Armenbezirken eine vergleichbare Verehrung zuteilwurde, wie den Gladiatoren der römischen Antike, bildeten eine Art Restbürgertum.
Zeitgleich mit der Reformierung der Exekutivorgane und der Einführung von ARGUS war die deutsche Bevölkerung mit dem Gesetz der »Nachhaltigen Terrorprävention« konfrontiert worden. Zur Sicherheit der Bürger und zum Zweck einer effektiven Verbrechensbekämpfung, so die amtliche Lesart, war mit seinem Inkrafttreten das Tragen des personal chip vorgeschrieben. Binnen einer Jahresfrist wurde jeder auf deutschem Territorium lebenden Person der Chip eingesetzt. Neugeborene bekamen ihn seither unmittelbar nach der Geburt implantiert. Der in den Hirnstamm eingepflanzte Mikrochip übernahm nach seiner Initialisierung die Steuerung der Informationsflüsse im Zwischenhirn sowie der Afferenzen vom und zum Rückenmark. Ein unqualifiziertes Entfernen des Chip oder der Versuch einer elektronischen Manipulation hatte schwerwiegende Beeinträchtigungen des Zentralnervensystems zur Folge und führte notwendigerweise zum Hirntod.
Der künstliche Körperteil stellte aber nicht nur das Überleben sicher, sondern regelte längst auch den Alltag. Ohne den Chip war man quasi nicht mehr existent. Er hatte Personaldokumente, wie Reisepass oder Führerschein, abgelöst. Alle persönlichen Informationen, unter anderem biometrische Daten, Gesundheitszustand, Auffälligkeiten, Lebenslauf, Qualifikationen wie auch die Bonität bildeten das »Persönliche Profil«, das auf dem Chip gespeichert und auf den zuständigen Behördenservern einzusehen war. Auch jeglicher Zahlungsverkehr wurde über den Chip abgewickelt. Ein direkter Kontakt mit seiner Bank war für den Kunden nicht mehr vorgesehen. Alle Kontobewegungen wurden via Satellit auf den Chip übertragen, und über sein »InterData,- Funk- & Media Access Device«, kurz Interface, war es jedem Bürger möglich, Geldbewegungen und seine daraus resultierende Kredithöhe einzusehen. Geldkarten aller Art waren abgeschafft und das wenige noch im Umlauf befindliche Bargeld fand im normalen Tagesgeschäft kaum noch Akzeptanz. Zahlkassen gab es in den Verkaufseinrichtungen nicht mehr, man zahlte per Chip »im Vorbeigehen« an einem der Disponierer, die in Märkten, Kaufhäusern und Läden an den Ausgängen angebracht waren.
Global Observation and Trace Tracking System – am Namen des Systems hatte ein ganzes Angestelltenheer des Informationsministeriums getüftelt. Auch wenn es im Englischen keine umgangssprachliche Entsprechung dafür gab, so ließ sich doch aus den Anfangsbuchstaben das Akronym ›GOTT‹ ableiten, ein Abstraktum, welches den Menschen von Anbeginn Ehrfurcht abverlangte und ihnen nun die neue Allmacht vergegenständlichen sollte. Und in der Tat, mit der Inbetriebnahme des Systems sah und wusste sein Betreiber, der Staatsschutz, alles über eine Person, konnte walten und richten, so, wie es in den Vorstellungen Gläubiger nur der Schöpfer selbst vermochte. Als das System, seinem Allgewalt suggerierenden Namen gerecht werdend, weltweit zum Einsatz kam, wurde das Kurzwort ›GOTT‹ auch in andere Sprachen übernommen, wenngleich es seiner Sinnfälligkeit aus dem Deutschen dort entbehrte.
Anfangs stieß ›GOTT‹ auf erhebliche Ressentiments bei der Bevölkerung. Denen begegnete man zuerst mit den üblichen Mantras, wie etwa »Zu Ihrer eigenen Sicherheit« oder »Fortschritt durch den Chip«. Derlei Slogans wären leicht als Täuschungsversuche zu entlarven gewesen, doch die Anfälligkeit großer Teile der Gesellschaft für seligmachendes Heilsgefasel spielte ihren Verbreitern unwillkürlich in die Hände. Nach einer »vertrauensstiftenden Phase« schließlich wurde das Tragen des Chip ohne weitere Debatten per Gesetz verordnet. Unbestritten wartete dieser mit einigen Features auf, die den Alltag vereinfachten. Tatsächlich aber ließ sich damit dessen originärer Zweck, nämlich die umfassende Kontrolle der Privatsphäre, unkompliziert verschleiern.
Das Konzept sah vor, dass jeder Person, neben ihrem persönlichen Profil, ein digitaler Identifikationscode zugeordnet und auf ihrem Chip hinterlegt war. Der Chip stand in permanentem Austausch mit einem Satellitensystem, den sogenannten Fahndungssatelliten, kurz »Fahnder« genannt. Alle ermittelten Daten wurden live an die Rechenzentren der Sicherheitsorgane gesendet, dort elektronisch ausgewertet und in einer Datenbank gespeichert, auf das auch Brandt im Rahmen seiner Ermittlertätigkeit zugriffsberechtigt werden konnte. Anhand dieser Informationen waren Polizei und Militär imstande, Aufenthalte und Wege einzelner Personen, genau wie Menschenansammlungen, zu jeder Zeit und an jedem Ort festzustellen.
Das neue Verbrechensbekämpfungsgesetz sah man in der Regierung als erforderlich an, weil sich infolge der Deindustriealisierung die Armut auch in den bislang besser situierten Schichten ausgebreitet hatte. Der Mittelstand war zusehends verarmt, und als die Banken begannen, Konten und Eigenheime der Bürger zu pfänden, entdeckten diese ihre Gemeinsamkeiten mit dem Prekariat. Eines Tages standen sie gemeinsam auf der Straße. Wöchentlich traf man sich in allen größeren Städten zu Protestmärschen, die oftmals dann, wenn die Sicherheitskräfte einschritten, in blutigen Straßenschlachten endeten. Am Ende waren die zuständigen Organe kaum mehr in der Lage, ihre Aufgabe zu bewältigen.
Um bei militärischen Einsätzen im Inneren stets die höchstmögliche Effizienz zu erzielen, hatte der Staatsschutz die alte Idee, die Bevölkerung per Chip zu erfassen und zu kontrollieren, wieder aus der Schublade gekramt. Versammlungen waren jetzt schon in ihrer Entstehung zu erkennen und befähigten das Militär, bei sich anbahnenden Ausschreitungen schnell und wirksam gegenzusteuern.
Bei der Einführung von ›GOTT‹ setzte die Regierung insbesondere auf das Vertrauen der jungen Leute. Und in der Tat war die Jugend auch schnell begeistert ob der neuen Möglichkeiten, die der künstliche Körperteil bot. Ohne die wirklichen Absichten seiner Betreiber zu hinterfragen, war man bereit, für einige innovative Spielereien sein Privatleben offenzulegen. Die Erfahrungen der Vergangenheit noch im Gedächtnis war es die ältere Generation, die kritisch bis ablehnend auf den Chip reagierte. Es hatte sie damals nicht unvorbereitet getroffen, als die Erfassung ihrer Daten und das Ausspionieren ihrer Privatsphäre Stück für Stück legalisiert und schließlich zur Normalität geworden war. Doch anstatt sich zu widersetzen, und wäre es nur durch den Verzicht auf einigen elektronischen Flitter gewesen, huldigten sie den Mainstreamclaqueuren. Mehr noch: Sie fanden es zunehmend unvernünftig, sich nicht jedem neuen vermeintlichen Komfortmuss zu unterwerfen. Was ein gesunder Verstand anfangs noch instinktsicher als nutzlos oder schädlich beurteilt, deutet ein durch methodische Einflüsterungen ermüdeter Verstand irgendwann als logisch und unverzichtbar um. Eine menschliche Schwäche, die sich politische Treiber und Trommler gern zunutze machen. Und so waren sie dem Apparat, dessen berechnende Radikalität sie regelmäßig unterschätzten, einmal mehr in die Falle gelaufen.
›GOTT‹ war zuerst ein deutsches, später dann ein Projekt der internationalen Konföderation, in dem Deutschland die Pionierrolle zukam. Angesichts der »guten Erfahrungen«, die man hier gesammelt hatte, verordnete man sehr schnell zuerst im restlichen Europa, dann in Nordamerika, Russland und den bevölkerungsreichen ostasiatischen Ländern seinen Einwohnern den Chip. Vier Jahre später war ›GOTT‹ weltweiter Standard. Einzig einige südafrikanische Staaten lehnten eine Verchipung ihrer Bevölkerung ab, der Grund, warum die Konföderation sie fortan boykottierte. Grenzübertritte in und aus diesen Ländern waren seither streng reglementiert, ebenso wie Handels- und diplomatische Beziehungen weitgehend eingestellt wurden.
Jeder Schritt, jede Bewegung gleich welcher Art, jeder Kontakt zu einem Lesegerät, jede gesendete oder empfangene Nachricht, jede Kontobewegung, jede Besorgung, selbst jeder Restaurantbesuch erzeugte Daten, die pausenlos vom Chip via Satellit zu einem der Zentralrechner übertragen und dort ausgewertet wurden. ›GOTT‹ verband als erstes intelligentes Spähsystem alle weltweit gesammelten Informationen. Es wusste, wo sich eine Person aufhielt, was sie tat, warum sie es tat und berechnete voraus, was sie als nächstes tun würde. Software-Algorithmen beurteilten, ob sich eine Person den Vorschriften gemäß oder verdächtig verhielt. Das System war sogar imstande, Schlüsse über Charakter und Wesensmerkmale zu ziehen. Was der Kirche in zweitausend Jahren mit der Proklamation eines allessehenden Gottes und mit der formelhaft wiederholten Warnung vor einem himmlischen Strafgericht nie vollständig gelungen war, nämlich das Massenbewusstsein zu lenken, erreichten die Geheimdienste mit dem Einsatz des Global Observation and Trace Tracking System. Im Unterschied zu den überlieferten Göttern aber, die noch nie jemand zu Gesicht bekommen hatte und deren Wirken gern von ungöttlichen Pannen begleitet war, existierte ›GOTT‹ real und arbeitete fehlerfrei.
Die Idee von der totalen Steuerung des Menschen war perfektioniert, das Instrument dafür in die Köpfe verschoben: Kontrolle durch Selbstkontrolle. Aus der verbindlichen Gewissheit einer Dauerobservierung erwuchs intuitiv die Angst, dass aus den gesammelten Daten falsche Schlüsse gezogen und man schuldlos von der unheimlichen Maschinerie verschlungen werden konnte. Und so hinderte man sich letztendlich, in gleichsam freiwillig gezwungenem Gehorsam, selber am Ausleben von natürlichen Bedürfnissen und Begabungen. Identitäten waren zu digitalen Adressen konvertiert.
Die Menschen wehrten sich nicht mehr dagegen. Sie flohen auch nicht mehr, denn es gab kein Wohin. Und dem Bastard, geboren aus der Ehe von Politik und Kapital, war ein gedeihlicher Fortbestand gesichert.
Personen in »herausragender gesellschaftlicher Stellung«, wie Rikard Avaran, ermöglichte man die Deaktivierung ihres personal chip. Diese Prozedur, so hieß es, sei ein technisch hochanspruchsvolles Verfahren, bei dem erst während des Eingriffs ein Programm die erforderlichen Codes generiere, die den Chip stilllegten und damit die Blockade des Nervensystems aufhoben. Danach konnte der Chip entfernt werden, ohne dass die betroffene Person Schaden nahm.
Indes besaß ein »Explantierter« einen Status, der die Inanspruchnahme von ARGUS nahelegte. So wurde die gewonnene Freiheit durch das Schutzprogramm, das, wie ein Fahnder, jeden Schritt beobachtete, praktisch wieder eingebüßt. Insofern war ein Souverän inhaftiert wie jeder andere auch, in einem Edelgefängnis zwar, aber inhaftiert. Trotzdem, allein die Gewissheit, selber zu entscheiden, wann und wie man überwacht wurde, ging, so fand man in den elitären Kreisen, mit einer elementaren Aufwertung der Lebensqualität einher. Zudem war es auf den Upper Class Partys immer wieder ein besonderer Genuss, einen »Chipsy« auf seinen »kleinen Makel« hinzuweisen.
»Warum Avaran?«, dachte Brandt laut.
»Ich kann mich irren«, antwortete Uhland bissig, »aber ich schätze, er hat sich nicht nur Freunde im Leben gemacht. Dieser Unfall, als den die Staatspresse seine Gewinnparanoia damals verkleidete, war die größte humane Katastrophe aller Zeiten.«
Brandt musste nicht daran erinnert werden. »Ihm wurde keine Schuld nachgewiesen.«
Uhlands Bissigkeit schlug in Groll um. »Nein. Weil es in diesem Land keine Gerichte für Leute wie ihn gibt.«
Während sich die Journaille seinerzeit mit Spekulationen überbot, was denn genau zur Katastrophe geführt hatte, sprachen die offiziellen Medien beharrlich von einem Unfall. Selbst Brandt, der sich als einen eher getreuen Staatsdiener bezeichnete, war diese These so wenig glaubhaft erschienen, wie das Presseorgan selbst. Denn immer dann, wenn es seinem Informationsauftrag hätte nachkommen sollen, sah es seine Bestimmung darin, die Ereignisse zu interpretieren statt zu erklären.
»Zugegeben, er gehört nicht zu den Opfern, die mein Mitgefühl erwecken. Aber es ist nicht unsere Aufgabe, die ethischen Maßstäbe der Justiz zu bewerten. Meine Frage zielte auf etwas ganz anderes ab: Avaran war ein Kontrollfreak. Dieses Haus gleicht einem Maginot-Bunker. Allein hier einzudringen ist ein Husarenstück. Aber ihn zu töten und wieder zu verschwinden, und das alles unerkannt und innerhalb weniger Sekunden, das ist ein wahrer technischer Coup.«
Tatsächlich schien das Schutzbedürfnis Rikard Avarans hochgradig ausgeprägt, hatte er doch, zusätzlich zu den ARGUS-Maßnahmen, noch weiter aufgerüstet. Neben der obligatorischen Wachmannschaft beaufsichtigte ein Dutzend Elitesoldaten das Schloss und seinen Herrn. Fünf Männer waren für die Sicherung von Höfen und Gärten zuständig, weitere fünf patrouillierten in den Umgebungsparks und zwei beaufsichtigten die Monitore im Erdgeschoss.
Im Frühjahr hatte eine Neuerscheinung auf der Securitymesse für Aufsehen gesorgt. Einer auf Überwachungstechniken spezialisierten schwedischen Firma war es gelungen, hochfrequente Felder in beliebigen Formen und Größen zu erzeugen. Mit Hilfe von Sendern und Sensoren, die man rund um ein Gelände in Fels oder Erdreich verdeckt platzierte, ließ sich ein halbkugelförmiges Energiefeld mit einem Durchmesser von mehreren hundert Meter aufbauen. Avaran war einer der ersten, der sein Anwesen mit Hilfe dieser unsichtbaren Kuppel schützen ließ.
Um seine Wissenslücken in punkto Sicherheitselektronik, speziell der auf Stolzenfels, zu füllen, begab sich Brandt nach unten in den großen Rittersaal, wo die Männer des Wachdienstes vor ihren Bildschirmen saßen. »Guten Morgen«, rief er ihnen angesichts der fortgeschrittenen Uhrzeit zu. Inzwischen war es fast fünf und draußen schickte der Tag sein erstes diffuses Licht über den Rhein. »Darf ich Ihren Namen erfahren?«, sprach er einen der Wachleute an.
»Hauser«, knurrte der ohne aufzuschauen. Hauser war ein finster dreinblickender Zweimeterriese, der Brandt augenblicklich an einen Eisenbieger erinnerte, den er als Kind einmal auf einer Kirmes bestaunt hatte. Sein kahler Schädel, ein schwarzer Kinnbart und eine dunkle Sonnenbrille, die er offenbar auch nachts nicht abnahm, beförderten zusätzlich sein angsteinflößendes Äußeres.
»Ich bin Hauptkommissar Brandt, der leitende Ermittler. Ich möchte Ihnen ein paar Fragen stellen.«
Hauser drehte sich langsam um. Dann stand er auf. Wenn sich seine Statur im Sitzen bereits erahnen ließ, ragte der Wachmann jetzt wie ein Berg vor dem Kommissar auf, der, selbst eine stattliche Erscheinung, ehrfürchtig nach oben blickte, als er dessen tatsächliche Ausmaße erfasste. Vorsichtig griff er nach der ausgestreckten klobigen Pranke. »Ist Ihnen gegen Mitternacht etwas Besonderes aufgefallen?«, fragte er, noch immer von Hausers physischer Wucht ergriffen.
»Bei meinem letzten Kontrollgang um halb zwölf gab es keine besonderen Vorkommnisse. Genau um null Uhr dann erlosch die Anzeige auf dem Lifescanner.«
Donnerwetter, es spricht, stellte Brandt erleichtert fest. »Was genau tut dieser Lifescanner?«
Hauser brachte sich in Positur, als hätte er einen wichtigen Vortrag zu halten. Dabei zeigte er sich weit weniger einsilbig und auch viel umgänglicher, als Brandt es nach dem ersten Eindruck befürchtet hatte. »Es handelt sich um ein hochsensibles Messinstrument, einfach gesagt, um eine Kombination aus Temperaturfühler und einer Art Seismograph. An allen Zimmerdecken befinden sich Sensoren, die thermographische Abweichungen wahrnehmen, wie sie durch unsere Körperwärme entstehen, genauso wie die Schwingungen, die unser Puls erzeugt. Mittels dieser beiden Informationen identifiziert es alles, was sich warmen Geblüts und eines Herzschlages erfreut als lebendes Objekt, welches dann schematisch auf dem Bildschirm dargestellt wird. Sehen Sie hier.« Er zeigte auf einen der Monitore. »Das ist das Schlafzimmer. Diese roten Visualisierungen sind ihre Leute.«
Brandt nickte. Es waren die »Kleckse«, die er vorhin auf Kallenbachs Interface gesehen hatte.
»Personen«, fuhr Hauser fort, »die sich im Gebäude aufhalten, werden von den Sensoren erfasst und als solche erkannt. Ändern sich die Voraussetzung, die zur Identifizierung führen, erlischt die Anzeige. Avarans Herzstillstand löste den Alarm aus.«
»Was haben Sie danach getan?«
»Was das Regelwerk von ARGUS in diesem Fall vorschreibt: Bei Unregelmäßigkeiten jedweder Art ist sofort die nächste Polizeidienststelle zu kontaktieren. Was ich auch unverzüglich tat. Dann sind ein Kollege und ich nach oben gegangen und haben nachgesehen. Er war tot.«
»Wie haben Sie seinen Tod festgestellt?«





























