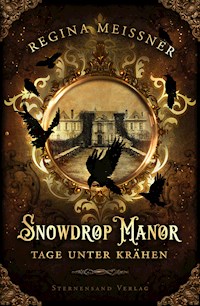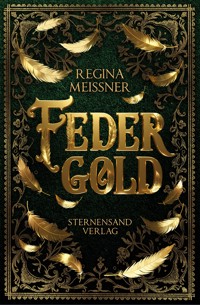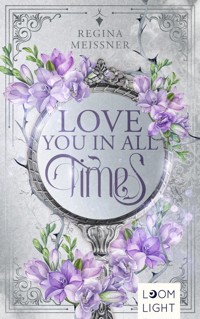4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Eine Geschichte über Verlust, Trauer und die Fähigkeit, zu vertrauen: »Gänseblümchen sterben einsam« - ein einfühlsamer Young-Adult-Roman von Regina Meißner. Als der Bruder der 17-jährigen Moira stirbt, versinkt sie in tiefer Trauer. Ihre Familie droht zu zerbrechen, da auch die Eltern über den Verlust ihres geliebten Sohnes nicht hinwegkommen und Moira darüber vernachlässigen. Da tritt Ryan in ihr Leben - ein fremder Junge, Skater wie ihr Bruder, und in einem Wohnwagen lebend. In kleinen Schritten gelingt es Ryan, dass Moira sich ihm öffnet und über ihre Gefühle spricht. Doch kann sie ihm wirklich vertrauen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
ISBN 978-3-492-98393-8
© Piper Verlag GmbH, München 2018
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Agentur EDITIO DIALOG, Dr. Michael Wenzel
Covergestaltung: Favoritbüro, München
Covermotiv: Jena_Velour/shutterstock
Redaktion: Diana Napolitano
Datenkonvertierung: abavo GmbH, Buchloe
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Cover & Impressum
Prolog
Kapitel 1 – Vier Tage ohne dich
Kapitel 2 – Fünf Tage ohne dich
Kapitel 3 – Sechs Tage ohne dich
Kapitel 4 – Sieben Tage ohne dich
Kapitel 5 – Acht Tage ohne dich
Kapitel 6 – Zehn Tage ohne dich
Kapitel 7 – Vierzehn Tage ohne dich
Kapitel 8 – Siebzehn Tage ohne dich
Kapitel 9 – Achtzehn Tage ohne dich
Kapitel 10 – Neunzehn Tage ohne dich
Kapitel 11 – Zwanzig Tage ohne dich
Kapitel 12 – Dreiundzwanzig Tage ohne dich
Kapitel 13 – Vierundzwanzig Tage ohne dich
Kapitel 14 – Fünfundzwanzig Tage ohne dich
Kapitel 15 – Ein Tag mit dir
Kapitel 16 – Zwei Tage mit dir
Kapitel 17 – Drei Tage mit dir
Kapitel 18 – Vier Tage mit dir
Kapitel 19 – Fünf Tage mit dir
Kapitel 20 – Sechs Tage mit dir
Kapitel 21 – Sieben Tage mit dir
Kapitel 22 – Im Delirium Teil Eins
Kapitel 23 – Im Delirium Teil Zwei
Kapitel 24 – Im Delirium Teil Drei
Kapitel 25 – Mittwoch
Kapitel 26 – Donnerstag
Kapitel 27 – Zwei Monate später
Prolog
Liam ist tot.
Diese drei Wörter bestimmen mein Leben. Ich habe sie schon mehrmals aufgeschrieben, mehrmals ausgesprochen, mehrmals zu hören bekommen, und doch ergeben sie keinen Sinn für mich. Es ist, als wäre die Abfolge der Worte verboten und in einer Konstellation wie dieser falsch. Es ist, als hätten sich Buchstaben miteinander verbunden, die vorher nur flüchtigen Kontakt zueinander hatten.
Liam ist tot.
Egal wie oft ich diesen Satz höre, er dringt nicht bis in mein Bewusstsein. In meinem Kopf gibt es irgendeine Schranke – eine Grenze, die Dinge abfängt und sie daran hindert, verstanden zu werden.
Liam ist tot.
Meine Eltern waren die Ersten, die den Satz ausgesprochen haben, und aus ihrem Mund kommt er am häufigsten. Beinahe so, als müssten sie mich daran erinnern, dass es meinen Bruder nicht mehr gibt. Als müssten sie mir wieder und wieder verdeutlichen, dass
Liam tot ist.
Vielleicht kann ich es nicht verstehen, weil sich in diesem einfachen Satz eine Abwegigkeit widerspiegelt. Weil sich ein Kontrast offenbart, der so breit ist wie eine Schlucht, die sich über ein ganzes Land spannt.
Liam kann nicht tot sein.
Liam war voller Lebensfreude, voller Enthusiasmus und Bejahung. Er sprühte vor Optimismus, hatte immer ein Lächeln auf den Lippen und einen sarkastischen Kommentar in der Hinterhand. Er war so viel positiver als ich. Weniger nachdenklich. Weniger in sich gekehrt. Erfüllt von allem, das das Leben ausmacht.
Der Tod, auf der anderen Seite, ist ein Konstrukt voller Dunkelheit. Ein Abbild des Schreckens, der Angst. Er kommt mit verweinten Augen und dem Gefühl des Erstickens daher.
Liam kann nicht tot sein.
Nie gab es eine größere Diskrepanz zwischen Leben und Sterben.
Ich bin nicht beschränkt, ich weiß, dass nichts ewig währt. Und doch sind es diese drei Worte, die mich verwirrt zurücklassen. Ich weiß nicht, ob ich es je verstehen werde.
Kapitel 1 – Vier Tage ohne dich
Beerdigungen laufen meist nach demselben Schema ab. Angehörige, Freunde und Bekannte des Toten versammeln sich, der Priester hält eine Predigt, der Leichnam wird in die Erde gelassen und Beileidsbekundungen werden ausgesprochen. Tränen, Schmerz und Kummer sind überall. Menschen brechen zusammen, werden wieder aufgehoben, nur um erneut in ihrer eigenen Trauer zu versinken. Eine Orgel spielt melancholische Musik, Bilder erinnern an das Leben des Toten. Manchmal gibt es Reden von Familienmitgliedern. Und die Blumen. So viele Blumen, die dem Verstorbenen mitgegeben werden auf seine letzte Reise. Als ob man da unten, zwischen Würmern und Käfern, noch Pflanzen braucht.
Eigentlich ist es auf Liams Beerdigung nicht anders. Meine Mutter weint sich die Augen aus dem Kopf, als der Leichnam in die Erde gelassen wird. Mir haben schon Dutzende Menschen die Hand geschüttelt. Von den meisten weiß ich nicht mal, wer sie sind. Eben wurde in der Kapelle ein herzzerreißendes Lied gespielt.
Es ist ähnlich, und doch ist es so anders.
Vielleicht liegt es an den zwei Frauen, die in der letzten Reihe gesessen und miteinander getuschelt haben. Vielleicht liegt es an dem Priester, in dessen Predigt es nicht um eine körperliche Krankheit und einen langen Leidensweg ging.
Vielleicht liegt es daran, dass sich Liam umgebracht hat.
Auch wenn es niemand öffentlich zugeben würde, geht man mit Selbstmördern anders um. Möglicherweise nicht gewollt, eher intuitiv. Dennoch wird das Thema mit Samthandschuhen angefasst. Niemand sagt wirklich, was er darüber denkt. Niemand spricht das aus, was er heimlich glaubt.
Selbstmörder sind die Seltsamen, die Skurrilen und Abstrusen. Die, die über etwas entschieden haben, was uns nicht zusteht. Aber stimmt das? Heißt es nicht immer, wir sind freie Menschen und dürfen frei bestimmen? Warum dann nicht über unser Leben?
Liam war nicht krank. Zumindest nicht körperlich. Er litt nicht unter einem physischen Malheur, ganz im Gegenteil: Er war kerngesund. Stand mit beiden Beinen im Leben. Und doch hat er sich aus diesem verabschiedet. Weil er aus irgendeinem Grund nicht mehr wollte.
»Es tut mir so leid für dich, Moira.«
Vor mir steht eine ältere Dame mit einem gigantischen fliederfarbenen Hut. Dasist definitiv untypisch für eine Beerdigung. Um ihre Augen haben sich Krähenfüße gebildet, die Lippen zittern. Ich merke, dass sie kurz davor ist, in Tränen auszubrechen. Reflexartig will ich ihr die Hand geben, aber sie ist schneller und drückt mich fest an sich. Mir bleibt die Luft weg, als ich ihr stechendes Parfüm rieche.
»Liam war so ein toller Junge«, schluchzt sie. Ihr Körper bebt unter meinen Händen. Verzweifelt stehe ich da, zur Eissäule erstarrt. Erstens bin ich nicht gut im Umarmen,ich mag es nicht einmal. Zweitens habe ich keine Ahnung, wer diese Frau sein soll. Vielleicht eine entfernte Verwandte. Vielleicht eine Freundin meiner Mutter, die mich nur über das Telefon kennt. Wie die Tatsachen auch stehen, sie klammert sich an mir fest, als wäre sie diejenige, die bemitleidet werden muss.
Endlich löst sie sich von mir und zieht geräuschvoll die Nase hoch.
»Es muss schlimm sein, seinen Bruder zu verlieren«, schluchzt sie. Ihre Wimperntusche ist verlaufen und dass sie sich mit der Hand über die Augen wischt, macht es nicht besser. »Ich weiß noch, wie er damals auf meinem Schoß saß, ein kleines Bündel, das so viel Liebe …«
Hilfe suchend sehe ich mich nach jemandem um, der mich aus der Misere befreien kann. Meine Mutter steht rechts von mir, aber sie ist zu beschäftigt, um sich um meine Nöte zu kümmern. Zu beschäftigt mit ihrem eigenen Kummer. Aus den Augenwinkeln sehe ich, wie sie zittert. Seit Tagen ist sie nun in diesem Zustand. Dem Zustand zwischen nach außen vorgespielter Stärke und vollkommenem innerem Zusammenbruch.
Ich seufze leise.
Die alte Frau vor mir kramt nach einem Taschentuch. Ich nutze den Augenblick, in dem sie in ihren Stoffbeutel schaut, und entferne mich geräuschlos. Dies ist nicht unbedingt die feine Art, aber an der Beerdigung meines Bruders darf ich so etwas.
Mein Blick schweift über die Anwesenden, die sich in einem Kreis vor dem Grab versammelt haben. Eben in der Kapelle habe ich sie gezählt, daher weiß ich, dass es genau dreiunddreißig sind. Wenig für eine Beerdigung, viel für einen Selbstmord? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass Liam mehr verdient hat. Dreiunddreißig Menschen sind bei Weitem nicht genug, um ihm gerecht zu werden. Selbst wenn die ganze Welt von Liam erfahren würde, wäre das noch nicht genug.
In einem stillen Moment entferne ich mich von den Anwesenden, suche mir eine freie Bank und lasse mich darauf sinken. Aus der Ferne betrachtet sieht das Ganze anders aus. Es kommt mir nicht so nah vor, wirkt unpersönlich. Beinahe so, als würden die Leute nicht um meinen Bruder, sondern um einen Unbekannten trauern. Für einen Moment gebe ich mich der Illusion hin.
Das Loch, in das sie eben den Leichnam gelassen haben, ist nun mit Erde bedeckt. Ein Holzkreuz wird bald symbolisieren, wessen Leiche unter dem Gras liegt. Friedhöfe haben bei näherer Betrachtung etwas Beunruhigendes an sich. Jeder Schritt, den man tut, ist ein Schritt über Tote.
Auf einmal wird mir kalt. Ich schlinge die Arme um meinen Oberkörper und presse die Lippen aufeinander. Eigentlich sollte man im Mai nicht mehr frieren, aber ich bin klug genug, um zu wissen, dass die Kälte in mir ist und nichts mit der Sonne zu tun hat, die ausgerechnet heute fehlt. Ein Zeichen? Vielleicht auch nur ein schlechter Scherz.
Als ich eine Hand auf meiner Schulter spüre, zucke ich zusammen und drehe mich nach hinten um. Mein Vater steht im Schatten der Bank und lächelt mich an. Es ist die Art von Lächeln, die es erst seit Liams Tod gibt. Vorsichtig, zerbrechlich.
»Hier hast du dich versteckt«, sagt er und streicht mir über den Kopf, so wie er es manchmal getan hat, als ich noch ein kleines Kind gewesen bin. Früher hat mir seine Berührung ein wohliges Gefühl verursacht, heute löst es eine unangenehme Gänsehaut in mir aus. Aber jetzt sage ich nichts dagegen, sondern bemühe mich um ein Lächeln.
»Ich wollte ein bisschen Abstand gewinnen«, sage ich leise und lasse den Blick über die Trauergäste schweifen. Ich höre, wie mein Vater seufzt. Eine Sekunde später sitzt er neben mir auf der Bank. Sein Blick ist starr geradeaus gerichtet, sodass ich mich spontan frage, ob er mir absichtlich nicht in die Augen schauen will.
In letzter Zeit kommen mir die Haare meines Vaters grauer vor, das Gesicht nicht mehr mit ganz so sorglosem Ausdruck wie früher.
»Deine Mutter hält sich gut«, murmelt er in diesem Moment. Schon will ich etwas entgegensetzen, aber ich schweige. Vielleicht ist es besser, meinen Vater in dem Glauben zu lassen, dass seine Frau damit klar kommt. Vielleicht ist es seine Art, damit klarzukommen.
Ich verschränke die Arme vor der Brust und starre auf das Gras unter mir. Es kommt mir zu grün vor für einen Tag in Schwarz. Ich würde meinen Vater gern fragen, wie lange es noch dauert. Wann ich endlich wieder nach Hause und mich in meinem Zimmer verkriechen kann. Denn genau da fühle ich mich am wohlsten. Aber als ich ihn mustere und an seiner unterdrückten Trauer beinahe ersticke, halte ich den Mund.
Nervös knetet er die Hände in seinem Schoß. Der Schweißfilm auf seiner Stirn wird immer größer. Gern würde ich etwas Intelligentes sagen. Etwas, das ihm den Schmerz wegnimmt. Irgendetwas, um dieser Situation nicht länger schweigend begegnen zu müssen. Aber da gibt es nichts. Es ist nicht so, dass mir nichts einfällt. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es da einfach nichts gibt. Also verschränke ich meine Hände und zähle die Anwesenden erneut. Die ersten sind schon nach Hause gegangen, daher hege ich die Hoffnung, dass es auch bei uns nicht mehr so lange dauern wird.
»Kommst du klar, Mole?«
Noch bevor ich über die Frage nachdenke, nicke ich. Das liegt an einer stillen Abmachung, die ich mit mir selbst getroffen habe. Ich breche nicht zusammen. Ich falle meinen Eltern nicht zur Last. Ich mache das mit mir selbst aus.
»Irgendwann kommen bessere Zeiten«, seufzt mein Vater und fährt sich durch das schüttere Haar. Ich nicke erneut, auch wenn ich seine Worte anzweifle. Wie kann es jemals besser werden, wenn Liam nicht mehr da ist? Er hat die Sonne in unser Leben gebracht, war das Lieblingskind meiner Eltern. Nie würde ich an ihrer Liebe zu mir zweifeln, aber mein Bruder war derjenige, der sie glücklich gemacht hat.
»Daran müssen wir glauben. Irgendwann kommt eine Zeit …« Er bricht ab und vergräbt den Kopf zwischen seinen Händen, sodass ich sein Gesicht nicht mehr sehen kann. Kurz darauf wird er von Schluchzern geschüttelt. Ich würde gern etwas für ihn tun, aber alles in mir ist wie lahmgelegt. Daher warte ich ab, bis er sich selbst wieder zusammengerissen hat.
Liam hat sich aus tausenden Facetten zusammengesetzt, ich habe nie alle erfassen können. Jetzt ist er nur noch ein toter Körper unter der Erde. Stumm stehe ich vor seinem Grab, die Hände wie aus Reflex gefaltet, der Blick gesenkt. Die Trauergemeinde ist gegangen, einen Leichenschmaus wird es nicht geben. Darauf hat meine Mutter bestanden. Offiziell, damit nicht noch mehr Kosten auf uns zukommen. Ich weiß aber, dass der Leichenschmaus nach einer Beerdigung der erste Schritt zurück in die Realität ist und so weit ist meine Mutter noch nicht. Sie will sich noch ein wenig in ihrer Trauer vergraben.
»Papa und ich gehen schon mal zum Auto«, flüstert sie mir in diesem Moment zu. Ich nicke abwesend.
Kurze Zeit später bin ich allein an Liams Grab.
Es fällt mir so schwer, den unpersönlichen Haufen Erde vor mir mit meinem Bruder zu vergleichen.
Nein, es fällt mir nicht schwer.
Ich kann es nicht.
Liam war der, der nachts immer zu spät heimgekommen ist, sodass ich mich aus meinem Bett schleichen und ihm öffnen musste.
Liam war der, der mich aufmuntern konnte, als ich mich mit Delilah gestritten habe.
Liam war der, der als Kind das Gemüse in der Waschmaschine versteckt hat, damit er es nicht essen musste.
Das alles – und noch viel mehr ist Liam.
Der Haufen Erde vor mir hat nichts mit ihm zu tun.
Als mir diese Erkenntnis kommt, wende ich mich ohne einen weiteren Blick ab und gehe zu unserem Auto. Mein Vater sitzt bereits hinter dem Steuer. An den Augen meiner Mutter erkenne ich, dass sie weint. Seufzend öffne ich die Hintertür und lasse mich auf den Sitz plumpsen. Auf der gesamten Rückfahrt sagt niemand von uns ein Wort.
Früher bin ich immer gern nach Hause gekommen, weil ich es mit Liebe und einem warmen Gefühl verbunden habe. Jetzt hat sich einiges geändert. Mit Liam ist auch die Sonne verschwunden. Ohne ihn wirken die Räume beengter, die Wände scheinen näher zu kommen und das Gefühl, ersticken zu müssen, ist omnipräsent. Nur in meinem Zimmer geht es mir halbwegs gut. Besonders schlimm ist es in der Küche, weil sie immer der Treffpunkt war. Hier haben wir nicht nur als Familie zusammen gegessen, sondern auch über unsere Sorgen und Nöte gesprochen. Die Küche ist der Ort, an dem meine Mutter uns Tee gekocht hat, als wir noch ganz klein waren und uns versicherte, dass alles ein gutes Ende nehmen würde. Heute fällt es mir schwer, daran zu glauben.
Als mein Vater die Tür aufgeschlossen hat, schiebe ich mich an ihm vorbei und laufe die Treppe hoch in mein Zimmer. Die Nachfrage meiner Mutter, ob ich etwas essen möchte, lasse ich unbeantwortet. In mir wächst der Drang, allein zu sein, mich zurückzuziehen und für eine Weile die Welt auszusperren. Sobald ich in meinem Zimmer bin, drehe ich den Schlüssel im Schloss um. Als Nächstes ziehe ich die Vorhänge zu. Das Licht draußen stört mich.
Erst als ich meine unbequeme Kleidung abgeworfen habe und in meinen grauen Schlafanzug geschlüpft bin, atme ich aus. Zentnerschwer fühle ich mich, als ich mich auf das Bett sinken lasse. Die Decke ist angenehm kühl, weswegen ich darunterkrieche. Ich ziehe sie mir bis zum Hals, dann starre ich nach oben, so wie ich es die letzten Tage dauernd getan habe.
Ich glaube, ich kenne meine Decke auswendig. Jedes kleine Loch und jede Unebenheit haben sich mir eingeprägt. Selbst jetzt, im Dunkeln, weiß ich, an welcher Stelle sich was befindet. Aber heute will ich nicht ewig im Bett liegen. Aus diesem Grund befreie ich mich schon Minuten später von der Decke und gehe zu meinem Schreibtisch, auf den ich gestern die weiße Kerze gestellt habe. Streichhölzer liegen daneben, nach denen ich nur greifen muss. Kurze Zeit später erhellt das Licht der Kerze den Raum. Ich nehme sie zwischen meine Finger und drapiere sie vor der Fotografie auf meinem Nachtschränkchen.
Liam,
denke ich und schaue direkt in seine stahlblauen Augen.
Ich weiß nicht, ob ich dich hassen oder um dich trauern soll. Es ist wohl eine Mischung aus beidem. Du hast mir einen riesigen Kloß im Hals beschert, der einfach nicht mehr verschwinden will, egal, was ich tue. Wegen dir kann ich nicht mehr schlafen, ohne dein Bild vor Augen zu haben. Aber es bist nicht du – nicht mein Bruder. Es ist ein Körper mit leerem Blick und seltsam verdrehten Armen, der am Grund des Belbony Rivers liegt. Ich habe dich nie tot gesehen, aber meine Fantasie beschert mir die schlimmsten Bilder.
Kraftlos sinke ich auf die Knie, sein Anblick noch immer in meinen Augen. Die Fotografie zeigt Liam an einem sonnigen Sommertag. Zusammen mit unseren Eltern sind wir ins Freibad gefahren, um schöne Stunden zu verleben. Liam grinst breit in die Kamera, hat die Arme in die Hüfte gestemmt. Das Wasser perlt von seinen blonden Haaren, die jenen Sommer etwas länger waren und ihm beinahe bis auf die Schulter reichten. Sein Oberkörper ist frei, er trägt eine blau gestreifte Badehose.
Ich habe unzählige Fotos von meinem Bruder. Und doch ist es dieses, das ich am liebsten mag, denn es ist die einzige Fotografie, die es geschafft hat, Liam genau so einzufangen, wie er war. Fröhlich, optimistisch und positiv.
Mit dem Finger streiche ich über das kalte Glas, fahre seine Konturen nach.
Es ist nicht fair, dass du mich allein lässt. Das weißt du hoffentlich! Du lässt mich und eine kaputte Familie im Stich. Du kannst nicht von mir verlangen, dass ich mich um alles kümmere, dass ich alles wieder ins Lot rücke, was du zerstört hast.
Mein ganzes Leben lang habe ich geglaubt, dass ich Liam kenne. Besser als irgendjemanden sonst. Er war mir näher als meine beste Freundin, näher als meine Eltern. Wir haben nicht nur die guten Zeiten miteinander geteilt, sondern auch die Tage, die von Schatten bevölkert waren. Liam war meine bessere Hälfte. Ohne ihn bin ich nicht mehr vollständig.
Ich bin mir sicher, dass du einen guten Grund hattest. Vielleicht hundert gute Gründe. Daher verurteile ich dich gar nicht dafür, was du getan hast. Ich verurteile dich dafür, wie du es getan hast. Still und heimlich, ohne ein einziges Wort! Liam, wann hast du angefangen, mir Dinge zu verschweigen? Habe ich mich verändert, dass du nicht mehr mit mir sprechen wolltest?
Meine Hände zittern, mein Herz klopft. Ich denke an die Notiz, die er hinterlassen hat. An den kleinen Zettel, den wir in seinem Zimmer gefunden haben.
Es tut mir so leid, aber es ist nötig. Irgendwann werdet ihr mich verstehen.
Ich presse meine Lippen aufeinander und versuche, auf andere Gedanken zu kommen. Doch mein Kopf ist schneller.
Ich fühle mich verraten. Erinnerst du dich an den Tag, als wir uns schworen, nie etwas vor dem anderen zu verheimlichen? Den Tag, als wir uns versprachen, immer für den anderen da zu sein? Ich habe es nicht vergessen – und ich war immer für dich da. Jede einzelne Sekunde. Warum habe ich dann nicht gemerkt, wie du mir entglitten bist? In letzter Zeit wirktest du so anders, viel verschlossener und in dich gekehrt – was hast du vor mir verheimlicht, Liam?
Manchmal denke ich, dass es leichter für mich gewesen wäre, wenn er unter einer Krankheit litt. Wenn sein Tod ein Unfall gewesen wäre. Er umgebracht worden wäre. Irgendetwas, das einen offensichtlichen Grund hat. Aber Liams Tod hätte verhindert werden können. Er war ein gesunder Mensch – und doch krank genug, um sich das Leben zu nehmen.
Ich hasse dich dafür, dass du mir Albträume bereitest. Ich hasse dich für die Momente am Morgen, in denen ich aufwache und eine Sekunde lang denke, dass alles in Ordnung ist, bevor die Realität auf mich niederprasselt. Ich hasse dich für das Skateboard, das unbenutzt herumsteht und auf dem niemand mehr fahren wird.
Ich hasse dich dafür, dass du mich zurückgelassen hast.
Das Haus ist still ohne ihn. Noch vor einer Woche war es erfüllt von seiner Stimme, seinen Erzählungen und Erlebnissen. Manchmal bilde ich mir ein, ihn noch in den Gängen zu hören.
Ich hasse dich für diese selbstsüchtige Tat. Liam, hast du nie daran gedacht, dass wir alle im selben Boot sitzen? Wolltest du uns wirklich so sehr verletzen?
Ich hasse dich dafür, dass mir meine Milch am Morgen nicht mehr schmeckt, weil ich daran denken muss, wie du einmal so sehr lachen musstest, dass dir alles aus dem Mund gespritzt ist.
Ich hasse dich dafür, dass mich nichts mehr freuen kann. Dass jeder schöne Moment von der grausamen Wahrheit überschattet wird, sobald sich meine Gedanken lichten.
Und ich hasse dich dafür, dass ich nicht weinen kann.
Ich kann es einfach nicht.
Kapitel 2 – Fünf Tage ohne dich
Wenn ich morgens aufwache, ist es still im Haus. Mein Vater ist bereits auf die Arbeit gegangen, meine Mutter hat noch Urlaub und verbringt die Vormittage im Bett. Ihr Verhalten symbolisiert die Art und Weise, wie sie mit Liams Tod umgehen. Während sich mein Vater in die Arbeit stürzt und erst spät am Abend zurückkehrt, ist meine Mutter manchmal gar nicht zum Aufstehen zu bewegen. Für mich selbst ist heute der erste Tag, an dem ich wieder die Schule besuche. Der erste Tag nach dem Tag, der mein Leben in einen Scherbenhaufen verwandelt und alles verändert hat.
Ohne sie würde ich es nicht schaffen. Delilah ist meine beste Freundin seit dem Kindergarten. Sie kennt mich beinahe so gut, wie Liam es getan hat, und ich weiß, dass ich mich zu hundert Prozent auf sie verlassen kann. Gestern Abend habe ich das erste Mal nach der schrecklichen Nachricht mit ihr telefoniert. Vorher brauchte ich die Zeit für mich.
Ich schlüpfe in meine graue Sommerjacke und schultere meinen rosafarbenen Rucksack. Als ich die Tür öffne, steht Delilah bereits davor. Unsere Blicke treffen sich – und für einen Moment weiß ich nicht, wie ich sie anschauen soll. Wie verhält sich ein Mädchen, das vor wenigen Tagen seinen Bruder verloren hat? Was wird von mir verlangt, welchem Rollenideal muss ich genügen? Muss ich ihr weinend in die Arme fallen, zusammenbrechen und sie unter einem Schluchzer darum bitten, mich von der Welt abzuschirmen? Ist es herzlos, wenn ich nicht weine?
Wenn ich nicht weinen kann?
Weil ich überfordert bin mit den Gedanken, die in meinem Kopf um die Oberhand kämpfen, versuche ich es auf die einfache Weise.
»Hi«, flüstere ich.
Delilah sieht mich an. Eine ganze Weile schaut sie mich mit ihren grünen Augen an. Dann tritt sie einen Schritt auf mich zu. Sie sagt nicht, dass es ihr leidtut. Sie sagt nicht, dass alles wieder gut werden wird. Sie steht vor mir wie eine verlässliche Seele. Wenn es wirklich so weit sein sollte und ich zusammenbreche, weiß ich, dass sie für mich da ist.
»Bist du dir sicher, dass du dir das antun willst?«, fragt sie, und ich weiß, worauf sie anspielt. Liams Tod hat sich herumgesprochen, er ist vor nicht allzu langer Zeit auf meine Schule gegangen. Dort werde ich nicht länger Moira sein, sondern die Schwester von dem, der sich umgebracht hat. Mir graut davor, angestarrt zu werden. Das Getuschel hinter meinem Rücken macht mich schon jetzt verrückt. Trotzdem nicke ich entschlossen.
»Früher oder später muss ich mich dem sowieso stellen«, sage ich leise und ziehe die Haustür hinter mir zu. Delilah streicht sich eine Strähne ihrer braunen Haare hinters Ohr. Sie bietet mir ihre Hand an, die ich ergreife. So wenig ich Umarmungen mag, so sehr brauche ich diese Geste. Das haben Delilah und ich schon gemacht, als wir noch klein waren. Immer, wenn eine schwierige Situation bevorstand oder eine von uns Probleme hatte, haben wir uns die Hand gegeben. Ein Zeichen, dass wir gemeinsam durch die Hölle gehen. Weil es nicht mehr so schlimm ist, wenn man jemanden an seiner Seite hat.
Bis zur Schule ist es nur eine viertel Stunde. Trotzdem haben wir uns früher verabredet, sodass wir nicht zu spät kommen. Nicht auszudenken, wenn ich nach dem Klingeln in die Klasse hechte und alle Augen auf mich gerichtet sind. Mein Plan ist es, möglichst unsichtbar zu sein. Ich weiß, dass nach ein paar Wochen Gras über die Sache gewachsen sein wird, daher ist es wichtig, dass ich auch in den kritischen, ersten Tagen keine Fehler mache.
Delilahs Hand fühlt sich warm an in meiner. Ich lasse meinen Blick über ihre schlanken Finger gleiten. Ein schlichter, goldener Ring ziert den vierten.
»Wie geht es Adrian?«, frage ich sie, ohne meinen Blick von dem Schmuckstück zu heben.
Delilah lässt sich mit der Antwort Zeit.
»Zwischen uns ist alles super«, sagt sie schließlich. Normalität tut mir gut, zumindest rede ich mir das ein.
So früh sind die Straßen leer, viele Rollläden heruntergezogen, die Menschen noch zu Hause. Ich bin froh, niemandem zu begegnen, und fühle mich mit jedem Schritt, den ich mich von der Nachbarschaft entferne, sicherer.
Delilah neben mir schweigt, und dafür bin ich dankbar. Ich möchte nicht, dass die Stille mit Fragen gefüllt wird, die nicht passen. Mit Fragen, die ich nicht beantworten will.
Die Sonne steht bereits am Himmel und wärmt mich mit ihren Strahlen, alles deutet auf einen schönen Tag im Mai hin. Kurz lege ich den Kopf in den Nacken, um mich bescheinen zu lassen. Liam hat den Frühling geliebt, es war die Jahreszeit, in der er am meisten aufgeblüht ist. Während ich den Winter bevorzuge, konnte er sich immer für die warmen Tage begeistern. Aber heute freue ich mich darüber, dass die Sonne hoch am Himmel steht. Ein bisschen ist es, als wäre er bei mir.
Unsere Schule ist ein hässliches, altes Backsteingebäude, das auf den ersten Blick eher an ein Gefängnis erinnert. Kastenförmig gebaut, wurde es in einem gräulichen Ton angestrichen, der sofort alle positiven Gefühle zunichtemacht. Nicht selten wird aus der »Sailory High School« daher eine »Jailory High School« gemacht.
Ich schlucke unwillkürlich, als wir uns dem Monument nähern. Glücklicherweise ist am Schulhof nicht so viel los. Eine Gruppe jüngerer Schüler spielt Fußball, ansonsten sehe ich nur vereinzelte Teenager, die sich auf dem Weg in das Gebäude befinden.
Delilah drückt meine Hand fester. Ich sehe sie an.
»Mach dir keine Gedanken«, sagt sie.
Der Kloß in meiner Kehle ist gigantisch. Zum ersten Mal zweifle ich an meiner Idee, mich einen Tag nach Liams Beerdigung schon wieder dem Wahnsinn zu stellen. Aber dann erinnere ich mich an meinen Vorsatz, den Alltag so früh wie möglich wieder in mein Leben zu lassen.
»Ich komme klar«, antworte ich daher und nicke entschieden. Mir entgeht nicht, wie Delilah das Gesicht kurz verzieht. Sie zweifelt an meiner Stärke. Weshalb ich nun umso mehr an mich glauben muss. Tief atme ich durch, dann setze ich den ersten Fuß auf den Schulhof.
Ich bin diese Strecke schon hundertmal gegangen, aber nie ist mir der Weg so schwer gefallen wie heute. Jedes Mal, wenn ein Schüler an mir vorbeihechtet, senke ich den Blick. Ich will nicht gesehen, noch weniger erkannt werden. Mein Atem geht unregelmäßig. Ich bekomme mit, wie mich Delilah fragend mustert. Aber da muss ich jetzt durch.
Endlich haben wir den Eingang erreicht. Meine Handflächen sind schweißnass, als ich gegen die Klinke drücke. Delilah geht nach mir durch die große Tür. Vor uns liegt eine hohe Treppe, die in den ersten Stock führt. Delilahs Klassenzimmer liegt auf der dritten, meins auf der vierten Etage. Mir graut schon vor den Stufen, die ich allein gehen muss.
Als hätte sie meine Ängste gehört, sagt sie in diesem Moment: »Ich bringe dich natürlich nach oben.«
Dankbar sehe ich sie an. In dem Chaos, das über mich zusammenbrechen wird, sobald die Klingel die erste Stunde einläutet, ist Delilah der Fels in der Brandung. Erst jetzt wird mir bewusst, dass ich schon wieder nach ihrer Hand gegriffen habe.
»Willst du schon in die Klasse?«, fragt meine Freundin, ich schüttle den Kopf. Noch ist es zu früh, sich in das leere Zimmer zu setzen. Ich würde Aufmerksamkeit erregen, wenn ich die Letzte, aber auch, wenn ich die Erste bin. Suchend sehe ich mich daher im Schulgebäude um, bis mir eine Idee kommt.
»Ich würde gern zur Toilette«, sage ich, erschrocken darüber, wie sehr meine Stimme zittert. Hilfesuchend greife ich mir mit der freien Hand an meinen Hals.
»Ganz wie du willst«, sagt Delilah.
Um ehrlich zu sein, habe ich gar nicht vor, mich auf der Toilette zu verkriechen bis kurz vor Unterrichtsbeginn. Stattdessen brauche ich einen Spiegel, in dem ich mich ansehen kann. Wenn ich nicht auffallen will, dann darf ich auch nicht wie eine lebende Leiche aussehen. Aber genau so fühle ich mich gerade. Delilah und ich gehen hoch in die erste Etage, dann ziehe ich meine Freundin mit mir. Erst als wir den Schulflur hinter uns gelassen haben, atme ich auf.
Auf der Toilette ist es gespenstisch still, doch das kommt mir entgegen. Seufzend stelle ich mich vor den Spiegel. Ich sehe außergewöhnlich blass aus, was bei meiner von Natur aus gebräunten Haut ungewöhnlich ist. Meine Frisur von heute Morgen hat sich bereits gelöst. Noch bevor ich mich nach einem Zopfgummi umsehen kann, hält Delilah mir eins hin.
»Danke.«
Schnell verstaue ich die ungekämmten Haare in einem Dutt am Hinterkopf. »Besser?«
Fragend drehe ich mich zu meiner besten Freundin hin, die mir einen erhobenen Daumen entgegenstreckt. Ob ich ihr wirklich glauben soll, weiß ich nicht. Aber da ihr Feedback momentan die einzige Resonanz ist, bleibt mir nichts anderes übrig.
Schon greife ich nach meinem Rucksack, den ich am Boden abgestellt habe, als plötzlich eine der Toilettentüren aufgeschlossen wird. Reflexartig halte ich den Atem an. Auch Delilah schaut in die Richtung. Als ein großes, braunhaariges Mädchen sich aus der engen Kabine schiebt, überlege ich ernsthaft, wegzulaufen. Aber da hat sie mich bereits entdeckt.
Ich habe nicht gewusst, dass sich Gesichtsausdrücke so schnell ändern können. Eine Sekunde lang mustert mich Anny neutral, dann gleitet Erkenntnis über ihre Miene, bevor sie sich schließlich die Hand erschrocken vor den Mund presst.
»Moira«, stößt sie aus und kommt auf mich zugelaufen. »Was machst du hier?«
Noch bevor ich mich recht versehe, lande ich in ihren ausgestreckten Armen. Wie durch einen inneren Abwehrmechanismus spannt sich mein Körper an. Einen Moment lang kann ich nicht mehr atmen. Anny riecht nach einer Mischung aus überteuertem Parfüm und blumigem Deo. Stumm zähle ich die Sekunden, bis sie mich endlich loslässt.
»Ich hätte nie gedacht, dass du schon wieder in die Schule kommst. Megan hat sogar gedacht, dass du gar nicht mehr kommst.«
Megan. Natürlich.
Ich blicke Anny direkt in die aufgerissenen, braunen Augen. Ihr Mund ist seltsam verzogen, sie bedenkt mich mit einem Blick, den man normalerweise einem Kind schenkt, das in den Matsch gefallen ist und sich das Knie aufgeschlagen hat.
»Oh Gott, Moira, es tut mir so leid«, heult sie und drückt mich noch einmal an sich. Wieder umnebelt mich die Parfüm-Deo-Mischung, und dieses Mal muss ich husten.
»Es muss schlimm sein, den Bruder zu verlieren«, schmiert mir Anny aufs Brot, während sie mir – erneut wie bei einem Kleinkind – über die Haare streicht. Aus den Augenwinkeln sehe ich Delilah, der ich einen Hilfe suchenden Blick schenke. Da lässt mich Anny wieder los, und nun bin ich klüger und weiche gleich ein paar Schritte zurück, bevor sie frei nach dem Motto Aller guten Dinge sind drei vorgehen kann.
»Ich verstehe das nicht mit Liam«, schluchzt sie und wirkt für einen Moment ehrlich verstört. »Er war doch immer so freundlich und nett. Wieso hat er so etwas Schlimmes getan?«
Mit einem imaginären Taschentuch tupft sich Anny über die Augen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll.
»Wie geht es dir damit, Moira?«, fragt sie jetzt, aber glücklicherweise fasst mich Delilah am Arm.
»Du wolltest doch noch zu deinem Spind«, raunt sie mir zu und zieht mich mit sich weg. Über die Schulter dankt sie Anny für ihre Anteilnahme, dann schließt sie die Tür.
Draußen auf dem Flur fällt ein großer Teil meiner Anspannung ab. Ich atme tief durch.
»Danke, Lilah«, sage ich.
»Ich konnte dich doch nicht mit der Schlange allein lassen«, entgegnet sie.
»Ich will gar nicht wissen, was Megan alles über Liam erzählt hat«, flüstere ich und schüttle den Kopf. Megan und Anny haben die Eigenschaft, die Wahrheit so zu verdrehen, dass sie keiner mehr wiedererkennt. Sie sind die Lästerschwestern meiner Klasse, auf den ersten Blick offen und zuvorkommend, hintenherum listige Schlangen.
»Sehen wir das Gute darin«, meint Delilah und durchdringt meine Gedanken. »Immerhin musst du dich ihr nicht gleich im Klassenzimmer stellen.«
Ihr nicht. Aber fünfundzwanzig anderen fragenden Gesichtern.
Mir wird so schlecht, dass ich mir die Hand auf den Magen presse.
»Alles okay?« Lilah legt mir die Hand auf die Schulter und sieht mich mitfühlend an.
Schwerfällig nicke ich. »Alles in Ordnung. Jetzt lass uns zu meinem Spind gehen.«
»Sag bloß, du musst da wirklich hin«, grinst Lilah. Ich nicke, während ich mich frage, ob ich mein Mathebuch tatsächlich in der Schule gelassen habe.
Wir gehen zwei Treppen hoch, dann biegen wir in den Gang ein, auf dem sich mein Spind befindet. Vorsichtshalber schaue ich mich um, aber außer einem kleinen Jungen sehe ich niemanden.
»Die Luft ist rein«, kommentiert auch Delilah.
Als ich vor meinem Spind stehe, wird der Kloß in meiner Kehle größer.
»Wir brauchen einen sechsstelligen Pin! Sechsstellig, wie soll ich mir das denn jemals merken? Ich sag dir gleich, ich ende mit 1-2-3-4-5-6.«
Liam lacht und rückt den Stuhl näher an den Küchentisch heran.
»Wie wäre es mit deinem Geburtsdatum?«, schlägt meine Mutter vor, die gerade eine Schüssel Nudeln auf die Platte stellt.
»Da kann ich ihn ja gleich offen lassen«, entgegne ich sarkastisch und vergrabe den Kopf in meinen Händen.
»Misch unsere Geburtsdaten doch einfach«, fällt es Liam auf einmal ein. Neugierig sehe ich ihn an. Seine blauen Augen blitzen, wie immer, wenn er eine Idee hat.
»3.3. für meinen Geburtstag, dahinter die 28.11. für deinen. Na, was sagst du?«
Einen Moment denke ich über seinen Vorschlag nach, dann nicke ich. Immerhin besser als nichts.
»Was ist los, Moira?«, fragt Delilah, als ich den Spind niederstarre. Mit den Gedanken bin ich noch immer in der Vergangenheit. Selbst als ich meine Freundin anschaue, sehe ich in Wirklichkeit meinen Bruder vor mir. Als ich langsam wieder das Hier und Jetzt erreiche, fällt mir etwas ein.
»Lilah«, sage ich leise. »Im … Spind hängen Bilder von ihm. Kannst du …«
Ich muss nicht zu Ende sprechen, sie hat mich bereits verstanden.
»Was brauchst du?«, fragt sie stattdessen.
»Mein Mathebuch.«
Demonstrativ schiebt sie mich vom Spind weg und gibt den sechsstelligen Pin ein. Als sie die Tür des kleinen Schranks öffnet, drehe ich mich um. Kurze Zeit später liegt das Buch in meiner Hand.
»Danke.«
Ich höre, wie das Schloss wieder einrastet, dann nimmt Lilah mich bei der Hand. »Ich fürchte, wir müssen jetzt los«, sagt sie mit gedrückter Stimme. Ich starre auf die Etage über mir und nicke. »Auf in den Kampf«, murmle ich.
Oben angekommen, hat sich meine Übelkeit verdreifacht. Jetzt könnte ich wirklich eine Toilette gebrauchen. Abwartend steht Lilah mit mir vor der Tür zu meinem Klassenraum. Sie ist geschlossen, aber bedeutet das unweigerlich, dass noch niemand da ist? Ich will nicht als Erste kommen, und doch will ich niemandem begegnen.
»Danke für alles«, sage ich zu Lilah und drücke ihre Hand ganz fest. Nun ist der Moment gekommen, sie loszulassen, aber alles in mir sträubt sich dagegen.
»Ich habe dir gestern schon am Telefon gesagt, dass du das nicht machen musst. Noch nicht. Jeder würde es verstehen, wenn du noch eine Weile zu Hause bleibst.«
Obwohl sie recht hat, schüttle ich den Kopf. »Ich kann nicht zu Hause sein«, hauche ich, ohne Delilah anzusehen. »Zu Hause erinnert alles an ihn.«
Entschlossen greife ich nach der Türklinke.
Mein Herz hämmert unregelmäßig, als ich den lichtdurchfluteten Klassenraum betrete. Schon auf den ersten Blick sehe ich, dass er nicht leer ist. Jasper sitzt in der letzten Reihe und spielt auf seinem Handy herum. Claire ist dabei, sich die Nägel zu lackieren. Neben ihr kritzelt Teresa etwas auf ihren Block.
Nur drei.
Das schaffe ich.
Tief atme ich ein und aus. Dann begehe ich den Fehler und lasse die Tür hinter mir geräuschvoll ins Schloss fallen.
Drei Augenpaare starren mich an.
»Moira?«, fragt Claire tonlos und hält im Lackieren inne. Teresas Mund ist zu einem stummen »O« geformt. Jasper legt sein Handy auf den Tisch und sieht mich fragend an.
Ich kann das nicht.
Liam, was tust du mir hier an?
Nervös zupfe ich an meinem Oberteil. Ich kann ihren Blicken nicht begegnen, sie scheinen mich in Grund und Boden zu starren.
»Hallo«, sage ich daher und husche so schnell es geht auf meinen Platz in der zweiten Reihe. Bis zum Unterrichtsbeginn sehe ich sie nicht mehr an.
Mr Ivanhoe betritt die Klasse mit fünf Minuten Verspätung. Mittlerweile müsste ein Großteil der Schüler anwesend sein. Genau kann ich das nicht sagen, denn mein Blick ist nach unten gerichtet. Eben habe ich Megan gehört. Ihr gackerndes Lachen drang mir durch Mark und Bein. Neben mir sitzt Lucas. Mehrmals hat er versucht, ein Gespräch mit mir anzufangen, aber ich habe immer abgeblockt.
Obwohl ich sie nicht sehe, weiß ich, dass sie mich anschauen.
Ich wusste, dass es schlimm werden würde.
Aber in diesem Moment glaube ich, mich noch nie so elend gefühlt zu haben.
»Wahrscheinlich haben Sie alle mitbekommen, was einem ehemaligen Schüler dieser Schule passiert ist«, fängt Mr Ivanhoe an und beschert mir den Schreck meines Lebens. Für einen Moment kann ich nicht atmen. Will er wirklich darüber reden? Muss er darüber reden? Schaut er mich in diesem Moment an?
»Ich weiß selbst nicht, was ich sagen sollte, außer dass Liam einer meiner Schüler war«, fährt er fort und schnieft. Noch nie habe ich mir so sehr gewünscht, unsichtbar zu sein. Jetzt stehe ich unweigerlich im Mittelpunkt, alle Blicke werden auf mich gerichtet sein. Ich umklammere die Kante des Tisches und schließe die Augen. Versuche, wegzuhören, aber je mehr Mühe ich mir gebe, desto mehr verstehe ich.
Mr Ivanhoe redet von Liam. Aber in seinen Erzählungen wird ein anderer Junge lebendig. Ich verbinde seine Worte nicht mit meinem Bruder. Kein Wunder: Wie soll ein Lehrer ihn schon gekannt haben? Wahrscheinlich tut er es nur, weil man ihn dazu aufgefordert hat. Ich weiß nicht, wie lange sein Vortrag dauert, aber als es überstanden ist, atme ich tief durch. Immerhin besaß Mr Ivanhoe das Taktgefühl und hat mich nicht angesprochen.
»So, meine Damen und Herren, weiter geht es mit Mathematik«, sagt er schließlich. »Schlagt eure Bücher auf Seite 124 auf, wir beginnen mit den Aufgaben von letzter Woche. Ivy, was hast du bei der ersten Funktionsgleichung herausgefunden?«
Der Unterricht geht los und zum ersten Mal bin ich darüber dankbar. Ich sehe, wie Bücher herausgeholt und Hefte aufgeschlagen werden. Ivy, die in der ersten Reihe sitzt, trägt mit Piepsstimme ihre Lösung vor.
Irgendwann schaffe ich es, meinen Collegeblock auf den Tisch zu legen und so zu tun, als würde ich mitschreiben. In Wirklichkeit kann ich mich auf nichts konzentrieren. Mein Kopf schwirrt. Immer wieder erwische ich jemanden dabei, wie er mich anstarrt. Das ist schlimm. Schlimmer ist lediglich, dass sie sofort den Blick senken, wenn ich sie ebenfalls anschaue.
Die neunzig Minuten wollen und wollen nicht vergehen. Die mathematischen Formeln kommen mir wie chinesische Schriftzeichen vor. Ich erwische mich dabei, wie mein Blick immer wieder in Richtung Fenster wandert. Als die Glocke endlich klingelt, kann ich meine Tasche gar nicht schnell genug packen.
»Hey, Moira«, sagt Lucas neben mir und legt mir seine Hand auf den Arm. Ich zucke unter der Berührung zusammen. Nur kurz werfe ich einen Blick auf sein markantes Gesicht. Die Brille ist ihm ein Stück weit von der Nase gerutscht.
»Wie geht es dir?«, fragt er und klingt so, als wollte er es wirklich wissen.
Wie geht es dir?
Wer kann schon genau sagen, wie es einem geht? Das Leben besteht nicht nur aus Gut und Böse, schön und hässlich. Es sind so viele Komponenten, die man einbeziehen muss, um die Frage zu beantworten.
Vor allem,
wenn Liam tot ist.
Meine Hände zittern, ich halte in der Bewegung inne.
Normalerweise mag ich Lucas. Er ist ein unaufgeregter Typ, der immer die Ruhe und einen klaren Kopf bewahrt. Heute aber fühle ich mich in seiner Anwesenheit unsicher.
»Geht schon«, murmle ich und schließe den Rucksack. Anschließend greife ich nach meiner Jacke. Innerlich mache ich drei Kreuze, dass er keine weiteren Fragen stellt, aber da sehe ich mich schon mit einem anderen Problem konfrontiert, das ich nicht ignorieren kann. Weil es mindestens 1,85 m groß ist und sich direkt vor mir aufbaut.
»Moira«, säuselt es und zieht dabei meinen Namen so in die Länge, dass mir schlecht wird. Nur ganz langsam hebe ich den Blick. Megan steht vor mir, Anny verlässlich neben sich. Megan schaut mich mitleidig an, so, wie es ihre Freundin eben getan hat. Nur dass jetzt die ganze Klasse zuschaut.
Warum geht niemand in die Pause?
»Ich … muss raus«, stammle ich, aber Megan versperrt mir den Weg.
»Das mit deinem Bruder tut mir so leid«, ruft sie und will mich in die Arme schließen, als ich zurückweiche. »Es kam so unerwartet«, fügt sie hinzu, ihre Stimme eine Ansammlung von geheucheltem Mitleid. »Er ist von einer Brücke gesprungen, oder?«
Wie vom Donner gerührt bleibe ich stehen. Ich hätte Megan viel Skrupel zugetraut, aber dass sie meine ganze Klasse darüber informiert, dass mein Bruder sich umgebracht hat, ist selbst für sie eine Nummer zu viel. Klar, unsere Stadt ist nicht die größte. Früher oder später hätte es jeder herausgefunden, aber das, was Megan gerade tut, geht zu weit.
Ich will sie zur Seite schieben, da kommt Anny auf mich zu.
»Warum hat er sich eigentlich umgebracht, Moira?«, fragt sie mich. Ich muss nur kurz den Kopf heben, um zu sehen, dass noch immer niemand den Raum verlassen hat. Dass alle Augen auf mich gerichtet sind und niemand meine Antwort verpassen will.
»Ja, warum ist er gesprungen?«, will jetzt auch Megan wissen und stemmt die Hände in die Hüfte.
Liam, ich hasse dich dafür, dass diese dummen Puten gerade genauso wenig wissen wie ich. Ich hasse dich für den dummen Zettel, den du hinterlassen hast und der mir nicht weiterhilft.
»Das geht euch nichts an«, zische ich mit letzter Entschlossenheit, dann hechte ich aus dem Klassenzimmer. Ich bin gerade aus der Tür, als ich Megans gehässige Stimme hinter mir höre.
»Ich wusste schon immer, dass er ein Feigling ist.«
Hals über Kopf stürme ich die Treppe hinunter. Ich muss dieses verdammte Gebäude verlassen. Immer zwei Stufen auf einmal nehmend bin ich schnell am Schulhof angekommen. Weil Pause ist, wimmelt er nur so von Gesichtern. Mein Blick ist starr geradeaus gerichtet, ich habe nur mein Ziel vor Augen. Ich bilde mir ein, dass jemand meinen Namen ruft, aber das ist mir egal. Wenn ich noch eine Sekunde bei diesen Menschen bleiben muss, die mich zu Boden starren, sterbe ich.
»MOIRA! MOIRA, BLEIB DOCH ENDLICH STEHEN!«
Die Stimme, eben noch fragend und leise, dringt nun laut zu mir herüber. Kurz darauf spüre ich, wie jemand nach meiner Hand greift. Ich bin im Begriff, sie ihm zu entziehen, als ich Delilah erkenne.
»Moira«, haucht sie und sieht mich mit einer Mischung aus Erschrecken und Angst an. »Was ist los?«
»Ich kann das nicht«, stammle ich, während ich unaufhörlich den Kopf schüttle. »Ich kann es einfach nicht.«
Delilah drückt meine Hand. »Lass uns abhauen«, sagt sie.
»Du musst nicht mehr in diese Schule zurück, wenn du nicht willst. Du musst gar nicht mehr zurück. Sag deinen Eltern, dass du dich dort nicht wohlfühlst.«
Delilah und ich sitzen an einem kleinen See, auf dem ein einzelner Schwan seine Runden dreht. Die Sonne scheint warm auf uns herab.
»Das kann ich nicht. Es bringt nichts, wegzulaufen.«
»Moira, dein Bruder ist gestorben. Du hast jedes Recht dazu, erst mal den Kopf in den Sand zu stecken.«
Wir tauschen einen kurzen Blick.
»Vielleicht … bin ich in ein paar Tagen …«
Kopfschüttelnd sieht sie mich an. Delilah rückt näher an mich heran. »Übernimm dich nicht, Moira«, rät sie mir und fährt mit der Hand durch das Gras. »Gestern war erst seine Beerdigung.«
Was ich in ihren Augen sehe, habe ich vorher noch nie an ihr bemerkt. Es erinnert mich an einen stummen Vorwurf, bei dem ich genau weiß, gegen was er gerichtet ist.
Die Beerdigung. Ich habe ihr verboten, zu kommen.
»Ich dachte, dass ich das schaffe«, sage ich mit stockender Stimme, während die Sonne meine Arme erwärmt. »Ich dachte, nach seiner Beerdigung kann ich mein Leben wieder aufnehmen.«
»Aber nur weil Liam beerdigt wurde, heißt das doch nicht, dass alles wieder ist wie vorher. Du kannst nicht von einem auf den anderen Tag beschließen, dass du dich wieder dem Alltag stellst.«
Nein, vielleicht kann ich das nicht. Aber was soll ich denn sonst tun? Wenn ich mich den ganzen Tag wie meine Mutter im Bett verkrieche, werde ich wahnsinnig.
Verzweifelt seufze ich. Delilah streichelt mir über den Rücken.
»Willst du darüber reden?«, fragt sie schließlich. Einen Moment überlege ich, dann schaffe ich es, sie anzuschauen. Ihr Blick ist freundlich – offen – typisch Delilah. Ich habe ihr jedes Geheimnis anvertraut, aber gerade jetzt sind meine Stimmbänder wie gelähmt.
»Ich will dich nicht bedrängen«, sagt sie leise, während sie mit ihrem Finger weiterhin Kreise auf meinem Rücken zieht. »Du musst nur wissen, dass ich für dich da bin, wenn du reden willst.«
Ich nicke. Mehr schaffe ich momentan nicht.
Liam, warum hast du das getan? Delilah denkt, ich kenne den Grund und will ihn ihr einfach nicht verraten. Aber ich habe doch keine Ahnung. Du warst mein Bruder – trotzdem wirkst du auf mich wie ein Fremder.
Die Stille des Moments droht mich zu erdrücken. Es kommt mir vor, als läge ein Gewicht auf meiner Brust, das immer schwerer wird.
»Lilah, können wir irgendetwas machen? Irgendetwas, das ablenkt?«
Sie nickt. »Was immer du willst.«
Obwohl es auch bei uns in der Stadt ein Kino gibt, steigen Delilah und ich in den Bus, um etwa dreißig Kilometer weit nach Exton zu fahren. Erstens ist dort die Gefahr kleiner, dass man mich erkennt und auf meinen Verlust anspricht, zweitens tut es mir gut, alles hinter mir zu lassen. Delilah und ich haben füreinander schon oft die Schule geschwänzt. Damals, als Adrian mit ihr Schluss gemacht hat, verkrochen wir uns sogar zwei Tage lang in ihrem Zimmer.
Vor dem Kino müssen wir eine halbe Stunde warten, bis die erste Vorstellung anfängt. Delilah fragt mich, welchen Film ich gucken will, aber mein Blick gleitet nur desinteressiert über die Plakate. Es ist mir egal, was wir uns anschauen. Es geht nicht um den Inhalt, es geht darum, dass Zeit vergeht. Irgendwann wird es besser werden. Und vielleicht gelingt es mir sogar, mich bei einem Film abzulenken.
»Also, wir haben hier ein kitschiges Liebesdrama mit Krebs und allem, was dazugehört«, fängt Lilah an und deutet auf ein Plakat. »Hier gibt es eine Dokumentation über irgendeinen fetten Opernsänger, der seine besten Jahre schon hinter sich hat.« Sie geht ein Stück nach rechts. »Was das ist, weiß ich nicht. Spontan würde ich auf eine Komödie tippen, aber das Plakat …« Sie legt den Kopf schief und schürzt die Lippen. »Na ja, lassen wir das. Zu guter Letzt ist hier noch ein Horrorfilm, sieht nach viel Blut und wenig Story aus.«
»Den nehmen wir«, entgegne ich sofort.
Lilah sieht mich komisch an, erwidert aber nichts, sondern zuckt nur mit den Schultern.
Ende der Leseprobe