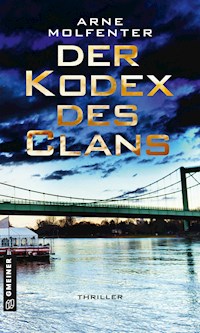10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Noch acht Wochen, nachdem die Invasion der Alliierten tatsächlich schon stattgefunden hat, warten 22 deutsche Divisionen auf den vermeintlichen Hauptangriff. Vergeblich. In die Irre geführt hat sie »Garbo«: Als einer ihrer wichtigsten Quellen in England hat der Agent die Deutschen überzeugt, dass die Landung erst noch bei Calais bevorstehe. Hitler werden Pujols Meldungen direkt vorgelegt, und die Deutschen vertrauen ihm weiter. Was die deutsche Führung nicht weiß: Pujol ist der wichtigste Doppelagent des britischen Geheimdienstes und spielt eine entscheidende Rolle bei der Operation »Fortitude«, dem Täuschungsmanöver der Alliierten, mit dem die Deutschen über den Zeitpunkt und den Ort der Landung der Alliierten in die Irre geführt werden sollten. Die Briten nennen Pujol »Garbo«, in Anklang an die Schauspielerin Greta Garbo. Aber wer ist dieser größte Schauspieler des Krieges wirklich?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Für A.
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe
1. Auflage 2014
ISBN 978-3-492-96626-9
© 2014 Arne Molfenter und Piper Verlag GmbH, München
Covergestaltung: Büro Jorge Schmidt, München
Covermotiv: Alexandra Bergman/Getty Images
Litho: Lorenz & Zeller, Inning am Ammersee
Datenkonvertierung: Kösel, Krugzell
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
I’m the twisted name on Garbo’s eyes
Living proof of Churchill’s lies
I’m destiny
I’m torn between the light and dark
Don’t believe in yourself
Don’t deceive with belief
Knowledge comes with death’s release
David Bowie, »Quicksand«
Prolog
Sainte Mère Eglise, Normandie, 6. Juni 1944
Im Morgengrauen herrschte grenzenloses Entsetzen bei den deutschen Soldaten. Drei Tage lang war die riesige Flotte in Sturm und Nebel auf See gewesen. Über 7000 Schiffe und 1000 Flugzeuge hatten sich auf den Weg gemacht. Am frühen Morgen des 6. Juni 1944 landeten britische, US-amerikanische, kanadische und französische Soldaten an der Küste der Normandie, auf einem 98 Kilometer breiten Abschnitt zwischen Sainte Mère Eglise im Osten und der Halbinsel Cotentin im Westen. Es war die größte militärische Landungsoperation, die die Welt je erlebt hatte. Die Vorbereitungen hatten 18 Monate gedauert, alles hatte bei der Konferenz von Casablanca im Januar 1943 begonnen. Jetzt entschied sich, wie gut der Plan war, als in der Nacht zum 6. Juni der Oberbefehlshaber der Alliierten, General Dwight D. Eisenhower, das Startsignal für die »Operation Overlord« gab. Die größte Schiffsflotte aller Zeiten hatte den Ärmelkanal passiert, jetzt sollten die alliierten Truppen die deutschen Linien überwinden und die Wehrmacht vernichtend schlagen. Der Morgen begann mit schweren Luftangriffen. Dann schafften es die ersten 20000 Soldaten, am Utah Beach an Land zu gehen. Bis zum Abend hatten sie hier nur 200 Opfer zu beklagen. Die Angriffe der Alliierten trafen die deutsche Wehrmacht vollkommen überraschend. Niemand glaubte auf deutscher Seite, dass dies die »wirkliche Invasion« war. Noch einen Tag zuvor, am 5. Juni 1944, hatte der Oberbefehlshaber West, Generalfeldmarschall Gerd von Rundstedt, in seinem Lagebericht für Frankreich vermerkt, »dass die Invasion keinesfalls unmittelbar bevorsteht«. 24 Stunden später waren bereits 176000 alliierte Soldaten an Land gegangen.
Trotz der monumentalen Truppenstärke waren sich die Alliierten zu Beginn keineswegs sicher, ob sie mit der »Operation Overlord« überhaupt einen dauerhaften Brückenkopf für die nachfolgenden Truppen würden errichten können. Doch innerhalb eines Jahres erreichten sie Berlin, und Europa wurde von der fünfjährigen grausamen Besetzung durch das nationalsozialistische Deutschland befreit.
Was war der entscheidende Grund für den Erfolg der Operation? War es die Luftschlacht um England vier Jahre zuvor, in der die Alliierten die endgültige Lufthoheit errungen hatten? Waren es die Entschlossenheit General Eisenhowers und des britischen Feldmarschalls Bernard Montgomery oder die Unfähigkeit Hitlers und seiner Generäle? Waren es die umfangreichen Täuschungsmanöver der Alliierten, die den Deutschen vormachten, es gebe eine gewaltige ›Erste US-Armee‹, die erst später in Calais angreifen würde? Oder gab es noch einen anderen Grund, über den bisher nur wenig bekannt ist?
Die Landung in der Normandie war erfolgreich, weil die deutsche Führung den umfassenden Täuschungsplan der Alliierten für die Landung nicht durchschaute. In diesem Plan spielte ein Mann die entscheidende Rolle: der spanische Hühnerzüchter Joan Pujol Garcia. Dem Doppelagenten gelang es, die deutsche Seite davon zu überzeugen, dass die Landung in der Normandie nur ein erstes Ablenkungsmanöver sei und die wirkliche Landung erst einige Wochen später anlaufen würde, rund 150 Kilometer weiter nordöstlich in der Nähe von Calais, an der engsten Stelle des Ärmelkanals. Hitler selbst vertraute seinem vermeintlichen Agenten und dessen Funksprüchen voll und ganz und entschied, die Mehrheit der deutschen Truppen in Calais zu lassen und nicht in die Normandie zu verlegen. Der Plan von Joan Pujol Garcia ging auf. Dies ist die wahre Geschichte eines der größten Täuschungsmanöver aller Zeiten: die Geschichte von Joan Pujol Garcia – dem Mann, der ›Garbo‹ hieß.
Kapitel 1
Auf der Jagd nach ›Alaric Arabel‹
Berlin/Malta, 2. April 1942
Nur noch wenige Lichter brannten um 22:07 Uhr in dem fünfstöckigen Gebäude aus grauem Sandstein. Ruhig floss das schwarze Wasser im Landwehrkanal vor dem Haus.
»Eine Eilmeldung aus Madrid! ›Alaric Arabel‹ hat Neuigkeiten!«, rief plötzlich eine der Sekretärinnen, die im Fernschreiberraum Nachtdienst hatte. Die Nachricht, die langsam aus dem Fernschreiber im vierten Stock der Abwehrzentrale am Tirpitzufer in Berlin kam, versetzte den diensthabenden Offizier sofort in Aufregung:
»V-Mann 372 der Stelle ›Felipe‹ berichtet, dass am 26. März 1942 ein Konvoi mit 15 Schiffen von Liverpool aus Kurs auf Gibraltar genommen hat. Möglicher Zwischenstopp: Lissabon. Endgültiges Ziel: Wahrscheinlich Malta. In diesem Konvoi unter anderem: ein Kohlenschiff, ein Tanker, fünf Frachtschiffe mit Munition und Waffen, drei Frachter mit Lebensmitteln, ein Frachter mit Technikern der britischen Luftwaffe an Bord sowie ein Frachter mit Medikamenten und Verbandsmaterial.«1
Nachdem die Meldung der Abwehrstelle Madrid eingegangen war, handelte das Hauptquartier der deutschen Spionage und Sabotage in Berlin rasch. Hektik brach aus in dem Haus, das intern nur der »Fuchsbau« hieß.2
»Alarmieren Sie sofort unsere Luftwaffenstützpunkte in Südfrankreich und die der Italiener auf Sardinien!«, befahl der diensthabende Offizier den Funkern im Nebenraum.
Nur kurze Zeit später stiegen deutsche und italienische Jäger in den Nachthimmel. Sie sollten aufklären, was es mit diesem großen Konvoi auf sich hatte. Auch über der Hauptstadt Maltas, La Valetta, tauchten erste Maschinen auf, um die mögliche Route der Schiffe zu überwachen.
Malta, das angebliche Ziel des Konvois, war britische Kolonie. Die Inselgruppe diente den Alliierten wegen ihrer strategisch wichtigen Lage als Marine-Stützpunkt. Wer Malta und seine Häfen beherrschte, kontrollierte das westliche Mittelmeer zwischen Sizilien und der nordafrikanischen Küste sowie die wichtige Route durch den Suez-Kanal. Deshalb versuchten die Deutschen und Italiener, jeden Konvoi zu versenken und die Inseln somit auszuhungern. Anfang 1942 waren viele Schiffszüge auf dem gefährlichen Weg nach Malta, um die Bevölkerung zu versorgen und die Alliierten mit Nachschub zu beliefern. Die meisten Versorgungsschiffe starteten vom ägyptischen Alexandria aus, und ihr Schicksal war rasch besiegelt. Deutsche und italienische Kampfflugzeuge versenkten die meisten Schiffe, kurz nachdem sie aufgebrochen waren, und Malta wurde ohne Pause bombardiert. Im Januar 1942 mussten die Bewohner der Inseln mehr als 2000 Luftangriffe überstehen, allein im Februar 1942 fielen über 1000 Tonnen Bomben auf die kleinen Mittelmeerinseln. Am 7. Februar hörte der Bombenhagel kaum noch auf, und es kam zu einem 13-stündigen Luftkampf. Die britische Luftwaffe hatte zur Verteidigung der Inseln nur eine Handvoll Flugzeuge zur Verfügung. Insgesamt wurden fast 35000 Häuser zerstört, mehr als 1000 Einwohner kamen bei den Angriffen ums Leben. Mit einer Fläche von 316 Quadratkilometern besitzt Malta nur ein Drittel der Größe Berlins. Bezogen auf die Fläche fielen hier pro Quadratmeter die meisten Bomben des Zweiten Weltkriegs – insgesamt 14000 Tonnen.3
Die Deutschen und Italiener wollten den Konvoi aus Liverpool stoppen, koste es, was es wolle. U-Boote gingen östlich vor Gibraltar in Position, um die britischen Schiffe in einen Hinterhalt zu locken und notfalls verfolgen zu können. Das Warten begann, ab und zu meldeten deutsche Schiffe Rauchfahnen am Horizont. Dann wieder funkten die Mannschaften, dass es sich um einen Fehlalarm gehandelt habe, denn vom gemeldeten Konvoi war auch nach Tagen nichts zu sehen. Alles schien vergebens. Hunderte Männer der Luftwaffe und der Marine waren ohne Erfolg in Bereitschaft gewesen, die Piloten hatten ihren Treibstoff verflogen und mussten wieder zurückkehren, die U-Boote nahmen ihren ursprünglichen Kurs wieder auf und begannen erneut, andere Schiffszüge zu verfolgen. Der Einsatz war zum Fiasko geworden, doch an der Meldung ihres Agenten ›Alaric Arabel‹ zweifelte die deutsche Seite nicht. Die Schuld am Scheitern der Aktion gab die Abwehr stattdessen den Italienern. Ungeduldig warteten die Deutschen auf weitere Erklärungen ihres Agenten. Doch auch an einem anderen Ort wuchs die Spannung, ob sich ›Alaric Arabel‹ bald wieder melden würde.
Bletchley Park, April 1942
Im abgeschiedenen Landsitz Bletchley Park, in der britischen Grafschaft Buckinghamshire, residierten die Codeknacker des britischen Geheimdienstes MI5. Gebaut im 19.Jahrhundert für Sir Herbert Leon und seine Frau Fanny, lag das Herrenhaus inmitten einer 120 Hektar großen Parklandschaft. Jedes Mal, wenn Sir Herbert auf einer seiner zahlreichen Reisen einen Architekturstil reizvoll fand, ließ er ihn am eigenen Herrenhaus nachbauen. So zierte ein grüner Kupferturm das Haus, an einem anderen Flügel wurden mächtige Burgzinnen angebracht, und georgianische Säulen schmückten die Eingangshalle. Der Taubenschlag neben dem Haus barg ein Geheimnis. Er wurde als Empfangsstation für geheime Nachrichten der Résistance genutzt. Die Tauben wurden in Käfigen per Fallschirm über Frankreich abgeworfen, von Widerstandskämpfern mit Botschaften versehen und wieder freigelassen.
Unter den Mitarbeitern in Bletchley Park waren viele Naturwissenschaftler und Mathematiker aus den nahe gelegenen Universitäten von Oxford und Cambridge. Der Aufwand, der betrieben wurde, um die deutschen Funkcodes zu brechen, war gigantisch. Die Codebrecher mussten hohe intellektuelle Fähigkeiten besitzen, und gegen Kriegsende arbeiteten hier bis zu 14000 Männer und Frauen. Ihre Aufgabe war es seit 1939, den deutschen Nachrichtenverkehr zu analysieren und die geheimen Verschlüsselungsmethoden der deutschen Wehrmacht, die Codes der Rotor-Schlüsselmaschine ENIGMA, des Siemens-Geheimschreibers und der Lorenz-Schlüsselmaschine zu entziffern. Die ENIGMA ähnelte einer Schreibmaschine mit eingebauter Verschlüsselung. Sie codierte alle Nachrichten durch die jeweils veränderte Stellung mehrerer Zahnräder und so konnte sie bis zu 200 Trilliarden mögliche Kombinationen schaffen. Aus Sicht der Deutschen war dieses System nicht zu knacken. Doch sie irrten sich. Einige der ENIGMA-Maschinen wurden von den Briten erbeutet, außerdem begingen die Deutschen schwere Fehler. Die deutsche Gründlichkeit beim Erstellen von Routinemeldungen war ihr Verhängnis. Jeden Morgen wurden Wetterberichte pünktlich zur gleichen Zeit und vom selben Ort gesendet. Das war eine Steilvorlage für die britischen Codeknacker. Eine täglich frisch verschlüsselte ENIGMA-Meldung, die stets mit den Worten »WETTERVORHERSAGE BEREICH SIEBEN« begann, war ebenso nützlich, wie wenn die Deutschen ihren Feinden direkt den gültigen Tagesschlüssel für die Maschine gegeben hätten. Die Vorarbeiten hatten polnische Wissenschaftler geleistet, doch endgültig brachen die Briten dann die deutschen Verschlüsselungscodes. Denn die britischen Mathematiker Alan Turing und Gordon Welchman reduzierten den Suchaufwand nach dem richtigen Schlüssel drastisch. Sie nutzten elektromechanische Maschinen, die wegen ihres Tickens »Turing-Welchman-Bomben« hießen. Mit einem weiteren Gerät namens »Colossus« konnten sie dann die verschlüsselten deutschen Nachrichten entziffern. »Colossus« gilt als einer der ersten Computer überhaupt.
Der Arbeit der britischen Entschlüsselungsexperten wurde so große Bedeutung beigemessen, dass für sie eine neue Geheimhaltungsstufe entwickelt wurde, die noch über der bisher höchsten Stufe »Streng Geheim« lag. Unter der neuen Bezeichnung »Ultra« konnten ab Januar 1940 zunächst die von der Luftwaffe und später auch die vom Heer mit der ENIGMA 1 verschlüsselten Nachrichten während des gesamten Krieges mitgelesen werden. Es war die reichste Quelle für geheime Informationen, und sie hatte einen immensen Einfluss auf die Strategie der Alliierten. Winston Churchill war sich rückblickend sicher, dass durch »Ultra« der Krieg gewonnen worden war.
Innerhalb des Deutschen Reichs kommunizierte die Abwehr über Landleitungen, die nicht abgehört werden konnten. Aber mit den Büros im Ausland stand das Hauptquartier in Berlin zunächst nur per Funk in Verbindung und sendete und empfing von Hand verschlüsselte Nachrichten im Morsecode. Der erste Einbruch in diese Verschlüsselungstechnik war Bletchley Park im März 1940 gelungen, als die Abwehrstelle in Hamburg Nachrichten an ein deutsches Spionageschiff vor der norwegischen Küste sendete. In Bletchley Park entstand eine neue Abteilung, die von dem erfahrenen Codeknacker Oliver Strachey geleitet wurde. Die entschlüsselten Meldungen wurden ISOS-Meldungen genannt (nach »Intelligence Service Oliver Strachey«). Diejenigen, die Zugang zu dem Material bekamen, bezeichneten sie mit dem ähnlich klingenden englischen Wort »Ice«. Die Eingeweihten galten als »geeist«.4 Ab Oktober 1941 konnten die Briten dann den gesamten Funkverkehr der Abwehr abhören.
Später nutzte die deutsche Abwehr zwischen Berlin und den Büros im neutralen und feindlichen Ausland etwas kompliziertere ENIGMA-Maschinen mit stärkerer Verschlüsselung. Sie sorgten dafür, dass andere deutsche Stellen nicht mitlesen konnten. Doch auch bei dieser Übermittlung gelang Bletchley Park im Dezember 1941 der Durchbruch, und die Codes wurden geknackt. Seit diesem Zeitpunkt war London jederzeit über alle Nachrichten, die von deutschen Agenten und für deutsche Agenten nach Großbritannien geschickt wurden, im Bild. Der britische Inlandsgeheimdienst MI5 und die Kollegen des Auslandsdienstes MI6 erhielten so genaueste Informationen über die Pläne und das Wissen der Abwehr. Jeder einzelne von den Deutschen angeworbene Agent war bekannt und konnte, wenn nötig, von den Briten als Doppelagent angeheuert werden. Über ihre Arbeit durften die Codeknacker von Bletchley Park niemals sprechen. Das ENIGMA-Geheimnis blieb bis in die Siebzigerjahre gut gehütet.
London, April 1942
Die mysteriösen Meldungen von ›Alaric Arabel‹ hatten auch bei den Mitarbeitern des britischen Auslandsgeheimdienstes MI6 für Nervosität gesorgt. Gerüchte machten die Runde, dass es sich um einen deutschen Agenten handeln musste, der es geschafft habe, unbemerkt nach England zu kommen. Andere Mitarbeiter hegten einen anderen Verdacht. In einer ersten Analyse hieß es:
»Das Unwissen über Geografie und militärische Angelegenheiten lässt eine drittklassige Quelle vermuten. Sehen wir wirklich tief unten genug in der Hierarchie nach, beim Personal der spanischen Botschaft? Üblicherweise machen Portiers, Diener und andere solche Fehler.«5
Als an einem nebeligen Morgen im April 1942 der Motorradkurier die neuen entschlüsselten Berichte aus Bletchley Park zum streng geheimen Sitz des MI6 in der Nähe der Abtei von St. Albans in London brachte, waren die Mitarbeiter wie elektrisiert.
»Das hier klingt wirklich sehr merkwürdig«, sagte Tim Milne, der die von den Deutschen abgefangenen Meldungen des vergangenen Tages sortierte. Der Raum war noch eiskalt von der Nacht. Milnes Kollege, Desmond Bristow, hatte erst vor wenigen Augenblicken das Holz im Kamin angezündet.
»Die Abwehr in Madrid berichtet nach Berlin, dass ihr V-Mann ›Alaric Arabel‹ die Zusammenstellung eines Konvois in der Bucht von Caernarfon an der Westküste südlich von Holyhead beobachtet habe.«
»›Alaric Arabel‹?«, fragte Bristow, »dieser Name ist doch schon ein paar Mal in den Meldungen aufgetaucht. Setzen Sie Scotland Yard auf seine Spur. Sie sollen herausfinden, wo sich dieser ›Alaric Arabel‹ aufhält. Wahrscheinlich ist er einer dieser spanischen Matrosen auf einem der Handelsschiffe, die in Liverpool angelegt haben.«
»I-i-ch fra-ge m-mich nur, wie er mm-ii-t den Deutschen k-o-m-m-uniziert«, meldete sich Kim Philby leise stotternd zu Wort. Philby hatte dieses Problem von Geburt an. Er war der Vorgesetzte von Bristow und Milne. Das Stottern, so behauptete er gegenüber seinen Kollegen, hatte ihm in seiner frühen Geheimdienstkarriere einmal das Leben gerettet, als er einen feindlichen Verhörbeamten damit völlig aus dem Konzept brachte und freigelassen wurde. Ob Legende oder Wahrheit, er war für seinen trockenen und leicht verzögerten Humor bekannt. Philby gehörte zur Abteilung V des MI6 und war zuständig für offensive Gegenspionage und verdeckte Operationen in Spanien, Portugal und Gibraltar. Sein Interesse war geweckt. Schließlich bewies die gescheiterte gegnerische Attacke auf den Schiffskonvoi, dass dieser Agent unglaublichen Einfluss auf den Feind besitzen musste. Würde er gefunden und vom britischen Geheimdienst gesteuert werden, könnte er – unter richtiger Anleitung des MI6 und des Inlandsgeheimdienstes MI5 – zu einem strategischen Spieler dieses Krieges werden und die Deutschen dank seiner hohen Glaubwürdigkeit entscheidend täuschen. Die Suche begann sofort.
Der erste Hinweis ließ nicht lange auf sich warten. Am nächsten Morgen telegrafierte der Verbindungsoffizier des MI5 zur britischen Admiralität, Ewen Montagu, an Philby:
»Konvoi. Caernarfon. Existiert nicht.«6
Einige Tage später waren Bristow und Philby noch verblüffter. Die Sondereinheit von Scotland Yard meldete:
»Nach intensiver Suche. Nord-Wales und Liverpool. Negativ zu unserem spanischen Freund ›Arabel‹.«7
Tatsächlich hatten zahlreiche britische Schiffskonvois im März den Hafen von Liverpool verlassen. Doch das Rätselhafte war: Keiner von ihnen stimmte mit der Beschreibung des Agenten überein, und keiner hatte Malta als Ziel. Wer war dieser Agent, der den Deutschen weismachen konnte, dass sich ein solcher Konvoi in Bewegung gesetzt hatte? Wieso hatten sie nicht den geringsten Zweifel, und wo hielt er sich auf? Dass der Konvoi nicht existierte, ließ nur einen Schluss zu: Irgendjemand, dem die deutsche Seite offenbar voll vertraute, tischte ihr Lügen und Phantasiemeldungen auf.
Plötzlich gab es wieder ein Zeichen von ›Alaric Arabel‹. Eine Woche später fing Bletchley Park eine weitere Meldung von ihm ab. Nun war Bristow, ein erfahrener Geheimdienstmann, völlig perplex. Die Fernschreibermeldung trug den gleichen Code wie die vorherige, die von der deutschen Abwehr in Madrid benutzt wurde:
»60: Abwehrstelle 1 Berlin. ›Arabel‹ berichtet: Konvoi fährt weiter in südliche Richtung.«8
»Was ist hier los?«, fragte Bristow und blickte seine Kollegen an. »Wir wissen, dass es keinen verdammten Konvoi gibt. Wer und wo ist ›Alaric Arabel‹, und warum lügt er so unverfroren?«
»Sollen wir nicht auch unsere Büros in Lissabon und Madrid alarmieren?«, fragte Tim Milne.
»Aaa- uuuf kk-keinen Faaa-ll!«, herrschte ihn Kim Philby an.
»Sonst bringen wir sie auf die Spur, dass wir ihre Codes geknackt haben«, sagte Bristow. »›Alaric Arabel‹ existiert nicht, sie wollen uns täuschen und auf eine falsche Fährte locken.«
Der seltsame Agent war den Abhörspezialisten bereits vor einigen Wochen aufgefallen, also bevor er die Meldungen zum Konvoi aus Liverpool übermittelte. Sein Wissen über Großbritannien schien gering zu sein. ›Alaric Arabel‹ kam offensichtlich nicht mit dem britischen Währungssystem zurecht, dem damaligen Prädezimalsystem, und stellte in seinen Berichten an die Deutschen seltsame Berechnungen an. Er schien völlig überfordert zu sein und nicht zu wissen, dass auf der Insel in einem komplizierten System von Pfund, Schillingen und Pennies gerechnet wurde. Damals war ein Pfund 240 Pennies wert und nicht 100 Pennies. ›Alaric Arabel‹ erschloss sich diese Welt des britischen Geldes nicht, und er gab deshalb grundsätzlich alles nur in Schillingen an. Auch in Fragen des lokalen Wetters schien es ihm an Erfahrung zu mangeln. So hatte er einige Wochen zuvor an die Abwehr berichtet:
»Die portugiesische Gesandtschaft ist heute gemeinsam mit den Diplomaten aller anderen Länder, die in London eine Botschaft unterhalten, an die englische Südküste nach Brighton umgezogen. Die Sommer in der britischen Hauptstadt sind einfach unterträglich heiß. Ich folge den Diplomaten jetzt dorthin, um weitere Kenntnisse zu erlangen.«9
Der merkwürdige Spion gab auch an, kürzlich einen seiner Mitagenten nach Glasgow geschickt zu haben. Dort habe dieser mit schottischen Hafenarbeitern gesprochen, um Routen weiterer Schiffskonvois herauszubekommen. Sein abschließendes Urteil über die Arbeiter im größten schottischen Hafen:
»Sie sind sehr geschwätzig gewesen und würden fast alles für einen Liter Rotwein tun.«10
Die Vorstellung, dass schottische Dockarbeiter neuerdings Rotwein trinken würden, sorgte beim MI6 für ungläubiges Staunen. Hier war ein Betrüger am Werk, der, obwohl er haarsträubende Fehler machte, die deutsche Seite zu militärischen Aktionen verleitete und manchmal in seinen Meldungen der Wahrheit nahe kam. Gefährlich nahe, wie die Briten fanden. Fest stand: Je größer seine Lügen waren, umso mehr schienen ihm die Deutschen zu glauben. Doch wo hielt er sich auf? In England? In Schottland? Oder außerhalb des Vereinigten Königreichs? ›Alaric Arabel‹ musste gefunden werden.
Kapitel 2
Die Flucht
Madrid, Januar 1941
Ein gutes Jahr zuvor lag der Januarhimmel tief und grau über der spanischen Hauptstadt, als eine zierliche Frau vor den eisernen Toren der britischen Botschaft am Paseo de la Castellana 259 auftauchte. Sie hatte ein graues Wollkostüm an, die Haare waren hochgesteckt, und um den Hals trug sie als einziges Schmuckstück eine dünne, silberne Kette. In der Empfangshalle verlangte sie, ohne zu zögern, ein vertrauliches Gespräch mit einem der Botschaftsattachés.
»Ihr Name und der Grund?«, fragte der Rezeptionist in einem nur mühsam freundlichen Ton.
»Araceli González«, sagte die Frau. »Es geht um meinen Mann. Es ist vertraulich.« Für eine Fremde war es mehr als schwierig, unangemeldet ein Gespräch mit einem leitenden Botschaftsmitarbeiter zu bekommen. Die Frau wurde vom Empfang ins Zentralsekretariat im ersten Stock geführt, dann weiter zu Botschaftsangestellten der mittleren Ebene. Keiner fand sich bereit, sie länger anzuhören.
»Die Mitarbeiter der Botschaft sind viel zu beschäftigt, um Ihrer Bitte nachzukommen. Wenn Sie uns etwas mitteilen möchten, tun Sie das schriftlich«, sagte einer der Angestellten zu Araceli González. Die britischen Diplomaten hatten strikte Anweisung, alles zu unterlassen, was die spanische Neutralität gefährden könnte. Der britische Botschafter, Sir Samuel Hoare, wollte jede Art geheimdienstlicher Tätigkeit vermeiden, und so wurde Araceli schnell abgespeist.
Enttäuscht verließ sie nach kurzer Zeit die Botschaft und kehrte nach Hause zurück. Dort wartete voller Anspannung der Mann, der sie zu den britischen Diplomaten geschickt hatte: Joan Pujol Garcia. Er war Aracelis Ehemann und hatte beschlossen, auf seine ganz eigene und stille Weise gegen das Dritte Reich zu kämpfen. Seiner Frau hatte er aufgetragen, in der Botschaft herauszufinden, ob die Briten ihn als einen ihrer Spione anheuern würden.11
Pujol war frustriert, als seine Frau berichtete, dass sein reichlich naiver Plan nicht aufgegangen war. Doch seine Enttäuschung wandelte sich rasch in Entschlossenheit.
»Wenn mich die Briten nicht akzeptieren, biete ich mich den Deutschen an. Vielleicht steigen so meine Chancen, doch noch von der britischen Seite angenommen zu werden«, sagte er zu seiner Frau.
Einige Zeit später setzte er seinen Plan um, rief die deutsche Botschaft an und ließ sich zur Abteilung für vertrauliche Angelegenheiten durchstellen. Rasch wurde er an einen ›Herrn Heidelberg‹ weitergeleitet, der sich am Apparat in fließendem Spanisch als Kanzler der Botschaft vorstellte. Pujol konnte nicht wissen, dass ›Heidelbergs‹ richtiger Name Wilhelm Leissner war. Leissner leitete seit 1937 die Abwehrstelle in Madrid.
Die deutschen Geheimdienstoperationen in der spanischen Hauptstadt waren beträchtlich. 87 feste Mitarbeiter der Abwehr waren direkt der deutschen Botschaft am Paseo de la Castellana 4 angegliedert. Hinzu kamen weitere 228 Abwehrmitarbeiter. Die gesamte Zahl von 315 überstieg bei Weitem die der Diplomaten in der Botschaft. Das Abwehr-Büro in Spanien galt als das am besten ausgestattete im Ausland. Zunächst waren alle Abwehrmitarbeiter in der Botschaft untergebracht worden, doch bald wurden sie gezwungen, sich eigene Gebäude zu suchen. Sie mieteten die erstbesten größeren Häuser an, die sie finden konnten. Eines in der Calle de Maria de Molina, das größere Haus in der Calle Claudio Coello, dessen Eingangstore immer weit offen standen. Stets parkten einige deutsche Autos davor. Alles sah sehr heruntergekommen aus.12
Die Abwehr kontrollierte in Spanien rund 1500 Agenten, viele von ihnen waren deutsche Emigranten. Diese wiederum unterhielten ein stetig wachsendes Netzwerk von Unteragenten. »Alle Schichten und Klassen sind darin zu finden – von Ministern mit Kabinettsrang bis zu unbekannten Schiffskellnern«, hieß es dazu in einem britischen Geheimdienstbericht. »In den höheren Schichten gibt es ohne Zweifel echte ideologische Überzeugungen, in den unteren Schichten ist die Gier bestimmendes Motiv. In einem Land, in dem so viele kurz vor dem Verhungern stehen, ist die Rekrutierung sehr einfach.«13
Der Leiter der Abwehr in Spanien, Wilhelm Leissner, war von seinem ehemaligen Marinekameraden, Admiral Wilhelm Canaris, dem Chef der deutschen Abwehr, auf diesen Posten gehoben worden. Direkt nach dem Ersten Weltkrieg war Leissner nach Nicaragua emigriert und hatte dort ein kleines Verlagshaus eröffnet. Doch mit Ausbruch des spanischen Bürgerkriegs überredete Canaris ihn, als sein persönlicher Vertreter nach Spanien zu gehen. Zunächst kümmerte sich Leissner um das Büro der Abwehr im südspanischen Algeciras, später lenkte er dann alle geheimdienstlichen Arbeiten in Spanien, unter anderem setzte er ein neuartiges Überwachungssystem mit Infrarot-Strahlen ein, um die Straße von Gibraltar besser kontrollieren zu können. Leissners Agentennetz sammelte so viele Informationen, dass 34 Funker und zehn Sekretärinnen für die Verschlüsselung gebraucht wurden. Madrid produzierte Berge von Nachrichtenmaterial, sodass neue Meldungen stündlich an eine Empfangsstation bei Wiesbaden gefunkt wurden und seit 1940 eine direkte Fernschreiberverbindung mit Berlin über Paris bestand. Im Ausland gliederte sich die Abwehr in sogenannte Kriegsorganisationen (KO). Die KO-Spanien bestand aus einem zentralen Büro und drei Abteilungen. Abteilung 1 war für Spionage zuständig. Abteilung 2 kümmerte sich um Sabotage und arbeitete gegen die Interessen der Alliierten in Spanien. Abteilung 3 konzentrierte sich auf Spionageabwehr und Desinformation. Diese Abteilung, die Oberstleutnant Eberhard Kiekebusch leitete, war wiederum in sieben Referate gegliedert, eines davon kümmerte sich um potenzielle neue Agenten, die ins Ausland geschickt werden sollten.
Am Telefon erklärte Joan Pujol seinem Gesprächspartner ›Heidelberg‹ alias Leissner, dass er für das »Neue Europa« arbeiten wolle und für die Deutschen alles tun würde, was für sie nützlich sein könnte. Er schlug vor, in Lissabon tätig zu werden oder, falls die Abwehr seine Reise nach England organisieren könnte, auch dort als Informant zu arbeiten. Leissner reagierte schroff und hielt das Telefonat kurz. Aber wenige Tage darauf meldete er sich wieder. Pujol wurde mitgeteilt, dass es für die Deutschen nicht interessant sei, wenn er nach Lissabon ginge. Grundsätzlich aber habe die Abwehr Interesse, wenn er es auf eigene Faust schaffen könne, nach England zu reisen.
»Wie Sie dort hingelangen und welche Tarnung Sie sich geben, ist Ihre Sache. Wir werden keine Vorschläge machen. Versuchen Sie in Lissabon ein Visum für Großbritannien zu bekommen«, sagte Leissner dem aufmerksam zuhörenden Pujol. Er wollte ihn auf die Probe stellen.
»Sie werden heute Abend Besuch von einem Mann namens ›Emilio‹ erhalten.« Dann hängte Leissner auf.
Einige Stunden später klingelte ein Mann an Pujols Tür. Er hatte dunkle Augen und dunkles Haar und trug einen Schnurrbart.14 Er sieht aus wie ein Spanier, dachte sich Pujol, als er dem Mann in die Augen blickte und dieser sich als ›Emilio‹ vorstellte. In Wahrheit handelte es sich um Georg Helmut Lang aus Heilbronn, der für die Abwehr arbeitete. Pujol erzählte ihm eine verwirrend lange und frei erfundene Geschichte über ein mögliches illegales Devisengeschäft in London, von dem er erfahren habe und das riesige Gewinne versprach. Insgesamt gehe es um fünf Millionen Peseten, die in britische Pfund getauscht werden sollten.
»Alles was ich von Ihnen brauche, ist ein Visum für Großbritannien. Können Sie mir dabei helfen?«, fragte er und schaute ›Emilio‹ dabei in die Augen.
»Das ist doch viel zu kompliziert und total absurd. Versuchen Sie, als Korrespondent einer spanischen Zeitung nach England zu kommen. Die Ausreise über Lissabon ist am unverdächtigsten.«
Der Deutsche gab Pujol 1000 Peseten und verließ rasch die Wohnung.
Lissabon, 26. April 1941
Pujol hatte nicht lange überlegt und sich auf den Weg von Madrid nach Lissabon gemacht. Sofort nach seiner Ankunft rief er die britische Botschaft an und beantragte formal ein Visum für Großbritannien. Dies tat er auch, um ein Alibi zu haben, falls ihn die Deutschen beobachten sollten.
Sein eigentlicher Plan war deutlich riskanter. Pujol versuchte, ein spanisches Diplomatenvisum zu fälschen. Durch Zufall war es ihm gelungen, das echte Dokument eines Geschäftsmannes abzufotografieren. Damit ging er in eine Druckerei, gab sich als Mitarbeiter der spanischen Botschaft aus und ließ sich 200 Blankobögen mit dem spanischen Staatswappen drucken.15 Auf einem der Bögen befestigte er sein Passfoto und trug seinen Namen als Inhaber ein. Sein neues Visum war fertig. Zufrieden kehrte er nach Madrid zurück und rief in der deutschen Botschaft an.
›Emilio‹, so erklärte ihm ein Mitarbeiter der Botschaft, könne ihn nicht treffen. Stattdessen solle sich Pujol in das Café Negresco in der Calle de Alcalá aufmachen. Dort werde ein anderer Kontaktmann mit dem Namen ›Federico‹ auf ihn warten.
Als Pujol in das Café hineinging, saß an einem der Tische ein junger Mann mit dunklem, leicht gewelltem Haar, der ihn bereits beim Betreten des Cafés ausführlich gemustert hatte. ›Federico‹ hatte »eine gerade Nase«, er »trug ein mächtiges silbernes Armband« und »einen Ring am Mittelfinger, den er ständig drehte«.16 Beide stellten sich einander vor, das Gespräch lief schleppend. Pujol gab sich als glühender Anhänger der Nationalsozialisten aus, ›Federico‹ zeigte sich nicht allzu interessiert, blies den Rauch seiner filterlosen Zigarette senkrecht in die Luft, und immer wieder schweifte sein Blick abseits und hinüber zur Bar. Aber Pujol spürte, dass der Deutsche seine Ideen auch nicht völlig ablehnte.
›Federico‹ alias Friedrich Knappe-Rathey wurde als jüngstes von sechs Kindern am 20. März 1914 in Madrid geboren und besaß einen deutschen Pass. In vielerlei Hinsicht war er unter den deutschen Agenten eine Ausnahme. Seine Familie war schon vor langer Zeit von Deutschland nach Madrid ausgewandert. Ursprünglich hatte er vorgehabt, Agraringenieur zu werden und nach Guinea auszuwandern. Sein Vater, Carlos Knappe, hatte seit 1896 Elektrogeräte importiert und verkaufte in Spanien die ersten Elektroherde und Röntgengeräte. Als erfolgreicher Geschäftsmann gewann Carlos Knappe Einfluss in Wirtschaft und Politik, auf seiner Finca waren viele bekannte Persönlichkeiten zu Gast, darunter der spanische General und Diktator Miguel Primo de Rivera und der spanische König Alfonso XIII. Ein regelmäßiger Besucher stammte aus Deutschland, es war der künftige Chef der Abwehr, Admiral Wilhelm Canaris.
Im Zuge des spanischen Bürgerkriegs kehrten die Knappes nach Deutschland zurück. Nur Friedrich blieb in Spanien, führte die Geschäfte des elterlichen Betriebs bis 1937 weiter, folgte aber kurze Zeit später seiner Familie. Dann zog es ihn zurück nach Spanien, als Funker der Legion Condor.
Die Legion Condor war eine verdeckt operierende Einheit der deutschen Wehrmacht, die 1936 gegründet worden war und an allen bedeutenden Kämpfen im spanischen Bürgerkrieg beteiligt gewesen war. Sie hatte einen beträchtlichen Anteil daran, dass die Putschisten unter General Franco Spaniens demokratisch gewählte Regierung besiegt hatten. Bis heute gilt die völkerrechtswidrige Bombardierung und Zerstörung der Stadt Guernica durch die Legion Condor, die weltweites Entsetzen ausgelöst hatte, als eines der dunkelsten Kapitel in der Geschichte des spanischen Bürgerkriegs.
Nach seinen Einsätzen für die Legion Condor erhielt Knappe-Rathey von Wilhelm Canaris das Angebot, als Agent für die Abwehr in Madrid zu arbeiten. Eine seiner ersten Aktionen bestand darin, zwei Funkgeräte zu installieren, von denen eines in seiner eigenen Wohnung in der Calle Viriato 73 stand, ein anderes im Stadtteil Cuatro Caminos. Er wurde einer der führenden Mitarbeiter von Karl-Erich Kühlenthal, der eines der wichtigsten Referate der Abwehr in Madrid leitete, das »Referat für Vertrauensmänner«, das Agenten für den Einsatz im Ausland anwarb. Knappe-Rathey und Kühlenthal hatten einiges gemeinsam. Beide hatten in der Legion Condor gedient, beide besaßen enge Verbindungen zum Chef der Abwehr, Wilhelm Canaris.
Mit 35 Jahren stand Kühlenthal im Rang eines Sonderführers. Dafür hatte Admiral Wilhelm Canaris persönlich gesorgt und mit dieser Beförderung Kühlenthals unter seinen Kameraden in der Abwehr »großes Erstaunen verursacht«.17 Kühlenthal operierte unter dem Namen ›Don Carlos‹ oder als ›Felipe‹, manchmal war er in den Madrider Bars und Cafés auch als ›Don Pablo‹ unterwegs. Den gegnerischen Geheimdiensten war Kühlenthal bekannt, weil er und seine engsten Mitarbeiter Georg Helmut Lang und Friedrich Knappe-Rathey im neutralen Spanien Agenten anheuerten, um sie dann ins Ausland zu schicken: nach Nordafrika, Portugal, Gibraltar und vor allem nach Großbritannien und in die Vereinigten Staaten. Das sogenannte ›Felipe-Netzwerk‹ umfasste Dutzende von Geheimagenten, die äußerst detaillierte Berichte zurückschickten. Kühlenthal galt als sehr vorsichtig und misstrauisch, er versuchte zu jeder Zeit, alle Fäden in der Hand zu behalten. »Seine Untergebenen konnten ihm zu keiner Zeit trauen«, hieß es in einem internen Bericht.18 »Nichts passierte in der Abwehrstation in Madrid, ohne dass er davon wusste«, erinnerte sich einer seiner Mitarbeiter.19
Alle Agenten Kühlenthals wurden übrigens meist unmittelbar nach ihrer Ankunft in Großbritannien von der gegnerischen Seite enttarnt. Entweder wurden sie sofort hingerichtet oder dazu gezwungen, als Doppelagenten zu arbeiten.
Mit seiner Erscheinung fiel Kühlenthal in den Straßen von Madrid auf. »Breitschultrig und sehr dünn«, trug er seine Haare zurückgekämmt, er hatte »fleischige, knochenlose Wangen« und »stechende, blaue Augen«. Seine Finger waren immer »sorgfältig manikürt«, er wirkte auf einige der gegnerischen Agenten, die ihn Tag und Nacht observierten, »eher unmännlich«. Er trug »gut geschnittene, doppelreihige Anzüge« und fuhr als Auto ein »dunkelbraunes, französisches Coupé mit vier Sitzen, dessen Nummernschilder er häufig wechselt«. Abends war er »mit einem dunklen deutschen Wagen unterwegs«. Die Leidenschaft für beide Autos mache es sehr leicht, ihm stets überallhin folgen zu können, notierten britische Agenten. Er galt außerdem als »sehr guter Tennisspieler« und bat einen seiner Agenten in Großbritannien »für ihn in England einen neuen Tennisschläger zu besorgen«.20
Kühlenthal wurde am 10. März 1908 in Koblenz als erstes Kind des Offiziers und späteren Generals Erich Kühlenthal geboren. Seine Mutter Josefine, geborene Wegeler, war eine Tochter von Carl Clemens Wegeler, dem Mitinhaber der Sektkellerei Deinhard in Koblenz. Kühlenthal zeichnete sich früh durch seine Sprachbegabung aus und zeigte auch großes Interesse an politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Entwicklungen auf internationaler Ebene. Das alles wurde gefördert durch sein Elternhaus und dessen nationale und internationale Verbindungen. Seine Eltern sprachen Englisch und Französisch, und das passte zu seinen beruflichen Zielen, die von seiner Mutter sehr unterstützt wurden. Kühlenthal sollte sich umfassend auf eine spätere Führungsaufgabe im internationalen Geschäft der Sektkellerei Deinhard vorbereiten. Er absolvierte nach seinem Abitur eine Lehre als Import- und Exportkaufmann in Hamburg. Nach dieser Ausbildung arbeitete er zunächst ein Jahr in der Londoner Niederlassung von Deinhard. In seiner Zeit in der britischen Hauptstadt lernte er viel über die Mentalität der Briten und übernahm die britischste Eigenart schlechthin: Er wurde auf der Insel zu einem großen Liebhaber des Nationalgetränks. Für sein Leben gern trank er Tee und kannte alle Sorten. Sein weiterer Berufsweg führte ihn anschließend zu einem großen Importunternehmen nach Barcelona. Er sah im Medium Hörfunk eine große Geschäftschance und spezialisierte sich in der Folge auf den inländischen Handel und den Import von Radiogeräten. Mitte der Dreißigerjahre hatte er es zu einem erfolgreichen und angesehenen Geschäftsmann in Madrid gebracht. Er hatte Grundbesitz erworben und sich weiteres Vermögen erarbeitet. Kühlenthal besaß aufgrund seiner geschäftlichen und gesellschaftlichen Kontakte gute Verbindungen zu vielen Menschen in Spanien, zu Verwaltung und Politik und auch zu anderen ausländischen Geschäftsleuten, besonders natürlich zu deutschen und schweizerischen. Spanien und die Mentalität der Menschen kannte er sehr genau. Er sprach perfekt Spanisch und Englisch und auch ein gutes Französisch. Schon deshalb war er ein Wunschkandidat für die Abwehr, die dringend geeignete Mitarbeiter in Spanien und Portugal suchte.21
Von den Wirren des spanischen Bürgerkriegs war auch Kühlenthal betroffen gewesen. Er hatte Teile seines Vermögens in dieser Zeit verloren. 1938 war er in Spanien Mitglied der deutschen Legion Condor geworden und beim Leiter der geheimdienstlichen Abteilung, Joachim Rohleder, tätig.22 Als Mitarbeiter der Abwehr wurde Karl-Erich Kühlenthal in einem britischen Geheimdienstdossier beschrieben als »sehr effizienter, ambitionierter und äußerst gefährlicher Mann, der enorme Leistungen erbringen kann«.23 Kühlenthal hatte sechs Mitarbeiter. Sein Büroleiter war Unteroffizier Wilhelm Knittel, der Gefreite Zierath arbeitete als Übersetzer; unter dem Tarnnamen ›Federico‹ führte Friedrich Knappe-Rathey die angeworbenen Agenten, zusammen mit dem Gefreiten Georg Helmut Lang alias ›Emilio‹. Fräulein Heinsohn war die Sekretärin, und als Sachbearbeiterin war Fräulein Mann tätig, die mit den Agenten korrespondierte und dafür verantwortlich war, die mit unsichtbarer Tinte geschriebenen Botschaften der Agenten zu entwickeln. Die Abwehr unterhielt in Madrid eine »Abteilung für Spezialunterlagen«, die vom Chemiker Dr. Künkele geleitet wurde. Er arbeitete in einem gut ausgerüsteten Labor und stellte die unterschiedlichen Geheimtinten her, mit denen die deutschen Agenten meist kommunizierten.
Eine der Hauptaufgaben von Friedrich Knappe-Rathey bestand darin, im Auftrag seines Vorgesetzten Kühlenthal neue Agenten für Einsätze im Ausland anzuwerben und diese auszubilden. Er zeigte ihnen, wie sie die Funkgeräte zu bedienen hatten und wie sie per Geheimcode mit der Abwehr in Kontakt treten sollten.24 Bevor das geschah, wollte die Abwehr in vielen Gesprächen möglichst genau die Motive und Kontakte der künftigen Agenten in Erfahrung bringen. Knappe-Rathey tat dies akribisch. Als ›Federico‹ benutzte er mehrere Tarnadressen der Abwehr; zum Beispiel traf er sich oft mit Agenten in einer kleinen Elektrikfirma, der Sanitas Electricidad in der Calle de Ayalá 53.25
In den nächsten Wochen kam es zu einem guten Dutzend Treffen zwischen ›Federico‹ und Pujol. »Ich besuchte so viele Cafés in dieser Zeit wie nie mehr in meinem ganzen weiteren Leben«, erinnerte sich Pujol später.26 ›Federico‹ gab sich während der vielen Treffen betont desinteressiert. Das änderte sich auf einen Schlag, als Pujol ihm von seinen angeblichen Kontakten zur spanischen Sicherheitspolizei und zum Außenministerium erzählte. Besonders hellhörig wurde ›Federico‹, als Pujol ihm eher beiläufig erzählte, dass ihn die Sicherheitspolizei als Honorarattaché an die spanische Botschaft nach London schicken wolle.
»Hier, sehen Sie. Die Dokumente sind bereits ausgestellt.« Pujol blickte sich um, ob niemand sie beobachtete, und faltete unter dem Tisch ein Blatt Papier auf. Es war das von ihm präparierte Dokument, auf dem das spanische Staatswappen prangte und das er ›Federico‹ jetzt für einen kurzen Moment zeigte. Schnell faltete er es wieder zusammen und steckte es in seine Tasche. Pujols Fälschung hatte auf ›Federico‹ den gewünschten Effekt.
»Sie sind ein guter Mann«, sagte ›Federico‹ und klopfte ihm auf die Schulter.
»Der Weg nach England ist jetzt frei für mich. Aber verraten Sie bitte nichts, denn sonst werde ich bei der Arbeit für Sie auffliegen«, sagte Pujol und schaute den Deutschen eindringlich an. Knappe-Rathey nickte.
»Verschieben Sie bitte Ihre Abreise nach England um ein paar Tage. Ich muss noch mit Berlin über Ihren Fall beraten.«
Einige Tage später, bei einem erneuten Treffen, spürte Pujol, dass Knappe-Rathey zunehmend nervöser wirkte. Dann ging alles ganz rasch. Zum nächsten Treffen brachte ›Federico‹ Pujol eine auf Mikrofotografien übertragene lange Liste und Fragebögen mit möglichen Spionagezielen und Aufgaben in Großbritannien mit, dazu eine Flasche mit unsichtbarer Tinte, eine Tabelle mit Chiffriercodes, eine Liste mit Tarnadressen in Lissabon, an die Pujol seine Botschaften schicken sollte, und ein Geldbündel mit 3000 US-Dollar.
»Ich beneide Sie um diesen Auftrag in Großbritannien. Es wird auch nicht gefährlich werden. Es geht nur darum, dass Sie als Beobachter Informationen für uns sammeln«, erklärte ›Federico‹ und versuchte dabei möglichst optimistisch auszusehen.
In den Folgetagen brachte der deutsche Agentenführer Pujol noch in einem Crash-Kurs bei, wie er Briefe mit Geheimtinte schreiben und damit zwischen die normalen Zeilen seine geheimen Botschaften platzieren sollte. Diese konnten dann mit einer Entwicklungsflüssigkeit sichtbar gemacht werden. Am letzten Treffen vor Pujols Abschied nahm auch ›Federicos‹ Vorgesetzter teil, Sonderführer Karl-Erich Kühlenthal.27
»In England versuchen Sie, so viele Informationen wie möglich zu sammeln. Unterschätzen Sie die Briten nicht. Sie sind starke Gegner«, warnte Kühlenthal und gab Pujol mit auf den Weg: »Dieser Krieg wird noch lange dauern, die Fragebögen sind nur ein Anhaltspunkt, wir sind an allem interessiert, was Sie herausfinden.«28 Vor allem wollte die Abwehr wissen, wo die meisten Soldaten auf der Insel stationiert waren, wo sich Flugplätze befanden und wie die Gegner ausgerüstet waren.
»Wenn Sie in London eintreffen, nehmen Sie Kontakt mit dem Korrespondenten der spanischen Zeitung ABC auf, Luís Calvo. Er ist einer unserer fest etablierten Informanten«, fügte Knappe-Rathey hinzu und übergab Pujol noch eine in Deutschland hergestellte Landkarte von Großbritannien.
»Ich hoffe, Sie geben meinen Namen nicht so schnell preis wie gerade den Calvos. Danke für das Angebot, aber ich arbeite lieber allein. Sie können ja anhand der Ergebnisse beurteilen, welcher Ihrer Agenten der Beste sein wird«, antwortete Pujol, der gute Gründe hatte, diesen Ratschlag sofort abzulehnen.29 Dann verabschiedeten ›Federico‹ und ›Don Carlos‹ ihren neu rekrutierten Agenten in Richtung London. Das glaubten sie jedenfalls.
Ihren neuen Spion führten sie als »Vertrauensmann 319« und gaben ihm den Tarnnamen ›Alaric Arabel‹. Seinen Vornamen ›Alaric‹ hatte er nach dem König der Westgoten, Alarich I., erhalten, dem germanischen Herrscher, der im Jahr 410 Rom eingenommen hatte. Seinen Nachnamen ›Arabel‹ trug Pujol zu Ehren seiner Frau Araceli. Auch die Abwehrleute waren von Pujols Frau und ihrer Schönheit gleich hingerissen, als sie sie kurz gesehen hatten. Sie nannten sie wegen ihrer feinen Gesichtszüge und ihrer dunklen Augen ›Araceli bella‹ und ihren Mann fortan ›Alaric Arabel‹.
Pujol steckte in einem Dilemma. Er wusste, dass er nicht länger in Spanien bleiben konnte. Zunächst hatte er überlegt, mit der Geheimtinte und den erbeuteten Chiffriercodes direkt zur britischen Botschaft zu gehen und den Briten so zu zeigen, wie falsch es von ihnen gewesen war, sein Angebot, für sie zu spionieren, abzuweisen. Doch wie konnte er sicher sein, dass die Deutschen nicht einen Informanten in der britischen Botschaft untergebracht hatten? Was, wenn die Deutschen merkten, dass er in Madrid geblieben war und sich nicht auf dem Weg nach London befand? Pujol beschloss, sofort aus der Stadt zu fliehen.
Lissabon, Juli 1941
Nichts konnte sie mehr aufhalten am Morgen des 12. Juli 1941. Hals über Kopf machten sich Joan Pujol, Araceli und ihr kleiner Sohn Joan Fernando auf den Weg nach Portugal. Die 3000 US-Dollar, die Pujol von ›Federico‹ erhalten hatte, rollte er zu einem festen Bündel und packte sie in eine Gummihülle. Dann öffnete er eine Zahnpastatube am hinteren Ende, drückte die Hälfte der Zahnpasta heraus, führte die Hülle ein und verschloss die Tube wieder. Sie war zu klein für alle Scheine, den Rest stopfte er in seine Rasiercremetube. Ohne kontrolliert zu werden, passierten die drei den Grenzposten bei Fuentes de Onoro. Zuerst mieteten sie ein Zimmer bei einem Fischer in Cascais, später zogen sie in das Seebad Estoril, 25 Kilometer westlich von Lissabon, blieben dort immer in Bewegung und darauf bedacht, nicht zu viele Spuren zu hinterlassen.
Ende der Leseprobe