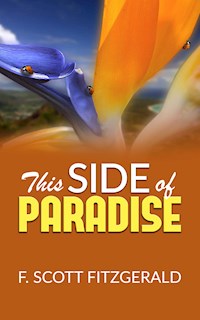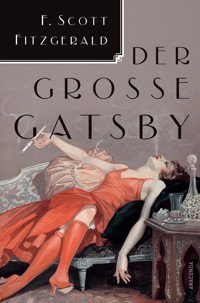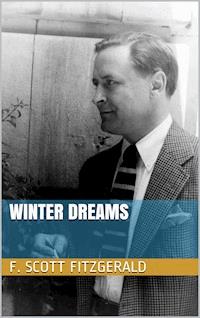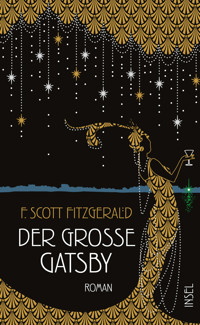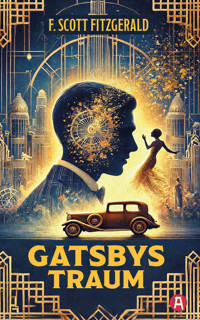
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: aionas
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Glanz, Ruhm, Reichtum – und der tiefe Fall danach. In kaum einem Werk wird die Illusion des Erfolgs so meisterhaft entlarvt wie in F. Scott Fitzgeralds Kurzgeschichten. Sein Roman Der große Gatsby ist längst ein Klassiker, doch auch in seinen Erzählungen spiegelt sich die verführerische, aber zerstörerische Welt des amerikanischen Traums. In diesem ersten Band „Gatsbys Traum“ vereinen sich elf seiner besten Kurzgeschichten – Geschichten über den Höhenflug und den unausweichlichen Absturz.
Der große Gatsby im Kurzformat – Aufstieg, Illusion und Verlust
Fitzgeralds Figuren sind Getriebene: Männer und Frauen, die nach Erfolg streben, dem süßen Gift des Wohlstands erliegen und erkennen müssen, dass Glück nicht mit Geld erkauft werden kann. In „Babylon Revisited“, einer seiner berühmtesten Erzählungen, kehrt ein ehemals reicher Lebemann nach Paris zurück, um seine Tochter zurückzugewinnen – doch die Schatten der Vergangenheit lassen ihn nicht los. „Der reiche Junge“ zeigt, dass Privilegien oft mehr entfremden als verbinden, während „Das verlorene Jahrzehnt“ von der bitteren Erkenntnis erzählt, dass Exzess und Vergessen untrennbar miteinander verbunden sind.
Mit scharfem Blick für die Trugbilder des gesellschaftlichen Aufstiegs schildert Fitzgerald die Faszination des Erfolgs – und seinen wahren Preis. „Der Diamant so groß wie das Ritz“ ist eine groteske Parabel über eine Familie, die auf einem Berg aus Diamanten lebt – ein absurdes Symbol für unermesslichen Reichtum, der niemandem etwas nützt. In „Drei Stunden zwischen zwei Flügen“ erfährt ein Mann auf einer Zwischenstation, dass das Leben weitermarschiert, ob er es begreift oder nicht.
11 meisterhafte Erzählkunst – ein unverzichtbarer Klassiker
Mit eleganter Sprache, poetischer Tiefe und scharfer Ironie zeichnet Fitzgerald das Bild einer Welt, in der sich alles um Erfolg dreht – und die wenig Platz für echte Erfüllung lässt. Seine Kurzgeschichten sind Momentaufnahmen einer Ära, die noch immer nachhallt. Gatsbys Traum – Aufstieg und Absturz ist der erste Band einer exklusiven dreiteiligen Sammlung, die Fitzgeralds beste Kurzgeschichten thematisch ordnet.
Wer Der große Gatsby liebt, wird in diesen Erzählungen die gleiche Mischung aus Sehnsucht, Glanz und unausweichlicher Ernüchterung finden. Tauchen Sie ein in die Welt von Fitzgerald – eine Welt voller Träume, die funkeln wie Champagner im Kerzenlicht, aber oft nur einen Moment lang halten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
F. Scott Fitzgerald
Gatsbys Traum
Die besten Kurzgeschichten(Band1)
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß §44b UrhG („Text und Data Mining“) zu gewinnen, ist untersagt.
F. Scott Fitzgerald
Gatsbys Traum – Die besten Kurzgeschichten (Band 1)
Übersetzung: Alexander Varell
Covergestaltung: Karl A. Fiedler
Aionas Verlag, Böhlaustr. 9, 99423 Weimar
1. Auflage, 2025
ISBN Printausgabe: 978-3-96545-054-7ISBN eBook: 978-3-96545-087-5
VorwortDer Traum, der zerbricht
Wenn es darum geht, die fieberhafte Energie der Roaring Twenties – der wilden 20er, die Eleganz der Dekadenz und die zerbrechlichen Träume seiner Figuren einzufangen, gibt es wenige Schriftsteller, die dies mit der gleichen Leichtigkeit, Poesie und messerscharfen Ironie vermochten wie F. Scott Fitzgerald.
Bekannt für seinen Roman „Der große Gatsby“, war Fitzgerald auch ein brillanter Meister der Kurzgeschichte – einer literarischen Form, die in den 1920er Jahren eine goldene Ära erlebte. Die knappe, pointierte Erzählweise passte perfekt zu einer Epoche, die von Geschwindigkeit, Exzess und ständiger Neuerfindung geprägt war. „Kein Autor hat je die Essenz des Jazz-Zeitalters so vollkommen eingefangen,“ schrieb Dorothy Parker, selbst eine scharfzüngige Beobachterin dieser Ära. Hemingway, der seine Rivalität mit Fitzgerald nur ungern zugab, bemerkte: „Sein Talent war so natürlich wie das Muster, das der Staub auf einem Schmetterlingsflügel bildet.“
Fitzgeralds Kurzgeschichten zeigen eine außergewöhnliche Bandbreite an Themen und Stimmungen: Sie sind mal verspielt, mal melancholisch, oft ironisch und immer scharf beobachtet. Vor allem aber beschäftigen sie sich mit den Versuchungen und Illusionen des „American Dream“, jenem verführerischen Versprechen, dass alles möglich ist – wenn man nur genug will.
Gatsbys Traum und die Illusion des Erfolgs
Dieser Band vereint elf Kurzgeschichten, die sich um dieselben zeitlosen Themen drehen, die auch „Der große Gatsby“ durchweben. Sie erzählen von Männern und Frauen, die sich mit unbändiger Sehnsucht nach Reichtum und Erfolg verzehren, als wäre der soziale Aufstieg die einzig wahre Erlösung. Ihre Träume, oft kühn und glänzend, scheinen zum Greifen nah – eine Einladung, sich das ersehnte Leben einfach zu nehmen. Doch was so verheißungsvoll funkelt, entgleitet ihnen immer wieder, als sei es aus Licht und Nebel gemacht. Der Glanz der High Society ist verführerisch, betört mit ihrer Opulenz, ihren rauschenden Festen, ihren verspielten Konventionen, die für Eingeweihte kaum noch Regeln folgen. Und doch, sobald der Champagner verflogen ist und die Musik verstummt, bleibt oft nichts als eine kühle, fremde Leere. Hinter der glitzernden Fassade dieser Welt verbirgt sich eine bittere Wahrheit: Erfolg ist trügerisch, Liebe ein Tauschgeschäft, Glück eine vergängliche Währung. Wer in diese Gesellschaft eintreten will, zahlt oft mit seiner Seele.
Fitzgeralds Kurzgeschichten sind Momentaufnahmen dieser glänzenden, aber brüchigen Welt, in der Menschen zwischen Hoffnung und Ernüchterung taumeln. In ihnen entfaltet sich das Drama des Aufstiegs und Absturzes, das Streben nach einem Leben, das immer wieder entgleitet. Mal melancholisch, mal satirisch, oft mit scharfem Blick für die Selbsttäuschungen seiner Figuren, entwirft Fitzgerald Porträts von Träumern und Getriebenen, von Glücksrittern und Verlorenen. Die folgenden elf Erzählungen spiegeln die Facetten dieses ewigen Spiels aus Ehrgeiz, Illusion und Niedergang wider – jede auf ihre eigene Weise ein Echo jenes großen Traums, der für Gatsby und so viele andere unerreichbar blieb.
„Der Diamant so groß wie das Ritz“ ist eine überhöhte Satire über Reichtum in seiner extremsten Form. Ein junger Mann wird von einem Schulfreund in dessen Familienanwesen eingeladen – ein Ort von so unerhörtem Reichtum, dass er buchstäblich auf einem riesigen Diamanten erbaut wurde. Doch wer diesen luxuriösen Palast einmal betritt, darf ihn nie wieder verlassen. Fitzgerald entwirft hier eine groteske Fantasie über unermesslichen Wohlstand, die gleichzeitig als bitterer Kommentar zur amerikanischen Elite gelesen werden kann. Wie Gatsby, der sich durch seinen Reichtum eine Welt geschaffen hat, die ihn von der Realität abkapselt, zeigt diese Geschichte, dass Reichtum nicht nur Macht bedeutet, sondern auch Isolation und moralische Verkommenheit.
„Der reiche Junge“ erzählt von Anson Hunter, einem jungen Mann, der mit allem aufgewachsen ist, was Geld kaufen kann – und dennoch emotional unerreichbar bleibt. Fitzgerald beschreibt in dieser Geschichte das Paradox des Wohlstands: Wer nie kämpfen musste, um etwas zu erlangen, entwickelt oft eine tiefsitzende Distanz zum Leben und zu den Menschen. Wie Tom Buchanan in „Der große Gatsby“ zeigt Anson, dass Reichtum nicht vor Einsamkeit schützt – im Gegenteil, er kann eine Mauer zwischen dem Individuum und der wahren Erfahrung des Lebens errichten.
„Das Hotelkind“ wirft einen ungewöhnlichen Blick auf die High Society: Es erzählt von einem Mädchen, das in Luxushotels aufwuchs und nie eine feste Heimat hatte. Zwischen Koffern und Butlern, zwischen Etikette und oberflächlicher Eleganz, stellt sich die Frage: Was bleibt einem Menschen, wenn alles, was ihn umgibt, nur temporär ist? Wie Gatsby, der seinen Wohlstand nutzt, um sich eine Welt zu erschaffen, die auf Sand gebaut ist, muss die Hauptfigur dieser Geschichte erkennen, dass wahre Zugehörigkeit mehr bedeutet als nur äußerer Glanz.
In „Babylon revisited“ kehrt Charlie Wales, einst ein wohlhabender Amerikaner in Paris, zurück in die Stadt, die er in seinen wildesten Jahren regierte. Doch das Paris der rauschenden Nächte, das er kannte, existiert nicht mehr – genau wie das Leben, das er einst führte. Er möchte seine Tochter zurückgewinnen, doch die Vergangenheit haftet an ihm wie ein Schatten. Seine Exzesse haben Spuren hinterlassen, und die Welt der „neuen Reichen“, die ihn einst feierte, ist für ihn verloren. Fitzgeralds vielleicht berühmteste Kurzgeschichte ist eine tief melancholische Reflexion über Schuld, Vergebung und den Preis, den man zahlt, wenn man zu spät erkennt, was wirklich zählt. Wie Gatsby hofft Charlie, die Vergangenheit in der Gegenwart wiederherzustellen – und wie Gatsby scheitert er daran.
„Bernice schneidet sich die Haare“ ist eine spielerische, aber scharf beobachtete Satire auf gesellschaftliche Erwartungen. Bernice, ein schüchternes, angepasstes Mädchen aus der Provinz, wird in die Welt der mondänen Gesellschaft eingeführt. Doch als sie sich wandelt, um in dieser Welt zu bestehen, nimmt ihre Geschichte eine unerwartete Wendung. Fitzgerald spielt hier mit den Motiven von Anpassung und Selbstbehauptung, die auch in „Der große Gatsby“ eine Rolle spielen: Wer sich verändert, um in eine Welt hineinzupassen, verliert manchmal genau das, was ihn einzigartig gemacht hat.
„Eine Auslandsreise“ ist eine subtile Erzählung über Entfremdung, Identität und den vergeblichen Versuch, durch Ortswechsel ein erfüllteres Leben zu finden. Nicole und Nelson Kelly, ein junges Ehepaar, reisen durch Nordafrika und Europa, getragen von der Illusion, dass ihr Glück und ihre Liebe unerschütterlich seien. Doch in der Begegnung mit der internationalen High Society, zwischen rauschenden Nächten und schillernden Fassaden, beginnt sich ihre Beziehung leise aufzulösen. Je weiter sie sich von ihrer Heimat entfernen, desto deutlicher wird, dass es nicht die Welt um sie herum ist, die sich ändern muss, sondern sie selbst. Wie Gatsby, der glaubt, die Vergangenheit mit Daisy wiederbeleben zu können, klammern sich die Kellys an die Vorstellung, dass ein anderes Leben an einem anderen Ort ihre Probleme lösen könnte. Doch am Ende bleibt nur die Erkenntnis, dass Flucht keine Rettung ist – und dass manche Entfremdung unumkehrbar ist.
In „Drei Stunden zwischen zwei Flügen“ verbringt ein Mann eine kurze Zeit in einer Stadt, die ihm einst viel bedeutete, und wird von Erinnerungen an frühere Lieben und verpasste Chancen überrollt. In dieser Geschichte, die von der Flüchtigkeit der Zeit und der Vergänglichkeit von Beziehungen handelt, zeigt Fitzgerald seine Meisterschaft darin, große Emotionen in kleine, alltägliche Momente zu verpacken. Der Protagonist schwankt zwischen Vergangenheit und Gegenwart, ähnlich wie Gatsby, der in der Illusion lebt, er könne sein einstiges Glück mit Daisy wiederbeleben.
„Jelly Bean“ erzählt die Geschichte eines jungen Mannes aus einfachen Verhältnissen, der sich in eine Frau verliebt, die für ihn unerreichbar scheint. Der Charme dieser Geschichte liegt in ihrer Mischung aus Leichtigkeit und Melancholie, denn am Ende wird klar, dass der Traum von gesellschaftlichem Aufstieg nicht für jeden zugänglich ist. Gatsby selbst musste seinen wahren Namen und seine Vergangenheit ablegen, um in Daisys Welt Einlass zu finden – doch der Zugang zu dieser Welt bleibt fragil, selbst wenn man es bis ganz nach oben schafft.
„Verrückter Sonntag“ zeigt die Schattenseite des Ruhms. Ein Drehbuchautor, der in die Welt der Hollywood-Elite eintaucht, merkt schnell, dass hinter den goldenen Fassaden Leere und Einsamkeit lauern. Fitzgerald beschreibt mit seiner gewohnten Eleganz die Verführungen des Erfolgs – und die bittere Wahrheit, dass Ruhm oft nur eine andere Form der Isolation ist. Wie Gatsby, der seine rauschenden Feste gibt, um eine einzige Frau zurückzugewinnen, erkennt auch der Protagonist dieser Geschichte, dass in dieser Welt viele Menschen einander suchen – und doch aneinander vorbeileben.
In „Das verlorene Jahrzehnt“ erwacht ein Mann nach Jahren des Exzesses und erkennt, wie die Welt sich verändert hat – oder vielleicht er selbst. Die Geschichte ist eine leise, aber eindringliche Meditation über die Zeit, die man einbüßt, während man sich in Vergnügungen verliert. Sie erinnert an Gatsbys Illusion, dass die Zeit nicht zurückgedreht werden kann. Doch wie Gatsby muss auch der Protagonist dieser Erzählung feststellen, dass sich die Welt nicht nach den Sehnsüchten eines Einzelnen richtet.
In „Die Überreste vom Glück“ reflektiert Fitzgerald über das, was bleibt, wenn der Glanz verblasst. Während Gatsbys Villa nach seinem Tod verlassen dasteht und seine berühmten Partys nur noch ein schwacher Widerhall in der Erinnerung sind, zeigt diese Geschichte, wie Menschen sich an die letzten Fragmente eines vergangenen Glücks klammern. Es ist ein leiser, aber eindringlicher Abschluss für diesen Band – eine Erinnerung daran, dass jede große Erzählung über Aufstieg und Ruhm letztlich eine Geschichte des Verlusts ist.
Fitzgeralds Vermächtnis: Ein Schriftsteller für unsere Zeit
Während Fitzgerald zu Lebzeiten oft mit finanziellen Schwierigkeiten kämpfte – ironischerweise, da er selbst in einem Gatsby’schen Kreislauf aus Reichtum, Verschwendung und Ruin gefangen war – ist sein Werk heute so relevant wie nie zuvor. Der Traum vom schnellen Erfolg, der Drang, sich neu zu erfinden, das Streben nach einer Liebe, die vielleicht nie wirklich existiert hat – all das sind Themen, die uns auch hundert Jahre später noch bewegen. Wer sich in diesen Geschichten verliert, wird nicht nur in eine vergangene Ära eintauchen, sondern auch erkennen, dass sich Hoffnungen, Sehnsüchte und Fehler der Menschen nie wirklich ändern. Aber vergessen Sie nicht, dass hinter jeder glänzenden Fassade ein dunkler Schatten lauert.
Der Diamant so groß wie das Ritz
John T. Unger stammte aus einer angesehenen Familie in Hades, einer kleinen Stadt am Mississippi, deren Name zugleich eine Anspielung auf die Unterwelt war. Johns Vater hatte sich durch zahllose Siege bei Amateur-Golfturnieren einen Namen gemacht, während Mrs. Unger in der Region für ihre temperamentvollen politischen Reden bekannt war, die mancher mit dem Spruch „von der heißen Kiste bis ins heiße Bett“ kommentierte. Der junge John T. Unger, der gerade sein sechzehntes Lebensjahr vollendet hatte, beherrschte bereits alle angesagten Tänze aus New York, noch bevor er begann, lange Hosen zu tragen. Jetzt stand ihm ein wichtiger Abschied bevor. Seine Eltern, ergriffen von dem tief verwurzelten Respekt vor einer erstklassigen Ausbildung in Neuengland – ein Ideal, das Provinzstädte Jahr für Jahr ihrer klügsten Köpfe beraubte – hatten entschieden, ihn auf die St. Midas‘s School nahe Boston zu schicken. Hades, da waren sie sich einig, war zu klein für ihren talentierten Sohn.
Wie jedem bekannt ist, der je in Hades war, sind die Namen elitärer Internate und Colleges dort kaum mehr als abstrakte Begriffe. Die Einwohner, lange abgeschottet von der Welt, stützen ihre Kenntnisse über Mode, Manieren und Literatur vornehmlich auf Hörensagen. Eine Veranstaltung, die in Hades als mondän gelten würde, könnte von einer Society-Dame aus Chicago bestenfalls als „etwas geschmacklos“ belächelt werden.
John T. Unger war bereit für seine Abreise. Mrs. Unger stopfte seine Koffer mit Leinenanzügen und elektrischen Ventilatoren, während Mr. Unger ihm eine mit Geldscheinen gefüllte Asbest-Brieftasche überreichte.
„Denk daran, Junge, du bist hier immer willkommen“, sagte er. „Wir sorgen dafür, dass das Feuer daheim niemals erlischt.“
„Das weiß ich“, antwortete John mit belegter Stimme.
„Vergiss nicht, wer du bist und woher du kommst“, fügte sein Vater stolz hinzu. „Du bist ein Unger – aus der Unterwelt.“
Die beiden Männer schüttelten einander die Hand und John verließ das Haus mit Tränen in den Augen. Zehn Minuten später hatte er die Stadtgrenze erreicht und blickte ein letztes Mal zurück. Über den Toren las er das altmodische, viktorianische Motto der Stadt, das ihm nun überraschend vertraut und anziehend erschien. Sein Vater hatte oft versucht, es durch etwas Schwungvolleres zu ersetzen – wie „Hades – Ihre Chance“ oder ein einfaches „Willkommen“ mit einem beleuchteten Handschlag. Doch jetzt …
John blickte nach vorne, straffte die Schultern und richtete seinen Blick entschlossen auf sein Ziel. Als er sich abwandte, glühten die Lichter von Hades vor dem Abendhimmel in warmer, leidenschaftlicher Schönheit.
***
Die St. Midas‘s School liegt mit dem Rolls-Pierce nur eine halbe Stunde von Boston entfernt. Die tatsächliche Entfernung bleibt ein Geheimnis, denn niemand, außer John T. Unger, ist je mit einem anderen Fahrzeug dort angekommen – und vermutlich wird es auch nie jemand tun. St. Midas‘s ist die exklusivste und teuerste Vorbereitungsschule für Jungen weltweit.
Johns erste zwei Jahre dort verliefen angenehm. Die Väter seiner Mitschüler waren durchweg reiche Magnaten. John verbrachte seine Sommer an luxuriösen Ferienorten. Obwohl er die Jungen, die er besuchte, mochte, fand er ihre Väter auffallend ähnlich und fragte sich oft über deren überraschende Gleichförmigkeit. Wann immer er von Hades erzählte, reagierten sie mit einem lockeren: „Ganz schön heiß da unten, was?“ John brachte dann ein gequältes Lächeln zustande und antwortete: „Allerdings.“ Die Witzelei wurde nicht besser, wenn jemand sie variierte mit „Heiß genug für dich da unten?“ – ein Spruch, den er noch mehr verabscheute.
Mitte seines zweiten Schuljahres kam ein stiller, gutaussehender Junge namens Percy Washington in seine Klasse. Percy war höflich, außerordentlich gut gekleidet – selbst für St. Midas – und hielt sich dennoch von den anderen fern. Der einzige, dem er sich annäherte, war John T. Unger. Doch selbst John gegenüber blieb er verschlossen, wenn es um seine Herkunft oder Familie ging. Dass Percy reich war, stand außer Frage, aber abgesehen von dieser offensichtlichen Tatsache wusste John wenig über ihn. Umso größer war seine Neugier, als Percy ihn einlud, den Sommer in seinem Zuhause „im Westen“ zu verbringen. Ohne zu zögern sagte John zu.
Im Zug wurde Percy das erste Mal gesprächiger. Eines Tages, während sie im Speisewagen zu Mittag aßen und über die Schwächen einiger Jungen in der Schule plauderten, wechselte Percy abrupt das Thema und machte eine unerwartete Bemerkung.
„Mein Vater“, sagte er, „ist mit Abstand der reichste Mann der Welt.“
„Oh“, entgegnete John höflich, unsicher, wie er darauf reagieren sollte. Ein „Das ist ja schön“ schien unpassend und hohl, während „Wirklich?“ so klang, als würde er die Aussage anzweifeln. Schließlich schwieg er einfach.
„Bei weitem der reichste“, wiederholte Percy mit Nachdruck.
„Im World Almanac stand“, begann John zögernd, „dass es in Amerika einen Mann mit einem Einkommen von über fünf Millionen Dollar im Jahr gibt und vier mit über drei Millionen –“
„Das ist nichts“, unterbrach Percy mit einem verächtlichen Grinsen. „Kleine Fische. Sparsame Kapitalisten, Kleinhändler und Geldverleiher. Mein Vater könnte sie alle aufkaufen und es nicht einmal bemerken.“
„Aber wie …“, begann John, doch Percy ließ ihn nicht ausreden.
„Warum zahlen sie nicht so viel Einkommensteuer wie er? Weil mein Vater praktisch keine Steuer zahlt. Höchstens einen kleinen Betrag – auf sein wirkliches Vermögen zahlt er gar nichts.“
„Er muss unglaublich reich sein“, sagte John schlicht. „Das freut mich. Ich mag sehr reiche Leute.“
„Je reicher, desto besser“, stimmte Percy mit glühender Überzeugung zu. „Letztes Osterfest war ich bei den Schnlitzer-Murphys. Vivian Schnlitzer-Murphy hatte Rubine, so groß wie Hühnereier, und Saphire, die wie leuchtende Kugeln aussahen.“
„Ich liebe Juwelen“, meinte John begeistert. „Früher habe ich sie statt Briefmarken gesammelt.“
„Und Diamanten“, fügte John hinzu. „Die Schnlitzer-Murphys hatten welche, so groß wie Walnüsse.“
„Das ist nichts“, sagte Percy leise, beugte sich vor und senkte die Stimme zu einem verschwörerischen Flüstern. „Mein Vater hat einen Diamanten, der größer ist als das Ritz-Carlton Hotel.“
II
Der Sonnenuntergang in Montana lag zwischen zwei Bergen wie ein gewaltiger Bluterguss, aus dem dunkle Adern in einen giftigen Himmel strömten. Weit unten, in unermesslicher Entfernung, duckte sich das Dorf Fish: klein, düster und vergessen. Zwölf Männer lebten dort, ein Dutzend geheimnisvoller Seelen, die eine karge Existenz aus den beinahe nackten Felsen pressten, die eine ebenso mysteriöse Macht einst mit Leben erfüllt hatte. Im Laufe der Zeit waren sie zu einer eigenen Spezies geworden, wie ein Relikt aus einer Laune der Natur, dem nichts blieb als der Kampf ums Überleben und das unausweichliche Vergessen.
Aus dem blauschwarzen Fleck der Ferne bewegte sich eine Reihe funkelnder Lichter auf die Einöde zu und die zwölf Männer von Fish versammelten sich wie Schatten an den Baracken, um den Transcontinental Express um sieben Uhr zu beobachten. Sechsmal im Jahr hielt dieser Zug hier, einer unergründlichen Regel folgend, und immer stiegen ein oder mehrere Reisende aus, bestiegen eine aus der Dämmerung auftauchende Kutsche und verschwanden in der Dunkelheit. Die Männer von Fish hatten das Spektakel zu einem Ritual erhoben. Doch es war ein Ritual ohne Illusionen, ohne Staunen oder Spekulation. Hätten sie sich eine Religion bewahrt, hätte dieses Mysterium zu einem Kult werden können. Doch in Fish war kein Platz für Glauben; keine Lehre, kein Altar und kein Priester konnten auf diesem unbarmherzigen Felsen überdauern. So blieb ihnen nur das tägliche Ritual: ein stummes Gebet voll blutleerer Verwunderung.
An diesem Abend im Juni befahl der große Bremser, den die Männer von Fish wohl als ihren Schutzpatron verehrt hätten, dass der Sieben-Uhr-Zug halten sollte. Zwei Minuten nach sieben stiegen Percy Washington und John T. Unger aus. Sie eilten mit schnellen Schritten an den starren, fassungslosen Blicken der zwölf Männer vorbei, stiegen in eine Kutsche, die wie aus dem Nichts aufgetaucht war, und verschwanden in der beginnenden Nacht.
Nach einer halben Stunde, als die Dunkelheit vollständig hereingebrochen war, rief der stumme Kutscher einen Gruß in die Leere vor ihnen. Aus der Finsternis leuchtete ein Licht wie ein böses Auge auf sie herab. Als sie näherkamen, erkannte John, dass es das Rücklicht eines Automobils war – eines riesigen und prachtvollen Wagens, größer und prächtiger, als er je gesehen hatte. Die Karosserie bestand aus einem glänzenden Metall, edler als Nickel, leichter als Silber, und die Radnaben waren mit schimmernden geometrischen Mustern in Grün und Gelb verziert. Ob diese aus Glas oder Edelsteinen gefertigt waren, wagte John nicht zu erraten.
Zwei Bedienstete in funkelnden Livreen, wie man sie aus Gemälden königlicher Prozessionen kennt, standen stramm neben dem Wagen. Als Percy und John aus der Kutsche stiegen, wurden sie in einer Sprache begrüßt, die John nicht verstand, die jedoch wie eine überzogene Variante des südlichen Dialekts der Afroamerikaner klang.
„Steig ein“, sagte Percy zu seinem Freund, während die Koffer auf das Ebenholzdach der Limousine geworfen wurden. „Tut mir leid, dass wir dich in diesem klapprigen Buggy so weit schleppen mussten, aber es wäre natürlich nicht gut, wenn die Leute im Zug oder diese armseligen Kerle in Fish dieses Auto zu Gesicht bekämen.“
„Meine Güte! Was für ein Auto!“ Johns Ausruf galt dem luxuriösen Innenraum. Die Polsterung bestand aus zahllosen, kunstvoll gewebten Seidenteppichen, die mit Juwelen und Stickereien durchzogen waren, auf einem schimmernden Hintergrund aus goldenem Stoff. Die beiden Sitze, auf denen sie Platz nahmen, erinnerten an Bettdecken, schienen jedoch aus bunten Straußenfedern gefertigt zu sein.
„Was für ein Auto!“, wiederholte John, noch immer sprachlos.
„Dieses Ding?“, lachte Percy. „Das ist doch nur ein alter Kombi, den wir für solche Zwecke benutzen.“
Inzwischen glitten sie durch die Dunkelheit, die sich wie ein Vorhang vor den Spalt zwischen zwei Bergen legte.
„In anderthalb Stunden sind wir da“, sagte Percy, einen Blick auf seine Uhr werfend. „Ich kann dir jetzt schon sagen, es wird anders sein als alles, was du je gesehen hast.“
Wenn das Auto ein Vorgeschmack war, dachte John, musste der Anblick atemberaubend sein. In seiner Heimat Hades herrschte eine fast religiöse Verehrung für Reichtum – eine Hingabe, die seine Eltern ebenso wie er selbst verinnerlicht hatten. Alles, was Percy ihm zeigte, erfüllte ihn mit einer andächtigen Bewunderung.
Nun erreichten sie die Lücke zwischen den Bergen, und sofort wurde der Weg uneben.
„Wenn der Mond scheinen würde, könntest du sehen, dass wir uns in einer großen Schlucht befinden“, erklärte Percy, der aus dem Fenster zu spähen versuchte. Er sprach ein paar Worte in ein Mikrofon, woraufhin einer der Bediensteten einen Suchscheinwerfer einschaltete, dessen mächtiger Strahl die Hänge absuchte.
„Recht steinig“, fügte Percy hinzu. „Ein normales Auto würde hier keine halbe Stunde überstehen. Ohne Panzerung wäre man verloren, wenn man den Weg nicht kennt. Merkst du, dass es bergauf geht?“
Das spürte John deutlich. Nach wenigen Minuten überquerte das Fahrzeug eine Anhöhe, von der aus sie den blassen Mond am Horizont aufgehen sahen. Plötzlich hielt der Wagen an und aus der Dunkelheit traten mehrere Gestalten hervor – weitere Bedienstete, die in demselben Dialekt sprachen wie zuvor. Sie befestigten vier gewaltige Kabel an den mit Edelsteinen verzierten Radnaben.
„Hey-yah!“, rief einer von ihnen, und John fühlte, wie der Wagen langsam vom Boden gehoben wurde – immer höher, über die höchsten Felsen hinaus, die auf beiden Seiten aufragten. Schließlich erhob er sich so weit, dass ein mondbeschienenes Tal vor ihnen sichtbar wurde, ein scharfer Kontrast zur rauen, steinigen Schlucht, aus der sie gekommen waren. Auf einer Seite war noch Fels, dann plötzlich nichts mehr – kein Fels, keine Barriere, nur das weite Tal.
Offenbar hatten sie eine gewaltige, senkrechte Steinklippe überwunden. Kurz darauf senkte sich der Wagen wieder und landete mit einem sanften Stoß auf festem, glattem Boden.
„Das Schlimmste haben wir hinter uns“, sagte Percy, der aus dem Fenster blinzelte. „Von hier sind es nur noch fünf Meilen. Unsere eigene Straße – aus Ziegelstein – führt direkt bis zum Ziel. Alles gehört uns. Hier, sagt mein Vater, enden die Vereinigten Staaten.“
„Sind wir in Kanada?“, fragte John überrascht.
„Nein, mitten in den Rocky Mountains von Montana. Aber jetzt bist du auf den einzigen fünf Quadratmeilen Land in diesem Land, die niemals vermessen wurden.“
„Warum nicht? Haben sie es vergessen?“
„Nein“, sagte Percy mit einem schelmischen Grinsen, „sie haben es dreimal versucht. Das erste Mal hat mein Großvater einfach die gesamte Abteilung für staatliche Vermessungen manipuliert. Beim zweiten Mal ließ er die offiziellen Landkarten der Vereinigten Staaten ändern, was sie für fünfzehn Jahre aufhielt. Beim dritten Mal war es schwieriger. Mein Vater hat dafür gesorgt, dass ihre Kompasse in einem der stärksten Magnetfelder der Welt versagten. Außerdem ließ er eine ganze Serie von Vermessungsinstrumenten mit einer feinen Abweichung herstellen, die verhinderten, dass dieses Gebiet erfasst wurde, und tauschte diese gegen die offiziellen Geräte aus. Schließlich hat er einen Fluss umgeleitet und ein künstliches Dorf an seinen Ufern errichten lassen, damit sie dachten, sie hätten eine Stadt weiter oben im Tal gefunden. Aber es gibt eine Sache, vor der mein Vater wirklich Angst hat – nur eine einzige.“
„Und was ist das?“, fragte John.
Percy senkte seine Stimme und flüsterte: „Flugzeuge. Wir haben ein halbes Dutzend Flugabwehrkanonen und haben es bisher geschafft, alles unter Kontrolle zu halten – aber es gab ein paar Tote und viele Gefangene. Uns macht das nichts aus, Vater und mir, aber es regt Mutter und die Mädchen auf. Und es besteht immer die Möglichkeit, dass es irgendwann schiefgeht.“
Die Wolken, die den Himmel zierten, schimmerten wie Chinchilla, zogen vor dem grünen Mond vorbei wie kostbare Stoffe, die einem Herrscher zur Inspektion dargeboten werden. John kam es vor, als sei es Tag, und er stellte sich vor, wie Männer über ihm durch die Luft segelten, Flugblätter und Traktate für abgelegene Dörfer abwarfen, Botschaften der Hoffnung für Menschen, die in den felsigen Schluchten gefangen waren. Er dachte an die Blicke der Piloten, die neugierig und forschend auf den Ort gerichtet waren, zu dem er unterwegs war. Was dann? Würden sie durch eine List zur Landung gezwungen und in eine Falle geraten, fernab von den Traktaten, die sie bei sich trugen? Oder, falls sie entkamen, hinterließen sie eine Rauchspur und den hallenden Knall einer explodierenden Granate – genug, um „Mutter und die Mädchen“ aufzuregen.
John schüttelte den Kopf, ein leises, hohles Lachen formte sich stumm auf seinen Lippen. Was für eine düstere, geheimnisvolle Macht spielte sich hier ab? Welche abscheuliche Transaktion verbarg sich hinter diesem ungeheuren Reichtum? Und welches goldene, furchterregende Geheimnis lag in der Luft?
Die Chinchillawolken wichen und die Nacht in Montana erstrahlte so hell wie der Tag. Die Ziegelsteine der Straße fühlten sich unter den Reifen sanft an, als sie an einem stillen, mondbeschienenen See vorbeifuhren. Für einen Moment verschwanden sie in der Dunkelheit eines kühlen Kiefernhains, bis sie auf eine breite, gepflegte Allee gelangten. Johns freudiger Ausruf fiel mit Percys trockenem „Wir sind zu Hause“ zusammen.
Voll im Sternenlicht erhob sich ein prächtiges Schloss am Seeufer, kletterte in marmorweißem Glanz den halben Hang eines benachbarten Berges hinauf und verschmolz nahtlos mit der dichten Dunkelheit eines Kiefernwaldes. Die zahllosen Türme, die filigranen Muster der Brüstungen, das kunstvolle Spiel aus gelbem Licht, das aus Hunderten von Fenstern strahlte, all das wirkte wie ein harmonischer Akkord, der tief in Johns Seele widerhallte.
Auf einem der höchsten Türme leuchtete ein Arrangement von Außenlichtern, das eine märchenhafte Illusion erschuf. Während John in verzauberter Bewunderung hinaufblickte, hörte er die leisen, verzückenden Klänge von Geigen, deren Melodien ihn an ein Rokoko-Paradies erinnerten.
Dann hielt der Wagen vor breiten Marmorstufen, die von einem süßen Blumenduft umgeben waren. Oben öffneten sich lautlos zwei große Türen und ein sanftes, bernsteinfarbenes Licht fiel heraus und zeichnete die Silhouette einer eleganten Dame mit hochgestecktem schwarzem Haar. Mit ausgebreiteten Armen trat sie ihnen entgegen.
„Mutter“, sagte Percy, „das ist mein Freund John Unger aus der Unterwelt.“
Später erinnerte sich John an diese Nacht wie an ein schillerndes Durcheinander aus Farben, Musik und Sinneseindrücken. Er dachte an einen weißhaarigen Mann, der aus einem Kristallkelch einen mehrfarbigen Likör trank. An ein Mädchen, das in einem Kleid aus Blumen Titania ähnelte, mit Saphiren im geflochtenen Haar. Er erinnerte sich an einen Raum, dessen goldene Wände unter seinem Druck nachgaben, und an einen anderen, dessen Wände, Boden und Decke vollständig aus Diamanten bestanden. Das Licht der violetten Lampen blendete ihn, eine strahlende Weiße, die jenseits menschlicher Träume oder Wünsche lag.
Die beiden Jungen durchwanderten ein Labyrinth aus Räumen, das John wie aus einem Traum erschien. Der Boden unter ihren Füßen leuchtete manchmal in intensiven Mustern auf, wenn ein Licht von unten aufflammte: lebhafte, kontrastierende Farben, sanfte Pastelltöne, reine Weißflächen oder komplizierte Mosaike, die wie aus einer Moschee an der Adria entnommen schienen. Unter dicken Schichten aus Kristall sah er blaues oder grünes Wasser strudeln, belebt von schillernden Fischen und regenbogenfarbenem Laubwerk. Dann wieder betraten sie weiche, pelzbespannte Flächen, Felle in allen Farben und Strukturen, oder wanderten durch Korridore aus reinem Elfenbein, das so makellos und gewaltig war, als stamme es von urzeitlichen Dinosauriern.
Die Eindrücke verwischten sich und plötzlich befanden sie sich beim Abendessen. Jeder Teller bestand aus zwei nahezu unsichtbaren Schichten massiver Diamanten, zwischen denen ein feines Muster aus Smaragden wie aus grüner Luft geschnitten war. Entfernte Korridore trugen leise, melancholische Musik heran, und der Stuhl, auf dem John saß, neigte sich sanft nach hinten, um ihn wie eine wolkige Umarmung aufzunehmen. Das erste Glas Portwein ließ ihn schläfrig werden. Er versuchte, eine Frage zu beantworten, doch die üppige Pracht um ihn herum verstärkte die süße Müdigkeit, die sich seiner bemächtigt hatte. Juwelen, Stoffe, Weine und metallene Reflexionen verschmolzen zu einem sanften Nebel.
„Ja“, murmelte er, halb im Schlaf. „Es ist unten jedenfalls heiß genug.“ Ein geisterhaftes Lächeln glitt über sein Gesicht, bevor er endgültig hinsank, ein halbgegessenes, rosafarbenes Dessert wie ein Traum auf dem Tisch zurücklassend.
Als er aufwachte, waren Stunden vergangen. Er lag in einem stillen Raum, dessen Ebenholzwände in einem diffusen, kaum wahrnehmbaren Licht schimmerten. Percy stand neben ihm.
„Du bist beim Abendessen eingeschlafen“, sagte er. „Ich hätte fast dasselbe getan – nach dem Schuljahr ist es ein Traum, endlich wieder bequem zu liegen. Die Diener haben dich ausgezogen und gebadet, während du geschlafen hast.“
„Ist das ein Bett oder eine Wolke?“, seufzte John. „Percy, Percy – ich muss mich entschuldigen.“
„Wofür?“
„Dafür, dass ich dir nicht geglaubt habe, als du gesagt hast, dein Diamant sei so groß wie das Ritz-Carlton-Hotel.“
Percy lächelte. „Ich wusste, dass du es anzweifelst. Es ist dieser Berg, weißt du.“
„Welcher Berg?“
„Der Berg, auf dem das Schloss steht. Er ist für einen Berg nicht besonders groß. Aber bis auf ein paar Meter Kies und Gras besteht er komplett aus reinem Diamant – eine makellose Kubikmeile groß. Verstehst du?“
John wollte antworten, aber die Worte kamen nicht. Er war wieder eingeschlafen.
III
Am nächsten Morgen wachte John auf und bemerkte, dass sein Zimmer vom Licht der Sonne durchflutet war. Eine Wand aus Ebenholz hatte sich lautlos auf Schienen beiseitegeschoben, sodass der Raum zur Hälfte offen für den Tag lag. Ein großer Bediensteter in weißer Uniform stand neben seinem Bett.
„Guten Abend“, murmelte John schläfrig.
„Guten Morgen, Sir. Sind Sie bereit für Ihr Bad? Bitte bleiben Sie liegen. Ich bringe Sie hin, wenn Sie nur Ihren Pyjama aufknöpfen. So, danke, Sir.“
John war amüsiert und ließ es geschehen. Doch anstatt von dem großen Mann hochgehoben zu werden, spürte er, wie sich das Bett langsam zur Seite neigte. Zunächst erschrocken, als er Richtung Wand rollte, entspannte er sich, als die Vorhänge sanft nachgaben. Er glitt eine weiche Rampe hinunter und landete schließlich mit einem leichten Plumps in warmem Wasser, das exakt die Temperatur seines Körpers hatte.
Er sah sich um. Der Raum, in den er gerollt war, war ein eingelassenes Aquarium. Die Badewanne, in der er saß, war aus klarem Kristall gefertigt, durch das er die Fische beobachten konnte, die zwischen goldenen und bernsteinfarbenen Lichtern schwammen. Sie glitten ohne Eile an seinen ausgestreckten Zehen vorbei, nur durch die dicke Kristallschicht von ihm getrennt. Von oben fiel grünes Sonnenlicht durch ein Glasdach, das die ganze Szenerie in ein beruhigendes, meergrünes Licht tauchte.
„Ich nehme an, Sir, Sie wünschen heute Morgen ein Bad mit warmem Rosenwasser und Seifenschaum, gefolgt von einer erfrischenden Spülung mit kaltem Salzwasser?“, fragte der Bedienstete höflich.
„Ja, wie Sie möchten“, antwortete John mit einem schläfrigen Lächeln. Der Gedanke, diesen luxuriösen Start in den Tag nach seinen eigenen Maßstäben zu gestalten, schien ihm absurd und fast vermessen.
Der Diener drückte einen Knopf und ein sanfter, warmer Regen begann herabzufallen, scheinbar von oben, tatsächlich aber aus einem kunstvollen Springbrunnen in der Nähe. Das Wasser nahm eine zarte Rosafärbung an. Aus vier kleinen Walrossköpfen an den Ecken der Wanne schossen Strahlen flüssiger Seife in das Becken. Binnen Sekunden verwandelten rotierende Schaufelräder an den Seiten die Mischung in einen leuchtenden Regen aus rosa Schaum, der John sanft umhüllte und dabei in zarten, schimmernden Blasen zerplatzte.
„Soll ich den Filmprojektor einschalten, Sir?“, fragte der Diener mit ehrerbietigem Ton. „Heute läuft eine exzellente Ein-Rollen-Komödie oder ich könnte Ihnen ein ernsthafteres Stück zeigen, falls Sie das bevorzugen.“
„Nein, danke“, lehnte John höflich ab. Das Bad war zu wohltuend, um sich ablenken zu lassen. Doch Ablenkung kam von selbst: Von draußen erklangen Flötenmelodien, die wie ein Wasserfall klangen, kühl und klar, ergänzt durch das verspielte Trillern einer Piccoloflöte.
Nach der abschließenden kalten Salzwasserspülung stieg John aus dem Bad und wurde in einen flauschigen Bademantel gehüllt. Auf einer weichen Couch rieb man ihn mit Öl, Alkohol und Gewürzen ein, bevor er schließlich, frisch rasiert und mit gestutztem Haar, aufstand.
„Mr. Percy wartet im Wohnzimmer auf Sie“, verkündete der Diener zum Abschluss. „Mein Name ist Gygsum, Mr. Unger. Ich werde jeden Morgen für Sie da sein.“
John betrat das sonnendurchflutete Wohnzimmer, wo Percy in eleganten weißen Ziegenlederknickerbockern saß, eine Zigarette rauchte und auf ihn wartete. Auf dem Tisch stand ein reich gedecktes Frühstück bereit.
IV
Beim Frühstück erzählte Percy die Geschichte seiner Familie.
Der Vater des heutigen Mr. Washington, Fitz-Norman Culpepper Washington, war ein Virginianer und direkter Nachfahre von George Washington und Lord Baltimore. Nach dem Bürgerkrieg war er ein 25-jähriger Colonel mit einer heruntergekommenen Plantage und etwa tausend Dollar in Gold.
Fitz-Norman beschloss, sein Anwesen seinem jüngeren Bruder zu überlassen und in den Westen zu ziehen. Begleitet von zwei Dutzend treuen Schwarzen, die ihn verehrten, kaufte er Tickets und zog nach Montana, wo er Land erwerben und eine Schaf- und Rinderfarm gründen wollte.
Einen Monat nach seiner Ankunft, geplagt von Misserfolgen, machte Fitz-Norman eine zufällige Entdeckung. Bei einem Ritt durch die Berge hatte er sich verirrt. Hungrig und ohne Gewehr verfolgte er ein Eichhörnchen, das etwas Glänzendes in seinem Maul trug. Kurz bevor es in seinem Bau verschwand, ließ das Tier seine Last fallen. Als Fitz-Norman den Schimmer im Gras bemerkte, verlor er augenblicklich seinen Hunger – und barg stattdessen einen Diamanten von unschätzbarem Wert.
Zurück im Lager erklärte er seinen Männern, er habe eine Bergkristallmine entdeckt. Da kaum jemand jemals einen echten Diamanten gesehen hatte, glaubten sie ihm. Erst später erkannte Fitz-Norman die wahre Bedeutung seiner Entdeckung: Der gesamte Berg war ein einziger massiver Diamant.
Mit vier Satteltaschen voller Proben ritt er nach St. Paul, wo er einige kleinere Steine verkaufen konnte. Doch als er einen größeren vorlegte, fiel ein Ladenbesitzer in Ohnmacht, und Fitz-Norman wurde wegen Ruhestörung verhaftet. Nach seiner Flucht zog er weiter nach New York, wo er mittelgroße Diamanten gegen Gold im Wert von zweihunderttausend Dollar eintauschte. Doch die Diamanten sorgten in Juwelierkreisen für Aufregung, da niemand ihre Herkunft erklären konnte. Gerüchte über Diamantenminen in den Catskills oder auf Long Island verbreiteten sich. Bald suchten Scharen von Schatzsuchern die Umgebung ab.
Zu diesem Zeitpunkt war Fitz-Norman längst zurück in Montana – und bereit, sein Leben auf dem Berg voller Diamanten aufzubauen.
Nach vierzehn Tagen schätzte Fitz-Norman Washington, dass der Diamantberg in sich etwa den Wert aller bekannten Diamanten der Welt vereinte. Doch sein Wert war jenseits jeder gewöhnlichen Berechnung, denn der Berg bestand aus einem einzigen massiven Diamanten. Würde er öffentlich zum Verkauf angeboten, würde nicht nur der Diamantenmarkt kollabieren, sondern auch die Weltwirtschaft, da es nicht genug Gold auf der Erde gab, um selbst ein Zehntel seines Wertes zu decken. Und was könnte man überhaupt mit einem Diamanten dieser Größe anfangen?
Es war eine außergewöhnliche Situation: In gewisser Weise war Fitz-Norman der reichste Mensch der Weltgeschichte – und zugleich war sein Besitz wirtschaftlich fast wertlos. Sollte sein Geheimnis ans Licht kommen, war ungewiss, welche Maßnahmen die Regierung ergreifen würde, um eine Panik bei Gold und Juwelen zu verhindern. Wahrscheinlich würde der Staat das Gebiet sofort beschlagnahmen und ein Monopol errichten.
Es blieb nur eine Lösung: Der Diamant musste heimlich vermarktet werden. Fitz-Norman rief seinen jüngeren Bruder nach Montana und übertrug ihm die Leitung der treuen Schwarzen, die, ohne jemals das Ende der Sklaverei begriffen zu haben, ihm blind ergeben waren. Um das sicherzustellen, verkündete er ihnen eine gefälschte Proklamation, in der er behauptete, General Forrest habe die Armeen der Südstaaten reorganisiert und den Norden besiegt. Die Männer nahmen die Nachricht begeistert auf, stimmten ab, erklärten die Sache zur Wahrheit und hielten daraufhin Erweckungsgottesdienste ab.
Mit 100.000 Dollar und zwei Koffern voller Rohdiamanten brach Fitz-Norman ins Ausland auf. Über Russland, wo er den Zarenhof besuchte und Diamanten verkaufte, führte ihn seine Reise in weitere Länder, immer in ständiger Gefahr entdeckt oder ermordet zu werden. Innerhalb von zwei Jahren hatte er 22 Hauptstädte bereist, zahlreiche Monarchen getroffen und sein Vermögen auf über eine Milliarde Dollar vergrößert. Doch keiner der größeren Diamanten, die er verkaufte, blieb lange in der Öffentlichkeit, ohne Geschichten von Intrigen, Kriegen oder Tragödien hervorzurufen.
Nach 1870 lebte Fitz-Norman ein Leben voller Reichtum und Macht. Neben der heimlichen Vermarktung des Diamantbergs gab es jedoch auch Schattenseiten: Um die Sicherheit seiner Operationen zu bewahren, musste er seinen Bruder töten, der wegen Trunkenheit ihre Deckung gefährdet hatte. Solche Vorkommnisse blieben jedoch selten.
Kurz vor seinem Tod änderte Fitz-Norman seine Strategie und investierte sein gesamtes Vermögen, abgesehen von einigen Millionen Dollar, in seltene Mineralien. Sein Sohn, Braddock Tarleton Washington, setzte diese Strategie fort und wandelte die Mineralien schließlich in Radium um, das eine Milliarde Dollar in einem Behälter von der Größe einer Zigarrenkiste speichern konnte.
Drei Jahre nach Fitz-Normans Tod entschied Braddock, die Mine endgültig zu versiegeln. Der unermessliche Reichtum, den sie birgt, sollte den kommenden Generationen der Washingtons einen Luxus bieten, der seinesgleichen sucht. Sein einziges Ziel war es, das Geheimnis des Berges zu bewahren, um eine weltweite Panik zu verhindern, die die gesamte Grundbesitzerklasse in den Ruin stürzen könnte.
Dies war die Familie, bei der John T. Unger zu Gast war. Und dies war die Geschichte, die er an seinem zweiten Morgen im schimmernden Wohnzimmer mit silbernen Wänden erfuhr.
V
Nach dem Frühstück wanderte John durch den großen Marmoreingang hinaus in das Tal und betrachtete die faszinierende Szenerie. Der gesamte Talkessel, vom Diamantberg bis zu den steilen Granitklippen fünf Meilen entfernt, war in einen goldenen Dunst gehüllt, der träge über Wiesen, Seen und Gärten schwebte. Gruppen von Ulmen warfen sanfte Schatten, die einen reizvollen Kontrast zu den kräftigen, dunkelgrünen Kiefernwäldern bildeten, die die Hügel umfassten.
Während John die Landschaft beobachtete, huschten drei Rehkitze in einer Reihe aus einem entfernten Gebüsch hervor, sprangen mit ungelenker Freude über die Wiese und verschwanden im Dunkel eines anderen Waldstücks.
John wäre kaum überrascht gewesen, einen Ziegenfuß in den Schatten tanzen zu sehen oder einen flüchtigen Blick auf rosa Haut und fliegendes goldenes Haar zwischen den tiefgrünen Blättern zu erhaschen – als hätte diese Szenerie nicht nur Schönheit, sondern auch das Übernatürliche in sich aufgenommen.
In einer kühlen Hoffnung stieg John die Marmorstufen hinab, wobei er den Schlaf zweier seidiger russischer Wolfshunde störte, die träge am Fuße der Treppe lagen. Er schlug einen Weg aus weißen und blauen Ziegeln ein, der scheinbar ziellos durch die Landschaft führte.
Er lebte den Moment, so gut er konnte, doch es ist das bittersüße Schicksal der Jugend, dass sie nie völlig in der Gegenwart verweilen kann. Stets misst sie den Augenblick an der strahlenden Zukunft, die sie sich ausmalt – Blumen, Gold, Mädchen und Sterne erscheinen nur als Vorboten eines unvergleichlichen Traums, der unerreichbar bleibt.
John bog um eine sanfte Kurve, wo dichte Rosenbüsche die Luft mit ihrem schweren Duft erfüllten. Er lief durch einen Park zu einer moosbewachsenen Stelle unter einigen Bäumen. Neugierig, ob Moos tatsächlich so weich war, wie sein Name versprach, ließ er sich darauf nieder. Da bemerkte er ein Mädchen, das über das Gras auf ihn zukam. Sie war das schönste Wesen, das er je gesehen hatte.
Sie trug ein leichtes weißes Kleid, das knapp unter ihre Knie reichte, und ein Kranz aus Reseden mit blauen Saphirscheiben hielt ihr Haar zusammen. Ihre nackten, rosafarbenen Füße spritzten den Tau auf, während sie sich näherte. Sie schien jünger als John, kaum älter als sechzehn.
„Hallo“, sagte sie leise, „ich bin Kismine.“
Für John war sie in diesem Moment schon viel mehr als nur ein Name. Er erhob sich zögernd, aus Angst, ihre bloßen Zehen zu berühren.
„Du kennst mich noch nicht“, fuhr sie sanft fort, ihre blauen Augen funkelten schelmisch. Sie schienen zu sagen: Oh, aber du hast etwas verpasst!
„Gestern Abend hast du meine Schwester Jasmine kennengelernt. Ich konnte nicht kommen, weil ich eine Salatvergiftung hatte“, erklärte sie mit einem Hauch von Selbstironie. „Wenn ich krank bin, bin ich süß – und wenn ich gesund bin …“
„Du hast einen unauslöschlichen Eindruck auf mich gemacht“, dachten Johns Augen. Doch seine Stimme sagte stattdessen: „Ich hoffe, es geht dir heute Morgen besser.“
Während sie plauderten, hatte sich ihr Spaziergang unbemerkt fortgesetzt. Auf ihren Vorschlag hin setzten sie sich zusammen auf das Moos, dessen vielgepriesene Weichheit John in diesem Moment kaum wahrnehmen konnte.
Er hatte Frauen gegenüber hohe Ansprüche. Ein einziger Makel – ein dickes Gelenk, eine raue Stimme, ein unechtes Auge – genügte, um ihn vollständig abzuschrecken. Doch nun saß er zum ersten Mal in seinem Leben neben einem Mädchen, das für ihn vollkommene Schönheit verkörperte.
„Kommst du aus dem Osten?“, fragte Kismine mit neugierigem Interesse.
„Nein“, antwortete John schlicht. „Ich komme aus der Unterwelt.“
Entweder hatte sie noch nie von Hades gehört oder sie wusste nicht, was sie darauf antworten sollte, denn sie ließ das Thema fallen.
„Im Herbst gehe ich in den Osten auf eine Schule“, erzählte sie. „Denkst du, es wird mir dort gefallen? Ich gehe zu Miss Bulge nach New York. Es ist sehr streng, aber an den Wochenenden werde ich bei meiner Familie in unserem Haus in der Stadt wohnen. Vater hat gehört, dass die Mädchen dort nur in Begleitung ausgehen dürfen.“
„Dein Vater möchte, dass du stolz bist“, bemerkte John.
„Das sind wir“, sagte sie und ihre Augen strahlten vor Würde. „Keiner von uns wurde jemals bestraft. Als Jasmine ein kleines Mädchen war, hat sie Vater einmal die Treppe hinuntergestoßen, und er ist einfach aufgestanden und davongehumpelt.“
„Mutter war ein wenig … beunruhigt, als sie hörte, woher du kommst“, fügte Kismine hinzu. „Sie sagte, es erinnere sie an etwas, das sie als junges Mädchen gehört hat – aber weißt du, sie ist Spanierin und etwas altmodisch.“
Um das Thema zu wechseln, fragte John: „Verbringst du viel Zeit hier draußen?“
„Jeden Sommer“, antwortete sie. „Percy, Jasmine und ich sind immer hier, aber nächsten Sommer fährt Jasmine nach Newport. Im Herbst geht sie nach London und wird am Hof vorgestellt.“
„Weißt du“, begann John zögerlich, „du bist viel kultivierter, als ich erwartet hatte.“
„Oh nein, das bin ich nicht!“, rief sie eilig aus. „Das könnte ich niemals glauben. Ich finde, kultivierte Menschen sollten ganz normal sein, findest du nicht auch? Aber ich bin es wirklich nicht. Wenn du sagst, ich wäre es, muss ich weinen.“
Ihre Lippen zitterten, und John fühlte sich verpflichtet zu protestieren: „Das habe ich nicht so gemeint. Ich wollte dich nur ein bisschen necken.“
„Weil es mir nichts ausmachen würde, wenn ich kultiviert wäre“, beharrte Kismine, „aber ich bin es nicht. Ich bin ganz unschuldig und mädchenhaft. Ich rauche nicht, trinke nicht und lese nichts außer Gedichte. Mathematik und Chemie kenne ich kaum und ich kleide mich sehr einfach – eigentlich kleide ich mich kaum. Kultiviert zu sein, ist wohl das Letzte, was man über mich sagen könnte. Ich glaube, Mädchen sollten ihre Jugend auf gesunde Weise genießen.“
„Da stimme ich dir zu“, sagte John herzlich.
Kismine war wieder fröhlich. Sie lächelte ihn an. Eine einsame, halbgeborene Träne tropfte aus dem Winkel ihres blauen Auges.
„Ich mag dich“, flüsterte sie vertraulich. „Wirst du die ganze Zeit mit Percy verbringen, während du hier bist, oder wirst du auch nett zu mir sein? Stell dir vor – ich bin absolutes Neuland. Kein Junge war je in mich verliebt. Ich durfte nie Jungen allein sehen – außer Percy. Ich bin extra hierher in dieses Wäldchen gekommen, in der Hoffnung, dich zu treffen, fern von meiner Familie.“
John fühlte sich geschmeichelt und verbeugte sich leicht, wie er es in der Tanzschule in Hades gelernt hatte.
„Wir sollten besser zurückgehen“, sagte Kismine sanft. „Ich muss um elf bei Mutter sein. Übrigens – du hast mich kein einziges Mal gefragt, ob du mich küssen darfst. Ich dachte, das tun Jungs heutzutage immer.“
John richtete sich auf, ein wenig stolz.
„Manche tun das“, entgegnete er, „aber ich nicht. Mädchen machen so etwas nicht – in der Unterwelt.“
Seite an Seite kehrten sie zum Haus zurück.
VI
John stand Mr. Braddock Washington im hellen Sonnenlicht gegenüber. Der Mann war um die vierzig, hatte ein stolzes, ausdrucksloses Gesicht, intelligente Augen und eine kräftige Statur. Er roch nach Pferden – und nicht nach irgendwelchen, sondern nach den besten Pferden. In der Hand hielt er einen Spazierstock aus grauer Birke mit einem großen Opal als Griff. Zusammen mit Percy führte er John durch das Anwesen.
„Dort drüben sind die Sklavenquartiere“, sagte Braddock Washington und deutete mit dem Stock auf einen Marmorkreuzgang, der in eleganter gotischer Bauweise entlang der Bergseite verlief. „In meiner Jugend ließ ich mich eine Zeit lang von absurdem Idealismus ablenken. Während dieser Phase lebten sie im Luxus. Ich habe beispielsweise jedes Zimmer mit einem gefliesten Badezimmer ausgestattet.“
„Ich nehme an“, wagte John mit einem einschmeichelnden Lachen, „dass sie die Badewannen benutzt haben, um Kohle darin aufzubewahren. Mr. Schnlitzer-Murphy hat mir erzählt, dass er einmal …“
„Die Meinung von Mr. Schnlitzer-Murphy ist irrelevant“, unterbrach ihn Braddock Washington kalt. „Meine Sklaven hatten keine Kohle in ihren Badewannen. Sie hatten den Befehl, jeden Tag zu baden, und das haben sie auch getan. Hätten sie es nicht getan, hätte ich sie vielleicht mit einem Schwefelsäureshampoo bestraft. Ich habe die Bäder aus einem anderen Grund eingestellt. Einige von ihnen haben sich erkältet und sind gestorben. Wasser ist für bestimmte Rassen nicht gut – außer als Getränk.“
John lachte unsicher und beschloss, nur stumm zu nicken. Braddock Washington bereitete ihm ein unterschwelliges Unbehagen.
„Diese Schwarzen sind Nachfahren derer, die mein Vater in den Norden gebracht hat“, fuhr Washington fort. „Es sind inzwischen etwa zweihundertfünfzig. Sie leben schon so lange abgeschieden, dass ihr ursprünglicher Dialekt zu einem nahezu unverständlichen Patois geworden ist. Einige von ihnen bringen wir Englisch bei – meiner Sekretärin und ein paar Hausangestellten.“
Sie schlenderten weiter über das samtige Wintergras, als Washington beiläufig hinzufügte: „Das dort ist der Golfplatz. Er ist vollständig grün – kein Fairway, kein Rough, keine Hindernisse.“
Er lächelte John freundlich an.
„Viele Männer im Käfig, Vater?“, fragte Percy plötzlich.
Braddock Washington stolperte und stieß einen unwillkürlichen Fluch aus.
„Einer weniger, als es sein sollte“, knurrte er und fügte nach einem Moment hinzu: „Es gab Schwierigkeiten.“
„Mutter hat mir erzählt“, begann Percy, „dass der Italienischlehrer …“
„Ein schrecklicher Fehler“, unterbrach Braddock Washington wütend. „Aber vielleicht haben wir ihn doch erwischt. Es ist möglich, dass er im Wald gestürzt oder über eine Klippe gefallen ist. Und selbst wenn er entkommen ist, könnte es sein, dass niemand seiner Geschichte glaubt. Trotzdem habe ich zwei Dutzend Männer in verschiedenen Städten in der Umgebung nach ihm suchen lassen.